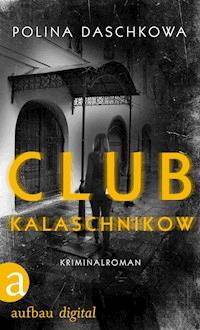Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Russische Ermittlungen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Eine Frau wird mit 18 Messerstichen ermordet. Die vierzehnjährige Ljussja behauptet, die Tat begangen zu haben und liefert sogar die Mordwaffe. Der Fall scheint klar. Doch Ermittler Borodin glaubt nicht an ihre Schuld. Tatsächlich setzt sich die Serie blutiger Morde fort. Eine heiße Spur führt zu einer gewissen „Mama Isa“ und ihrem Kinderheim - hier lebte auch Ljussja. Bildet Isa ihre Schützlinge wirklich zu Dieben, Prostituierten und Attentätern aus? Borodin ist einem gefährlichen kriminellen Netzwerk auf der Spur …
"Ein intelligentes Meisterwerk" Aachener Nachrichten.
"Unglaublich dicht und spannend." Brigitte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Polina Daschkowa
Polina Daschkowa, geboren 1960, wird auch gerne als Königin des russischen Krimis bezeichnet. Sie studierte am Gorki-Literaturinstitut in Moskau und arbeitete als Dolmetscherin und Übersetzerin, bevor sie zur beliebtesten russischen Krimiautorin avancierte. Sie lebt in Moskau.
Ganna-Maria Braungardt, geboren 1956, studierte russische Sprache und Literatur in Woronesh (Russland); Lektorin; seit 1991 freiberufliche Übersetzerin. Übertrug Polina Daschkowa, Ljudmilla Ulitzkaja, Boris Akunin und viele andere ins Deutsche.
Informationen zum Buch
Eine Frau wird mit 18 Messerstichen ermordet. Die vierzehnjährige Ljussja behauptet, die Tat begangen zu haben und liefert sogar die Mordwaffe. Der Fall scheint klar. Doch Ermittler Borodin glaubt nicht an ihre Schuld. Tatsächlich setzt sich die Serie blutiger Morde fort. Eine heiße Spur führt zu einer gewissen „Mama Isa“ und ihrem Kinderheim – hier lebte auch Ljussja. Bildet Isa ihre Schützlinge wirklich zu Dieben, Prostituierten und Attentätern aus? Borodin ist einem gefährlichen kriminellen Netzwerk auf der Spur …
»Ein intelligentes Meisterwerk« Aachener Nachrichten.
»Unglaublich dicht und spannend.« Brigitte.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Polina Daschkowa
Das Haus der bösen Mädchen
Kriminalroman
Aus dem Russischenvon Ganna-Maria Braungardt
Inhaltsübersicht
Über Polina Daschkowa
Informationen zum Buch
Newsletter
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Impressum
Erstes Kapitel
Nach einem endlosen, matschigen Winter mit heftigen Schneefällen, nach Aprilfrösten und tristen Mairegen brach in Moskau endlich der Sommer an. Der Juni begann grell und heiß, jeder Sonnentag war ein Fest. Nachts tobten Gewitter, doch bei Sonnenaufgang war kein einziges Wölkchen mehr am Himmel, die Spatzen tschilpten aufgeregt, und glitzernde Tropfen fielen von den Bäumen.
Auf der von alten Linden gesäumten Terrasse eines teuren kleinen Cafés in einer stillen Straße in der Nähe des Taganka-Platzes standen zum ersten Mal in diesem Jahr drei Tische. Das Café öffnete erst mittags, und Punkt zwölf erschien der erste Gast – ein Mann in hellem Sommeranzug. Er wirkte krank und zerknittert, als hätte er die Nacht schlaflos verbracht und sich am Morgen nicht gewaschen. Er entschied sich für einen Tisch an der Umzäunung und ließ sich so schwer auf den Stuhl fallen, dass die zierlichen Aluminiumbeine sich bogen. Der Mann sah aus wie das Produkt eines Kinderspiels, bei dem der eine den Kopf zeichnet, dann das Blatt faltet, der nächste blind den Rumpf ergänzt, der dritte die Beine usw. Sein Kopf war zu groß für den dünnen Hals, die schmalen Schultern passten nicht zum gewichtigen Unterkörper, der seinerseits einen Gegensatz zu den Kranichbeinen und den breiten Plattfüßen Größe fünfundvierzig bildete. Das strohblonde Haar, obwohl dünn und weich, stand störrisch nach allen Seiten ab wie das nasse Gefieder eines Kükens. Das runde Gesicht mit der kleinen Nase und den großen schokoladenbraunen Augen hatte kindliche Proportionen bewahrt, und ohne den fast greisenhaften Bass hätte man den Mann für einen kränklichen, schläfrigen Jugendlichen halten können.
Die Schatten der zitternden Lindenblätter tanzten wie große Flecke auf dem Tischtuch, dem Anzug, dem Gesicht und den Händen des Gastes und erweckten den Anschein, als werde der Mann von Fieber geschüttelt. Ohne die Speisekarte aufzuschlagen, rief er barsch: »Kaffee!«
»Espresso? Capuccino? Orientalisch?«, fragte der Kellner höflich.
»Orientalisch. Stark und süß.«
Plötzlich fuhr der Mann hoch wie von der Tarantel gestochen und rief: »Lilja! Hier bin ich!«
Der Kellner drehte sich um. Eine Frau Mitte dreißig betrat die Terrasse, eine adrette kleine Blondine in einem weißrosa Kleid. Leichtfüßig kam sie heran, die schmalen Absätze ihrer weißen Schuhe klapperten, und sie roch nach Jasmin – der Kellner identifizierte das altmodische, aber angenehme Parfüm »Diorissimo«.
»Hallo«, sagte die Blondine, strich sorgfältig ihr Kleid glatt und setzte sich dem Mann gegenüber. Sie zog die hellen Augenbrauen zusammen, die Mundwinkel sanken herab, das angenehme rundliche Gesicht wirkte nun angespannt. Sie schien wenig erfreut über die Begegnung. Der Kellner kam erneut an den Tisch und sah die Frau fragend an.
»Lilja, was soll ich für dich bestellen?« Der Mann entblößte lächelnd seine großen nikotinbraunen Zähne.
»Ein Glas Wasser. Stilles.«
»Hier, das hab ich dir mitgebracht, damit du mal siehst, wo ich arbeite«, murmelte der Mann. Er kramte unbeholfen in seiner Ledertasche und förderte schließlich ein dickes Hochglanzmagazin zutage. Unter dem blutroten Titel »Blum« auf dem Umschlag räkelte sich ein nacktes, kahlköpfiges Mädchen in glänzendem Quecksilbergrau.
»Danke.« Die Frau blätterte das Magazin mechanisch durch und erstarrte plötzlich, die durchsichtigen hellgrauen Augen auf den Mann gerichtet. Sie hielt ein dickes weißes Kuvert in der Hand, das zwischen den Seiten gelegen hatte. »Was ist das?«, fragte sie drohend.
»Machs auf, sieh nach.« Sein Gesicht verzog sich zu einem dümmlichen Lächeln.
Die Frau schaute in das Kuvert, warf es auf den Tisch und erhob sich abrupt.
»Das reicht, wir beide haben nichts zu besprechen.«
»Lilja, warte doch, was hast du denn?« Er griff erschrocken nach ihrer Hand. »Was stellst du dich so an, he? Sag bloß, du brauchst kein Geld?«
»Nimm das weg, wir werden schon beobachtet.« Sie blickte zum Kellner, der mit einer Flasche Mineralwasser auf einem Tablett kurz vor ihrem Tisch verharrte.
»Bitte setz dich, bitte. Siehst du denn nicht, wie schlecht es mir geht?«, klagte der Mann.
»Dir geht es immer schlecht«, erwiderte die Frau ärgerlich, setzte sich aber wieder. »Warum hast du mich hergebeten?« Sie starrte ihn unverwandt an, und die Anspannung ließ ihre Augen vollkommen durchsichtig wirken.
Er hustete und wurde puterrot. »Sei so gut und erklär mir: Warum darf ich nicht kommen?«, bellte er, griff nach der Serviette und schnäuzte sich geräuschvoll.
»Weil ich dich nicht einlade«, antwortete sie höflich lächelnd.
Der Mann schleuderte eine Schachtel Marlboro mit Menthol auf den Tisch und brauchte sehr lange, bis er endlich eine Zigarette herausgefischt und angezündet hatte.
»Ich will aber kommen«, sagte er, nahm einen langen Zug und blies den Rauch durch die Nase aus. »Was heißt, du lädst mich nicht ein? Wir sind doch erwachsene Menschen!«
»Du und erwachsen?« Sie lachte, und ihre kleinen weißen Zähnchen blinkten. »Du und erwachsen?«
»Da gibt es nichts zu lachen. Ich habe schon ein Geschenk gekauft, und überhaupt, du hast keinerlei Rechte, nach den Papieren bist du niemand.«
»Ach so?« Sie neigte den Kopf und hob die Brauen. »Tja, wenn du so anfängst – die echten Papiere liegen bei mir, sie sind unanfechtbar, und darin kommt dein Name nicht vor.« Lilja leerte ihr Wasserglas in einem Zug. »Wenn hier einer niemand ist, dann du, Oleg, nicht ich. Bedank dich bei deiner cleveren Mama. Das hat sie bestens arrangiert.«
»Meine Mutter lass aus dem Spiel.« Oleg mied ihren Blick und starrte in seine Kaffeetasse. »Um sie geht es jetzt nicht. Ich soll also nicht kommen, ja? Und weiter?«
»Weiter werde ich mich an offizielle Stellen wenden und die Fälschung der Papiere melden, und nicht nur das. Da ist noch etwas Ernsteres. Weit ernster.«
»Hör mal, kannst du dich nicht klar ausdrücken statt in albernen Andeutungen?«
»Vorerst nicht. Aber ich verspreche dir, meine unklaren Andeutungen werden bald glasklar sein.«
»Was ist eigentlich passiert? All die Jahre hast du geschwiegen, und jetzt explodierst du auf einmal – wieso? Zehn Jahre lang warst du mit der Situation durchaus zufrieden, und nun willst du dich, wie du sagst, an offizielle Stellen wenden. Ans Gericht etwa?«
»Genau, ans Gericht.«
»Was wirfst du uns denn vor?«
»Dir gar nichts. Aber deiner genialen Mutter habe ich etwas vorzuwerfen. Und zwar etwas sehr Ernstes, glaub mir.«
»He, was soll das? Erklär mir, was du willst, lass uns in Ruhe darüber reden, wir werden uns schon einigen.«
»Wir werden uns niemals einigen.« Lilja schüttelte ihr kurzes, gewelltes Haar. »Ich treffe mich nur mit dir, weil du mir leid tust. Aber dass du Bescheid weißt: Dieses Mitleid wird mich nicht von meinem Plan abbringen. So, Schluss jetzt.«
»Schluss?«, kreischte der Mann plötzlich. »Was haben wir dir getan? Zehn Jahre kein Wort des Vorwurfs, und nun auf einmal, aus heiterem Himmel …«
»Schrei nicht so, Oleg.« In ihren hellgrauen Augen blitzte Mitleid auf. »Du hast mir nichts getan, du bist vermutlich überhaupt zu keiner bewussten Handlung fähig. Aber deine Mutter … Egal, wie gesagt, lassen wir das lieber. Entschuldige, aber ich muss los.« Sie stand auf, maß ihn mit einem Blick von Kopf bis Fuß und sagte leise: »Du solltest etwas für deine Gesundheit tun, du siehst schlecht aus.«
»Warte!« Er packte ihren Arm und riss so heftig daran, dass sie beinahe gestürzt wäre. »Setz dich, du hast mir noch immer nicht erklärt, warum ich nicht kommen darf.«
»Kannst du dir nicht vorstellen, dass es mir wehtut, dich bei mir zu sehen? Stimmt, du hast nichts getan, aber dein Nichtstun war schlimmer als ein Verbrechen. Ich weiß, du warst noch hilfloser als Olga, aber sie ist tot, und du lebst. Komm nicht, ich bitte dich sehr.«
»Meine Schuld ist also, dass ich noch lebe, ja? Tut mir leid, aber diese Schuld werde ich tilgen. Gib mir noch zwanzig, dreißig Jahre.«
»Hör auf.« Lilja seufzte müde. »Musst du immer den Narren spielen?«
Er öffnete den Mund, schüttelte den Kopf, stemmte die Ellbogen auf den Tisch, richtete sich auf, seine hervorquellenden braunen Augen blitzten, er wollte etwas Wichtiges, Heftiges sagen, brachte es aber nicht heraus. Seine Augen erloschen – so langsam wie das Licht im Kino.
»Nimm wenigstens das Geschenk«, knurrte er und zog ein kleines rotes Etui aus der Tasche. »Es sind goldene Ohrringe, so was mag sie doch.«
»Danke. Aber sie hat keine Ohrlöcher, das gäbe also nur Enttäuschung statt Freude. Die Zeitschrift nehme ich mit. Was bedeutet übrigens ›Blum‹?«
»Nichts. Klingt einfach schön.«
»Sind Artikel von dir drin?«
»Nein. Wie gesagt, ich bin stellvertretender Chefredakteur, ich schreibe selten selbst«, erwiderte er mit abgehacktem mechanischem Bass und sah ihr zum ersten Mal in die Augen. »Lilja, deine Schwester hat sich vor zehn Jahren umgebracht. Daran ist niemand schuld. Ich verspreche dir, dass ich nicht mehr bei dir auftauchen werde, bis du mich selbst einlädst. Aber beantworte mir eine einzige Frage: Was hat sich geändert? Warum gibst du plötzlich jemandem die Schuld an ihrem Tod?«
Sie antwortete nicht, packte die Zeitschrift sorgfältig in eine Plastiktüte, stand auf und ging.
Der Kellner kam, um die Tasse mit dem erkalteten, unangerührten Kaffee abzuräumen, und hörte den Mann sagen: »Miststück … Zicke … Ich hasse sie …«
Früh um halb vier überfuhr ein Streifenwagen der Miliz in einer menschenleeren Gasse in einem als relativ ruhig geltenden Schlafbezirk um ein Haar eine Frau. Die Männer brauchten eine Pause. Eben hatte das Gewitter aufgehört, aber es regnete noch immer und war merklich kühler geworden. Im Wagen war es warm und gemütlich. Unterleutnant Teletschkin hatte eine Zweiliterthermoskanne mit starkem Kaffee dabei, Hauptmann Krasnow ein geräuchertes Hähnchen. Sie wollten in einem Hof parken und etwas essen.
Die Frau tauchte ganz plötzlich auf, wie aus dem Nichts. Der Fahrer konnte gerade noch bremsen. Die Frau erstarrte mitten auf der Fahrbahn und rührte sich nicht, reagierte weder auf das Kreischen der Bremsen noch auf die grellen, blendenden Scheinwerfer oder auf den Schrei des Fahrers. Sie war in ein weites, helles Gewand gehüllt und wirkte im leblosen Scheinwerferlicht und im zitternden Regenschleier wie ein Gespenst.
»Steig mal aus, Kolja, sieh nach, was los ist«, befahl Hauptmann Krasnow dem Unterleutnant.
»Die ist stoned oder besoffen«, knurrte Kolja. »Wegen so einer dummen Kuh raus in den Regen …« Als er näher heran war, entdeckte er, dass es ein Mädchen war, vielleicht fünfzehn, barfuß, in einer Art Kittel oder Nachthemd.
»Klar, die ist stoned«, wiederholte der Unterleutnant und fragte: »He, bist du lebensmüde oder was?«
»Ich habe Tante Lilja getötet«, sagte das Mädchen langsam, die irren Augen auf den Milizionär gerichtet. Sie hatte einen Sprachfehler und eine helle Kinderstimme.
»Was?«
»Zweite Kalugaer Straße acht, Block zwei, Wohnung vierzig.«
»Na schön, komm mit zum Wagen, wir klären das.« Er nahm ihren Arm, sie wehrte sich nicht, stieg folgsam ins Auto und wiederholte laut: »Ich habe Tante Lilja getötet.«
»Wie alt bist du?«, erkundigte sich Hauptmann Krasnow und verzog angeekelt das Gesicht. Das Mädchen roch merkwürdig. Zwiebeln, erriet der Hauptmann. Aber um so zu stinken, musste man ein ganzes Pfund davon essen.
»Vierzehn«, antwortete das Mädchen und setzte nach einer kurzen Pause hinzu: »Ljussja Kolomejez.«
»Also, wen hast du getötet, Ljussja Kolomejez?«
»Tante Lilja. Sie liegt da in der Küche und bewegt sich nicht mehr. Jemand muss die Schnelle Hilfe rufen, aber ich hab Angst vor Ärzten.«
»Wieso denn?«, fragte Teletschkin mit dümmlichem Lachen.
»Die geben Spritzen. Das tut weh«, antwortete das Mädchen und ergänzte nachdenklich: »Sie sind böse und tun einem gern weh.«
Der am Steuer sitzende Sergeant Surkow fing im Spiegel Krasnows Blick auf und verdrehte vielsagend die Augen.
»Wer ist denn Tante Lilja?«
»Na, meine Tante. Die Schwester von meiner Mama.«
»Und wo ist deine Mama?«
»Die ist tot«, erklärte das Mädchen und seufzte. »Schon lange, da war ich noch klein. Erst ist Mama gestorben, dann Oma. Ich hab nur noch Tante Lilja.«
»Hast du einen Vater?«
»Nö. Ich hab keinen. Nur Tante Lilja.«
»Und wieso hast du dann deine Tante getötet, deine einzige Verwandte?«, fragte Teletschkin und räusperte sich.
Das Mädchen schwieg.
In der Gasse stand nur alle paar Meter eine Straßenlaterne, das Auto tauchte immer wieder aus dem Dunkel ins Licht, das Gesicht des Mädchens leuchtete auf und verschwand wieder, und dem Unterleutnant war mulmig zumute. Er konnte das Mädchen nicht richtig sehen, und sie wirkte auf ihn wie ein Zombie.
Die Tür war offen. Überall brannte Licht. Es roch nach Sauberkeit, nach Lavendel und guter Seife. Eine ganz normale kleine Wohnung mit winzigem Flur und zwei hintereinander liegenden Zimmern. Von der Küchentür aus fiel der Blick auf zwei Füße in gemusterten Wollsocken.
»Entschuldigung, könnten Sie bitte die Schuhe ausziehen? Draußen ist es schmutzig«, sagte das Mädchen mit heller Stimme und trat sich die nackten Füße sorgfältig an der Fußmatte ab.
»Was?«, fragte Krasnow und entdeckte auf ihrer Stirn und ihrer Nase weiße Spuren einer dicken Salbe.
»Dort im Schrank sind Latschen. Bei Tante Lilja darf niemand mit Straßenschuhen in die Wohnung. Was sehen Sie mich so an? Ich hab mich mit einer Salbe gegen Pickel eingecremt.«
Sie sagte kein Wort weiter, ging ins Zimmer, setzte sich an den Tisch, faltete die Hände auf dem Schoß und starrte vor sich hin.
Die Tote war höchstens vierzig. Sie war gepflegt, blond, hatte ein glattes, regelmäßiges Gesicht und sah aus, als habe sie sich nur auf den Boden gesetzt, den Rücken an die Heizung gelehnt und die Beine ausgestreckt. Sie trug einen warmen Frottéebademantel und flauschige gemusterte Socken. Auf dem zartrosa weichen Stoff hatten sich dunkle Blutflecke ausgebreitet. Nach der Blutmenge zu urteilen, waren ihr mindestens ein Dutzend Messerstiche beigebracht worden. Auch die Tatwaffe lag da – ein langes Küchenmesser mit schwarzem Plastikgriff.
Der Fall schien simpel. Eine banale Beziehungstat. Ein schwachsinniges Mädchen tötet seine Tante und gesteht die Tat. Die Zeugen, ein älteres Ehepaar aus der Nachbarwohnung, seufzten lange, dann erzählten sie flüsternd, Ljussja sei Waise und von Geburt an behindert.
»Alles klar, keine Fragen«, bemerkte Krasnow tiefsinnig und seufzte. »Ein Traum von einer Leiche.«
Das Einsatzkommando erschien nach zwanzig Minuten. Ausgerechnet Ilja Borodin hatte Dienst. Er war berüchtigt dafür, auch die einfachsten Fälle zu verwirren und kompliziert zu machen. Der rundliche kleine Mann mit der leisen, monotonen Stimme trieb mit seiner intellektuellen Pedanterie selbst die geduldigsten Kriminalisten und Experten zur Verzweiflung.
Kaum über die Schwelle getreten, murmelte Borodin, für ein derartiges blutiges Gemetzel sei es hier viel zu sauber.
»Wieso?«, fragte der Spurensicherer erstaunt. »Hier ist doch jede Menge Blut. Aber die Tote trug einen dicken, weichen Bademantel, der hat fast alles aufgesaugt.«
»Das meine ich nicht«, erklärte der Untersuchungsführer mit dumpfer Stimme. »Die Tote ist eine normale Frau, ordentlich und sauber. Kaum anzunehmen, dass sie mit dubiosen Geschäften zu tun hatte. Ihr Lebensstandard lag offensichtlich unter dem Durchschnitt, soweit man heutzutage überhaupt noch von Durchschnitt sprechen kann. Raub ist so gut wie auszuschließen, Alkohol oder eine betrunkene Prügelei sind es mit Sicherheit.«
»Die Sache ist die«, flüsterte Unterleutnant Teletschkin ihm ins Ohr, »das Mädchen hier hat sie getötet, ihre Nichte. Sie hat die Tat gestanden. Sie ist behindert, debil oder so. Solche Menschen wissen nicht, was sie tun.«
»Warum flüstern Sie denn? Ist das Ihr erster gewaltsamer Tod?«, fragte Borodin mit leicht erhobener Stimme.
»Ja«, bekannte Teletschkin und sah sich zum ersten Mal aufmerksam und in Ruhe um in der Wohnung, in der er sich bereits seit einer halben Stunde befand. Die reinste Puppenstube – gemütlich und hübsch wie in einem Zeichentrickfilm. In der Küche weiße Möbel, weißes Linoleum, in den Zimmern blassgelbes Parkett, hellblaue Tapeten mit rosa Blümchen, Vorhänge mit Volands, die Bezüge des Sofas und der beiden Sessel aus dem gleichen Stoff wie die Vorhänge. Auf dem Sofa drei große Puppen in Rüschenkleidern, mit Hut und Schuhchen. Mitten im Zimmer ein runder Tisch, darauf ein zartrosa Tischtuch mit langen Fransen, auf dem Tisch eine Vase mit drei Tulpen und eine große Schachtel Pralinen mit einer Schleife darum.
»Hattet ihr Besuch?«, wandte sich Borodin an Ljussja.
Das Mädchen zuckte zusammen und schrie: »Nein!«
»Dann hat also jemand Geburtstag?«
»Nein, kein Geburtstag, keiner war hier.« Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her und wurde tiefrot, wodurch die weißen Salbenflecke in ihrem Gesicht noch stärker auffielen.
»Wieso dann die Blumen und die Pralinen?«
»Einfach so.«
»Ich verstehe.« Borodin nickte. »Und wer hat die einfach so vorbeigebracht?«
»Niemand.« Das Mädchen senkte den Kopf und flocht einen Zopf aus den Fransen der Tischdecke.
»Ljussja, warum hast du deine Tante getötet?«, fragte Borodin sanft.
Keine Reaktion.
»Na schön, nehmen wir an, das weißt du selber nicht. Wohnst du bei deiner Tante, oder warst du nur zu Besuch bei ihr?«
Ljussja war mit dem ersten Zopf fertig und begann mit dem nächsten.
»Sie ist Waise«, flüsterte die Nachbarin, »sie lebt in einem Sonderschulinternat außerhalb von Moskau. Lilja hat sie früher immer dort besucht, aber seit kurzem hat sie das Mädchen in den Ferien und am Wochenende zu sich geholt. Wissen Sie, Lilja stand völlig allein, ihre Schwester, Ljussjas Mutter, ist tot, und das Mädchen ist behindert.« Die Nachbarin rückte näher an Borodin heran und flüsterte noch leiser: »Ljussjas Mutter war drogensüchtig, der Vater ist unbekannt. Mein Gott, was für eine Tragödie! Ja, ja, es stimmt schon: Keine gute Tat bleibt ungestraft. Lilja war ein guter, reiner Mensch, und sie hatte wirklich Talent. Alles Schöne, was Sie hier sehen, hat sie selbst gemacht – die Vorhänge, die Möbelbezüge, die Tischdecke …« Die Nachbarin schluchzte auf und schnäuzte sich laut. »Ich kann es noch gar nicht fassen – was für eine Tragödie!«
»Ja, ja«, murmelte Borodin, stand auf, ging zur Wand und klopfte mit den Fingerkuppen dagegen. »Sagen Sie, haben Sie irgendwelchen Lärm gehört?«
»Nein.« Die Nachbarin schüttelte den Kopf. »Ich habe einen sehr leichten Schlaf, und die Wände sind dünn. Wenn etwas gewesen wäre, hätte ich es bestimmt mitbekommen.«
»Sie haben also keine Schreie gehört oder das Poltern von Möbeln?«
»Gott behüte! Dann wären mein Mann und ich doch sofort zu Hilfe geeilt und hätten die Miliz gerufen. Wir verstanden uns sehr gut mit Lilja.«
»Ilja, kann ich Sie kurz sprechen?«, rief der Gerichtsmediziner aus der Küche.
»Entschuldigen Sie mich.« Borodin ging hinaus.
»Der Tod ist vor höchstens zwei Stunden eingetreten«, sagte der Pathologe, zündete sich eine Zigarette an und setzte sich auf einen Hocker. »Dieses Mädchen ist eine Bestie. Achtzehn Stichwunden am ganzen Körper, sechs davon in den Rücken. Sie hat sie erst getötet und dann zur Heizung geschleppt und hingesetzt.«
»Und das alles ganz leise, quasi auf Zehenspitzen«, sagte Borodin. »Sonst hätte jemand was gehört, bei den Pappwänden hier.«
»Klar, Plattenbau.« Der Pathologe nickte und hielt Borodin die geöffnete Zigarettenschachtel hin. »Bedienen Sie sich.«
»Danke, ich rauche nicht.« Borodin hockte sich neben die Tote. »Eine hübsche Frau.«
Der Pathologe nickte. »Ja, nicht übel.«
»Jung, hübsch, allein. Häuslich, reinlich und mit einem Faible für Handarbeiten.« Borodin sah den Pathologen nachdenklich an. »Eine Frau, die Spitzendecken häkelt, ist bestimmt ruhig und ausgeglichen.«
»Vielleicht hat das ja die Nichte so aufgebracht«, mutmaßte der Pathologe.
»Achtzehn Messerstiche.« Borodin schüttelte den Kopf. »Klingt eher nach einem wilden Streit im Suff.«
»Klingt nach einem Psychopathen.« Der Pathologe lachte schief und blies einen Rauchkringel in die Luft. »Und wenn der erste Stich überraschend kam und ins Herz traf, dann hat sie auch nicht geschrien und sich nicht gewehrt.«
»Um das Herz auf Anhieb zu treffen, muss man genau wissen, wo es liegt«, knurrte Borodin. »Außerdem braucht er eine ruhige, starke Hand. Nein, was meinen Sie, warum hat das Opfer nicht geschrien und sich nicht gewehrt?«
»Das fragen Sie mich?« Der Pathologe hob die Brauen.
»Nein, mich selbst.« Borodin lächelte. »Die Nachbarn sagen, am Abend und in der Nacht sei es ruhig gewesen. Und es gibt keinerlei Kampfspuren.«
»Die Kleine hat ihrer lieben Tante erst Clonidin verabreicht und dann auf sie eingestochen«, bemerkte der Pathologe sarkastisch. »Ziemlich clever für eine Geisteskranke. Aber vielleicht simuliert sie ja nur? Obwohl – wer so oft zusticht, muss schon krank im Kopf sein, eine wahre Bestie. Echter Schwachsinn, das Ganze.«
Borodin nickte. »Schwachsinn, genau.«
Die Tote, Lilja Anatoljewna Kolomejez, hatte allein gelebt, war kinderlos und, wie aus dem Ausweis hervorging, nie verheiratet gewesen. Sie arbeitete als Designerin in einer Spielzeugfabrik. In einer Schachtel mit Papieren lag ein Totenschein – Olga Kolomejez, gestorben am 30. Juni 1989, Todesursache: Suizid. Und die Geburtsurkunde von Ljussja, Ljudmila Kolomejez. In der Spalte »Vater« war ein Strich. Interessant war das Geburtsdatum: 6. Juni 1985. Ljussja war also gestern fünfzehn geworden.
»Ljussja, wie alt bist du?«, fragte er, ohne auf eine Antwort zu hoffen. Doch das Mädchen sagte laut und deutlich: »Vierzehn.«
»Und wann hast du Geburtstag?«
»Ich weiß nicht.« Ihr Kopf sank zwischen die Schultern, ihr Gesicht war leer.
»Sie lügt«, flüsterte Unterleutnant Teletschkin Borodin ins Ohr. »Sie weiß ihre Adresse und ihr Geburtsjahr, sie weiß garantiert auch den Tag, und überhaupt ist sie weniger gestört, als sie uns weismachen will.«
Borodin sah ihn interessiert an, nickte schweigend und wandte sich wieder an Ljussja.
»Sag mal, hast du Zwiebeln gegessen?«
»Nein. Ich reib mir damit den Kopf ein, damit die Haare besser wachsen.«
»Wer hat dir denn das erzählt? Deine Tante?«
»Nein, die Krankenschwester bei Mama Isa.«
»Und wer ist Mama Isa?«
»Wer?«, fragte das Mädchen erschrocken zurück.
»Na, du hast doch eben gesagt: Mama Isa.«
»Das hab ich nicht gesagt, ich weiß nicht, fragen Sie Tante Lilja.« Ihre Augen huschten unruhig hin und her, ihre Lider flatterten, ihr Gesicht war tiefrot.
»Tante Lilja ist tot«, sagte Borodin sanft, »du sagst doch selbst, dass du sie getötet hast. Kannst du uns erzählen, wie du das gemacht hast?«
»Gar nicht.«
»Das heißt, du erinnerst dich nicht?«
»Doch.«
»Woran denn?«
»Ich habe Tante Lilja getötet. Ljussja ist böse.«
»Na komm, zeig mir mal, wie es war.«
Das Mädchen erstarrte, sie schien sogar den Atem anzuhalten.
»Komm mit in die Küche, Ljussja.«
»Nein. Ich habe Angst.«
»Aber vorm Töten hattest du keine Angst?«
»Nein!«, flüsterte Ljussja laut, lehnte sich kraftlos in den Stuhl zurück, schloss die Augen und flüsterte hastig: »Ich weiß nicht, bitte, nein… Das Blut… Ich habe Angst… Bitte nicht, das tut ihr weh…« Ihr Gesicht war nun weiß, ihre Lippen bewegten sich lautlos weiter.
Der Kriminaltechniker trat an den Tisch und griff nach der Pralinenschachtel, um Fingerabdrücke zu sichern. Ljussja zuckte zusammen wie von einem Stromschlag getroffen. Borodin zog die Brauen hoch und schüttelte den Kopf, der Techniker hob wortlos die Achseln und verschwand in der Küche. Im Zimmer herrschte Stille. Ljussja saß mit geschlossenen Augen da und bewegte lautlos die Lippen.
»Magst du Schokolade, Ljussja?«, fragte Borodin freundlich.
Sie zuckte erneut zusammen, öffnete die Augen und flocht wieder einen Zopf aus den Fransen der Tischdecke.
»Du hast Pralinen geschenkt bekommen und sie nicht einmal probiert.« Borodin langte nach der Schachtel.
»Nicht anfassen!«, rief Ljussja und errötete.
»Warum nicht?«
»Das sind meine! Die hab ich geschenkt gekriegt!«
»Von wem?«
»Von einem Mann.« Sie warf den Kopf zurück und strich sich kokett das Haar glatt.
»Wie heißt er?«
»Das sage ich nicht.«
»Er war gestern Abend hier und hat dir Blumen und Pralinen zum Geburtstag geschenkt, ja?«
Ljussja sprang plötzlich auf, riss die Arme hoch, als wollte sie sich auf Borodin stürzen, presste aber nur die Hände vor den Mund, sank zurück auf den Stuhl und erstarrte. Dann sagte sie kein Wort mehr.
Ein Team des psychiatrischen Notdienstes traf ein. Ljussja tat brav alles, was man ihr sagte, wusch sich und zog sich an. Ihre Sachen, weite helle Jeans und ein blaues T-Shirt, lagen ordentlich zusammengefaltet auf einem Stuhl im kleinen Zimmer, neben dem gemachten Bett. Ljussja beantwortete keine einzige Frage, als habe sie das Sprechen endgültig verlernt. Ihr Gesicht war bläulichblass, ihr Blick starr auf einen Punkt gerichtet, ihre Bewegungen waren schlaff und träge.
»Was können Sie über sie sagen?«, fragte Borodin die Psychiaterin, eine energische junge Frau, als diese im Treppenhaus eine Rauchpause machte.
»Sie ist debil – die leichteste Form geistiger Behinderung.« Die Ärztin zuckte die Achseln. »Im Prinzip durchaus zurechnungsfähig.«
»Könnte sie sich zu Unrecht selbst beschuldigen?«
»Das müssen Sie schon selbst herausfinden.«
Ljussja wurde weggebracht, die Tote hinausgetragen, die Wohnung weiter durchsucht.
Im Kleiderschrank, in der Kommode und auf dem kleinen Hängeboden herrschte perfekte Ordnung. Die Winterkleidung war in alte Bett- und Kissenbezüge eingenäht, die Sommerkleidung hing auf Bügeln im Schrank, zwischen den akkuraten Stapeln gestärkter Bettwäsche lagen Leinensäckchen mit getrocknetem Lavendel. Jedes Säckchen war mit einer geflochtenen Schnur zugebunden und mit zierlichen Stickereien versehen: Blümchen, Pilze oder Kirschen.
Den kleinen Bücherschrank füllten vor allem Handarbeitsbücher und Bände wie »Geschichte des russischen Spielzeugs«, »Kinder und die Welt der Kindheit im 19. Jahrhundert«, »Lexikon der Puppenmode«. In den unteren Fächern lagen Zeitschriftenstapel: »Verena«, »Burda Moden« und anderes zum Thema Handarbeit, Spitzenklöppelei, Puppen- und Kinderkleidung.
Eines gab es in der Wohnung nicht: Geld. Selbst die Handtasche der Toten, die sie vermutlich bei sich gehabt hatte, als sie das letzte Mal die Wohnung verließ, enthielt nicht eine Kopeke. Es gab keine Sparbücher, keine Kreditkarten. Kein einziges Schmuckstück, weder in der Wohnung noch an der Toten. Die Nachbarn wussten natürlich nicht, wie viel Geld in der Wohnung gewesen sein könnte, auch über eventuellen Schmuck konnten sie nichts sagen. Allerdings erinnerte sich die Nachbarin, dass Lilja teure goldene Ohrringe mit großen Saphiren besessen und angeblich stets getragen habe.
Die Schreibtischfächer enthielten Mappen mit Schnittmustern auf Pergamentpapier, Glückwunschkarten und zwei Fotoalben. Die steckte Borodin ein, um sie sich in Ruhe anzusehen. Irgendetwas ließ ihm keine Ruhe. Er setzte sich an den Schreibtisch, verfasste das Protokoll und hielt plötzlich inne, den Blick auf das raffinierte Muster der gehäkelten Tischdecke gerichtet.
Eine Frau mit einem Faible für Handarbeiten muss doch Wolle, Strick- und Häkelnadeln, Scheren und Stoffreste im Haus haben. In der Wohnung der Toten gab es eine teure Nähmaschine, aber keine einzige Garnrolle, keinen einzigen Wollfaden.
Blödsinn, sagte sich Borodin, angenommen, das schwachsinnige Mädchen hat in einem Zustand der Verwirrung seine Tante erstochen. Schön, so was kommt vor. Dann nimmt sie Geld und Schmuck, die Saphirohrringe womöglich aus den Ohren der Toten, dazu sämtliche Handarbeitsutensilien, bringt das alles weg, versteckt es, geht zurück, sieht die tote Tante, bekommt einen Schreck und läuft wieder hinaus auf die Straße, und zwar barfuß und im Nachthemd? Blödsinn!
Borodin wollte nicht mit dem Auto ins Präsidium fahren, sondern lieber ein Stück laufen. Mit der Morgendämmerung hatte es aufgeklart, die Luft war weich und seidig wie Quellwasser. Nach der schlaflosen Nacht war ihm ein wenig schwindlig, aber er fühlte sich ausnehmend munter. Er war wütend, und das machte ihn immer munter.
Er liebte komplizierte, verworrene Fälle. Und dies war so ein Fall. Es würde schwer sein, zu beweisen, dass Ljussja den Mord nicht begangen hatte, er war ja selbst nicht hundertprozentig sicher. Es würde nicht leicht sein, den bewussten »Mann« zu finden – wenn es ihn wirklich gab, denn die Blumen und Pralinen konnte auch Lilja Kolomejez ihrer Nichte zum Geburtstag geschenkt haben.
Wütend war Borodin aber vor allem deshalb, weil ihm die stille, einsame junge Frau, die Puppenkleider entworfen, Spitzentischdecken gehäkelt und Blümchen auf Leinensäckchen mit getrocknetem Lavendel gestickt hatte, unendlich leid tat.
Tief in Gedanken, sah Borodin sich nicht um. Er kannte die Gegend – als er aus dem Haus kam, wusste er sofort, dass die Metro ganz in der Nähe war und er den Weg durch Höfe und kleine Gassen abkürzen konnte. In einem Hof stolperte er, stieß mit dem Knie gegen ein gewaltiges, aus der Erde ragendes Eisenrohr und wäre beinahe gestürzt. Hier wurden neue Rohrleitungen verlegt, man hatte den Asphalt aufgerissen, alles aufgebuddelt und es versäumt, die Baustelle zu umzäunen. Der Weg darum herum führte über einen Spielplatz. Humpelnd ging Borodin weiter. Ein unerträglicher Gestank drang ihm in die Nase. Auf dem Rand des Sandkastens saß ein Obdachlosenpärchen. Der Mann schlief, an die Schulter seiner Freundin gelehnt, und sie kramte konzentriert in einem kleinen truhenähnlichen Korb auf ihrem Schoß, wühlte in etwas Buntem, Weichem. Borodin erstarrte.
»Was kuckstn so?«, fragte die Obdachlose. »Geh weiter.«
In ihren schmutzigen, schwieligen Händen zitterte wie lebendig ein Knäuel zartrosa Wolle – aus dieser Wolle war die Tischdecke mit den langen Fransen in der Wohnung der Toten.
Zweites Kapitel
Die Redaktion der Zeitschrift »Blum« nahm die unterste Etage einer kleinen Villa in einer gemütlichen Gasse im Zentrum von Moskau ein. Ein flüchtiger Blick auf die Villa, den gepflegten grünen Hof und die dort geparkten ausländischen Wagen offenbarte, dass hier nicht die ärmsten Firmen und Organisationen residierten.
Trotz der harten Konkurrenz prosperierte das Hochglanzmagazin. Etwa siebzig der hundert Seiten waren mit Werbung gefüllt, die übrigen dreißig mit Fotoreportagen von angesagten Szene-Events, Artikeln über Sex, Interviews mit dubiosen Psychologen, die Dinge behaupteten wie: der Mutterliebe liege ein unbewusstes Inzeststreben zugrunde oder Arbeitseifer sei die Folge unterdrückter sexueller Instinkte. Ein paar Seiten enthielten spöttische Kritiken zu Neuem aus Film, Theater und Literatur sowie Notizen zur Avantgarde-Mode. Zum Dessert wurde Pikantes serviert: Ein bebilderter Bericht über das Nachtleben in einer bekannten Homosexuellen-Bar. Und als Sensation die Entdeckung eines neuen Virus, der die männliche Potenz angeblich ins Unermessliche steigert. Plus eine neckische Reportage von einer schwarzen Messe oder von einem echten Satanistensabbat auf einem Moskauer Vorortfriedhof.
Normalerweise herrschte nach der Fertigstellung einer Nummer, wenn sämtliches Material zum Druck nach Finnland abgeschickt war, in der Redaktion einige Tage lang selige Ruhe. Diese Zeit liebte der stellvertretende Chefredakteur Oleg Solodkin am meisten. Dann erschien er früher zur Arbeit als sonst, gegen zehn, kochte sich einen starken Kaffee, schaltete den Computer ein, schob eine Beatles- oder Rolling-Stones-CD ins Laufwerk, rauchte Kette und versuchte, etwas Geniales zu schöpfen.
Oleg war vom ersten Tag an bei »Blum«, der Chefredakteur war ein Kommilitone von der Filmhochschule. Sie hatten das Magazin zusammen gegründet.
Oleg lebte in einer Fünfzimmerwohnung mit seiner Mutter und seiner Frau Xenia, die halb so alt war wie er und ihm vor drei Monaten eine Tochter geboren hatte. Außerdem besaßen sie eine solide winterfeste Datscha bei Moskau. Doch all das gehörte allein seiner energischen Mutter Galina. Das winzige Büro in der Redaktion war der einzige Ort, wo Oleg sich frei fühlte.
Am Donnerstag, dem 8. Juni um elf herrschte in Olegs geliebtem Büro eine so sanfte, frische Stille, dass er nicht einmal Musik einlegte. Er saß bereits über eine Stunde vor dem Computermonitor. Seine schmalen, trägen Finger lagen auf der Tastatur und zitterten merklich. Auf dem weißen Bildschirm stand in fetter Schrift: »Kreativität ist ein Akt seelischen Exhibitionismus. Nikolai Gogol ließ seine Nase künstlich verlängern, damit sie dem Zeugungsorgan ähnelte.«
Er brütete über einem Artikel zum Thema: »Alle Genies sind verrückt«, als das Haustelefon klingelte.
»Oleg Wassiljewitsch, hier sind zwei Mädchen, die wollen zu Ihnen«, sagte der Sicherheitsmann.
»Was für Mädchen?« Oleg verzog das Gesicht und wollte schon sagen, dass er nicht gestört zu werden wünsche, da verkündete der Sicherheitsmann spöttisch: »Zwei gleiche.«
Oleg wusste, wen er meinte. Siebzehnjährige Zwillinge, sehr hübsch. Er hatte sie vor einem halben Jahr kennengelernt und ihnen törichterweise seine Telefonnummer gegeben. Seitdem riefen sie regelmäßig an und waren schon mehrmals in der Redaktion erschienen, einfach so, zu Besuch. Einer der Hausfotografen des Magazins war auf sie aufmerksam geworden, hatte ihnen seine Visitenkarte in die Hand gedrückt und versprochen, sie aufs Titelblatt zu bringen.
»Okay, lass sie rein«, sagte er.
Kurz darauf war das winzige Büro von melodischem Lachen und dem Geruch eines starken süßen Parfüms erfüllt. Bevor die Mädchen den Hausherrn begrüßten oder zumindest beachteten, richteten sie ihr Haar und zogen sich vorm Spiegel die Lippen nach, setzten sich auf die Lehnen des einzigen Sessels, zündeten sich gleichzeitig eine Zigarette an und geruhten erst dann, im Chor zu zwitschern: »Hallo! Wie geht’s?« Um daraufhin erneut zu kichern.
Sie waren hübsch und frech. Hochgewachsen, schlank, mit langem blondem Haar und regelmäßigen Puppengesichtern. Ihre absolute Ähnlichkeit verdoppelte den Effekt, und das wussten sie und verhielten sich, als sei ihre Anwesenheit ein großes, unverdientes Geschenk für jeden. Sie kleideten sich meist gleich, doch diesmal trugen sie Minikleidchen von verschiedener Farbe. Die eine in Weiß, die andere in Schwarz.
»Und, wo ist Ihr Fotograf?«, fragte das Mädchen in Weiß.
»Wieso gibt er uns eine Telefonnummer, unter der er nie zu erreichen ist?«, ergänzte das Mädchen in Schwarz.
»Ich habe eigentlich zu tun«, antwortete Oleg mürrisch, bemüht, die beiden nicht anzusehen.
»Dann rufen Sie den Fotografen zu Hause an. Auf der Visitenkarte steht nur die Telefonnummer der Redaktion und die vom Fotostudio. Keine Privatnummer.«
»Gut.« Oleg nickte. »Ich werde ihn anrufen. Aber jetzt habe ich keine Zeit.«
»Eine Nummer wählen dauert doch nicht ewig!«
Na schön, dachte Oleg gereizt, wenn dieser Idiot versprochen hat, sie auf die Titelseite zu bringen, soll er sich gefällig selbst mit ihnen rumärgern.
Er blätterte in seinem Notizbuch, schrieb die Privatnummer des Fotografen auf einen Zettel und reichte ihn den Mädchen.
»So, und jetzt geht, ich habe zu tun.«
»Oje, seine Hände zittern ja«, bemerkte die Weiße mitfühlend und griff nach dem Zettel. »Zu viel getrunken gestern?« Sie zwinkerte fröhlich und sah Oleg aus klaren, reinen, himmelblauen Augen an.
»Nein«. Die Schwarze schüttelte den Kopf. »Wodka – das ist viel zu grob. Oleg hat einen exquisiten Geschmack.«
»Ich vermute, Oleg als echter Aristokrat ist auf Koks oder Heroin«, sagte die Weiße.
»Schluss jetzt, Mädels, ich habe zu tun«, knurrte Oleg und starrte auf den Computerbildschirm. Das Zittern wurde immer stärker.
»Können wir den Fotografen nicht von hier aus anrufen?«, fragte die Schwarze.
»Nein. Ich habe zu tun.«
»Ach ja, ständig am Schreiben«, seufzte die Weiße. »Woran arbeiten Sie denn gerade?«
»Das geht dich nichts an.« Oleg spürte, dass sein Hemd unter den Achseln ganz nass war.
»Nein, wie grob.« Die Schwarze schüttelte traurig den Kopf. »Sie sind doch ein guter Mensch, Oleg, Sie sind so nett. Aber Sie haben wohl gerade Unannehmlichkeiten und sind deshalb so nervös? Wir helfen Ihnen gern, sich zu entspannen.« Sie schloss die Augen und fuhr sich langsam mit der Zunge über die Lippen.
»Geht ihr nun endlich?« Oleg ballte so heftig die Fäuste, dass die Fingernägel sich in die Handfläche bohrten. »Ich rufe gleich den Sicherheitsdienst, die schmeißen euch raus.«
»Was haben wir Ihnen denn getan?« Die Weiße lächelte entwaffnend. »Wir meinen es doch nur gut mit Ihnen.«
»Geht jetzt, bitte, geht«, stöhnte Oleg und setzte kaum hörbar hinzu: »Das ist unerträglich.«
»Können wir Nikolai von hier aus anrufen?«, fragte die Weiße mit gesenktem Kopf. »Nur ein kurzer Anruf, und wir sind wieder weg.«
Oleg griff wortlos zum Telefon, wählte die Privatnummer des Fotografen, lauschte eine Weile dem Amtszeichen, dachte schon, Nikolai sei nicht zu Hause, und wollte wieder auflegen, als sich eine hohe Stimme verschlafen meldete: »Hallo?«
»Hallo, Nikolai«, knurrte Oleg, »hast du den Zwillingen versprochen, ein Titelfoto von ihnen zu machen?«
»Oleg, ich schlafe noch«, verkündete Nikolai laut gähnend.
»Du schläfst, und die Mädchen sitzen hier und halten mich von der Arbeit ab. Du hast ihnen was versprochen, also kümmere dich um sie.« Er übergab den Hörer dem Mädchen in Weiß.
Die Zwillinge verabredeten sich mit dem Fotografen, dann verabschiedeten sie sich höflich von Oleg und gingen.
Als die Tür hinter ihnen zugefallen war, brauchte Oleg lange, um sich eine Zigarette anzuzünden, so heftig zitterten ihm die Hände. Nach einem ersten langen Zug machte er sich mit ein paar obszönen Beschimpfungen Luft, die nicht den beiden Mädchen galten, sondern ihm selbst, bewegte die Maus, um den Bildschirmschoner zu deaktivieren, und rang um den Beginn des Artikels über verrückte Genies. Doch sein Kopf war leer. Mindestens zehn Minuten saß er so da. In seinem Mundwinkel zitterte die erloschene Zigarette. Eine dicke Fliege setzte sich auf den Monitor.
Oleg spuckte den Zigarettenstummel auf den Fußboden, pustete auf die Fliege, und wieder tauchte der Bildschirmschoner auf – ein Ziegellabyrinth. Die Fliege drang mühelos durch das Glas in das Computerlabyrinth ein, kroch erst langsam, beinahe widerwillig, dann immer schneller. Oleg beobachtete, wie das unappetitliche Insekt mit den schillernden Flügeln zitterte und hektisch die dünnen Drahtbeinchen bewegte. Im Inneren des Computers ertönte ein widerliches Brummen. Das Labyrinth füllte sich mit fetten weißen Maden, sie krochen herum und verschmolzen zu weichen, eiförmigen Körpern. Oleg bewegte die Maus, das Labyrinth verschwand, doch statt Buchstaben glitten schwarze Fliegen über den Bildschirm.
»Nach einer Aussage des Dichters Jasykow erzählte Gogol einmal, er sei in Paris von berühmten Ärzten untersucht worden, und die hätten festgestellt, dass sein Magen verkehrtherum im Bauch liege«, tippte Oleg rasch, konnte das Geschriebene jedoch nicht lesen. Er sah nur fette Fliegen, keinen einzigen Buchstaben. Die Insekten gelangten direkt aus seinem Kopf in den Computer. Sein Schädel war voller Fliegen, sie summten unerträglich laut, krochen durch seine Gehirnwindungen und legten dort Eier. Ein heftiger, ziehender Schmerz sprengte seinen Kopf, lief durch Wirbelsäule und Rippen und ergriff rasch und unerbittlich von seinem gesamten Körper Besitz. Kein einziger Knochen war mehr ohne Schmerzen. Tränen spritzten ihm aus den Augen, eine Gänsehaut überzog seinen Körper, der Schüttelfrost wurde immer heftiger. Er wusste, dass dies Entzugserscheinungen waren.
Nichts war einfacher und angenehmer, als eine Entscheidung zu treffen. Wie oft hatte er das schon durchgemacht? Er hatte längst aufgehört zu zählen. Wie viele Ärzte hatten ihn schon mit Metadon versorgt, einem synthetischen Opiumersatz! Zwanzig Tage lang wurde der Entzug gedämpft durch eine armselige Simulation von Rausch, gestützt durch Psychotherapie und Autosuggestion.
»Ich bin ruhig, ich bin ganz ruhig«, murmelte Oleg, lehnte sich im Stuhl zurück und schloss die Augen. »Es geht mir gut, es geht mir ausgezeichnet, wie einem Gehängten in der Agonie des Todes, wie einem Psychopathen, der mit Elektroschocks behandelt wird. Ich werde aufhören und weiterleben. Ich habe Mama, die mich sehr liebt. Ich habe meine Frau Xenia, sie ist jung und schön. Ich habe meine Tochter Mascha, sie ist drei Monate alt. Ich bin sehr glücklich. Mein Vater hat nach einem Gespräch mit einem allwissenden Drogentherapeuten, der erklärte, ich hätte keine Chance, einen Herzinfarkt erlitten. Mutter gibt mir die Schuld an Vaters Tod. Ich bin schuld. Ich bin auch an vielem anderem schuld, an Schrecklichem, nie wieder Gutzumachendem, aber daran kann ich nicht denken.
Außer dem Metadon hatte er eine Dosis LSD-25 bei sich. Eine kleine Ampulle mit einer durchsichtigen, geruch- und geschmacklosen Flüssigkeit. Ein magischer Tropfen Lebenswasser, durch geheimnisvolle Verwandlung gewonnen aus Mutterkorn. Das beste aller Psychodelika, besser als Heroin. Purpurner Nebel. Goldene Sonnenstrahlen. Orangerotes Leuchten. Er musste nur die Hand ausstrecken, in seine an der Stuhllehne hängende Tasche greifen, und in wenigen Minuten wäre die Welt erfüllt von wundervollem Licht und der Schmerz verschwunden, die unerträglichen Schuldgefühle würden verblassen, die Fliegen sich in Schmetterlinge verwandeln, das widerliche Summen in überirdische Musik, und er würde eine märchenhafte Reise in Zeit und Raum antreten.
Oleg verabschiedete sich von der Idee eines Artikels über verrückte Genies. Dafür brauchte man heftigen Neid auf die toten Genies und Verachtung für die lebenden Idioten, die diese Toten anbeteten. Bosheit und Frivolität. All das empfand Oleg, wenn er versuchte aufzuhören, wenn er auf Entzug war und dabei schier den Verstand verlor. Nun aber war er ruhig und glücklich.
Beim Anblick des Handarbeitskorbs stand Borodin eine Weile da wie angewurzelt und schaute in die verschiedenfarbigen Augen der Obdachlosen. Sie entlud sich in einem so deftigen obszönen Monolog, dass er die Hoffnung auf ein ruhiges, vertrauensvolles Gespräch augenblicklich fallenließ und zur Metro lief, um in uniformierter Begleitung wiederzukommen.
Nina Simakowa, genannt Sima, war auf dem Milizrevier gut bekannt. Bis vor kurzem hatte sie in dem Haus gewohnt, wo der Mord geschehen war. Ihre winzige Einzimmerwohnung war eine regelrechte Spelunke gewesen, in der rund um die Uhr ihre Saufkumpane lärmten, allen voran ein gewisser Iwan Rjurikow, genannt Rjurik, aus dem Nebenhaus. Vor einigen Jahren hatte Sima ihre Wohnung an Kaukasier verkauft und war zu Rjurik gezogen. Eine Zeitlang lebten sie in Frieden und Eintracht zusammen, doch als das Geld alle war, stritten sie sich erbittert. Sima wollte zurück nach Hause und konnte lange nicht begreifen, dass sie kein Zuhause mehr hatte. Sie belagerte das Milizrevier, schwor, die Kaukasier hätten sie falsch verstanden, sie habe ihre Wohnung gar nicht verkaufen, sondern nur für ein Jahr vermieten wollen. Schließlich ließ sie sich auf einem Treppenabsatz zwischen zwei Etagen in ihrem ehemaligen Haus nieder. Anfangs verhielt sie sich still; rührend zusammengerollt schlief sie auf einer Kindermatratze. Draußen herrschte ein strenger Winter, die Mieter bedauerten Sima, brachten ihr heißen Tee und etwas zu essen und luden sogar ein Fernsehteam ein. Sima hielt vor der Kamera eine flammende Rede: Ihre schlimme Lage sei das Ergebnis der kriminellen Verquickung von korrupten Bürokraten der Wohnungsverwaltung mit der kaukasischen Mafia. Nun im ganzen Land berühmt, wurde Sima übermütig, lud Gäste zu sich auf den Treppenabsatz ein, und da hatte die Geduld der Mieter ein Ende. Mit Hilfe der Miliz wurde Sima samt Matratze hinausgesetzt. Nach kurzem Umherziehen von Bahnhof zu Bahnhof kehrte sie wieder zurück, allerdings nicht ins Treppenhaus, sondern zu Rjurik. Doch ihr aufsehenerregendes Fernsehdebüt hatte eine seltsame Auswirkung auf ihr Wesen. Sie lechzte nun geradezu nach sozialem Kampf, sie wurde Stammgast bei Kundgebungen und Demonstrationen, egal welcher Art, Hauptsache, sie konnte nach Herzenslust herumschreien und im Mittelpunkt stehen.
»Das ist doch ein Genozid an den Menschenrechten, echt«, jammerte Sima laut, weinte und rieb sich die verschiedenfarbigen, von blauen Flecken gerahmten Augen mit den Fäusten. »Diese Pracht lag auf dem Müll, warum sollte ich so was Schönes verrotten lassen?«
»Hast du gesehen, wer den Korb weggeworfen hat?«, fragte Borodin zum dritten Mal.
»Ich hab nichts gesehen und weiß von nichts. Da hab ich arme Frau einmal im Leben Glück, und Sie wollen mir gleich einen Mord anhängen, Bürger Natschalnik! Sima hat im ganzen Leben keiner Fliege was zuleide getan, fragen Sie, wen Sie wollen, Sima würde ihr letztes Stück Brot mit einem streunenden Tier teilen, und du sagst so was! Wenn Sie’s genau wissen wollen, ich glaube an Gott, warum also sollte ich mir eine solche Sünde auf die Seele laden? Ich leide hier schon genug, soll ich etwa auch im Jenseits leiden? Die letzte Zeit ist angebrochen, bald kommt das Jüngste Gericht, da muss man sich für alles verantworten! Ich bin doch nicht mein eigener Feind!«
»Stop – wie kommst du darauf, dass es um Mord geht?«, unterbrach Borodin.
»Na, weil du gleich losgerannt bist, die Bullen holen, du alter Bock!«, kreischte Sima. Die Tränen waren im Nu getrocknet, ihre Augen funkelten böse. »Ihr Schweine habts doch alle drauf abgesehn, die Schwachen zu kränken, die Zeitungen haben ganz recht! Das gibts nur in unsrer Scheißdemokratie, solche Gesetzlosigkeit gegen die Rechte des gequälten Individuums! Aber wartet nur, auch für euer Diktat wird sich ein Richter finden. Ich hab keine Angst! Ich habe nichts zu verlieren als meine Ketten, ich sage alles frei heraus, ihr sollt die reine Wahrheit hören von einem einfachen russischen Menschen proletarischer Herkunft!«
»Was meinst du denn mit Diktat, Sima?« fragte Borodin streng.
Sima zwinkerte verwirrt, hustete und erklärte kategorisch: »Halt mich nicht für blöd, ja! Diktat, das ist, wenn man Unschuldige festhält und mitnimmt!«
»Was soll dieser Ton, Simakowa?«, mischte sich der Revierchef ein. »Du hast wohl lange keine Nacht in der Zelle verbracht? Kannst du gleich haben, kein Problem.«
»Glaub bloß nicht, du kannst mich einschüchtern!« knurrte Sima und lief rot an. Der frische dunkelrote Fleck unter ihrem rechten Auge war nun kaum noch zu erkennen, dafür leuchtete ein alter gelbgrüner umso stärker. »Ich bin so schon durch und durch krank an den Nerven. Nichts als Hunger und Kälte, nichts Positives. Ein einziges ökonomisches Tschernobyl.«
»Du solltest weniger trinken und dich nicht dauernd auf Kundgebungen rumtreiben, wo du lauter schlaue Reden aufschnappst«, brummte der Revierchef. »Entschuldige dich und rede gefälligst wie ein normaler Mensch, stell meine Geduld nicht auf die Probe.«
»Schon gut, zum Teufel mit euch. Ich entschuldige mich, kommt nicht wieder vor.« Sima verzog den Mund zu einem mädchenhaft schüchternen Lächeln und entblößte ihr lückenhaftes Gebiss. Ihre Stimmung wechselte von einem Moment zum anderen, von tränenreicher, klagender Hysterie zu trockener Bosheit, dann erneut zur Klage; und nun lächelte Sima plötzlich, beinahe kokett. »Wenn Sie gut zu mir sind, sage ich alles.«
»In Ordnung, Sima.« Borodin nickte. »Also, im Guten: Woher weißt du von dem Mord?«
»Ich hab doch gesagt, ich füttere die streunenden Tiere, teile meinen letzten Bissen mit ihnen, mit Hunden und Katzen. Die Tiere spüren alles, besonders die Hunde. Haben Sie mal gehört, wie ein Hund nach einem Verstorbenen jault? Sie spüren einen Toten auf einen Kilometer, und ich genauso. Ich sag ja, ich bin quasi eine Hellseherin. Ich halte die Nase in die Luft und wittere das. Aber du, entschuldige, du bist doch anscheinend ein kultivierter Mann« – sie maß Borodin mit einem tadelnden Blick –, »warum fragst du nicht ganz ruhig, Sima, woher hast du den Korb mit der Wolle? Stattdessen starrst du mich an, als wär ich dir eine Pulle Wodka schuldig, und rennst weg. Ich hab gleich gewusst, dass du wiederkommst, ich habs gespürt, dass ich verschwinden sollte, aber ich wollte Rjurik nicht wecken, er hat so schön geschlafen an der frischen Luft, mein Süßer, so schön geschlafen hat er. He, Rjurik, sag ihnen, dass wir nichts gesehen haben, stimmt doch, oder?«
Rjurik hatte noch kein Wort gesagt. Es war ziemlich hinüber. Seine Augen waren verdreht, sein Kopf schwankte von einer Seite zur anderen, er bewegte träge die Lippen und gab merkwürdige Grunzlaute von sich. Als seine Freundin für einen Augenblick verstummte, waren sie als die alte Romanze »Steppe ringsumher« zu identifizieren, wobei Rjurik die Melodie ziemlich gut traf.
»He, Rjurikow, was soll das, gibst du hier ein Konzert? Hör auf zu brummen, du verhinderter Schaljapin.« Der Revierchef stieß ihn leicht gegen die Schulter. »Los, erzähl uns, wie die Sache war. Von Anfang an und schön der Reihe nach.«
»Ich brumme nicht!« Rjurik warf heftig den Kopf hoch. »Ich singe. Ich habe nämlich eine Musikschule besucht. Aber von wegen verhindert, da haben Sie recht, Bürger Natschalnik. Die Wahrheit nehm ich nicht übel. Hätt man mich nicht am Weiterlernen gehindert, hätt man mich aufs Konservatorium gelassen, dann wär ich heute genauso gut wie Pavarotti.«
»Was quatschtst du denn da!« Sima verzog das Gesicht und klopfte ihrem Freund auf die Schulter. »Pavarotti ist Tenor, und du bist Bass.«
»Mann, sind die Penner heutzutage gebildet, nicht zu fassen«, spottete der Reviermilizionär, »Sima ist Politikerin, Rjurik Opernsänger. So, Bürger, nun aber Schluss mit den Faxen. Jetzt antwortet ihr gefälligst auf unsere Fragen.«
»Was sollen wir denn antworten, wenn wir gar nichts gesehn haben?« Rjurik zuckte die Achseln. »Wir kommen heute früh zum Müllhaus, und da liegt ein Haufen Wolle rum und ein Korb. Das war alles.«
»Woher wusstet ihr von dem Mord?«
»Ich sage doch, ich hab eine göttliche Gabe, ich bin eine echte Hellseherin. Ich könnte Ihnen alles erzählen, was war und was sein wird und auch, wie das Herz zur Ruhe kommt – wenn Sie im Guten mit mir reden würden.«
»Red keinen Blödsinn, du dummes Huhn! Von wegen Hellseherin! Die Bullen warn da und ne Leiche wurde rausgetragen, das haben wir gesehn. Aber sonst nichts«, murmelte Rjurik hastig, senkte den Kopf und sang erneut vor sich hin.
»Lassen Sie uns doch gehen, liebe Herren Bürger«, bat Sima und schniefte kläglich.
»Also, mein süßes Pärchen«, sagte der Reviermilizionär nach einem Räuspern in amtlichem Ton, »noch seid ihr beide nur Zeugen, aber ihr habt Sachen aus der Wohnung der Toten bei euch. Du, Simakowa, kennst alle Mieter aus dem dritten Aufgang, und du auch, Rjurik. Ihr wusstet, dass in der Wohnung Nummer vierzig eine alleinstehende, schutzlose Frau lebte. Und da habt ihr euch zu einem Raubmord entschlossen.«
Borodin versuchte mit schmerzverzerrter Miene vergebens, das gegen das Rohr geprallte Bein auszustrecken. Das Knie tat unerträglich weh. Sie sollten die beiden Unglücksraben laufen lassen. Der Mörder hatte das Haus spätestens um halb zwei verlassen. Zum Durchsuchen der Handarbeitskorbs hatte er vielleicht fünfzehn Minuten gebraucht, dann war er verschwunden, und das Pärchen war erst im Morgengrauen gekommen. Mindestens drei Stunden später. Die beiden waren keine Zeugen.
»Na los, Sima, pack aus, ich hab die Nase voll!«, brüllte der Reviermilizionär und rückte der Erschrockenen dicht auf den Leib.
Sima zitterte, als hätte sie Schüttelfrost, nahm sich ohne zu fragen noch eine Zigarette aus der Schachtel, riss das Feuerzeug vom Tisch und rauchte gierig. Rjurik hatte sich wieder in sich selbst und seinen Gesang zurückgezogen. Er schaukelte vor und zurück, brummte vor sich hin und erinnerte an einen riesigen, nachdenklichen räudigen Kater.
»Oje, unsere schweren Sünden, oje, oje«, stöhnte Sima, »was für ein verfluchtes Jahr! Wenn man die Ziffern umdreht, wissen Sie, was dann rauskommt? Drei Sechsen, das Zeichen des Leibhaftigen. Er ist es gewesen, er selbst in seiner scheußlichen Person!«
»Wer?«, fragten Borodin und der Reviermilizionär im Chor.
»Das feuerspeiende Ungeheuer«, flüsterte Sima.
»Du machst dich über uns lustig, ja?«, erkundigte sich der Reviermilizionär einschmeichelnd.
»Wie ich ihn gesehn hab, wusste ich gleich, dass er eine unschuldige Seele holen will. Die Frau aus Wohnung vierzig, die war so nett und still, hier, ihre Schuhe hat sie mir geschenkt.« Sima streckte ein Bein aus und demonstrierte einen noch ganz passablen hellbraunen Lederschuh. »Und wenn ich auf der Treppe geschlafen hab, hat sie mir eine Decke gebracht und Tee und Brot mit Butter und Wurst. Eine herzensgute Frau, die netteste im ganzen Aufgang, immer mitfühlend. Ein mitfühlender Mensch ist für den Bastard schlimmer als Weihrauch.«
»Sima, du bist doch auch ein guter Mensch und hast eine reine Seele«, sagte Borodin nachdenklich und fing den erstaunten Blick des Reviermilizionärs auf, »du teilst dein letztes Stück Brot mit streunenden Tieren und tust keiner Fliege was zuleide, stimmts?«
»Das stimmt, und ob das stimmt, Bürger Natschalnik.« Sima senkte den Kopf und schluchzte laut auf. »Aber keiner weiß das zu schätzen, keiner versteht meine reine Seele.«
»Aber das feuerspeiende Ungeheuer, das spürt deine reine Seele, und deshalb wirst du das nächste Opfer sein, Sima.« Borodins Stimme klang dumpf und beängstigend, er rückte näher an Sima heran, schaute ihr direkt in die Augen und sagte, bemüht, nicht durch die Nase zu atmen: »Er hat dich doch gesehen, nicht? Genauso deutlich wie du ihn?«
»Ja!«, flüsterte Sima. »Er hat mich gesehen! Er wird mich holen!«
»Das wird er.« Borodin nickte. »«Wenn wir ihn nicht kriegen, dann wird er das bestimmt. Also, wie sah er aus?«
»Die Visage ganz schwarz, die Augen rot, und große Hauer«, rief Sima und schwankte auf ihrem Stuhl. »O nein, ich kann nicht mehr, ich habe Angst!«
»Damit du keine Angst zu haben brauchst, musst du uns helfen, Sima. Rette dein Leben, erzähl uns alles der Reihe nach. Wo hast du ihn gesehen?«
»Auf dem Hof, auf einer Bank. Er hat den Korb durchwühlt. Ich wollte leere Flaschen einsammeln, wie immer, da saß er da. Von hinten sah er ganz normal aus, hatte ein T-Shirt an, aber dann bin ich näher ran und hab ihn von der Seite gesehn und bin furchtbar erschrocken.«
»Wann war das?«
»In der Nacht.«
»Um welche Uhrzeit?«
»Wann schon! Um Mitternacht natürlich! Ich hab keine Armbanduhr, aber ich weiß genau, dass dieses Scheusal immer Punkt Mitternacht kommt.«
»Nein, dieses blöde Weib!« Rjurik wurde plötzlich munter. »Treibt sich sonstwo rum, trinkt ohne mich, dann kommt sie zurück und schreit, sie hätte auf dem Hof den Teufel gesehn, mit schwarzer Visage und roten Augen. Ich sag zu ihr, Sima, sag ich, das kommt vom Suff, echt, darauf sie: Wenn du mir nicht glaubst, komm mit, ich zeig ihn dir, da auf der Bank sitzt er und wühlt in einem Handarbeitskorb mit Wolle, wiehert und flucht. Blödes Weib, sag ich, was soll der Teufel mit Wolle? Aber sie meint: Er hat sie genommen, also wird er sie wohl für irgendwas brauchen. Er sucht was in den Wollknäueln. Ob ers gefunden hat oder nicht, weiß ich nicht, komm mit, sagt sie, wir sehn nach. Ich sag, wenn dus unbedingt wissen willst, sag ich, geh alleine, ich will schlafen. Jedenfalls, sie redet auf mich ein, komm mit, komm mit, sagt sie, allein hab ich Angst. Wir wollen grad los, da wirds plötzlich laut auf dem Hof. Mein Fenster geht direkt auf den dritten Aufgang raus, ich kuck also raus und seh, da steht ein Milizauto. Na, den Rest wissen Sie selber. Ich sag zu Sima, wir müssen warten, bis die Bullen weg sind.«
Sima wollte ihn mehrfach unterbrechen, doch er schnitt ihr jedes Mal grob das Wort ab, also schwieg sie, und er fuhr fort.
»Wir warten also ab, sehen aus dem Fenster, und da kommt der Leichenwagen. Volles Programm, Sanitäter, Bullen und alles, und sie tragen eine Leiche aus dem Haus. Sima, das blöde Weib, hätte beinahe losgeschrien, aber ich hab ihr zum Glück das Maul zugehalten. Bis das ganze Hin und Her vorbei war und die wieder weg warn, wars schon ganz hell, ich war furchtbar müde, aber sie gibt keine Ruhe und sagt, ich hab genau gesehn, da hat der Teufel gesessen, das war er, er hat jemanden umgebracht. Und ich weiß auch, wen, sagt sie. In Aufgang drei, Wohnung vierzig, die Frau, die in der Puppenfabrik gearbeitet hat, so eine Ruhige, Nette, Lilja hieß sie. Na, wir also hin zum Müllhaus, und da liegt ein Haufen von dieser Wolle rum. Sima hat alles eingesammelt und aufgerollt, und dann sind Sie gekommen, Bürger Natschalnik.«
»Sima, woher wusstest du, dass die Tote Lilja aus Wohnung vierzig war?«, fragte Borodin freundlich.
»Wegen der Wolle.« Sima schluchzte. »Das war ihr Korb.«
»Hast du den früher schon mal gesehen?«
»Ja, hab ich. Sie hat mich im Winter ein paarmal in ihre Wohnung gelassen, zum Duschen, so eine nette Frau war das. Und der Korb, der stand bei ihr auf dem Tisch.«
»Und du hast ihn gleich wiedererkannt?«
»Ja, hab ich. Weil er so schön ist und alt. Meine Großmutter hatte so einen, sie hat auch Wolle darin aufbewahrt, sie hat gern gestrickt.«
»Gut.« Borodin nickte. »Und nun versuch dich noch mal zu erinnern, wie der Mann aussah, der in dem Korb gewühlt hat.«
»Aber das war kein Mann!«, schrie Sima so laut, dass Rjurik von seinem Stuhl auffuhr und Borodin Ohrensausen bekam. »Wie oft soll ich das noch sagen! Das war kein Mensch! Schwarze Visage, riesige rote Augen, die Nase hing über der Oberlippe, und Hörner, echte Hörner, kapieren Sie das oder nicht? Er hat mich doch direkt angesehen, ich wär vor Angst beinahe gestorben und hab mich bekreuzigt, und er hat losgewiehert und wie wild geflucht. Klar?«
»Also schwarzes Gesicht, rote Augen, Hörner auf dem Kopf«, wiederholte Borodin. »Und die Haare?«
»Er hatte keine Haare. Er hatte eine Glatze, der ganze Kopf war schwarz und hat geglänzt, und obendrauf saßen Hörner, so kleine, rote.«
»Was meinst du, war er dick oder dünn?«
»Breite Schultern, aber nicht dick.«
»Ist er mal von der Bank aufgestanden?«
»Nein.«
»Du hast also nicht gesehen, wie groß er war?«
»Er kann jede Größe annehmen, ganz wie er will, so klein wie eine Maus oder so groß wie ein Elefant.«
»Du sagst, er hat wild geflucht. Wie klang seine Stimme?«
»Kreischend, hässlich.«
»Kreischend? Also hoch? Vielleicht eine Frauenstimme?«
»Weiß der Geier.« Sima winkte ab. »Ist doch egal! Er kann mit jeder beliebigen Stimme sprechen, ganz wie er will, ob Bass, Tenor oder hoher Sopran. Bei mir hat er gequiekt wie ein Schwein.«
»Aha, ich verstehe.« Borodin nickte. »Und von hinten, sagst du, sah er ganz normal aus?«
»Ja, ganz normal. Ein blaues T-Shirt.«
Borodin fiel ein, dass Ljussja ein blaues T-Shirt besaß, und er fragte traurig: »Und die Hörner? Waren die denn von hinten nicht zu sehen?«
»Ach, was weiß ich! Stell dir vor, du gehst friedlich deiner Wege, zum Container, leere Flaschen einsammeln, wie jeder normale Mensch, und da sitzt ein Bursche auf der Bank. Kuckst du dir den etwa genau an? Ich dachte, er hätte eben so eine Mütze auf.«
»Er trug also eine Maske.« Borodin seufzte erschöpft und sah den Reviermilizionär an. »Es gibt spezielle Läden, wo solche Horrormasken verkauft werden. Unser Mörder trug also eine Teufelsmaske mit Hörnern. Ein Witzbold.«
»Sie glauben mir nicht?«, kreischte Sima. »Sie denken, das bilde ich mir im Suff ein? O nein!« Sie schüttelte den Kopf. »Die letzte Zeit ist angebrochen. Er wird weiter töten, ohne Unterschied, alle nacheinander, Sünder und Gerechte. Und wenn ihr sämtliche Bullen auf die Beine bringt – den kriegt ihr nie!«
Drittes Kapitel
Die Zwillinge verließen die Villa der Redaktion des Magazins »Blum« und gingen in Richtung Alter Arbat. Sie hatten noch drei Stunden bis zu ihrem Treffen mit dem Fotografen Nikolai und besaßen insgesamt zehn Rubel – das reichte für zwei Piroggen mit Kohl oder für zwei Portionen Eis. Sie waren mit dem Sieben-Uhr-Zug aus Lobnja gekommen; sie hatten sehr früh aufstehen müssen und nicht gefrühstückt, und Solodkin hatte ihnen nicht einmal Kaffee angeboten.
Im Frühjahr waren sie siebzehn geworden. Nun konnten sie einmal in der Woche nach Moskau fahren und erhielten etwas Taschengeld. Sie bummelten gern durch die Stadt. Aufgewachsen in Sonderkinderheimen außerhalb der Stadt, hinter Betonmauern, ließen sie sich berauschen vom Geruch nach Benzin und heißem Asphalt, von Glanz und Lärm, vom bunten Treiben auf den Straßen der Stadt, von schicken Restaurants und Limousinen, von Männerblicken und von ihrem eigenen Spiegelbild in den Schaufenstern.
Selbst Kinder und Greise schauten sich nach ihnen um. Schicke ausländische Wagen bremsten neben ihnen. Ihre Beine, Schultern und Rücken waren von bronzener Bräune, ihr langes hellblondes Haar wehte und glänzte in der Sonne. Sie waren beide hochgewachsen, einsachtzig plus acht Zentimeter Plateausohle, schlank wie afghanische Borsois, und sie sahen vollkommen gleich aus.
Geld besaßen sie nur sehr wenig, darum dachten sie unentwegt daran, bewunderten die Kleider in den Schaufenstern exklusiver Geschäfte, und ihre blauen Augen wurden noch durchsichtiger und leuchtender, und ihre Wangen färbten sich zartrot.
»Wir hätten bei Solodkin wenigstens Kippen schnorren sollen.« Ira seufzte und nahm eine Schachtel mit nur noch zwei Zigaretten aus der Tasche.
Die Mädchen blieben stehen und beobachteten durch einen efeubewachsenen Gitterzaun hindurch, wie in einer teuren Grillbar die Tische eingedeckt wurden. Schneeweiße gestärkte Tischdecken flogen auf, gepflegte Kellner mit Fliege schritten gemächlich einher, am Eingang warb ein grelles Schild für einen Business-Lunch für nur sechshundertfünfzig Rubel.
»Komm, kaufen wir uns wenigstens ein Eis«, stöhnte Sweta.
Ira schüttelte den Kopf. »Ich will kein Eis. Ich will einen Business-Lunch, auf einem weißen Tischtuch, und dass mich so ein geleckter Lakai bedient.«
»Einen Business-Lunch muss man sich verdienen«, bemerkte Sweta mit resigniertem Lachen.
»Klar, zum Beispiel die Wechselstube da drüben ausrauben. Hast du nicht zufällig eine Kanone in der Tasche? Mann, hab ich einen Knast, ich kann nicht mehr!« Ira verdrehte die Augen, so dass man nur noch das Weiße sah.
Sweta schaute sich um und entdeckte eine schwangere blinde Bettlerin. Die junge Frau stand ein paar Meter weiter, vorm Eingang der Grillbar. Über ihren Augen lag ein trüber, gallertartiger Schleier. Sie trug ein kariertes Männerjackett,