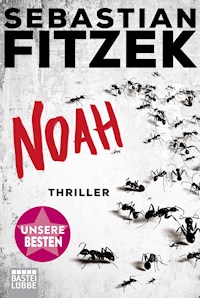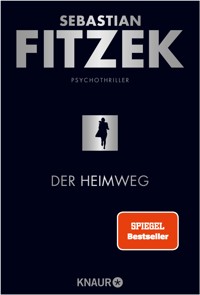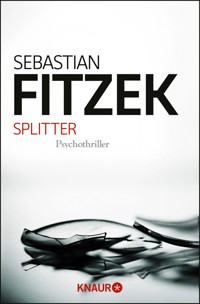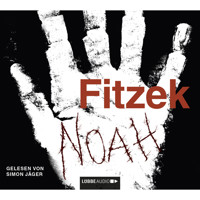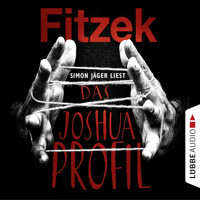
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der erfolglose Schriftsteller Max ist ein gesetzestreuer Bürger. Anders als sein Bruder Cosmo, der in der Sicherheitsverwahrung einer psychiatrischen Anstalt sitzt, hat Max sich noch niemals im Leben etwas zuschulden kommen lassen.
Doch in wenigen Tagen wird er eines der entsetzlichsten Verbrechen begehen, zu denen ein Mensch überhaupt fähig ist. Nur, dass er heute noch nichts davon weiß ... im Gegensatz zu denen, die ihn töten wollen, bevor es zu spät ist.
Entdecken Sie auch "Die Blutschule" - unter dem bisher anonymen Schriftsteller Max Rhode verbirgt sich niemand geringeres als Bestsellerautor Sebastian Fitzek!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 49 min
Sprecher:
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Der erfolglose Schriftsteller Max ist ein gesetzestreuer Bürger. Anders als sein Bruder Cosmo, der in der Sicherheitsverwahrung einer psychiatrischen Anstalt sitzt, hat Max sich noch niemals im Leben etwas zuschulden kommen lassen.
Doch in wenigen Tagen wird er eines der entsetzlichsten Verbrechen begehen, zu denen ein Mensch überhaupt fähig ist. Nur, dass er heute noch nichts davon weiß … im Gegensatz zu denen, die ihn töten wollen, bevor es zu spät ist.
Entdecken Sie auch »Die Blutschule« - unter dem bisher anonymen Schriftsteller Max Rhode verbirgt sich niemand geringeres als Bestsellerautor Sebastian Fitzek!
Über den Autor
Sebastian Fitzek, Jahrgang 1971, geboren in Berlin, entschied sich nach dem Studium der Rechtswissenschaften und der Promotion zum Dr. jur. gegen einen juristischen Beruf und für eine kreative Tätigkeit in den Medien. Nach dem Volontariat bei einem privaten Hörfunksender wechselte er als Unterhaltungschef und später als Chefredakteur zur Konkurrenz und machte sich danach als Unternehmensberater und Formatentwickler für zahlreiche Medienunternehmen in Europa selbständig. Er lebt in Berlin, wo er derzeit in der Programmdirektion eines großen Hauptstadtsenders tätig ist. »Mit so einem großem Erfolg hätte ich nie gerechnet«, sagt Fitzek zu BILD. »Die Resonanz auf das Buch ist unglaublich. Jeden Tag bekomme ich seitenlange Leserpost.«
Sebastian Fitzek
DAS
JOSHUA
PROFIL
Thriller
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Sebastian Fitzek wird vertreten von der AVA international GmbH
www.ava-international.de
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Regine Weisbrod, Konstanz
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung eines Motivs von © PixxWerk®, München
Einband-/Umschlagmotiv: © Arcangel Images/Sally Mundy
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1271-3
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Roman Hocke
Now I’m not looking for absolution
Forgiveness for the things I do
But before you come to any conclusions
Try walking in my shoes
Depeche Mode
Es sah aus wie in einem Klassenzimmer. Wie in einem ärmlichen Klassenzimmer, denn die ockerfarbenen Stühle mit den unzerstörbaren Metallkufen sowie die dazu passenden Pulte wirkten wie vom Flohmarkt zusammengekauft. Von Generationen von Schülern zerkratzt und abgewetzt und eigentlich längst ausrangiert, standen sie hier völlig fehl am Platz.
»Setzt euch«, befahl uns Papa und schritt zum Kopfende des Raumes; dorthin, wo er tatsächlich eine Tafel aufgestellt hatte, auf der mit weißer Kreide stand: »Non scholae sed vitae discimus.«
»Wo sind wir hier?« Mark flüsterte, aber nicht leise genug. Papa schnellte an der Tafel herum. »Wo wir sind?«, bellte er. Der Anflug eines düsteren Lächelns zeigte sich auf seinen Lippen. Er quetschte seine Finger so laut, dass es knackte.
»WO WIR HIER SIND?«
Er verdrehte die Augen und schlug mit beiden flachen Händen auf das Lehrerpult direkt vor ihm. Bei den nächsten Worten schien er sich wieder beruhigt zu haben, jedenfalls sprach er sie deutlich leiser. Nur das Flackern in seinem Blick war noch da, als würde hinter seinen Pupillen eine Kerze im Wind stehen.
»Wonach sieht es denn aus?«
»Nach einer Schule«, sagte Mark.
»Genau. Aber es ist nicht eine Schule. Schon gar nicht irgendeine, sondern DIE Schule. Die einzige, die wirklich zählt.«
Papa befahl uns ein zweites Mal, uns zu setzen, und diesmal gehorchten wir ihm. Wir ließen uns in der mittleren der Dreierreihe nieder, Mark rechts und ich links von meinem Vater, der sich wie unser alter Lateinlehrer Schmidt in die Mitte des Ganges gestellt hatte. Nur, dass er keine Vokabeln abfragte, sondern einen irren Monolog hielt.
»Dort, wo ihr bisher hingegangen seid, hat man euch verarscht«, sagte er. »Man hat euch Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Ihr könnt jetzt englische Texte verstehen, wisst, was das Säugetier vom Reptil unterscheidet und wieso der Mond nicht auf die Erde fällt, zumindest hoffe ich, dass ihr das wisst, weil ihr während des Unterrichts wenigstens ab und zu mal aufgehört habt, darüber nachzudenken, in welches Höschen ihr eure dreckigen Finger als Nächstes schieben könnt.«
Ich wurde rot. Noch nie hatte mein Vater so vulgär mit uns geredet. Am liebsten wäre ich vor Scham im Boden versunken. Ich sah zu Mark und spürte, dass es ihm ähnlich erging.
»Man sagt euch, ihr müsstet aus der Geschichte lernen, zeigt euch Atlanten, um die Welt zu verstehen, und das Periodensystem mit den Elementen, aus denen sich das Universum zusammensetzen soll, aber das Wichtigste, das lehrt man euch nicht. Wisst ihr, wovon ich rede?«
Wir schüttelten den Kopf.
»Nein. Ihr wisst nichts. Und damit zitiere ich nicht den Kinderficker Sokrates. Ihr wisst weniger als nichts, aber das ist nicht eure Schuld. Es ist die Schuld dieser unfähigen sogenannten Pädagogen, die euch das wichtigste Fach vorenthalten. Das einzige Fach, nein, sogar das ERSTE Fach, das auf diesem Planeten je unterrichtet wurde und ohne das unsere menschliche Spezies längst ausgestorben wäre. Na, wovon rede ich? Wer sagt es mir?«
Ich spürte eine Hitzewallung meinen Körper fluten, wie immer, wenn ich in der Schule Angst vor einer Klausur hatte, für die ich nicht gelernt hatte. Nur, dass ich diesmal das Gefühl hatte, noch nie zuvor im Leben so ungenügend auf eine Prüfung vorbereitet gewesen zu sein.
»Keiner?«
Ein schneller Seitenblick zu Mark zeigte mir, dass auch er den Kopf gesenkt hielt. Ich merkte, dass ich dringend auf die Toilette musste, traute mich aber nicht, etwas zu sagen.
»Na schön, dann will ich euch mal auf die Sprünge helfen«, hörte ich Papa murmeln, als würde er zu sich selbst sprechen. Ich hob den Kopf und sah, wie er an seinem Gürtel herumfummelte. Plötzlich blitzte es vor meinen Augen auf. Licht reflektierte auf dem Metall.
»Was machst du?«, fragte ich meinen Vater, starr vor Angst. Noch nie zuvor hatte ich einen derart entrückten Blick in seinen Augen gesehen. Und noch nie zuvor dieses lange, gezackte Messer in seiner Hand.
»Denkt nach, welches Fach meine ich wohl?«, fragte er und richtete seinen Blick jetzt auf Mark, der sich noch immer nicht traute, ihm in die Augen zu schauen, was vermutlich der Auslöser dafür war, dass er sich für ihn entschied.
Mit zwei schnellen Schritten war er bei ihm, riss seinen Kopf an den Haaren hoch und setzte ihm die Klinge an die Kehle.
»Papa!«, schrie ich und sprang vom Stuhl auf.
»Bleib, wo du bist!« Die Blicke meines Vaters durchbohrten mich, es war, als ob er mit seinen Augen zwei weitere Messer führte. Zu meinem Bruder, dem der Schweiß von der Stirn perlte, sagte er: »Denk nach, Kleiner. Worin werde ich euch unterrichten?«
Mark zitterte. Alle seine Muskeln schienen bis zum Bersten gespannt, als hätte er einen Ganzkörperkrampf.
Ich sah die Furcht in seinem Gesicht, sah, wie er feucht wurde zwischen den Beinen, und in dem Moment, in dem ich die Todesangst riechen konnte, wusste ich die Antwort, die mein Vater verlangte, so verrückt und schrecklich sie auch war.
»Töten«, sagte ich und erlöste damit meinen Bruder.
»Töten?« Vater drehte sich zu mir. Erst nach einer weiteren Sekunde nahm er die Klinge von Marks Hals und lächelte zufrieden.
»Sehr gut. Das gibt ein Sternchen ins Klassenbuch.«
Ohne auch nur einen Hauch von Ironie in seiner Stimme lobte er mich für meine Antwort und nickte mir anerkennend zu.
»Es stimmt. Ihr habt nie gelernt zu töten. Niemand hat es euch beigebracht. Aber keine Sorge, dieses Versäumnis werden wir jetzt nachholen.«
Max Rhode, »Die Blutschule«, Kapitel 24, S. 135–139
Gott würfelt nicht!
Albert Einstein
Und selbst wenn Gott würfeln sollte – wir sind ihm auf der Spur.
Rudi Klausnitzer, Das Ende des Zufalls
1. Kapitel
Berlin
Dreizehn Leichen, elf vergewaltigte Frauen, sieben Verstümmelungen, ebenso viele Entführungen und zwei an ein Heizungsrohr angekettete Schwestern, die qualvoll verhungern würden, sollte man sie nicht rechtzeitig finden. Ich war zufrieden mit meiner bisherigen Bilanz, und eigentlich hätte ich ihr heute Nachmittag noch einen weiteren Mord hinzugefügt, wenn ich nicht um 15.32 Uhr gestört worden wäre, als ich gerade mit einem wehrlosen Opfer auf dem Weg in die Berliner Kanalisation war.
Zuerst hatte ich versucht, das Klingeln zu ignorieren; normalerweise schaltete ich mein Handy während der Arbeit ab, aber heute war Montag, und montags war ich mit dem Fahrdienst für unsere zehnjährige Tochter an der Reihe, selbst wenn meine Frau ausnahmsweise mal im Lande war, was wegen ihres Jobs als Langstrecken-Pilotin leider nur sehr unregelmäßig vorkam.
Zwar kannte ich die Nummer im Display nicht, doch es war ungefähr die richtige Uhrzeit. Jolas Schwimmtraining musste gerade vorbei sein, und vielleicht rief sie ja mit dem Telefon einer Freundin an. Ich entschied mich, den Anruf besser nicht auf die Mailbox laufen zu lassen, auch auf die Gefahr hin, gleich einen Callcenter-Agenten am Ohr zu haben, der mir eine Zahnzusatzversicherung oder ein Pay-TV-Abo aufschwatzen wollte und den es nicht im Geringsten kümmerte, dass ich seit Monaten mit dem Dispo im Minus hing.
Und so hatte ich entnervt mit der Zunge geschnalzt, das Kapitel des Thrillers, an dem ich gerade arbeitete, mitten im Satz zwischengespeichert und nach dem surrenden Handy auf meinem Schreibtisch gegriffen. Was, um es kurz zu machen, der Grund dafür war, weshalb ich jetzt im Stau auf der Avus Höhe Hüttenweg stand und von meiner Tochter fünf Euro verlangte.
»Die zahl ich nicht.« Jola schüttelte den Kopf und schaute trotzig aus dem heruntergekurbelten Seitenfenster in Richtung der S-Bahn-Gleise, die hier parallel zur Stadtautobahn verliefen. Es war Mitte August, wir standen in der prallen Sonne, vor uns flimmerte die Luft über den Dächern der Blechlawine, und ich hatte das Gefühl, in einem Schnellkochtopf und nicht in meinem alten VW Käfer zu sitzen.
»Wir haben eine Abmachung«, erinnerte ich sie.
Fünf Euro für jedes Mal, wenn ich zu einem »Elterngespräch« gebeten wurde, weil sie wieder etwas angestellt hatte.
»Ich dachte, das gilt nur für die Schule. Nicht für die Freizeit.«
»Du vergisst, dass Herr Steiner nicht nur dein privater Schwimm-, sondern auch dein offizieller Sportlehrer ist. Also her mit dem Geld!«
Sie sah mich an, als hätte ich sie gezwungen, ihre dunklen Locken abzuschneiden, das Einzige an ihrem Körper, worauf sie stolz war. Ansonsten hasste sie ihre schiefe Nase, die dünnen Lippen, den viel zu langen Hals, ihre »Krüppelfüße« (der kleine Zeh hatte ihrer Ansicht nach einen viel zu kleinen Nagel) und den zarten Leberfleck auf ihrer Wange. Ganz besonders den Leberfleck, den sie an Tagen, an denen sie schlecht drauf war, mit einem Pflaster abdeckte.
»Das ist unfair«, maulte sie.
»Unfair ist, was du mit Sophia gemacht hast.«
Ich bemühte mich, nicht zu grinsen, denn eigentlich fand ich es gar nicht so schlimm, verglichen mit dem, was ich so alles angestellt hatte, als ich in ihrem Alter war. Die Erinnerung an das unangenehme Gespräch im Büro des Trainers half mir dabei, verärgert zu wirken.
»Ich weiß, Jola ist mit Abstand die Beste im Team, und ich lass ihr wirklich vieles durchgehen«, hatte Schwimm-Steiner mir zum Abschied mit auf den Weg gegeben. »Aber sollte sie sich noch so ein Ding leisten, schmeiß ich sie aus der Mannschaft.«
»Sophia hat mich einen Bastard genannt«, versuchte Jola sich zu rechtfertigen.
»Und deshalb hast du ihr Spülmittel in die Shampooflasche gefüllt?«
Ihre Mannschaftskameradin hatte einen Heulkrampf unter der Dusche bekommen, als die Haare nicht aufhören wollten zu schäumen, egal wie lange sie unter der Brause stand. Der Schaum musste den gesamten Waschraum bis in die Umkleide gefüllt haben.
»Ich hab ihr nur den Kopf gewaschen.« Jola grinste, fingerte aber einen zerknitterten Fünfeuroschein aus der Vordertasche ihres Rucksacks, wo sie ihren iPod und das Taschengeld aufbewahrte.
»Du weißt schon, dass man einen Streit besser mit Worten löst?«, fragte ich sie.
»Klar, so wie in deinen Büchern.«
Eins zu null für sie.
Jola wedelte mit dem Geldschein.
»Leg ihn ins Handschuhfach«, bat ich sie und rollte zwei Meter weiter. Irgendwo am Funkturm musste es gekracht haben. Der Verkehrsreport brachte natürlich noch nichts, aber seit zehn Minuten ging es nur in Trippelschritten voran.
»Hey, Chips, wie geil.«
Sie nahm die Tüte heraus, die ich in das kleine Handschuhfach gestopft hatte, und ich konnte in letzter Sekunde verhindern, dass sie die Verpackung aufriss.
»Halt, nein! Das ist ein Geschenk für Mama!«
Sie warf mir einen skeptischen Blick zu. »Wie bitte?«
»Ja. Nächste Woche, zum Hochzeitstag.«
»Kartoffelchips?« Jola musste mir keinen Vogel zeigen, damit ich sah, was sie dachte.
»Nicht irgendwelche Kartoffelchips.« Ich deutete auf das Logo der Packung. »Das sind Peng-Chips.«
»Aha.«
»Ja, die gibt es gar nicht mehr. Die Produktion wurde vor Jahren eingestellt. Hab ich dir nicht erzählt, wie Mama und ich unser erstes Date hatten?«
»Nur etwa tausend Mal!« Jola rollte mit den Augen und begann die wesentlichen Eckpfeiler der Geschichte aufzuzählen.
»Ihr wolltet ins Autokino. Du hattest den Käfer beim Aldi um die Ecke geparkt, doch als ihr losfahren wolltet, war Aldi schon zu und der Parkplatz gesperrt.«
Ich nickte und ergänzte: »Also haben wir es uns mit Peng-Chips und Cherry-Cola gemütlich gemacht, durch die Windschutzscheibe auf den leeren Discounter gestarrt und so getan, als würden wir Jurassic Park sehen.«
Wie immer, wenn ich daran zurückdachte, machte sich ein leicht dämliches, weil selbstvergessenes Grinsen auf meinem Gesicht breit. Wie Kim und ich eng umschlungen auf den Vordersitzen kuschelten und ich ihr in schillernden Farben die Geschichte eines Films erzählte, den ich mir in dieser Sekunde gerade ausdachte, zählte zu den schönsten Erinnerungen in meinem Leben. Abgesehen von dem Tag vor zehn Jahren natürlich, an dem das Amt uns Jola als Pflegekind anvertraute.
»Deine Mutter ist damals voll auf diese pfeffrigen Peng-Teile abgefahren«, sagte ich und rollte wieder ein Stück nach vorne. »Am Tag, an dem sie aus dem Sortiment genommen wurden, ging eine Welt für sie unter.«
»Muss echt schlimm für sie gewesen sein.«
Wir grinsten beide.
»Ja. Also hab ich den Hersteller bei Bahlsen ausfindig gemacht und ihn davon überzeugen können, für mich noch einmal eine einzige Packung herzustellen. Mama wird ausrasten, wenn sie die sieht.«
»Ganz bestimmt«, sagte Jola wenig euphorisch, stopfte den Fünfer in das Handschuhfach und schloss es wieder.
»Das wird sicher ausreichen, um sie umzustimmen.«
Ich wollte Jola fragen, wie sie das meinte, aber ich war kurzfristig abgelenkt, weil ein Vollidiot in einem SUV neben uns versuchte, die Spur zu wechseln, als würde der Stau sich dadurch schneller auflösen. Außerdem war mir ohnehin klar, dass Jola sehr viel mehr mitbekam, als sie sollte. Sie war so unglaublich sensibel, da konnten wir uns noch so sehr bemühen, nicht in ihrer Gegenwart zu streiten. Zwar hatten Kim und ich, auch wenn wir alleine waren, das Thema Trennung nie offen angesprochen, aber die subtilen Zeichen der Entfremdung konnten Jola nicht entgangen sein.
»Fahren wir jetzt wie versprochen Pizza essen?«
Bevor ich Jola erklären konnte, dass sie sich das eigentlich nicht verdient hatte, klingelte mein Handy zum zweiten Mal an diesem Tag. Ich nahm es aus der Ablage und sah auf die Nummer. Schon wieder ein unbekannter Teilnehmer.
Jola öffnete das Handschuhfach und nahm sich ihr Geld wieder heraus.
»Wieso das denn?«, fragte ich in einer Klingelpause.
»Handy beim Fahren«, erinnerte sie mich an den zweiten Teil unserer – zugegeben etwas merkwürdigen – Taschengeldvereinbarung. Wann immer ich fluchte, etwas Verbotenes tat oder eine Verabredung verschob, hatte sie Anspruch auf eine Zahlung.
»Wir stehen«, protestierte ich und deutete auf die Kolonne vor uns.
»Aber der Motor läuft«, entgegnete Jola und steckte die fünf Euro wieder ein. Kopfschüttelnd, aber amüsiert nahm ich den Anruf entgegen.
Mein Grinsen verschwand mit dem ersten Wort, das der unbekannte Teilnehmer sagte.
»Hallo?«
Schmerz. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss. Dieser Mann hat Schmerzen.
»Wer ist denn da?«
Ich hörte ein elektronisches Warnsignal im Hintergrund, als würde ein Wecker klingeln, dann gab es eine längere Pause, und ich dachte schon, die Verbindung wäre wieder getrennt.
»Hallo?«
Nichts. Nur ein kurzes, statisches Rauschen. Dann, als ich gerade wieder auflegen wollte, sagte der Mann: »Ich liege im Westend auf der Intensivstation. Kommen Sie schnell. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit.«
Ich kniff die Augen zusammen, weil sich etwas Schweiß von meinen Brauen gelöst hatte und auf die Wimpern tropfen wollte. Neben mir fächelte sich Jola Luft mit einem Werbeprospekt zu, den sie im Fußraum gefunden hatte.
»Kann es sein, dass Sie sich verwählt haben?«, fragte ich den
Mann mit der brüchigen Stimme.
»Das glaube ich kaum, Herr Rhode.«
Na schön, er kennt also meinen Namen.
»Mit wem spreche ich denn bitte?«, fragte ich ihn noch einmal, jetzt schon etwas ungeduldiger.
Der Mann hustete, dann, kurz bevor er auflegte, sagte er nach einem lang gezogenen, gequälten Stöhnen:
»Sie reden mit einem Mann, der eine Frau, vier Kinder, sechs Enkel, aber nur noch Kraft für einen einzigen Anruf hat, bevor er in wenigen Minuten stirbt. Wollen Sie nicht wissen, weshalb ich ihn ausgerechnet an Sie verschwende?«
2. Kapitel
Eine alte englische Redensart lautet: »Neugier ist der Katze Tod.«
Der von Autoren vermutlich auch. Zumindest Autoren wie mir.
Eine halbe Stunde, nachdem der Stau sich aufgelöst hatte, stand ich im Büro des Oberarztes der Intensivmedizin im Klinikum Westend und fragte mich, ob ich den Verstand verloren hatte.
Vermutlich würde sich kein normal denkender Familienvater mit einem anonymen Anrufer treffen, der einen an sein Sterbebett zitiert, aber ich hatte nicht ohne Grund vor sechs Jahren meine Stelle als Gerichtsreporter bei einem privaten Radiosender aufgegeben. Es war die Neugierde auf Menschen und ihre Geheimnisse, die mich an den Schreibtisch getrieben und aus mir einen Schriftsteller gemacht hatte, wenn auch keinen besonders erfolgreichen; von meinem ersten Thriller einmal abgesehen. »Die Blutschule«, streng genommen dem Horrorgenre zuzuordnen, hatte sich knapp achtzigtausendmal verkauft. Der erste von insgesamt fünf Romanen. Und mit Platz zwölf auf der Paperback-Liste mein einziger Bestseller. Schon für die Fortsetzung interessierte sich nur noch die Hälfte der Leser, und mein letzter Band hatte nicht einmal mehr den Vorschuss eingespielt. Bis auf meinen Erstling waren meine Werke schon heute nicht mehr lieferbar. Würde es jetzt zur Scheidung kommen, wäre meine Frau diejenige, die mir Unterhalt zahlen müsste.
Peinlich, aber wahr.
Leider musste ich davon ausgehen, dass auch mein nächster Thriller, dessen Abgabetermin nur noch wenige Monate entfernt lag, ein Flop werden würde. Ich hatte schon hundertzweiundzwanzig Seiten zu Papier gebracht und noch immer keinen Zugang zu den handelnden Personen gefunden. Normalerweise entwickelten sie spätestens nach dem ersten Akt ein Eigenleben und degradierten mich zu einem Beobachter, der selbst darauf gespannt war, was seine Helden als Nächstes tun würden. Doch jetzt hatte ich bereits vierzehn Kapitel getippt, und die Figuren taten noch immer genau das, was ich im Exposé für sie vorhergesagt hatte. Kein gutes Zeichen. Und wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb ich den Ausflug in die Klinik als willkommene Ablenkung betrachtete, der weitaus mehr Aufregung versprach als das, was ich mir am heimischen Schreibtisch aus den Fingern zu saugen versuchte.
»Der Patient durchlebt gerade eine paradoxe Phase«, klärte mich Dr. Anselm Grabow auf, kaum dass ich sein Büro betreten hatte; eine mit Akten und Lehrbüchern vollgestopfte Kammer, viel kleiner, als ich es in einem meiner Romane beschrieben hätte.
Der vollbärtige Arzt, dem mein Kommen augenscheinlich angekündigt worden war, machte sich nicht die Mühe, mir einen Platz anzubieten, und kam gleich zur Sache: »Noch ist der Patient ansprechbar und reagiert. Das ist nicht unüblich bei Verbrennungen dieser Art. Über achtzig Prozent der Haut sind betroffen, fast alle Zonen dritten, manche sogar vierten Grades.« Damit hatte sich die Nachfrage nach einer Prognose erübrigt.
Er popelte nervös an dem Knopfloch seines fleckigen Kittels und sah mich aus blutunterlaufenen Augen an, so feuerrot, als hätte der Mediziner den Kopf mit weit aufgerissenen Lidern in ein Aquarium voller Quallen getaucht. Entweder war er hundemüde, hatte eine Bindehautentzündung oder litt an Heuschnupfen.
»Eigentlich hätten wir ihn längst intubiert und in ein künstliches Koma versetzt, aber das hat der Patient uns ausdrücklich untersagt. In dieser paradoxen Phase, in der er sich jetzt befindet, ist sein Kreislauf relativ stabil, doch das wird sich sehr bald ändern. Wir gehen davon aus, dass sein Körper bald kollabieren wird und ein multiples Organversagen einsetzt.«
»Wie heißt er?«, wollte ich wissen. »Ich meine, wer ist der Mann, und wieso will er ausgerechnet mit mir sprechen?« Dr. Grabow zog die Mundwinkel nach unten und sah mich an, als wäre er gerade in einen Hundehaufen getreten. »Ich bin nicht befugt, Ihnen das zu sagen«, sagte er und schob, bevor ich protestieren konnte, hinterher: »Mein Patient hat mir ausdrückliche und unmissverständliche Anweisungen erteilt, was den Informationsfluss anbelangt. Ich bin von ihm nur insoweit von der ärztlichen Schweigepflicht befreit, als dass ich Ihnen sagen darf, dass er vor etwa sechs Stunden nach einem Suizidversuch mit schweren Brandtraumata bei uns eingeliefert wurde …«
»Selbstmord?«
»Nach eigener Aussage, ja.«
Da der Arzt keinen Zweifel daran ließ, dass er mir keine weiteren Informationen anvertrauen wollte, hatte ich keine Lust, kostbare Zeit und damit die paradoxe Phase des Patienten zu vergeuden. Zumal ich Jola unten im Wagen auf dem Besucherparkplatz hatte sitzen lassen, was mich weitere fünf Euro kostete, weil sich dadurch unser verabredetes Pizzaessen verzögerte.
Dr. Grabow ließ mich von einer südländisch aussehenden Krankenschwester auf die Intensivstation führen, wo ich mit einem polizeigrünen OP-Einwegoverall, Mundschutz und Gummihandschuhen ausstaffiert wurde. »Vorschrift ist Vorschrift«, sagte die Schwester, bevor sie die Tür zum Krankenzimmer hinter mir schloss und ich mich einem Mann gegenübersah, der – im Gegensatz zu den fiktiven Figuren in meinen Romanen – tatsächlich im Begriff stand, in wenigen Stunden oder gar Minuten eines qualvollen Todes zu sterben.
Am Telefon hatte ich mich über seine schmerzverzerrte, brüchige Stimme gewundert. Jetzt, eine Dreiviertelstunde später, während ich vor seinem hydraulisch verstellbaren Krankenbett stand, fragte ich mich, wie der sterbende Unbekannte auf der himmelblauen Kunststoffmatratze es überhaupt geschafft hatte, zum Hörer zu greifen.
Der Mann sah aus, als wäre er von einem geisteskranken Chirurgen bei lebendigem Leib präpariert worden; als atmendes Studienobjekt für Anatomiestudenten. Neben dem rechten Auge fehlten dem Gesicht die obersten Hautschichten. Sie waren wie mit einer Schleifmaschine abgetragen. Statt Stirn, Wangen, Kinn und Schläfen betrachtete ich eine verbrühte Wunde, durchzogen von milchigen Sehnen und pulsierenden Blutgefäßen. Der gesamte Körper, von den Füßen bis zum Hals, war mit sterilen Verbänden bedeckt, abgesehen von den Stellen, wo sich die Zugänge für den Morphiumtropf und die Elektrolytlösung befanden, aber ansonsten war der Mann nahezu vollständig mumifiziert, was den Schluss nahelegte, dass er unter den Verbänden nicht anders aussah als im Gesicht.
Was für ein Glück, dass Jola unten im Auto wartete. Ich hatte ihr erzählt, dass ich nur rasch einen befreundeten Arzt besuchte, den ich anfangs wegen der schlechten Verbindung nicht an der Stimme erkannt habe und der mir für meine Recherche wichtige Unterlagen geben wolle. Ich schwindelte Jola nur sehr ungern an, aber angesichts des grauenhaften Anblicks, der sich mir hier bot, war ich froh, zu dieser Notlüge gegriffen zu haben.
So, und jetzt?
Die Tür hinter mir war mittlerweile gut zwei Minuten geschlossen. Zwei Minuten, in denen ich nicht wusste, wohin ich schauen und was ich sagen sollte. Ich räusperte mich verlegen, nachdem das Brandopfer, abgesehen von einem schwachen Zucken, keinerlei Regung zeigte.
»Entschuldigung?«, fragte ich und fühlte mich dabei selbst in einer paradoxen Phase gefangen, wenn auch gewiss nicht in einer so schmerzhaften wie die, in der der Todgeweihte gerade steckte. Ich kam mir vor wie ein Eindringling. Die Tatsache, dass ich ausdrücklich einbestellt worden war, machte das Gefühl nicht besser, solange ich nicht wusste, aus welchem Grund.
»Können Sie mich hören?«
Der Mann, der mit dem verbliebenen Auge unverwandt zur Zimmerdecke starrte, nickte. Ein pfeifendes Geräusch entwich dem Loch in seinem Gesicht, dort, wo sich früher einmal der Mund befunden haben musste. Das Geräusch mischte sich mit dem Rauschen der Atemunterstützung, die in den verkrusteten Löchern seines Nasenstumpfs steckte. Ich räusperte mich erneut, verlegen und unwissend, was ich als Nächstes tun sollte. Mein Overall raschelte bei jeder Bewegung. Es roch nach Desinfektionsmitteln, nach verbrannter Haut und Benzin, wobei meine Sinne mir bei Letzterem vermutlich einen makabren Streich spielten. Ich hasste den Geruch von Benzin. Seit meiner Kindheit hatte ich Angst vor dieser Flüssigkeit, eine regelrechte Phobie, die Tankstellen nicht gerade zu meinen beliebtesten Aufenthaltsorten machte.
Vermutlich bildete ich mir den »Duft der Angst«, wie ich ihn heimlich nannte, nur ein. Ganz sicher aber war es unerträglich heiß auf der Station. Draußen herrschten einunddreißig Grad, hier drinnen war es vielleicht etwas kühler, aber dafür wehte kein Wind. Ich spürte, wie mir der Schweiß den Rücken hinablief, und fragte mich, ob ein Verbrennungsopfer überhaupt noch Hitze fühlen konnte.
»Sie wollten mich sprechen?«, sagte ich und klang dabei nicht nur dem Wortlaut nach wie ein Butler, der auf das Läuten seines Dienstherrn parierte. Ein weiteres Nicken. Ein weiterer Pfeifton. Ich wollte mich kratzen. Die Gummischlaufen des Mundschutzes kitzelten mich hinter den Ohren, aber aus irgendeinem Grund wollte ich mich nicht bewegen. Nicht, bevor der Unbekannte mir nicht den Grund meiner Anwesenheit verraten hatte.
»Kommen Sie«, sagte der Mann erstaunlich klar.
»Wohin?«
»Hier. Zu mir.« Er klopfte mit der bandagierten Hand auf die Decke.
Alles, nur das nicht.
Ich würde mich nicht zu ihm auf die Bettkante setzen. So weit ging die Neugierde nun doch nicht. Wohl aber so weit, dass ich mich hinabbeugte.
»Es tut mir leid …«, flüsterte der Sterbende, als ich dicht genug bei ihm war, um seinen Atem an meiner Wange zu spüren, »… aber Joshua hat Sie auserwählt!«
3. Kapitel
Jola hatte nicht bemerkt, dass sich jemand dem Auto näherte. Mit Biffy Clyro in den Ohren und der Lautstärke des iPods im roten Bereich hätte ein Hubschrauber hinter dem Käfer landen können, und sie hätte sich nur über das Laub gewundert, das auf einmal um sie herum hochwirbelte. Deshalb blieb ihr fast das Herz stehen, als plötzlich eine Hand durch das geöffnete Seitenfenster griff und sie an der Schulter berührte.
»Verdammt, haben Sie mich erschreckt.«
Sie riss sich die Stöpsel aus den Ohren und stoppte ihre aktuelle Lieblingsband. Blut schoss ihr in die Wangen, ein Gefühl, das sie hasste, weil ihr das oft passierte, wenn sie sich aufregte, und ihr dann jeder ansehen konnte, was für ein schreckhaftes Häschen sie war.
»Sorry, tut mir sehr leid. Bist du Jola?«
Sie nickte und kniff die Augen zusammen, denn die Sonne reflektierte ungünstig auf dem Plastikschild an dem weißen Kittel, zudem war der Name darauf so klein, dass sie ihn kaum entziffern konnte.
Westend. Station 6, Dr. Schmidt, Schmied – oder Schmitz?
»Dein Vater schickt mich.«
»Mein Vater?«
»Ja, ich soll dich zu ihm bringen.«
»Ach so? Wieso denn?«
»Krieg jetzt keinen Schreck, aber es geht ihm nicht so gut. Du sollst bei ihm warten, bis deine Mutter da ist.«
»Oh, okay.«
Die Sorge um Papa ließ ihren Puls wieder auf das Tempo des Rocksongs hochschnellen, den sie gerade gehört hatte.
»Was ist denn passiert?«
»Ganz dumme Sache. Er wollte seinem Freund, unserem Oberarzt, einen Kickbox-Trick zeigen, dabei ist er gestolpert und hat sich wohl das Bein gebrochen.«
»Echt?« Jola schüttelte den Kopf. Kann man ihn denn keine Sekunde aus den Augen lassen?
So viel zum Thema »Das mit der Pizza holen wir gleich nach«.
Manchmal fragte sie sich, wer von ihnen beiden das Kind, und wer der Erwachsene war.
»Also schön, wo ist er denn jetzt?«, fragte Jola und griff sich ihren Rucksack. Den Wagen konnte sie offen lassen. Das einzig Wertvolle in dieser Rostlaube waren die Peng-Chips im Handschuhfach, und die waren für einen Dieb wohl kaum von Interesse.
»Komm mit, ich bring dich zu ihm«, sagte Dr. Schmidt, Schmied oder Schmitz und nahm ihre Hand.
Jola war das etwas unangenehm, auch weil die Hand sich so feucht und beinahe glitschig anfühlte, aber sie wollte nicht unhöflich sein, und bei dem Wetter schwitzte man nun mal, also erwiderte sie das Lächeln und hoffte, dass der Weg, den sie in Richtung Park einschlugen, nicht allzu lange dauern würde.
4. Kapitel
Joshua hat mich auserwählt?
Ich fühlte mich wie ein Idiot, jetzt, da der Alte auf der Intensivstation seinen ersten vollständigen Satz gesagt hatte. Irgendwie ging ich davon aus, dass der Mann alt war, wahrscheinlich, weil man unbewusst immer darauf hofft, niemals mit Sterbenden konfrontiert zu werden, die gleichaltrig sind oder gar jünger als man selbst.
Joshua! Na toll.
Ein Bibelspinner!
Ich murmelte eine Entschuldigung, ohne zu wissen wofür, und drehte mich um, als der Mann hinter mir zu brüllen begann:
»Halt. Hiergeblieben!« Ich sah zurück. Die verbrannte Haut im Gesicht des Sterbenden schien noch einmal dunkler geworden zu sein.
»Sie müssen fliehen, bevor es zu spät ist«, sagte er mit erstaunlich fester Stimme. »Joshua hat Sie auserwählt, und Joshua irrt nicht.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wer, zum Teufel, ist Joshua? Meinen Sie den biblischen Propheten?«
Und wer, zum Teufel, sind Sie?
»Dafür haben wir keine Zeit. Bitte, hören Sie auf mich. Sie dürfen sich nicht strafbar machen. Unter keinen Umständen!«
Der Mann hustete, Speichel lief ihm übers Kinn. Ich näherte mich ihm wieder.
»Wieso vermuten Sie, dass ich etwas Verbotenes tun sollte?« Ich fragte mich, ob er mich vielleicht mit einem anderen, polizeibekannten Rhode verwechselte. Im Gegensatz zu meinem Bruder Cosmo war ich jedoch noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
»Ich vermute gar nichts«, sagte das Brandopfer. »Ich weiß, dass Sie sich strafbar machen werden. Joshua kennt Sie besser als Sie sich selbst.« Ein weiteres Husten, gefolgt von einem weiteren Pfeifton.
Im ersten Impuls hatte ich lachen wollen, es mir dann aber verkniffen angesichts des jämmerlichen Zustands, in dem sich mein merkwürdiger Gesprächspartner befand, weswegen ich jetzt lediglich einen knappen, kehligen Laut ausstieß. »Hören Sie, es tut mir sehr leid, dass es Ihnen so schlecht geht, aber …«
Der Mann packte meine Hand. Ich zuckte zusammen. Einerseits, weil ich mit dieser Berührung nicht gerechnet hatte, andererseits, weil der Griff des Fremden so unerwartet fest war. Trotz der flexiblen Bandage, in der seine Finger steckten.
»Ich weiß, Sie kennen mich nicht. Aber ich kenne Sie. Sie sind Maximilian Rhode, achtunddreißig Jahre alt, Steuernummer 11/2557819. Mit neunzehn Jahren Boxprofi im Halbschwergewicht, bis eine Knieverletzung Ihre Karriere beendete, Ex-Reporter bei 105 Punkt Null und so, wie es aussieht, bald ein Ex-Schriftsteller mit einem Netto-Einkommen im letzten Jahr von 18224 Euro und 63 Cent …«
»Moment mal …«, versuchte ich den Redeschwall des Alten zu unterbrechen. Mit jedem Wort hatte er einen Treffer gelandet. Und jeder einzelne Treffer hatte mich bis ins Mark erschüttert.
Und die Einschläge kamen noch näher.
»… verheiratet mit Kim Rhode, geborene Staffelt, zwei Jahre älter, Lufthansa-Pilotin, zeugungsunfähig von Geburt an, weswegen Sie keine leiblichen Kinder haben, dafür aber ein Pflegekind, Jola Maria, zehn Jahre alt, die als Baby von ihren cracksüchtigen Eltern auf einer öffentlichen Toilette zum Verkauf angeboten worden war und die Sie gerne adoptiert hätten, was aber wegen Ihres pädophilen Bruders immer wieder abgelehnt wurde …«
Ein Hustenfall hinderte ihn daran, noch weitere Fakten aufzuzählen. Als er wieder normal atmete, stand mein Mund immer noch offen. Ich war so schockiert, dass ich eine Weile brauchte, um meine Stimme wiederzufinden.
»Woher … ich meine wie … woher zum Teufel wissen Sie das alles?«
Gut, einiges war im Internet zu finden, aber vieles davon, insbesondere Jolas Vergangenheit, waren gut gehütete Geheimnisse, vor allem, dass sie als Baby hatte »verkauft« werden sollen. Wer oder was auch immer dieser Mann war, er hatte ebenso eindrucksvoll wie furchteinflößend unter Beweis gestellt, dass er kein Spinner war, der meine Nummer zufällig aus dem Telefonbuch gewählt hatte.
Ich entzog ihm die Hand. Die Ansprache schien seine letzten Kräfte verbraucht zu haben. Er war noch weiter in sich zusammengesunken, seine Stimme klang nun nicht einmal mehr halb so laut.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte ich, und zum ersten Mal, seit ich im Westend angekommen war, hatte ich Angst davor, eine Antwort auf eine meiner Fragen zu bekommen.
»Ich will Sie warnen. Verlassen Sie noch heute die Stadt! Erzählen Sie niemandem, wo Sie hingehen! Weder Frau noch Tochter. Kommen Sie nicht zurück! Wenigstens ein Jahr nicht, haben Sie verstanden?«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf. »Weil sonst was passiert?«
Der Mann seufzte. Eine Träne trat in sein verbliebenes Auge. Erst jetzt fiel mir auf, dass der Sterbende nicht blinzelte, da ihm das Lid dafür fehlte.
»Sonst enden Sie so wie ich«, hauchte er. Dann begann er plötzlich zu piepen.
Ich glaubte im ersten Moment tatsächlich, der Laut würde wie das Pfeifgeräusch zuvor aus seinem lippenlosen Mundloch strömen. Ich bemerkte die Nulllinie auf dem Kontrollmonitor erst, als die Tür aufgerissen und eine Schwester, dann ein Arzt und schließlich noch zwei Pfleger in den Raum schossen, mich zur Seite drängten, jedoch keine Wiederbelebungsmaßnahmen einleiteten. Entweder, weil der Patient es so verfügt hatte.
Oder weil es ohnehin sinnlos war.
Der namenlose Unbekannte war bereits tot.
5. Kapitel
Auf meinem Weg aus dem Neubau des Klinikums kam ich an einem Getränkeautomaten vorbei und zog uns zwei Cola. Am Kiosk kaufte ich Jola noch eine Bravo. Dann setzte ich mich kurz auf eine Parkbank, um einen klaren Kopf zu bekommen, bevor ich meiner Tochter unter die Augen trat.
Ich war kein guter Schauspieler, und gerade Jola erkannte oft auf einen Blick, wie ich mich fühlte. Ich wollte auf keinen Fall, dass sie mir ansah, wie sehr mich die morbide Begegnung gerade eben mitgenommen hatte. Allerdings wollte ich sie nun auch nicht zu lange warten lassen, weshalb ich mich nach einer kurzen Atempause auf dem schnellsten Weg zum Besucherparkplatz machte, wo ich das Auto verlassen vorfand.
Ich hätte vielleicht auch mal auf die Toilette gehen sollen, dachte ich und öffnete die unverschlossene Fahrertür. Mein Blick fiel auf das offen stehende Handschuhfach, und ich wunderte mich etwas, dass Jola noch einmal die Chipstüte herausgeholt und auf den Beifahrersitz gelegt hatte. Immerhin wusste sie, dass es nur noch ein Exemplar davon auf der Welt gab.
Über den Sitz gelehnt versuchte ich, die Tüte wieder in das Handschuhfach zu stopfen, doch in dem lag auf einmal ein kleiner Kosmetikbeutel. Eine jener mausgrauen Plastiktaschen, wie sie auf Nachtflügen den Passagieren in der Businessclass ausgeteilt wurden und die Kim hin und wieder von ihren Reisen mitbrachte.
Wie kommt das Ding denn auf einmal hierher?
Während ich mit meinem Handy Jolas Nummer wählte, um zu fragen, wie lange sie noch brauchte, öffnete ich den Reißverschluss und warf einen Blick in das Etui. Es enthielt ein kleines braunes Fläschchen mit weißem Sicherheitsverschluss, wie es Apotheker verwenden, um selbst hergestellte Arzneien abzufüllen. Ohne Etikett konnte ich mir nicht sicher sein, aber die Flasche kam mir bekannt vor, was mich beunruhigte. So wie die Tatsache, dass es nun schon zum vierten Mal klingelte und Jola nicht abnahm.
Ich öffnete den Deckel und roch an der Flüssigkeit.
Bitter. Stechend. Scharf.
Ich sah meinen Verdacht bestätigt, und mit einem Mal wurde mir schlecht vor Sorge.
Jola!, dachte ich, nun gar nicht mehr davon überzeugt, dass sie nur kurz aufs Klo gegangen war. Ich trat vom Wagen weg und sah mich um. Trotz der drückenden Hitze hatte ich Gänsehaut auf den Unterarmen und fröstelte. Und dann wurde es noch kälter, als am anderen Ende endlich abgenommen wurde und ich nicht Jola, sondern eine Männerstimme hörte.
»Hallo? Wer ist da?«
Rau. Kehlig. Aber auch nervös.
Ich sah mich in allen Richtungen um, in der abwegigen Hoffnung, irgendwo einen Mann mit einem Handy am Ohr zu sehen, der mich beobachtete. Selbstverständlich sah ich ihn nicht.
»Wo ist meine Tochter?«, fragte ich.
»Wer spricht da?«, wollte der Fremde wissen.
Ich spürte, wie sich ein Teil meiner Sorge in Wut verwandelte.
»Ich bin ihr Vater, und Sie sagen mir jetzt sofort, wer Sie sind und was Sie mit Jola gemacht haben.«
Die Antwort des Fremden riss mir den Boden unter den Füßen weg und ließ mich taumeln, obwohl ich mich keinen Zentimeter bewegte. Die Welt drehte sich ohne mich, für eine kurze Weile zumindest, bis ich entschied, dass das alles ein großer Irrtum sein musste. Ein schlechter Scherz. Oder einfach nur ein ganz fürchterliches Missverständnis.
Also riss ich mich zusammen und machte mich auf den Weg in die Pathologie.
6. Kapitel
Acht Stunden später
»Hast du deinen gottverdammten Verstand verloren, Max?«
Noch hielt Kim die Stimme gesenkt und weinte nicht, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändern und sie mir unter Tränen ihre aufgestaute Wut ins Gesicht brüllen würde, zumal wir diese Unterhaltung heute in verschiedenen Variationen schon öfter geführt hatten.
»Ich hab sie nur kurz alleine gelassen«, sagte ich nicht zum ersten Mal und folgte ihr in Jolas Zimmer, wo Kim die oberste Schublade einer Kommode aufriss.
»Kurz?« Sie drehte sich so rasch zu mir herum, dass ihr langer blonder Zopf wie ein Pendel nach vorne schlug. Kim hatte meinen Hilferuf heute Nachmittag auf dem Laufband im Fitnesscenter erhalten und war sofort ins Krankenhaus gehetzt. Jetzt, kurz vor Mitternacht, trug sie immer noch einen eng anliegenden schwarzen Jogginganzug und die Laufschuhe, mit denen sie die Treppen der Notaufnahme hochgesprintet war.
»Über eine Stunde hast du sie warten lassen.«
Sie stopfte wahllos Unterwäsche, Socken und einen Schlafanzug in die Sporttasche, dann schob sie sich an mir wieder vorbei in den Flur. Ihr nächstes Ziel war das Badezimmer, wohin ich ihr ebenfalls folgte.
»Wie konnte das denn nur passieren?«
Ich schüttelte den Kopf. Zuckte mit den Achseln, weil ich mir auch keinen Reim darauf machen konnte. Im Spiegel des Badezimmerschränkchens sah ich selbst, wie hilflos meine Reaktion wirkte. Und wie alt ich auf einmal aussah. Als hätte ich seit der Grundschule Kette geraucht und den schlechten Geschmack am Morgen mit Whiskey runtergespült. Meine Wangen hatten die Farbe von eingelegtem Sushi-Ingwer, und die Schatten unter meinen Augen sahen aus, als hätte ein untalentierter Maskenbildner versucht, seinen ersten Zombie zu gestalten.
Kims ungeschminktes, von jugendlichen Sommersprossen verziertes Gesicht hingegen erinnerte an ein Werbeversprechen einer Beautyfarm. In einer Bar wäre sie nach dem Ausweis und ich danach gefragt worden, weshalb ich mit meiner Tochter ausging. Aber in eine Bar würden wir so schnell nicht wieder gemeinsam gehen wollen, so viel war klar.
»Es war ein Krankenhausparkplatz. Ich hab sie nicht zwischen Junkies und Dealern auf einer Bank im Görlitzer Park ausgesetzt!«
Kim atmete tief ein und aus, doch es gelang ihr nicht, ihre Stimme zu beruhigen. »Darum geht es doch gar nicht, Max. Die Frage ist, wie du so blöd sein konntest, dieses Teufelszeug in deinem Auto zu lagern!«
»Das hab ich doch gar nicht.«
»Ach nein?«
Sie hatte sich Jolas Zahnbürste vom Waschbeckenrand gegriffen und stocherte mit ihr drohend in meine Richtung. »Dann sind die K. o.-Tropfen also ganz alleine aus dem Arbeitszimmer in dein Handschuhfach geflogen, damit Jola sich mit ihnen vergiften kann?«
Zwei Schwestern hatten sie während ihrer Raucherpause reg- und bewusstlos im Eingang ihrer Station gefunden, ausgerechnet vor der Pathologie! Die Ärzte hatten zunächst auf Alkoholmissbrauch oder Drogen getippt. Später ergab die Laboranalyse, dass Jola Gammahydroxybuttersäure, kurz GHB, im Blut hatte. Eine sogenannte Date-Rape-Droge, die Vergewaltiger ihren potenziellen, meist weiblichen Opfern in einem unbeobachteten Moment in die Getränke schütten. Je nach Dosierung verlieren einige schon nach zehn Minuten das Bewusstsein und können sich nach dem Aufwachen an nichts mehr erinnern. So offenbar auch Jola.
Nach Stunden des Bangens war sie gegen Mitternacht endlich wieder kurz zu sich gekommen, körperlich unversehrt, aber ohne die geringste Erinnerung, weshalb sie den Wagen verlassen hatte und was danach mit ihr geschehen war. Das Letzte, was sie wusste, war, dass ich sie von ihrem Schwimmtraining abholte. Danach Filmriss.
Eine typische Folge der Einnahme von GHB.
Ich kannte mich mit dem Stoff gut aus, da er in meinem aktuellen Roman eine zentrale Rolle spielte. Deshalb hatte ich mir von einem befreundeten Apotheker auch ein kleines Fläschchen geben lassen, den Selbstversuch an mir bislang allerdings nie gewagt.
»Ich hab es bei dir auf dem Schreibtisch gesehen«, sagte Kim.
»Ja, in meinem Arbeitszimmer. Und das schließe ich immer gut ab. Nur du und ich haben einen Schlüssel! Glaubst du ernsthaft, ich reiße das Etikett von der Flasche und fahre mit K. o.-Tropfen spazieren?«
Ich hob ein Handtuch auf, das ihr heruntergefallen war.
»Und selbst wenn ich das getan haben sollte, dann denk doch bitte einen Schritt weiter und sag mir, ob du unsere Tochter wirklich für so dämlich hältst, einen Schluck aus einer nach Säure stinkenden Pulle zu nehmen?«
»Jola ist nicht dämlich. Jola ist zehn. Sie ist ein Kind. So etwas gehört nicht in ihre Nähe. Verdammt, sie gehört auch nicht auf den Parkplatz eines Krankenhauses. Was, zum Teufel, hattest du da überhaupt zu suchen?«
Ich seufzte.
»Du warst doch dabei, als die Polizei mich vernommen hat. Dieser Selbstmörder hat mich angerufen …«
»Ja, ja. Das weiß ich.«
Zum Glück hatte Dr. Grabow den Beamten meine Geschichte bestätigen können. Da er sich nach dem Tod seines Patienten nicht mehr so umfassend an seine Schweigepflicht gebunden fühlte, erfuhr ich auch, dass es sich bei dem Verbrennungsopfer um einen verschrobenen Wissenschaftler handelte, der vermutlich an Depressionen litt und sich in seiner Doppelgarage in Köpenick mit Benzin übergoss und anzündete. Wegen des eindeutig erklärten Suizidwillens gab es wohl keine weiteren Ermittlungen. Zudem hatten die Schwestern im Nachttisch mehrere Ausgaben meiner Bücher gefunden, viele mit handschriftlichen Notizen. Die Vermutung lag nahe, dass es sich um einen geistig verwirrten »Fan« handelte. Ein Literatur-Stalker, dem sein sterbendes Hirn in den letzten Minuten seines Lebens einen Streich gespielt hatte, wobei mir natürlich immer noch nicht klar war, wie er an so viele Informationen über mich gekommen sein konnte, aber das war mir im Augenblick völlig egal.
»Was ich mich frage, ist, wieso du Jola da mit reinziehen musstest? Jeder andere normale Vater wäre wie verabredet in die Pizzeria gefahren.«
»Normale Väter verdienen ihren Lebensunterhalt auch nicht mit dem Schreiben von Thrillern.«
»Ach, tust du das neuerdings wieder? Geld verdienen?«
Treffer. Tiefschlag und versenkt.
Über Kims Gesicht wanderte ein Schatten, und sie wirkte ehrlich betroffen, als sie den Blick senkte und leise sagte: »Hör zu, es tut mir leid. Das ist mir rausgerutscht, okay?«
Sie sah wieder auf. Ich hielt den Mund und wartete auf das unvermeidliche »Aber«.
»Aber du lebst in deiner eigenen Welt, Max. Du denkst nicht nach, oder wenn, dann immer über die nächste Geschichte, die du schreiben willst. Manchmal sitze ich vor dir am Esstisch und wiederhole einen Satz dreimal, bis du mir endlich antwortest, weil du mal wieder in Gedanken bei deinen Psychopathen und Serienmördern bist, aber nicht hier bei uns zu Hause. Dann frage ich mich, ob du überhaupt noch zwischen deinen Geschichten und der Realität unterscheiden kannst. Vermutlich hast du gar nicht mitbekommen, wie du die Tropfen eingesteckt hast.«
Sie weinte, und auch mir kamen die Tränen bei dem Gedanken, was alles hätte passieren können. Jola war weder missbraucht noch misshandelt worden, und die Konzentration in ihrem Blut würde keine Langzeitschäden hinterlassen. Doch hätte sie mehr GHB zu sich genommen, würde sie jetzt nicht ihren Rausch im Westend ausschlafen, sondern an Beatmungsgeräten hängen. An das Schlimmste, was hätte passieren können, wagte ich nicht zu denken.
Kim hatte alle Kosmetik- und Hygieneartikel, die sie für Jolas Krankenhaustasche einsammeln wollte, gefunden und verließ das Bad.
Wir gingen zur Haustür, wo ich meine Jacke von der Garderobe nahm.
»Nicht«, sagte sie und schüttelte den Kopf. Sie blinzelte erschöpft, müde der Diskussion, die sie erwartete.
»Wieso?«, fragte ich. »Jola wird sich freuen, mich zu sehen, wenn sie aufwacht.«
»Ja, Jola schon.«
Aber du nicht.
Verstehe.
Ich hob die Hand, unschlüssig, was ich mit ihr vorhatte. Vermutlich wollte ich Kim berühren, ihr sagen, dass es mir leidtat, dass es meine Schuld war und ich mir den Fehler ewig nicht würde verzeihen können, auch wenn ich mich nicht daran erinnerte, die Flasche aus dem Arbeitszimmer genommen zu haben, und mir keinen Reim darauf machen konnte, wie sie in das Auto gelangt war. Doch Kim kam mir zuvor und sagte: »In einem Roman ist es vielleicht eine amüsante Idee, wenn der starke Held seine kluge Tochter mit in ein Abenteuer zieht. Aber in der Realität ist das eine ganz große Dummheit.«
Ich weiß.
»Ich würde Jola niemals in Gefahr bringen«, sagte ich.
»Nicht absichtlich, keine Frage. Du würdest für sie töten und sterben, und du bist immer für sie da, wenn es drauf ankommt.«
Ich nickte.
»Aber nur, wenn es drauf ankommt. Verstehst du? Das ist das Problem. Jola braucht keine Feuerwehr, sondern einen Vater. Und ich brauche schon lange keinen Traumtänzer mehr, der mich mit Peng-Chips füttert und sich Geschichten ausdenkt, sondern einen Ehemann, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht.«
Sie sah mich traurig an und schulterte Jolas Sporttasche.
Merkwürdigerweise schmerzte ihr darauf folgender Abschiedssatz weitaus weniger als der zuvor:
»Ich weiß, das Timing könnte nicht schlechter sein, aber ich hab jemanden kennengelernt, Max.«
Vermutlich, weil ich schon lange damit gerechnet hatte, ihn irgendwann zu hören.
Zwei Monate später
7. Kapitel
Ein schlechtes Zeugnis. Die Faust meines Vaters. Der metallische Geschmack im Mund.
Blut.
Kindheitserinnerungen, die ich zu verdrängen versuchte, als ich mich in Jolas Klassenzimmer umsah.
Noch hatte ich keine Ahnung, was sie dieses Mal wieder angestellt hatte, aber so wie die Biolehrerin aussah, auf deren Veranlassung das »Elterngespräch« einberufen worden war, würde meine Tochter heute wohl nicht mit einer Fünf-Euro-Strafe davonkommen.
»Es gibt wahrlich keine Entschuldigung für Jolas Verhalten«, empörte sich Frau Jasper, eine früh ergraute und damit vom Alter her schwer zu bestimmende Frau mit einem Gesichtsausdruck wie eine zusammengeballte Faust. Wie fast alle Grundschullehrer meiner Tochter war auch sie ein vornamenloses Wesen. In keinem anderen Berufszweig habe ich es bislang erlebt, dass sich mir Fremde konsequent nur mit dem Nachnamen vorstellten. Frau Irgendwer Jasper unterrichtete Jola in Biologie und Englisch und war erst seit einem Jahr an der Wald-Grundschule, anders als Frau Fischer, Jolas Klassenlehrerin, die im nächsten Jahr als Schulrektorin in Pension gehen würde.
Sie hatte mich vor der Schule abgefangen und »wegen der jüngsten Vorfälle« zu dieser Unterredung gebeten, deretwegen ich jetzt meinen Einzeltermin bei der Paarberatung versäumte, die Kim und ich seit sechs Wochen aufsuchten.
»Worum geht es denn?«, fragte ich mit einer Mischung aus Neugierde und Ungeduld. Wir saßen auf viel zu kleinen Stühlen und bildeten ein Dreieck vor der frisch geputzten Tafel, und ich hatte große Mühe, mich zu konzentrieren. Der allgegenwärtige Geruchsmix aus Terpentin, Wachsmalfarben, nassen Schuhen, Staub und Kreide versetzte mich in eine Zeit, in der meine größten Probleme noch vor mir gelegen hatten und an die ich dennoch nicht gerne zurückdachte. Schulräume erzeugten in mir immer ein Gefühl der Beklemmung, gerade jetzt, in der ersten Heizperiode im Oktober, wenn die Luft so trocken und der Sauerstoff nach einem langen Unterrichtstag verbraucht war. Vermutlich war ich der Einzige, der den Diesel riechen konnte, mit dem die Heizöltanks der Schule kürzlich aufgefüllt worden waren, aber ich hatte schon immer eine bessere Nase gehabt, als mir in manchen Situationen lieb war, und der »Duft der Angst« sorgte wieder einmal dafür, dass ich mich in diesem Klassenzimmer nicht besonders heimisch fühlte.
»Damit hat sie nach mir geworfen!«
Frau Jasper zog aus den Untiefen ihrer Hosentasche einen kinderfaustgroßen Stein, den sie mit zusammengekniffenen Lippen auf die an ihrem Stuhl befestigte Schreibunterlage legte.
»Mit einem Alkalifeldspat?«, entfuhr es mir. Nicht, dass ich mich großartig mit Steinen auskannte, aber Jola war fasziniert von den Dingern, die sie beinahe täglich von ihren Spaziergängen mit nach Hause schleppte. Quarze, Minerale, Kristalle, egal was, Hauptsache ungewöhnlich. Sie wusch, sortierte und kategorisierte die Steine, für die sich in der Vitrine in ihrem Zimmer schon lange kein Platz mehr fand, weshalb unser halbes Wohnzimmer mit Granitgneisen, Tigeraugen oder Migmatitbrocken vollgepflastert war. Oder mit einem grünlich schimmernden Alkalifeldspat wie jenem, den sie mir heute Morgen beim Frühstück stolz präsentiert hatte. Es verging kein Tag, an dem sie sich nicht einen ihrer Steine aussuchte, um ihn mit in die Schule zu nehmen. Als Glücksbringer – und offensichtlich hin und wieder auch als Wurfgeschoss.
»Sie hat ihn mir an den Kopf geschmissen.« Frau Jasper verzog das Gesicht, als würde sie in diesem Moment noch einmal getroffen. »Mit voller Absicht.« Sie drehte sich mit wütendem Blick zur Direktorin, und mir fiel eine Kreuz-Tätowierung hinter ihrer rechten Ohrmuschel auf, die so gar nicht zu ihrem konservativen Modegeschmack passen wollte – schlichte Schnürstiefel, einen unvorteilhaft sitzenden Hosenanzug Marke »Bundeskanzlerin«, dazu ein farblich passendes rotes Haarband.
»Weshalb?«, fragte ich. Nach meiner Klassifizierung des Steins die zweite unpassende Bemerkung in den Augen der Biologielehrerin.
»Können Sie sich auch nur einen einzigen, entschuldbaren Grund vorstellen, der es rechtfertigen würde, einen Pflasterstein nach seiner Lehrerin zu werfen?«, zischte sie.
Feldspat, nicht Pflaster, hörte ich Jola in Gedanken korrigieren.
»Nein, aber ebenso wenig kann ich mir vorstellen, dass meine Tochter völlig grundlos einem anderen Menschen wehtut. So ist sie nicht.«
»Mit Verlaub, vielleicht kennen Sie sie ja nicht so gut. Sie ist ja nur …«
»Nur was?«, fuhr ich Frau Ja-leck-mich-doch-Jasper an. Drei Sätze nur, und die Frau hatte es geschafft, dass ich am liebsten vom Stuhl hochgesprungen wäre. »Sprechen Sie es aus«, forderte ich sie auf. »Sagen Sie, was Sie denken.«
Dass Jola nur ein Pflegekind ist. Und ich nicht der leibliche Vater.
»Ich denke, dass es nichts bringt, wenn wir uns streiten«, schaltete sich Frau Fischer in die Runde, und in ihrer gewohnt ruhigen Art sagte sie mit warmer Stimme: »Lassen Sie uns bitte sachlich bleiben und gemeinsam eine Lösung finden.«
Frau Jasper räusperte sich.
»Ich wollte nur sagen, dass Sie nicht wissen, wie Jola sich in der Schule benimmt.«
Hm. Klar. Und deshalb hast du deinen letzten Satz mit »Sie ist ja nur …« eingeleitet. Dumme Kuh.
»Was genau ist passiert?«, fragte ich. Die Biolehrerin atmete schwer aus wie jemand, der kurz davorsteht, von einer schweren Enttäuschung zu berichten.
»Wie Sie ja wissen dürften, behandeln wir im Unterricht gerade das Thema Sexualkunde.«
Ich nickte und wusste es tatsächlich.
Nachdem die polizeilichen Ermittlungen eingestellt worden waren – ich war mit einer Ermahnung davongekommen –, hatte ich meinen Verlag darüber informiert, dass sich der Abgabetermin verschieben würde. Um mehr Zeit für Jola, aber auch für die Rettung meiner Ehe zu haben, verlor ich mich nicht länger in abenteuerlichen Recherchen und nächtelangen Schreibklausuren. Stattdessen arbeitete ich nur noch, wenn Jola in der Schule war, half ihr bei den Hausaufgaben und hielt jede getroffene Familienverabredung ein, bei denen ich fortan nicht nur körperlich, sondern auch geistig anwesend war. So schaltete ich beispielsweise mein Handy beim Abendessen aus, um nicht – wie früher – schnell mal was für meinen neuen Roman zu googeln, anstatt mich am Gespräch zu beteiligen. Als Kim mir signalisierte, diesen ominösen »Mr. Escape«, wie sie ihn nannte und mit dem angeblich noch nichts gelaufen war, vorerst nicht zu sehen, gab ich meine Vorbehalte bezüglich einer Paartherapie auf. Was man halt so macht, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
»Offensichtlich ist das Thema noch zu früh für sie«, erklärte Frau Jasper unterdessen. »Es ging um die Benutzung des Kondoms. Jola benahm sich sehr unreif, lärmte, störte den Unterricht durch wiederholtes Zwischenrufen. Und mit einem Mal warf sie mir den Stein an die Stirn.« Sie griff nach ihrem Pflaster. »Ein Glück, dass die Wunde nicht genäht werden musste!«
Ich dachte einen Moment nach, dann stand ich auf. Die Direktorin hob erstaunt die Augenbrauen, während Frau Jasper anfing zu stottern: »Was ist … also … wo wollen Sie denn hin?«
»Ich würde nur gerne die andere Version hören.«
»Welche andere Version?«, fragte die Biologielehrerin entrüstet.
»Die meiner Tochter«, sagte ich, öffnete die Tür und bat Jola herein.
Es dauerte eine Weile, bis sie von der Heizungsverkleidung, auf der sie im Schneidersitz gehockt hatte, heruntergesprungen war und mit trotzigem Schritt ins Klassenzimmer stapfte. An dem roten Rand des Leberflecks auf ihrer Wange erkannte ich, dass sie in den vergangenen Minuten wild an ihm herumgekratzt haben musste.
»Okay, ich will jetzt die Wahrheit hören«, sagte ich und führte sie zu den Stühlen, auf denen Frau Fischer und Frau Jasper mit eng aneinandergedrückten Knien saßen.
Jola trug enge Jeans, die in neongelben Regenstiefeln irgendeiner Luxusmarke steckten. Ich vermutete, dass sie die nur trug, um ihrer Mutter einen Gefallen zu tun, denn eigentlich passten sie nicht zu ihrem »Ich spiel lieber mit den Jungs«-Stil. Doch ich konnte Kim verstehen. Wäre ich so oft unterwegs gewesen wie sie, hätte ich meine Tochter vermutlich auch mit Duty-free-Geschenken zugeschüttet. Und immerhin passten die Stiefel, die Jola schon längst mit einem Edding »verschönert« hatte, zu dem grau-regnerischen Schmuddelherbst, den Berlin gerade erlebte.
»Wieso hast du das getan?«, fragte ich sie streng. Ich rechnete mit ihrer Allzweck-Antwort, mit der sie mich immer abspeiste, wenn sie keine Lust hatte zu reden. Ein gleichgültiges Achselzucken, das je nach Sachlage »Keine Ahnung«, »Lass mich in Ruhe!« oder »Kann dir doch egal sein« heißen konnte. Stattdessen verblüffte sie mich mit einem ganzen Satz:
»Sie hat was gegen Schwule.« Jola deutete mit dem Zeigefinger auf Frau Jasper.
»Bitte?«, fragte ich irritiert.
Die Biolehrerin machte eine »Halb so wild«-Fuchtelbewegung und rollte mit den Augen. »Blödsinn. Ich habe nur die Bibel zitiert, in der gleichgeschlechtliche Liebe als Sünde dargestellt wird, 3. Buch Mose 18, 22.«
Ich legte mir eine Hand ans Ohr. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, dass Frau Fischer ebenfalls glaubte, sich verhört zu haben.
»Sie haben was …?«, setzte ich an, bevor Jola dafür sorgte, dass die Unterhaltung noch bizarrer wurde.
»Und ich habe Sie lediglich bestraft, weil Sie diese hässliche Kleidung tragen, Frau Jasper.« Jola zeigte auf den Hosenanzug der Biolehrerin. Mit einer Mischung aus Verärgerung und Triumph in der Stimme stand Frau Jasper auf und rief:
»Ha, da hören Sie ja selbst, wie unverschämt Ihre Tochter ist! Sie beleidigt mich sogar in Ihrer Gegenwart, Herr Rhode.«
»Moment mal, der Reihe nach«, versuchte die Direktorin, die Kontrolle über die Diskussion wieder an sich zu reißen, doch vergeblich. Ich war stinksauer.
»Hab ich das richtig verstanden? Sie haben meiner Tochter erzählt, dass Homosexualität eine Sünde ist?«
»Nun. Was auch immer die liberalen Medien heutzutage behaupten, die Bibel ist eindeutig und verbietet …«
»… von Gott nicht geduldete Kleider. Levitikus, 19, 19.«
Ich hatte gerade Frau Jasper fragen wollen, ob sie den Verstand verloren hatte, solche reaktionären Ansichten gegenüber Grundschülern zu predigen, doch nun schwenkte mein Kopf zu Jola, die für mich in Rätseln sprach.
»Wer zum Geier ist Levitikus?«, wollte ich von ihr wissen.
»Auch das 3. Buch Mose«, antwortete sie.
Meine Verblüffung steigerte sich, als Frau Jasper zustimmend nickte. »Da hat sie recht, aber da steht ja wohl kaum drin, dass man Pädagogen mit Steinen bewerfen soll, wenn …«
»… wenn diese Kleider tragen, die aus zwei verschiedenen Stoffen genäht sind, doch. Ihr Anzug, Frau Jasper, besteht aus Polyester und Baumwolle. Gemäß Levitikus 19,19 ist das verboten, und der Sünder muss von der Dorfgemeinschaft gesteinigt werden.«
Rums.
Jola hätte keinen größeren Effekt erzielen können, wenn sie eine Waffe gezogen hätte. Alle Münder standen offen. Meiner, der von Frau Fischer, am weitesten aber der der bibelfesten Biolehrerin. Jolas Worte hingen für eine Weile wie Schwebeteilchen im Klassenzimmer, und nach einer kurzen Pause, in der keiner ein Wort verlor, konnte ich mich nicht mehr halten. Ich fing an zu lachen. Erst leise kichernd, dann lauter, prustend, bis das Klassenzimmer vor meinen tränenden Augen Schleier zog.
8. Kapitel
»Das hast du dir ausgedacht, oder?«, fragte ich Jola eine Viertelstunde später, als sie auf dem Rücksitz des Käfers stur durch die Scheibe in den Regen starrte. Sie aus Sicherheitsgründen in dem alten, airbaglosen Käfer nicht mehr vorne sitzen zu lassen, war eine weitere Maßnahme aus meinem »Ich will ein verantwortungsbewussterer Vater und Ehemann werden«-Katalog. Etwas, was ihr verständlicherweise gar nicht schmeckte.
Wortlos und ohne nach vorne zu sehen, reichte sie mir einen Fünfeuroschein.
»Den kannst du behalten, wenn du mir vernünftige Antworten auf meine Fragen gibst.«
Wir fuhren die Eichkampstraße hinunter Richtung Auerbacher Tunnel, meine Lieblingsabkürzung zwischen Westend und Grunewald. Nach meinem Lachanfall hatte Frau Jasper entrüstet den Raum verlassen, und Frau Fischer, die mit dem Gesprächsverlauf etwas überfordert gewesen war, hatte die weise Entscheidung getroffen, erst einmal ein Einzelgespräch mit der Biologielehrerin zu suchen, bevor es ein weiteres Zusammentreffen in der großen Runde gab; am besten zu einem Zeitpunkt, an dem auch Kim mit von der Partie sein konnte. Aktuell stieg sie gerade in Newark in ihr Cockpit, laut dem Notizzettel am Kühlschrank wollte sie ab morgen für drei Tage wieder bei uns sein.