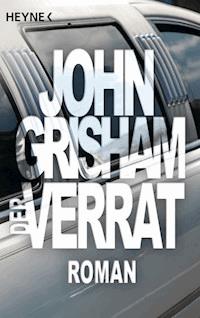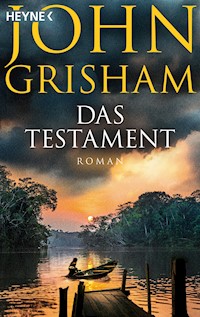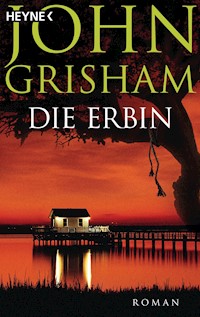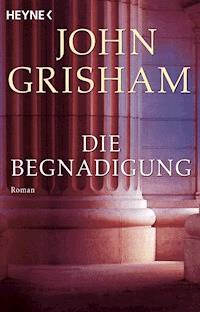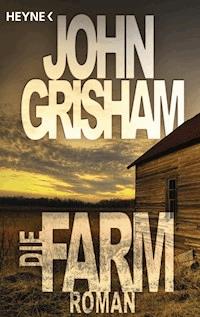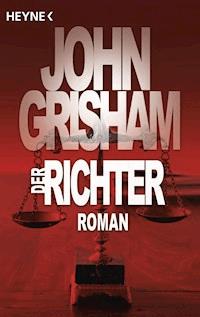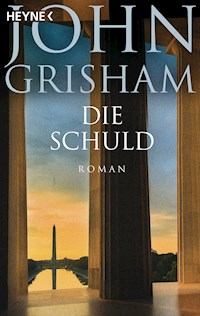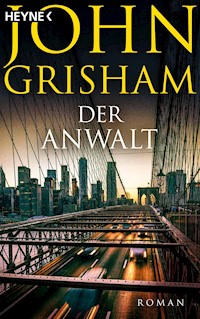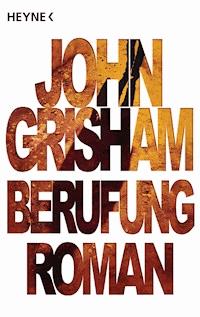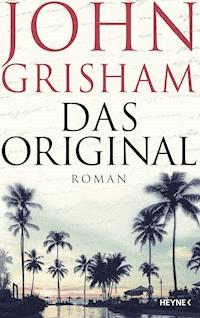
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein Coup, der die Buchwelt erschüttert
In einer spektakulären Aktion werden die handgeschriebenen Manuskripte von F. Scott Fitzgerald aus der Bibliothek der Universität Princeton gestohlen. Eine Beute von unschätzbarem Wert. Das FBI übernimmt die Ermittlungen, und binnen weniger Tage kommt es zu ersten Festnahmen. Ein Täter aber bleibt wie vom Erdboden verschluckt und mit ihm die wertvollen Schriften. Doch endlich gibt es eine heiße Spur. Sie führt nach Florida, in die Buchhandlung von Bruce Cable, der seine Hände allerdings in Unschuld wäscht. Und so heuert das Ermittlungsteam eine junge Autorin an, die sich gegen eine großzügige Vergütung in das Leben des Buchhändlers einschleichen soll. Doch die Ermittler haben die Rechnung ohne Bruce Cable gemacht, der überaus findig sein ganz eigenes Spiel mit ihnen treibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
In einer spektakulären Aktion werden die handgeschriebenen Manuskripte von F. Scott Fitzgerald aus der Bibliothek der Princeton University gestohlen. Eine Beute von unschätzbarem Wert. Das FBI übernimmt die Ermittlungen, und binnen weniger Tage kommt es zu ersten Festnahmen. Ein Täter aber bleibt wie vom Erdboden verschluckt, und mit ihm die wertvollen Schriften. Doch endlich gibt es eine heiße Spur. Sie führt nach Florida, in die Buchhandlung von Bruce Cable, der seine Hände allerdings in Unschuld wäscht. Und so heuert das Ermittlungsteam eine junge Autorin an, die sich gegen eine großzügige Vergütung in das Leben des Buchhändlers einschleichen soll. Doch die Ermittler haben die Rechnung ohne Bruce Cable gemacht, der überaus findig sein ganz eigenes Spiel mit ihnen treibt.
Der Autor
John Grisham hat 30 Romane, ein Sachbuch, einen Erzählband und sechs Jugendbücher veröffentlicht. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Er lebt in Virginia.
JOHN GRISHAM
DAS ORIGINAL
ROMAN
Aus dem Amerikanischen vonKristiana Dorn-Ruhl, Bea Reiterund Imke Walsh-Araya
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Camino Island
bei Doubleday, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Belfry Holdings, Inc.
Copyright © 2017 der deutschen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
DasZitat stammt aus Virginia Woolf: Ein eigenes Zimmer/Drei Guineen,S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2001, Übersetzung: Heidi Zerning,herausgegeben von Klaus Reichert.
Redaktion: Oliver Neumann
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-21948-2V003
www.heyne.de
Für Renée
Danke für die Geschichte
kapitel 1
Der Raub
1.
Der Betrüger benutzte den Namen eines tatsächlich existierenden Juniorprofessors für Amerikanistik der Portland State University, der in Kürze zur Promotion nach Stanford wechseln würde: Neville Manchin. In seinem Schreiben, das einen perfekt gefälschten Briefkopf der Universität trug, stellte sich »Professor Manchin« als angehender Spezialist für F. Scott Fitzgerald vor, der sich darauf freue, im Rahmen einer geplanten Reise an die Ostküste die Originalmanuskripte und -schriften des berühmten Autors einsehen zu dürfen. Adressiert war der Brief an Dr. Jeffrey Brown, Leiter der Manuskriptsammlung, Abteilung für Sammlungen und Rara, Firestone Library, Princeton University. Das Schreiben wurde mit den übrigen Postsendungen des Tages gewissenhaft sortiert und weitergeleitet, bis es auf dem Schreibtisch eines Bibliotheksassistenten landete, zu dessen überwiegend monotonen Aufgaben es gehörte, Adressaten solcher Anfragen auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen.
Ed Folk bekam pro Woche mehrere solche Briefe, und sie waren im Grunde alle gleich. Alle stammten von Fitzgerald-Fans und -Experten, hin und wieder war sogar eine echte Koryphäe darunter. Im vergangenen Jahr hatte Ed einhundertneunzig Besucher aus aller Welt überprüft und in die Bibliothek eingelassen. In ihren Augen stand ehrfürchtiges Staunen, wenn sie vor ihn traten, als wären sie Pilger im Angesicht eines Heiligtums. Seit vierunddreißig Jahren saß er an diesem Schreibtisch, niemand kam an ihm vorbei. Der Strom der Bewunderer riss nicht ab, denn die Faszination für F. Scott Fitzgerald war ungebrochen. Wie vor drei Jahrzehnten standen die Besucher seinetwegen Schlange. Ed fragte sich längst, ob es im Leben des großen Mannes noch etwas gab, was nicht erforscht, analysiert und veröffentlicht worden war. Erst kürzlich hatte ihm ein Experte erzählt, dass es inzwischen über hundert Bücher und mehr als zehntausend wissenschaftliche Artikel über Fitzgerald als Mensch und Schriftsteller, seine Werke und seine verrückte Frau gebe.
Dabei hatte er sich mit vierundvierzig Jahren zu Tode gesoffen! Was, wenn er bis ins hohe Alter hätte schreiben können? Ed hätte einen Assistenten gebraucht, vielleicht sogar zwei oder eine ganze Abteilung. Andererseits war ein früher Tod oft Garant für posthumen Ruhm (und höhere Tantiemen).
Nach Tagen kam Ed endlich dazu, sich Professor Manchin vorzunehmen. Ein kurzer Blick in das Mitgliederverzeichnis der Bibliothek ergab, dass es sich bei ihm um einen Unbekannten handelte, der zum ersten Mal anfragte. Einige Besucher kamen so regelmäßig, dass es Ed genügte, wenn sie sich kurz vorher telefonisch anmeldeten. »Hallo, Ed, ich komme nächste Woche vorbei.« Für die Stammgäste war das in Ordnung. Bei Manchin ging das natürlich nicht. Ed durchsuchte die Website der Portland State University und fand den Namen. Der Mann besaß einen Bachelor in Amerikanischer Literatur von der University of Oregon, einen Master von der University of California in Los Angeles und war seit drei Jahren Juniorprofessor. Das Foto zeigte einen unscheinbaren Mittdreißiger mit schmaler, rahmenloser Brille und dem leichten Ansatz eines Bartes, der nach vorübergehender Laune aussah.
In seinem Schreiben bat Professor Manchin um Rückantwort per E-Mail an seine private Gmail-Adresse, mit der Begründung, dass er seinen Uni-Account selten checke. Wird daran liegen, dachte Ed, dass er Hilfsprof ist und wahrscheinlich nicht mal ein eigenes Büro hat. Solche Gedanken gingen ihm öfter durch den Kopf, doch natürlich war er professionell genug, sie für sich zu behalten. Zur Sicherheit schickte er am nächsten Tag eine E-Mail an die Uni-Adresse des Professors, in der er ihm für sein Interesse dankte und ihn nach Princeton einlud. Er erkundigte sich, wann in etwa mit ihm zu rechnen sei, und wies auf die besonderen Richtlinien hin, die für die Fitzgerald-Sammlung gälten. Es sei eine ganze Menge zu beachten, deshalb empfehle er dem Professor, sich auf der Bibliothekswebsite damit vertraut zu machen.
Als Antwort kam eine automatische Abwesenheitsnotiz, der Ed entnehmen konnte, dass der Professor für einige Tage nicht erreichbar sei. Ein Mitglied von »Professor Manchins« Gang hatte sich in das System der Portland State University gehackt und den Server der Amerikanistik-Abteilung manipuliert, ein Kinderspiel für einen Profi. So wussten beide sofort Bescheid, dass Ed sich gemeldet hatte.
Aha, dachte Ed, nicht erreichbar. Am nächsten Tag schickte er die gleiche E-Mail noch einmal an Professor Manchins private Gmail-Adresse. Binnen einer Stunde reagierte dieser mit überschwänglichem Dank. Er freue sich sehr auf den Besuch, habe sich bereits ausgiebig auf der Bibliothekswebsite umgesehen und stundenlang im digitalen Fitzgerald-Archiv gestöbert. Er habe einige Jahre lang mit der mehrbändigen Faksimileausgabe erster handschriftlicher Entwürfe des großen Schriftstellers arbeiten dürfen und interessiere sich besonders für die kritischen Rezensionen des Erstlingswerks: Diesseits vom Paradies.
Alles klar, dachte Ed. Diese Sorte kannte er gut. Der Typ versuchte schon, ihn zu beeindrucken, ehe er überhaupt da war.
2.
F. Scott Fitzgerald nahm sein Studium in Princeton im Wintersemester 1913 auf. Gerade sechzehn Jahre alt, träumte er davon, den großen amerikanischen Roman zu schreiben, und hatte auch schon mit einer ersten Fassung von Diesseits vom Paradies begonnen. Vier Jahre später brach er das Studium ab, um Soldat zu werden und in den Krieg zu ziehen, der jedoch endete, bevor er zum Einsatz kam. Sein Klassiker,Der große Gatsby, erschien 1925, erlangte aber erst posthum Berühmtheit. Fitzgerald litt während seiner ganzen Karriere unter Finanznöten. Irgendwann konnte er sich nur noch mit dem Verfassen drittklassiger Drehbücher in Hollywood über Wasser halten, während es gesundheitlich und literarisch mit ihm bergab ging. Am 21. Dezember 1940 erlag er einem Herzinfarkt, Folge seines jahrelangen Alkoholmissbrauchs.
1950 übergab Scottie, seine Tochter und einziges Kind, alle originalen Manuskripte, Notizen und Briefe – seine gesammelten Schriften – an die Firestone Library der Princeton University. Fitzgerald hatte seine fünf Romane von Hand geschrieben, auf billigem dünnem Papier. Die Bibliothek erkannte rasch, dass es nicht sinnvoll war, Forscher ungehindert damit hantieren zu lassen, und so wurden hochwertige Abschriften angefertigt. Die Originale kamen in einen Tresorraum im Untergeschoss, in dem sich Luft, Licht und Temperatur exakt einstellen ließen. Im Laufe der Jahre wurden sie nur wenige Male daraus entnommen.
3.
Der Mann, der sich als Professor Neville Manchin ausgab, traf an einem herrlichen Herbsttag Anfang Oktober auf dem Campus der Princeton University ein. Er erkundigte sich nach dem Weg zur Abteilung Sammlungen und Rara, wo ihn Ed Folk begrüßte und an einen Kollegen übergab. Der prüfte seinen aus Oregon stammenden Führerschein und fertigte eine Kopie davon an. Natürlich war der Führerschein eine Fälschung, wenn auch eine sehr gelungene. Der Fälscher, der zugleich Computerhacker war, hatte bei der CIA gelernt und blickte auf eine lange Karriere in der obskuren Welt der Privatspionage zurück. Die laxen Sicherheitsmaßnahmen einer Universität zu überwinden war für ihn alles andere als eine Herausforderung.
»Professor Manchin« wurde fotografiert und bekam einen Besucherausweis ausgehändigt, verbunden mit der Aufforderung, diesen ständig sichtbar bei sich zu tragen. Er folgte dem Bibliotheksmitarbeiter in den ersten Stock und in einen großen Raum mit zwei langen Tischen und Schubladenschränken aus Stahl, die mit Schlössern gesichert waren. Der Betrüger registrierte mindestens vier Überwachungskameras in den oberen Raumecken, die nicht zu übersehen waren. Vermutlich gab es weitere, die versteckt angebracht waren. Er versuchte, den Bibliotheksassistenten in einen Small Talk zu verwickeln, blitzte aber ab. In scherzhaftem Ton erkundigte er sich, ob er das Originalmanuskript von Diesseits vom Paradies sehen dürfe. Der Mann erwiderte mit gönnerhaftem Lächeln, dass das nicht möglich sei.
»Haben Sie die Originale schon mal gesehen?«, erkundigte sich »Manchin«.
»Nur einmal.«
Eine weitere Erläuterung blieb aus, doch der Betrüger wollte es genauer wissen. »Bei welchem Anlass?«
»Ein renommierter Literaturwissenschaftler wollte sie sehen. Wir sind mit ihm in den Tresorraum gegangen und haben ihn einen Blick darauf werfen lassen. Angefasst hat er sie aber nicht. Nur unser Bibliotheksleiter darf das, und auch nur mit Spezialhandschuhen.«
»Selbstverständlich. Nun denn, machen wir uns an die Arbeit.«
Der Mitarbeiter öffnete zwei der großen Schubladen, die beide die Aufschrift »Diesseits vom Paradies« trugen, und entnahm ihnen große, dicke Notizbücher. »Das sind die Buchkritiken zur Erstausgabe. Wir haben aber auch eine Sammlung mit späteren Rezensionen.«
»Perfekt«, erwiderte der Mann, der sich Manchin nannte, lächelnd. Er öffnete seine Aktentasche, nahm einen Schreibblock heraus und schien es gar nicht abwarten zu können, in das Material auf dem Tisch einzutauchen. Eine halbe Stunde später – der Betrüger war in seine Arbeit vertieft – entschuldigte sich der Mitarbeiter und verschwand. Wegen der Kameras hielt »Manchin« die ganze Zeit über den Blick gesenkt. Irgendwann stand er auf, als wollte er zur Herrentoilette gehen, wählte dann aber einen anderen Weg und streifte durch die Abteilung, ohne mit jemand Kontakt aufzunehmen. Überall befanden sich Kameras. In diesem Moment sah höchstwahrscheinlich niemand zu, doch die Aufzeichnungen würden später mit Sicherheit für Ermittlungen herangezogen werden. Er sah einen Aufzug. Statt einzusteigen, nahm er die Treppe daneben. Das erste Untergeschoss ähnelte dem Parterre, aber im zweiten Untergeschoss, »B2« (Basement 2), endete die Treppe vor einer schweren Tür, auf der in großen Lettern »Nur im Notfall« stand. Neben der Tür befand sich ein Tastenfeld, und ein Schild warnte, dass sofort Alarm ausgelöst werde, sobald sich jemand ohne »volle Zugangsberechtigung« an der Tür zu schaffen mache. Zwei Kameras erfassten die Tür und den Bereich davor.
Der Betrüger machte kehrt und nahm denselben Weg zurück, den er gekommen war. Als er seinen Arbeitsplatz erreichte, wartete dort der Mitarbeiter auf ihn. »Alles in Ordnung, Professor Manchin?«
»Ja, ja. Ich habe mir wohl leider einen leichten Magen-Darm-Virus eingefangen. Hoffentlich nichts Ansteckendes.« Der Mann entfernte sich hastig, und »Manchin« verbrachte den Rest des Tages damit, in den Unterlagen aus den Stahlschubladen zu stöbern und alte Rezensionen zu lesen, die ihn nicht im Geringsten interessierten. Mehrmals stand er auf, um durch das Gebäude zu streifen, sich alles genau anzusehen, einzuprägen und im Geiste zu vermessen.
4.
Drei Wochen später war er wieder da, diesmal jedoch nicht als Professor Manchin. Glatt rasiert, die Haare rötlich blond gefärbt, trug er eine Fensterglasbrille mit rotem Gestell und hatte einen gefälschten Studentenausweis mit passendem Foto bei sich. Falls ihn jemand ansprach, womit er nicht rechnete, würde er behaupten, er sei Gaststudent aus Iowa. Im echten Leben hieß der Mann Mark. Von Beruf – falls man das so bezeichnen durfte – war er professioneller Dieb, spezialisiert auf sorgfältig geplante Überfälle zur Erbeutung teurer Kunstgegenstände und Raritäten, die den verzweifelten Opfern hinterher zurückverkauft werden konnten. Er gehörte zu einer Fünfergang, die von Denny angeführt wurde, einem ehemaligen Elitesoldaten, der die Verbrecherlaufbahn eingeschlagen hatte, nachdem er aus dem Militär geflogen war. Bislang war Denny nie erwischt worden und hatte keine Vorstrafen, ebenso wie Mark. Bei zwei ihrer Komplizen sah das anders aus: Trey war zweimal verurteilt worden und zweimal aus der Haft geflohen, zuletzt aus einem Bundesgefängnis in Ohio. Dort hatte er Jerry kennengelernt, einen Gelegenheitsdieb, der ebenfalls in Kunst machte und zurzeit auf Bewährung frei war. Von einem Langzeithäftling, der wegen Kunstraubs einsaß und mit dem er sich eine Zelle geteilt hatte, wusste er von den Fitzgerald-Schriften.
Die Voraussetzungen für den Coup waren perfekt. Es gab insgesamt nur fünf Originalmanuskripte, alle von Hand geschrieben, alle an einem Ort aufbewahrt. Und für Princeton waren sie Gold wert.
Das fünfte Gangmitglied bevorzugte es, von zu Hause aus zu arbeiten. Ahmed war Computergenie, Meisterfälscher und Schöpfer von Scheinwelten, allerdings fehlte ihm der Mut, eine Waffe zu tragen. Er arbeitete von seinem Keller in Buffalo aus und war noch nie ertappt oder verhaftet worden, weil er keine Spuren hinterließ. Fünf Prozent der Beute würden an ihn gehen, den Rest würden die anderen unter sich aufteilen.
An einem Dienstagabend um einundzwanzig Uhr befanden sich Denny, Mark und Jerry als Studenten getarnt in der Firestone Library, den Blick auf ihre Armbanduhren gerichtet. Ihre gefälschten Studentenausweise hatten sich bewährt und bei niemandem auch nur den leisesten Verdacht geweckt. Denny fand ein Versteck in einem Damen-WCim zweiten Stock, wo er über der Toilette ein Deckenpaneel hochdrückte. Er warf seinen Rucksack in das Loch, kletterte hinterher und machte es sich für ein paar Stunden in der stickigen Enge bequem. Unterdessen öffnete Mark mithilfe eines Dietrichs die Tür zum zentralen Versorgungsraum im Erdgeschoss und wartete, ob der Alarm ausgelöst würde, was nicht geschah, weil Ahmed sich erfolgreich in das Sicherheitssystem der Uni eingehackt hatte. Mark ging zum Notstromgenerator und zog die Benzineinspritzleitungen ab. Zur gleichen Zeit fand Jerry einen Platz in einer abgelegenen Lesekabine, verborgen hinter Regalreihen voller Bücher, denen seit Jahrzehnten niemand Beachtung geschenkt hatte.
Trey schlenderte in seinem Studentenoutfit auf dem Campus umher, den Rucksack über der Schulter, und sah sich nach Stellen um, wo er seine Bomben deponieren konnte.
Um Mitternacht schloss die Bibliothek. Die vier Gangmitglieder und Ahmed in seinem Keller standen in Funkkontakt. Um 0.15 Uhr gab Denny, der Anführer, durch, dass alles so ablaufen könne, wie sie es geplant hätten. Um 0.20 Uhr betrat Trey das McCarren Residential College, ein Tagungs- und Bildungszentrum mit Schlafunterkünften, das mitten auf dem Unigelände lag. Die Kameras waren immer noch dort, wo er sie letzte Woche gesehen hatte. Er nahm die nicht überwachte Treppe zum ersten Stock, schlüpfte in ein Unisex-WC und schloss sich in eine Kabine ein. Um 0.40 Uhr holte er einen Blechzylinder von der Größe einer Halbliter-Getränkedose aus seinem Rucksack. Er aktivierte einen Zeitschalter und versteckte den Zylinder hinter der Toilette. Dann verließ er das WC und begab sich in den zweiten Stock, wo er in einer Duschkabine eine weitere Bombe deponierte. Um 0.45 Uhr entdeckte er in dem im ersten Stock untergebrachten Schlaftrakt des Zentrums einen schwach beleuchteten Flur und warf ein Päckchen aus zehn Black-Cat-Böllern hinein. Während er die Treppe hinunterhastete, krachte und knallte es bereits hinter ihm. Sekunden später detonierten beide Rauchbomben und füllten die Flure mit widerlich stinkendem Nebel. Auf dem Weg nach draußen hörte Trey erste panische Schreie. Er trat hinter ein Gebüsch in der Nähe des Gebäudes, nahm sein Wegwerfhandy aus der Tasche und wählte den Notruf der Universität, um eine schockierende Mitteilung zu machen. »Im ersten Stock des McCarren-Zentrums ist ein Kerl mit einer Waffe und schießt um sich!«
Aus einem Fenster im zweiten Stock drang Rauch. Jerry, der immer noch in der dunklen Lesekabine der Bibliothek saß, machte einen ähnlichen Anruf mit seinem Prepaidhandy. Je stärker die Panik um sich griff, umso mehr nahmen die Anrufe zu.
An jeder amerikanischen Schule oder Universität gibt es klare Anweisungen für die Bedrohung durch »bewaffnete Eindringlinge«, nur schreckt jeder im ersten Moment davor zurück, sie umzusetzen. Die diensthabende Beamtin brauchte ein paar Sekunden, um sich aus ihrer Schreckstarre zu lösen und die richtigen Tasten zu drücken, doch dann heulten die Sirenen los. Sämtliche Studenten, Professoren und Verwaltungsangestellten der Universität erhielten automatisch eine SMS und eine E-Mail mit Anweisungen. Alle Türen seien zu schließen und zu verriegeln, alle Gebäude zu sichern.
Jerry wählte noch einmal die Notrufnummer und gab durch, dass zwei Studenten angeschossen worden seien. Aus dem McCarren-Zentrum quelle Rauch. Trey warf drei weitere Bomben in verschiedene Mülleimer. Studenten rannten zwischen den Gebäuden hin und her; niemand wusste, wo man sicher war und wo nicht. Sicherheitsleute vom Campus und Polizeibeamte der Stadt Princeton strömten herbei, gefolgt von einem halben Dutzend Feuerwehrfahrzeugen und Krankenwagen. Das erste von vielen weiteren Fahrzeugen der New Jersey State Police traf ein.
Trey legte seinen Rucksack an der Tür zu einem Verwaltungsgebäude ab und wählte dann den Polizeinotruf, um einen verdächtigen Fund zu melden. Die Zeitschaltuhr an der Rauchbombe im Rucksack sollte in zehn Minuten losgehen, während die Bombenexperten bereits vor Ort waren und aus der Ferne zusehen konnten.
Um 1.05 Uhr funkte Trey an die anderen: »Panik ausgebrochen. Alles voller Rauch. Überall Polizei. Ihr könnt loslegen.«
»Schalt die Beleuchtung ab«, ordnete Denny an.
Ahmed, der in Buffalo bei starkem Tee auf dieses Zeichen gewartet hatte, klickte sich durch das Sicherheitssystem der Uni, loggte sich in die digitale Stromsteuerung ein und deaktivierte das gesamte Netz, nicht nur der Firestone Library, sondern auch von etwa einem halben Dutzend umliegender Gebäude. Zur Sicherheit legte Mark, der inzwischen eine Nachtsichtbrille trug, auch den Hauptschalter im Versorgungsraum um. Mit angehaltenem Atem wartete er, ob der Generator ansprang, und atmete auf, als nichts geschah.
Der Stromausfall löste in der Überwachungszentrale einen Alarm aus, doch niemand achtete darauf. Ein bewaffneter Eindringling trieb sein Unwesen. Für Bagatellen blieb da keine Zeit.
Jerry hatte in der letzten Woche zwei Nächte in der Firestone Library verbracht und herausgefunden, dass sich keine Wachen im Gebäude befanden, solange es geschlossen war. Nachts machte ein uniformierter Sicherheitsbeamter ein- oder zweimal einen Rundgang um das Gebäude, um mit seiner Taschenlampe kurz die Türen anzuleuchten und dann seinen Weg fortzusetzen. Auch ein Polizeifahrzeug drehte seine Runden, doch diesen Beamten ging es mehr darum, betrunkene Studenten aufzugreifen. Normalerweise ähnelte das Gelände von Princeton dem jeder anderen Universität – zwischen ein Uhr nachts und acht Uhr morgens war tote Hose.
In dieser Nacht jedoch herrschte der Ausnahmezustand. Jemand hatte es auf die klügsten Köpfe des Landes abgesehen. Trey schilderte den anderen das Chaos, das auf dem Gelände ausgebrochen war – überall Cops, SWAT-Teams in voller Kampfmontur, Sirenengeheul, krächzende Funkgeräte, Millionen rote und blaue Blinklichter. Rauch hänge in den Bäumen wie Nebel, und über ihnen seien Hubschrauber zu hören. Ein Riesentohuwabohu.
Denny, Jerry und Mark huschten durch die Dunkelheit und nahmen die Treppe in das Untergeschoss unterhalb der Abteilung Sammlungen und Rara. Alle trugen Nachtsichtbrillen und Stirnlampen. Jeder schleppte einen schweren Rucksack und Jerry außerdem einen kleinen Armeeseesack, den er zwei Nächte zuvor in der Bibliothek versteckt hatte. Im zweiten Untergeschoss hielten sie vor einer schweren Stahltür, schwärzten die Sicherheitskameras und warteten auf die magischen Kräfte aus Buffalo. Ahmed arbeitete sich ruhig durch das Alarmsystem der Bibliothek, bis er die vier Sensoren der Tür deaktivieren konnte. Ein lautes Klicken ertönte. Denny drückte die Klinke und zog die Tür auf. Dahinter fanden sie einen kleinen quadratischen Raum mit zwei weiteren Stahltüren vor. Mark leuchtete mit der Taschenlampe die Decke ab und entdeckte eine Kamera. »Da oben«, sagte er. »Eine.« Jerry, mit seinen über ein Meter neunzig der größte von ihnen, nahm eine kleine Spraydose mit schwarzer Farbe und besprühte die Linse.
Denny blickte zwischen den zwei Türen hin und her. »Wollen wir eine Münze werfen?«
»Was seht ihr?«, fragte Ahmed über Funk.
»Zwei identisch aussehende Stahltüren«, erwiderte Denny.
»Ich hab hier nichts, Leute«, gab Ahmed zurück. »Im System wird nichts angezeigt. Ihr könnt anfangen zu schneiden.«
Jerry holte aus seinem Seesack zwei Fünf-Liter-Flaschen, eine mit Sauerstoff, eine mit Acetylen gefüllt. Denny stellte sich vor die linke der beiden Türen, entzündete einen Schneidbrenner mit einem Gasanzünder und fing an, fünfzehn Zentimeter oberhalb der Klinke eine Stelle zu erhitzen. Binnen Sekunden sprühten Funken.
Unterdessen hatte sich Trey vom McCarren-Gebäude und dem Chaos dort entfernt und gegenüber der Bibliothek im Dunkeln Schutz gesucht. Zum Geheul der Alarmsirenen kamen die Sirenen der Rettungsfahrzeuge. Hubschrauberrotoren flappten laut über dem Campus, doch sehen konnte Trey sie nicht. Um ihn herum war die Straßenbeleuchtung aus und keine Menschenseele war zu sehen. Alle hatten anderswo zu tun.
»Draußen vor der Bibliothek ist alles ruhig«, berichtete er. »Wie kommt ihr voran?«
»Wir schneiden jetzt«, entgegnete Mark knapp. Je weniger gesprochen wurde, umso besser. Das wussten alle fünf. Langsam und geschickt trennte Denny das Metall mit dem Schneidbrenner, dessen Düse eine bis zu tausend Grad heiße und mit Sauerstoff angereicherte Flamme ausstieß. Minutenlang troff geschmolzenes Metall zu Boden. Rote und gelbe Funken sprühten. Irgendwann sagte Denny: »Das Türblatt ist zweieinhalb Zentimeter dick.« Er beendete den horizontalen Schnitt und bewegte sich geradewegs nach unten. Es ging langsam voran, die Minuten zogen sich zäh hin, und allmählich stieg bei allen die Anspannung. Trotzdem behielten sie die Nerven. Jerry und Mark kauerten hinter Denny und ließen ihn nicht aus den Augen. Als die untere Seite durchtrennt war, rüttelte Denny an der herausgeschnittenen Platte. Sie löste sich ein Stück weit, blieb dann jedoch hängen. »Da ist ein Bolzen«, erklärte er. »Ich schneide ihn durch.«
Fünf Minuten später schwang die Tür auf. Ahmed, der unentwegt auf seinen Bildschirm starrte, gab erneut Entwarnung. »Keine weitere Sicherung zu sehen.« Denny, Mark und Jerry betraten den Raum, in den sonst niemand mehr gepasst hätte. Ein schmaler Tisch, sechzig Zentimeter breit und drei Meter lang, stand darin, außerdem rechts und links jeweils ein Holzschrank mit vier Schubladen. Mark, der Tresorknacker, klappte die Nachtsichtbrille hoch, richtete die Stirnlampe aus und untersuchte den Schließmechanismus. Dann schüttelte er den Kopf. »Wie zu erwarten. Kombischlösser, wahrscheinlich mit computergenerierten Codes, die täglich wechseln. Die lassen sich nicht knacken. Wir müssen aufbohren.«
»Na, dann los«, sagte Denny. »Während du bohrst, schneide ich die andere Tür auf.«
Jerry förderte eine Akkubohrmaschine mit ¾-Zoll-Bohrer und zwei Extrahaltegriffen zutage. Er setzte die Spitze auf das Schloss, und Mark drückte mit aller Kraft dagegen. Der Bohrer glitt heulend von der Messingoberfläche ab, die zunächst unzerstörbar schien. Doch dann sprang ein Span nach dem anderen ab, bis sich der Bohrer unter dem Druck der Männer schließlich in das Metall fraß. Aber selbst als das Schloss nachgab, ließ sich die Lade nicht aufziehen. Mark stieß ein schmales Brecheisen in den Spalt oberhalb des Schließzylinders und zerrte mit aller Gewalt daran. Irgendwann splitterte der Holzrahmen, die Schublade öffnete sich und offenbarte eine Archivbox mit schwarzen Metallkanten, vierzig mal fünfzig Zentimeter groß, 7,5 Zentimeter hoch.
»Vorsichtig«, mahnte Jerry, als Mark die Box öffnete und behutsam ein dünnes gebundenes Buch herausnahm. »Die gesammelten Gedichte von Dolph McKenzie«, las Mark langsam vor. »Die wollte ich schon immer haben.«
»Wer ist das?«
»Keine Ahnung. Für Gedichte sind wir sowieso nicht gekommen.«
Denny blickte hinter ihnen durch die Tür. »Okay, macht weiter. Es sind noch sieben Schubladen in diesem Raum. Ich bin nebenan fast fertig.«
Sie begaben sich wieder an die Arbeit. Trey saß währenddessen auf einer Bank gegenüber dem Gebäude, rauchte zur Entspannung eine Zigarette und blickte immer wieder auf die Armbanduhr. Das Durcheinander auf dem Campus war nach wie vor in vollem Gange, doch es würde nicht ewig andauern.
Die zweite und dritte Schublade im ersten Raum offenbarten weitere Raritäten, von deren Schöpfern die Männer noch nie gehört hatten. Nachdem Denny den Weg in den zweiten Raum freigeschnitten hatte, wies er Jerry und Mark an, die Bohrmaschine zu bringen. Auch im zweiten Raum standen zwei Schränke mit je vier Schubladen, die genauso aussahen wie die im ersten Raum. Um 2.15 Uhr meldete sich Trey mit der Nachricht, dass der Campus noch immer abgeriegelt sei und sich neugierige Studenten auf dem Rasen versammelten, um das Spektakel zu verfolgen. Polizisten hätten sie über Megafon aufgefordert, zurück auf ihre Zimmer zu gehen, doch die Menge sei groß und lasse sich nicht wegschicken. Zwei weitere Hubschrauber seien hinzugekommen, die in der Luft standen und die Lage verkomplizierten. Er verfolge CNN auf seinem Smartphone, Princeton sei im Moment die Topmeldung. Ein aufgeregter Reporter berichte vom »Tatort«, erzähle von »unbestätigten Verletzten« und vermittle erfolgreich den Eindruck, dass »mindestens ein bewaffneter Täter« zahlreiche Studenten angegriffen habe.
»Mindestens ein bewaffneter Täter?«, murmelte Trey. Brauchte man für eine Schießerei nicht immer mindestens einen bewaffneten Täter?
Denny, Mark und Jerry besprachen, ob sie die Schubladen mithilfe der Lötlampe öffnen sollten, entschieden sich jedoch dagegen, jedenfalls vorläufig. Die Brandgefahr war zu hoch, verkohlte Manuskripte würden ihnen nichts nützen. Stattdessen zog Denny einen kleineren ¼-Zoll-Bohrer heraus und fing an zu bohren. Mark und Jerry arbeiteten mit dem größeren. Die erste Schublade im zweiten Raum enthielt einen Stapel dünnes Papier, beschrieben von einem weiteren längst vergessenen Dichter, den sie nicht kannten und trotzdem hassten.
Um 2.30 Uhr bestätigte CNN, dass zwei Studenten tot und mindestens zwei weitere verletzt seien. Das Wort »Gemetzel« tauchte erstmals in der Berichterstattung auf.
5.
Als die erste Etage des McCarren-Gebäudes gesichert war, entdeckte die Polizei die Überreste von Feuerwerkskrachern. In WC und Dusche fanden sich die leeren Patronen der Rauchbomben. Treys abgelegter Rucksack wurde von Bombenentschärfern geöffnet, die die Überreste der Bombe sicherstellten. Um 3.10 Uhr benutzte der Einsatzleiter zum ersten Mal den Ausdruck »böser Scherz«, doch die Aufregung war immer noch so groß, dass niemand auf die Idee kam, es könnte sich um ein Ablenkungsmanöver gehandelt haben.
6.
Um 3.30 Uhr gab Trey durch: »Hier draußen scheint sich die Lage allmählich zu beruhigen. Wie läuft es bei euch? Wir sind schon seit drei Stunden hier.«
»Mühsam«, kam die knappe Antwort von Denny.
Die Arbeit im Tresorraum ging in der Tat nur langsam voran, doch sie ließen nicht nach. Die ersten vier Schubladen enthielten alte Manuskripte, teils handschriftlich, teils getippt, alle von bedeutenden Schriftstellern, die ihnen im Moment jedoch völlig egal waren. Die fünfte Schublade brachte endlich den Hauptgewinn. Denny nahm eine Box heraus und öffnete sie vorsichtig. Auf einem von der Bibliothek eingefügten Deckblatt stand: »Die Schönen und Verdammten – handschriftliches Originalmanuskript – F. Scott Fitzgerald«.
»Volltreffer«, sagte Denny ruhig. Er entnahm der Schublade eine zweite, identisch aussehende Box und stellte sie behutsam auf den schmalen Tisch, um sie zu öffnen. Darin lagen die Originalmanuskripte von Zärtlich ist die Nacht und Der letzte Taikun.
Ahmed, der immer noch an seinem Laptop klebte und inzwischen zu einem stark koffeinhaltigen Energydrink übergegangen war, freute sich über das, was aus dem Funkgerät drang: »Jungs, wir haben drei von fünf. Der Gatsby muss noch irgendwo sein, das Paradiesauch.«
»Wie lange noch?«, wollte Trey wissen.
»Zwanzig Minuten«, antwortete Denny. »Hol den Transporter.«
Trey überquerte in aller Ruhe den Campus, mischte sich unter die Schaulustigen und sah einen Moment lang zu, wie die Polizisten durcheinanderliefen. Immerhin suchten sie nicht mehr Deckung oder warfen sich im Laufschritt mit vorgehaltener Waffe hinter Autos. Die akute Gefahr schien gebannt zu sein, doch noch immer blinkte überall Blaulicht. Trey setzte seinen Weg fort, bis er achthundert Meter weiter die Grenze des Campus erreichte. In der John Street stieg er in einen weißen Transporter mit der Aufschrift »Princeton University Printing« auf beiden Fronttüren. Daneben stand die Zahl 12. Er hatte keine Ahnung, was das bedeutete, aber das Fahrzeug sah genauso aus wie der Wagen, den er in der Woche zuvor hier fotografiert hatte. Er fuhr auf den Campus, machte einen Bogen um den Menschenauflauf am McCarren-Gebäude und parkte hinter der Bibliothek an einer Laderampe. »Transporter steht bereit«, gab er durch.
»Wir öffnen gerade die sechste Schublade«, informierte ihn Denny.
Während Jerry und Mark die Brillen hochklappten und sich mit ihren Stirnlampen über den Tisch beugten, öffnete Denny die Archivbox. Auf dem Deckblatt stand: »Der große Gatsby – handschriftliches Originalmanuskript – F. Scott Fitzgerald«.
»Na also«, sagte er ruhig. »Da ist er ja, Gatsby, der alte Schweinehund.«
»Yippie«, murmelte Mark, der sich wie die anderen mit Begeisterungsäußerungen zurückhielt. Jerry hob die zweite der beiden Boxen aus der Schublade. Darin befand sich das Manuskript von Diesseits vom Paradies, Fitzgeralds erstem Roman, erschienen im Jahr 1920.
»Wir haben alle fünf«, sagte Denny. »Jetzt nichts wie raus.«
Jerry packte Bohrmaschinen, Schneidbrenner, Sauerstoff- und Acetylenflaschen sowie Brechstangen wieder ein. Als er sich bückte, um den Seesack hochzuheben, blieb er mit dem Handgelenk am gesplitterten Holz der dritten Schublade hängen. In der Aufregung fiel ihm das kaum auf, und er rieb sich nur kurz über die Wunde, ehe er nach dem Sack griff. Denny und Mark verstauten die fünf kostbaren Handschriften vorsichtig in den drei Rucksäcken. Dann huschten die Diebe eilends aus dem Tresorraum, mitsamt Werkzeugen und Beute, und hasteten die Treppen zum Erdgeschoss hoch. Sie verließen die Bibliothek über einen Lieferanteneingang, wo sie durch eine dichte Hecke vor Blicken abgeschirmt waren, sprangen in den Laderaum des Transporters, und Trey fuhr los. Als ihnen ein Wagen mit zwei Sicherheitsleuten der Uni entgegenkam, hob er lässig die Hand zum Gruß. Sie reagierten nicht einmal.
Trey blickte auf seine Uhr, die 3.42 Uhr anzeigte, und funkte an alle durch: »Melde Vollzug. Wir verlassen jetzt den Campus mit Mr. Gatsby und seinen Freunden.«
7.
Der Stromausfall löste überall in den betroffenen Gebäuden Alarm aus. Ein Elektrotechniker klickte sich durch die Computersteuerung des Uni-Stromnetzes, bis er das Problem verortete. Um vier Uhr konnte der Strom in allen Gebäuden wieder angestellt werden, nur in die Bibliothek musste der Sicherheitschef gesondert drei seiner Leute schicken. Innerhalb von zehn Minuten war auch dort die Ursache für den Alarm entdeckt und behoben.
Zur selben Zeit hielt die Gang bereits vor einem billigen Motel an der Interstate 295 nahe Philadelphia. Trey parkte neben einem Sattelzug, weit weg von der einsamen Kamera, die den Parkplatz überwachte. Mark nahm eine Dose mit weißer Farbe und übersprühte die Aufschrift »Princeton University Printing« auf den Fahrzeugtüren. In demselben Zimmer, in dem sie schon tags zuvor übernachtet hatten, schlüpften sie in Jagdmonturen und stopften alles, was sie während des Einbruchs getragen hatten – Jeans, Turnschuhe, Sweatshirts, schwarze Handschuhe – in einen Seesack. Im Bad musterte Jerry die kleine Schnittwunde an seinem linken Handgelenk. Auf der Fahrt hatte er den Daumen darauf gepresst, doch jetzt musste er feststellen, dass sie stärker blutete, als er gedacht hatte. Er wischte mit einem Handtuch darüber und überlegte, ob er den anderen davon erzählen sollte. Nicht jetzt. Vielleicht später.
Schweigend packten sie zusammen, löschten das Licht und verließen das Zimmer. Mark und Jerry stiegen in einen gemieteten Pick-up – ein größeres Modell mit Rücksitzbank –, Denny setzte sich ans Steuer, und sie folgten Mark und dem Transporter zurück zur Interstate. Sie ließen Philadelphia und seine Vorstädte im Süden hinter sich und drangen über einsame Highways in das ländliche Pennsylvania vor. In einer unbesiedelten Gegend nahe Quakertown erreichten sie ihr Ziel, eine Nebenstraße, der sie anderthalb Kilometer folgten, bis sie in einen unbefestigten Weg überging. Trey parkte den Transporter in einem Graben, nahm die gestohlenen Nummernschilder ab, schüttete einen Kanister Benzin über die Rucksäcke mit Werkzeug, Handys, Funkgeräten und Kleidung und entzündete ein Streichholz, das er darauf fallen ließ. Die Flammen züngelten sofort hoch, und als die Männer mit dem Pick-up wegfuhren, waren sie überzeugt, sämtliche Beweise vernichtet zu haben. Zwischen Trey und Mark auf der Rückbank lagen sicher verpackt die Manuskripte.
Während die Dämmerung langsam über die Hügel heraufkroch, fuhren sie schweigend dahin, die Blicke aufmerksam auf die Umgebung gerichtet, wo es jedoch wenig zu sehen gab, außer hin und wieder einem Fahrzeug, das ihnen entgegenkam, einem Farmer, der zu seinem Stall stapfte, ohne auf den Highway zu achten, oder einer alten Frau, die sich auf ihrer Veranda nach einer Katze bückte. In der Nähe von Bethlehem fuhren sie auf die Interstate 78 Richtung Westen. Denny hielt sich streng an das Tempolimit. Seit sie Princeton verlassen hatten, war ihnen keine Polizei begegnet. Sie hielten an einem Drive-in-Imbiss auf einen Kaffee und Sandwichs mit Hühnchen, dann fuhren sie auf der Interstate 81 nach Norden Richtung Scranton.
8.
Kurz nach sieben Uhr trafen die ersten beiden FBI-Beamten in der Firestone Library ein und wurden vom Sicherheitspersonal der Uni und der Polizei der Stadt Princeton über den Stand der Dinge informiert. Sie sahen sich den Ort des Geschehens an und rieten dringend, die Bibliothek bis auf Weiteres geschlossen zu lassen. Ermittler und Spurensicherer vom FBI-Büro im benachbarten Trenton seien schon unterwegs.
Der Präsident der Universität war gerade nach einer sehr langen Nacht in seine auf dem Campus gelegene Wohnung zurückgekehrt, als er die Nachricht erhielt, dass etwas Wertvolles entwendet worden sei. Er eilte in die Bibliothek, wo er den Bibliotheksleiter, das FBI und Beamte der örtlichen Polizei vorfand. Gemeinsam entschieden sie, diesen Teil der Geschichte so lange wie möglich geheim zu halten. Der Leiter der FBI-Abteilung in Washington, die für Kunstraub zuständig war, würde in Kürze eintreffen. Seiner Ansicht nach würden sich die Diebe bald bei der Uni melden, um einen Deal vorzuschlagen. Öffentliche Aufmerksamkeit würde es auch so schon genug geben. Es war besser, die Dinge nicht zu verkomplizieren.
9.
Die Feier wurde aufgeschoben, bis die vier vermeintlichen Jäger ihren Unterschlupf tief in den Pocono Mountains erreicht hatten. Denny hatte sich Geld geliehen und das Holzhaus für die Dauer der Jagdsaison gemietet. Den Betrag würde er zurückzahlen, sobald sie ihre Beute in Barmittel umgesetzt und zwei bis drei Monate dort ausgeharrt hätten. Von den vieren war Jerry der Einzige, der eine ständige Adresse hatte, eine kleine Mietwohnung in Rochester im Staat New York, wo er mit seiner Freundin lebte. Trey, der entlaufene Häftling, befand sich im Grunde auf der Flucht, seit er volljährig war. Mark wohnte zeitweise bei einer Exfrau in der Nähe von Baltimore, doch Nachweise gab es dafür nicht.
Alle vier besaßen mehrere falsche Identitäten, einschließlich Reisepässen, die jeder Zollkontrolle standhielten.
Im Kühlschrank standen drei Flaschen billiger Champagner. Denny öffnete eine davon, verteilte den Inhalt auf vier unterschiedliche Kaffeebecher und rief aus voller Brust: »Prost, Jungs, und Glückwunsch! Wir haben’s geschafft!« Eine halbe Stunde später waren die drei Flaschen leer, und die erschöpften Männer fielen in einen langen, tiefen Schlaf. Die Manuskripte, die immer noch in ihren einheitlichen Archivboxen lagen, waren in einem Waffenschrank hinter Goldbarren sicher verstaut, wo sie für die nächsten Tage von Denny und Trey bewacht werden würden. Jerry und Mark würden morgen ausgepowert nach Hause aufbrechen. Eine einwöchige Jagd war anstrengend.
10.
Während Jerry schlief, setzte sich die Maschinerie der Bundesbehörden mit voller Wucht gegen ihn in Gang. Eine Mitarbeiterin der FBI-Spurensicherung entdeckte auf der ersten Stufe zum Untergeschoss der Firestone Library einen winzigen Fleck, den sie zu Recht für Blut hielt, so frisch, dass es noch nicht nachgedunkelt war. Sie sicherte die Spur und informierte ihren Vorgesetzten, der den Fund auf schnellstem Weg in ein FBI-Labor in Philadelphia schickte. Das Ergebnis eines unverzüglich durchgeführten DNA-Tests wurde mit der landesweiten Verbrecherdatenbank verglichen, und binnen einer Stunde lag aus Massachusetts ein Treffer vor: Es handelte sich bei dem Gesuchten um einen gewissen Gerald A. Steengarden, vor sieben Jahren verurteilt wegen Gemäldediebstahls bei einem Kunsthändler in Boston. Sofort nahm ein Team von Analytikern Steengardens Spur auf. Es gab landesweit fünf Personen dieses Namens, vier davon wurden rasch von der Liste gestrichen. Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnung, Handydaten und Kreditkartenbewegungen wurden eingeholt. Als Jerry aus seinem langen Schlaf in den Pocono Mountains erwachte, hatte das FBI längst seine Wohnung in Rochester ins Visier genommen. Die Beamten beschlossen, trotz vorhandenen Durchsuchungsbeschlusses vorläufig nicht hineinzugehen, sondern abzuwarten.
Es bestand immerhin die Chance, dass Mr. Steengarden sie zu seinen Komplizen führte.
In Princeton wurde eine Liste der Studenten angefertigt, die die Bibliothek in der letzten Woche genutzt hatten. Das ging schnell, denn jeder Besuch wurde auf dem Ausweis gespeichert. Die Ausweise der Eindringlinge fielen dabei sofort auf, weil Studenten sie normalerweise nur fälschten, um Alkohol zu kaufen, nicht um unerkannt Bücher auszuleihen. Es wurde der exakte Zeitpunkt ihres Einsatzes festgestellt und mit den Aufzeichnungen der Überwachungskameras verglichen. Gegen Mittag lagen dem FBI Standfotos von Denny, Jerry und Mark vor, mit denen jedoch vorläufig nichts anzufangen war, da sich die Männer gut maskiert hatten.
In der Abteilung für Sammlungen und Rara hatte Ed Folk zum ersten Mal seit Jahrzehnten alle Hände voll zu tun. Im Beisein von FBI-Beamten ging er emsig Anmeldelisten und Fotos der letzten Besucher durch. Jeder Einzelne erhielt zur Überprüfung einen Telefonanruf, auch Juniorprofessor Neville Manchin von der Portland State University, der dem FBI glaubhaft versichern konnte, dass er noch nie in Princeton gewesen sei. Von Mark besaß dasFBI nun zwei Fotos. Nur sein Name war noch nicht bekannt.
Knapp zwölf Stunden nach dem erfolgreichen Coup waren vierzig FBI-Beamte mit vollem Einsatz dabei, Videoaufzeichnungen auszuwerten und Daten zu analysieren.
11.
Am späten Nachmittag versammelten sich die vier Männer in ihrer Jagdhütte in den Pocono Mountains um einen Kartentisch und machten jeweils ein Bier auf. Obwohl alles längst erschöpfend besprochen war, fing Denny noch mal von vorn an. Der Job sei erfolgreich erledigt, doch bei jedem Verbrechen blieben Spuren zurück. Jeder mache Fehler, und kein Genie der Welt könne sich ausmalen, was alles schiefgelaufen sein möge. Die gefälschten Ausweise würden identifiziert und untersucht werden. Damit wüssten die Cops, dass sie die Bibliothek schon Tage vor dem Raub ausgekundschaftet hatten. Außerdem könne man nicht wissen, was die Aufzeichnungen der Überwachungskameras verrieten. Unter Umständen hätten sie Fasern ihrer Kleidung oder Fußabdrücke hinterlassen. Zwar gingen sie davon aus, keine Fingerabdrücke hinterlassen zu haben, aber ein Restrisiko bleibe immer. Sie seien alle erfahren genug, um sich keine Illusionen zu machen.
Das schmale Pflaster auf Jerrys linkem Handgelenk war den anderen nicht aufgefallen, woraufhin er beschlossen hatte, den kleinen Unfall zu ignorieren. Er redete sich ein, dass er unmöglich Folgen haben könne.
Mark holte vier Geräte hervor, die aussahen wie das iPhone 5 von Apple, einschließlich Firmenlogo. In Wahrheit waren es keine Smartphones, sondern sogenannte Sat-Traks, GPS-Ortungsgeräte, die über Satellit weltweit Empfang hatten und somit ohne Mobilfunknetz auskamen, sodass die Polizei sie nicht aufspüren oder abhören konnte. Mark erinnerte die Männer zum x-ten Mal eindringlich daran, dass sie alle, einschließlich Ahmed, in den nächsten Wochen unbedingt Kontakt halten müssten.
Die Sat-Traks hatte Ahmed über eine seiner zahlreichen Quellen besorgt. Sie hatten keinen Powerschalter, stattdessen musste man zur Aktivierung eine dreistellige PINeingeben. Sobald das Gerät eingeschaltet war, brauchte man ein fünfstelliges Passwort, um Zugriff zu erhalten. Ab sofort würden sie sich zweimal am Tag, morgens und abends um acht Uhr, einloggen und ein kurzes »OK« durchgeben. Verzögerungen wurden nicht geduldet, weil man dann davon ausgehen musste, dass das Sat-Trak beziehungsweise sein Benutzer in Gefahr war und Unheil drohte. Nach fünfzehn Minuten Verspätung würde Plan B in Kraft treten, der vorsah, dass Denny und Trey die Manuskripte an einen zweiten sicheren Ort bringen sollten. Meldeten die beiden sich nicht rechtzeitig, würde die gesamte Operation – zumindest deren letzte Phase – abgebrochen werden. Jerry, Mark und Ahmed müssten das Land sofort verlassen.
Die schlichte Mitteilung »Rot« stand für die höchste Alarmstufe und bedeutete, dass 1) etwas schiefgegangen war, 2) die Manuskripte sofort zum dritten sicheren Ort gebracht werden mussten und 3) man so schnell wie möglich das Land verlassen sollte, ohne Fragen zu stellen oder Zeit zu verlieren.
Für den Fall, dass einer von ihnen der Polizei in die Hände fiel, wurde absolutes Stillschweigen erwartet. Alle hatten sich die Namen von Verwandten der anderen und deren Adressen eingeprägt, um Verrat an der Sache und den Komplizen vorzubeugen. Wer redete, musste mit Vergeltung rechnen.
Trotz Dennys düsterer Ausführungen war die Stimmung gut, ja geradezu ausgelassen. Sie hatten einen brillanten Coup gelandet und eine perfekte Flucht hingelegt.
Trey, der Mehrfachausbrecher, schwelgte in Erinnerungen. Bei ihm sei es immer gut gelaufen, weil er nach seinen Ausbrüchen einen Plan gehabt habe, während die meisten anderen nur an die Flucht dächten und nicht darüber hinaus. Genauso sei es bei Verbrechen. Man verbringe Tage und Wochen mit der Planung, doch sobald es vorbei sei, wisse man nicht, was man tun solle. Sie bräuchten einen Plan.
Doch sie konnten sich nicht einigen. Denny und Mark waren dafür, rasch zu handeln und Princeton innerhalb einer Woche eine Forderung zukommen zu lassen. Dann wären sie die Manuskripte rasch los, müssten sich nicht überlegen, wie sie sie schützen und transportieren sollten, und kämen sofort an ihr Geld.
Jerry und Trey, die Routiniers, sprachen sich dafür aus, Geduld zu bewahren. Man solle abwarten, bis sich der Wirbel gelegt habe und die Neuigkeit auf den Schwarzmarkt gelangt sei. Es sei besser, etwas Zeit verstreichen lassen, bis sie sicher sein könnten, dass sie nicht unter Verdacht stünden. Princeton sei nicht der einzige mögliche Abnehmer, es gebe mit Sicherheit noch andere Interessenten.
Die Diskussion war lang und hitzig, aber begleitet von Scherzen, Gelächter und großen Mengen Bier. Schließlich einigten sie sich auf einen vorläufigen Plan. Jerry und Mark sollten am nächsten Tag nach Hause aufbrechen, Jerry nach Rochester, Mark über Rochester nach Baltimore. Sie würden sich unauffällig verhalten, die Nachrichten verfolgen und sich natürlich zweimal am Tag beim Team melden. Denny und Trey würden sich um die Manuskripte kümmern und sie in einer Woche zum zweiten sicheren Ort bringen, einer billigen Wohnung in einem heruntergekommenen Viertel von Allentown, Pennsylvania. In zehn Tagen würden sie sich dann mit Jerry und Mark dort treffen, um einen endgültigen Plan zu fassen. In der Zwischenzeit würde Mark Kontakt zu einem alten Bekannten im Kunstraubmilieu aufnehmen, der ihnen als Mittelsmann dienen konnte. Er würde ihm zunächst nur im Jargon der Insider mitteilen, dass er »etwas über die Fitzgerald-Manuskripte wisse«. Details würden sie bei einem persönlichen Treffen besprechen.
12.
Um 16.30 Uhr verließ Jerrys Freundin Carole die gemeinsame Wohnung und fuhr zu einem nahe gelegenen Supermarkt. Die Beschatter entschieden, vorläufig nicht in die Wohnung zu gehen, weil zu viele Nachbarn in der Nähe waren. Eine einzige beiläufige Bemerkung würde genügen, um die Observierung auffliegen zu lassen. Carole ahnte nicht, dass sie aus nächster Nähe beobachtet wurde. Während sie einkaufte, befestigten die Beamten, die ihr gefolgt waren, zwei Peilsender unter ihrer Stoßstange. Zwei weitere Beamte – Frauen in Jogginganzügen – sahen sich an, was sie einkaufte (nichts von Interesse). Eine SMS an ihre Mutter wurde gelesen und gespeichert. Einen Anruf bei einer Freundin hörten die Beamten Wort für Wort mit. Beim Besuch einer Bar lud ein Beamter in Jeans sie auf einen Drink ein. Als sie kurz nach einundzwanzig Uhr nach Hause kam, war jeder ihrer Schritte an diesem Tag beobachtet, gefilmt und dokumentiert worden.
13.
Unterdessen lag ihr Freund in einer Hängematte auf der Veranda einer Jagdhütte in den Pocono Mountains, ganz in der Nähe eines idyllischen Sees, trank Bier und las Der große Gatsby. Mark und Trey waren mit dem Boot hinausgefahren, um Brassen zu angeln, während sich Denny um die Steaks auf dem Grill kümmerte. Als die Sonne unterging, kam ein kühler Wind auf, und die vier Männer zogen sich ins Wohnzimmer zurück, wo ein Kaminfeuer prasselte. Um exakt zwanzig Uhr zogen sie ihre nagelneuen Sat-Traks heraus, loggten sich ein und tippten das Wort »OK«, genauso wie Ahmed in Buffalo, und alles war gut.
Tatsächlich lief alles reibungslos. Knapp vierundzwanzig Stunden zuvor waren sie noch auf dem nächtlichen Campus von Princeton herumgeschlichen, die Nerven zum Zerreißen gespannt und gleichzeitig fiebrig vor Aufregung. Ihr Plan war perfekt aufgegangen, die kostbaren Manuskripte waren in ihrem Besitz, und bald hätten sie das Geld. Die Übergabe würde nicht einfach werden, doch damit würden sie sich später befassen.
14.
Der Alkohol half nur kurz, alle vier schliefen schlecht. Früh am nächsten Morgen stand Denny bereits in der Küche, um Eier mit Speck zu braten und starken Kaffee aufzubrühen, während Mark mit einem Laptop an der Küchentheke saß und die Schlagzeilen der Ostküste überflog. »Nichts«, sagte er. »Alles Mögliche über das Geballere auf dem Unigelände, das jetzt offiziell als ›böser Scherz‹ bezeichnet wird, aber kein Wort über die Manuskripte.«
»Bestimmt wollen sie das unter der Decke halten«, mutmaßte Denny.
»Ja, nur für wie lang?«
»Die Presse wird bald darauf stoßen. Spätestens morgen sickert irgendwo etwas durch.«
»Bleibt nur die Frage, ob das für uns gut oder schlecht ist.«
»Ich würde sagen, weder noch.«
Trey trat mit frisch rasiertem Schädel in die Küche. Stolz rieb er sich über die Vollglatze. »Was sagt ihr?«
»Umwerfend«, scherzte Mark.
»Hoffnungslos«, warf Denny ein.
Keiner der vier sah noch so aus wie vierundzwanzig Stunden zuvor. Trey und Mark hatten sich alles abrasiert – Bart, Haare, Augenbrauen. Denny und Jerry hatten ihre Bärte ebenfalls abgenommen und sich die Haare gefärbt. Denny war von dunkelblond zu dunkelbraun übergegangen, Jerry hatte sich für ein weiches Kupferrot entschieden. Alle vier würden von jetzt an Schirmkappen und Brillen tragen, die sie täglich wechselten. Sie wussten, dass es Videoaufzeichnungen von ihnen gab und dass die Gesichtserkennungstechnologie des FBI sehr gut war. Sie wussten, dass sie Fehler gemacht hatten, doch es war zu verlockend, den Gedanken daran einfach auszublenden. Es war Zeit für den nächsten Schritt.
Zudem hatte sie ein gewisser Übermut erfasst, der ganz normal war nach einem perfekten Coup. Zusammengekommen waren sie erstmals vor einem Jahr, als Trey und Jerry, die beiden Profis, Denny kennenlernten. Denny kannte Mark, der wiederum Ahmed kannte. Stundenlang hatten sie zusammengesessen und den Plan ausgetüftelt, sich darüber gestritten, wer welche Aufgabe übernehmen würde, wann der beste Zeitpunkt wäre und wohin sie danach fahren würden. Es gab tausend Dinge zu beachten, und jedes winzige Detail war wichtig. Seit der Job erledigt war, war all dies Geschichte. Jetzt ging es nur noch darum, an das Geld zu kommen.
Am Donnerstagmorgen um acht Uhr sahen sie sich gegenseitig beim Sat-Trak-Ritual zu. Bei Ahmed war alles in Ordnung. Jerry und Mark verabschiedeten sich und brachen Richtung Rochester auf, dessen Außenbezirke sie vier Stunden später erreichten. Sie hatten keine Ahnung, dass ein Riesenaufgebot an FBI-Beamten geduldig nach dem Toyota Pick-up, Baujahr 2010, Ausschau hielt, den sie drei Monate zuvor gemietet hatten. Als Jerry vor seiner Wohnung parkte, zoomten verborgene Kameras heran, während er mit Mark in aller Ruhe den Parkplatz überquerte und die Treppe zum zweiten Stock nahm.
Die digitalen Fotos wurden sofort online an das FBI-Labor in Trenton übermittelt. Als Jerry Carole zur Begrüßung küsste, waren die Aufnahmen längst mit den Standbildern der Überwachungskameras aus der Princeton-Bibliothek verglichen. Mithilfe der Bilderkennungstechnik identifizierte das FBIJerry alias Mr. Gerald A. Steengarden und bestätigte, dass Mark derjenige war, der sich für Professor Neville Manchin ausgegeben hatte. Da Mark keine Vorstrafen hatte, war er in der nationalen Verbrecherdatenbank nicht verzeichnet und konnte nicht identifiziert werden.
Doch das war nur eine Frage der Zeit.
Man beschloss, zunächst abzuwarten und zu beobachten. Jerry hatte ihnen Mark geliefert, vielleicht würde er sie zu weiteren Komplizen führen. Nach dem Mittagessen traten die beiden Männer aus dem Haus und gingen zum Toyota zurück. Mark trug eine billige braune Nylon-Sporttasche, Jerry hatte kein Gepäck dabei. Auf dem Weg in die Innenstadt hielt sich Jerry streng an die Geschwindigkeitsbegrenzung, beachtete peinlich genau alle Verkehrsregeln und machte einen großen Bogen um Polizisten.
15.
Unterwegs achteten sie auf jedes Detail, egal, ob es ein Fahrzeug oder ein alter Mann auf einer Parkbank war, der sich hinter einer Zeitung verbarg. Sie waren sicher, dass ihnen niemand folgte, doch in ihrem Gewerbe musste man stets wachsam bleiben. Dass der Hubschrauber, der in tausend Meter Höhe vermeintlich harmlos über ihnen schwebte, ihretwegen da war, ahnten sie nicht.
Am Amtrak-Bahnhof stieg Mark ohne ein weiteres Wort aus dem Wagen und eilte über den Gehsteig zum Haupteingang. Drinnen kaufte er ein Sparpreisticket für den Zug um 14.13 Uhr nach Manhattan, Pennsylvania Station. Beim Warten las er in einer alten Taschenbuchausgabe von Der letzte Taikun. Lesen war seine Sache nicht, aber diesen Fitzgerald fand er spannend. Beim Gedanken an die handschriftlichen Manuskripte musste er ein Lächeln unterdrücken.
Jerry hielt an einem Schnapsladen und kaufte eine Flasche Wodka. Als er den Laden verließ, versperrten ihm drei ziemlich große junge Männer in dunklen Anzügen den Weg, sagten »Hallo«, hielten ihm kurz ihre Dienstmarken hin und erklärten, sie würden sich gern mit ihm unterhalten. Als Jerry dankend ablehnte und sagte, er habe zu tun, wurden sie aktiv. Einer zückte Handschellen, ein anderer nahm ihm den Wodka ab, und der Dritte durchsuchte seine Taschen und holte Brieftasche, Schlüssel und Sat-Trak heraus. Jerry wurde zu einem großen schwarzen Chevrolet Suburban geführt und zum Stadtgefängnis gefahren, das nur vier Häuserblocks entfernt lag. Während der kurzen Fahrt sprach niemand ein Wort. Er stellte keine Fragen, sie nannten keine Erklärung. Als ein ehrenamtlicher Gefängnishelfer zu seiner Zelle kam, um ihn zu begrüßen, fragte Jerry: »Sagen Sie, haben Sie eine Ahnung, was das soll?«
Der Mann blickte links und rechts den Flur entlang und beugte sich näher an die Gitterstäbe. »Keine Ahnung, Kumpel, aber Sie müssen den hohen Tieren ganz schön auf den Schlips getreten sein.« Jerry legte sich auf seine Pritsche, starrte an die verschmierte Decke und fing an zu grübeln. Was war schiefgelaufen?
Während er in seiner dunklen Zelle lag und in seinem Kopf die Gedanken kreisten, klingelte es bei Carole an der Wohnungstür. Sie öffnete und stand einem halben Dutzend FBI-Beamten gegenüber. Einer hielt ihr einen Durchsuchungsbeschluss hin, ein anderer forderte sie auf, in ihrem Auto zu warten, ohne den Motor zu starten.
Um vierzehn Uhr stieg Mark in den Zug und suchte sich einen Platz. Die Türen schlossen sich um 14.13, doch der Zug bewegte sich nicht. Um 14.30 Uhr gingen die Türen wieder auf, zwei Männer in dunkelblauen Trenchcoats stiegen ein, die sich mit strengem Blick vor ihm aufbauten. Entsetzt wurde Mark klar, dass sich das Blatt gewendet hatte.
Mit gedämpften Stimmen gaben sich die Männer zu erkennen und baten ihn, ihnen aus dem Zug zu folgen. Der eine ergriff seinen Ellbogen, während der andere seine Tasche aus dem Gepäcknetz nahm. Auf dem Weg zum Gefängnis wurde nicht gesprochen. Irgendwann zehrte das Schweigen an Marks Nerven. »Bin ich jetzt verhaftet?«
Ohne sich umzudrehen, erwiderte der Fahrer: »Normalerweise führen wir unbescholtene Bürger nicht in Handschellen ab.«
»Aber warum bin ich verhaftet?«
»Das werden Sie im Gefängnis erfahren.«
»Ich dachte, ihr Jungs müsst mir das sagen, wenn ihr mir meine Rechte erklärt.«
»Sie sind neu in dem Metier, was? Wir müssen Ihnen Ihre Rechte nicht erklären, solange wir keine Fragen stellen. Im Moment möchten wir unsere Ruhe haben.«
Stumm beobachtete Mark den Verkehr. Er ging davon aus, dass Jerry geschnappt worden war. Andernfalls hätten sie nicht wissen können, dass er, Mark, in diesem Zug saß. Es konnte doch nicht sein, dass Jerry ausgepackt hatte – oder doch?
Bislang hatte Jerry keine Silbe gesagt, denn er hatte noch gar keine Gelegenheit dazu gehabt. Um 17.15 Uhr wurde er aus seiner Zelle geholt und zum FBI-Büro ein paar Straßen weiter gebracht. Man führte ihn in einen Verhörraum und setzte ihn an einen Tisch. Die Handschellen wurden ihm abgenommen, und er bekam eine Tasse Kaffee. Ein Beamter namens McGregor trat ein, zog seine Jacke aus, setzte sich und begann ein freundliches Gespräch, in dem er dem Verhafteten nebenbei dessen Rechte erklärte.
»Schon mal festgenommen worden?«, wollte McGregor wissen.
Allerdings. Deshalb wusste Jerry auch, dass der nette Mr. McGregor sein Vorstrafenregister längst kannte. »Ja.«
»Wie oft?«
»Hören Sie, Sie haben mir gerade gesagt, dass ich das Recht habe zu schweigen. Ich werde kein Wort sagen, und ich will einen Anwalt, und zwar sofort. Verstanden?«
McGregor sagte: »Klar«, und verließ den Raum.
Gleich um die Ecke saß in einem anderen Verhörraum Mark. McGregor trat ein und spulte das gleiche Programm ab wie bei Jerry. Sie hätten mit einem Durchsuchungsbeschluss Marks Tasche durchsucht und alle möglichen interessanten Dinge gefunden. McGregor öffnete einen großen Umschlag, zog ein paar Plastikkarten heraus und begann sie auf dem Tisch auszulegen. »Die stammen aus Ihrer Brieftasche, Mr. Mark Driscoll. Ein Führerschein aus Maryland, ein schlechtes Foto von Ihnen mit vollem Haar und Augenbrauen, zwei gültige Kreditkarten und eine zeitlich begrenzte Jagdlizenz für Pennsylvania.« Weitere Karten wurden ausgebreitet. »Die stammen auch aus Ihrer Tasche. Ein Führerschein aus Kentucky, ausgestellt auf Arnold Sawyer, auch hier mit üppigem Haar. Eine gefälschte Kreditkarte.« In aller Ruhe förderte er weitere Karten zutage. »Ein gefälschter Führerschein aus Florida, Foto mit Brille und Bart, ein Mr. Luther Banahan. Und dann noch dieser hochwertige Pass, ausgestellt in Houston auf Clyde D. Mazy, zusammen mit passendem Führerschein und drei falschen Kreditkarten.«
Der Tisch war vollständig mit Plastikkärtchen bedeckt. Mark war plötzlich speiübel, doch er biss die Zähne zusammen und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Sie hatten in seiner Tasche Plastikkarten gefunden. Na und?
»Ganz schön beeindruckend«, sagte McGregor. »Wir haben alles überprüft und wissen, dass Sie in Wirklichkeit Driscoll heißen und keinen festen Wohnsitz haben. Sie sind wohl viel unterwegs.«
»Ist das eine Frage?«
»Nein, bislang nicht.«
»Gut, denn ich werde nichts sagen. Ich habe das Recht auf einen Anwalt. Besser, Sie besorgen mir einen.«
»Okay. Komisch, dass Sie auf all diesen Fotos ganz behaart sind, sogar im Gesicht, und immer mit Augenbrauen. Jetzt ist alles weg. Laufen Sie vor irgendetwas davon, Mark?«
»Ich will einen Anwalt.«
»Natürlich. Sagen Sie, Mark, wir haben gar keine Papiere für Professor Neville Manchin von der Portland State University gefunden. Klingelt bei dem Namen was?«
Und ob. Ein ganzes Glockenspiel.
Durch eine verspiegelte Glasscheibe war eine hochauflösende Kamera auf Mark gerichtet. In einem benachbarten Raum saßen zwei Verhörexperten, die durch Beobachtung feststellen konnten, ob Verdächtige oder Zeugen logen. Sie registrierten jede Regung von Mark, achteten auf seine Pupillen, seine Oberlippe, seine Kiefermuskeln, darauf, wie er den Kopf hielt. Ihnen entging nicht, dass er bei der Erwähnung von Neville Manchins Namen zusammenzuckte. Als er stammelte: »Äh, ich werde nichts sagen, ich will einen Anwalt«, nickten beide lächelnd. Volltreffer.
McGregor verließ den Raum, sprach mit den Kollegen und trat dann wieder bei Jerry ein. Er setzte sich,