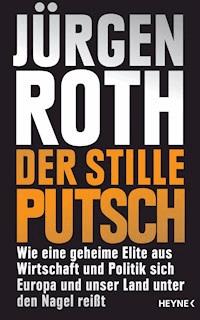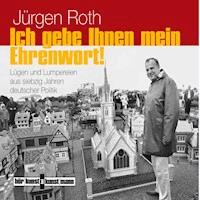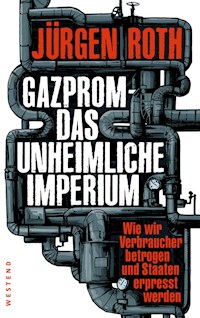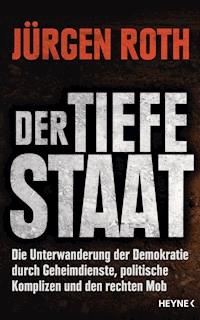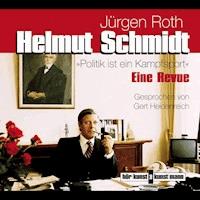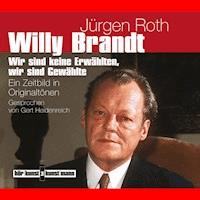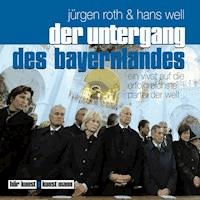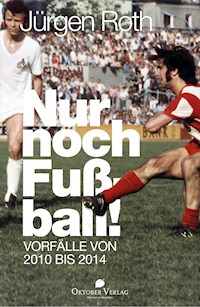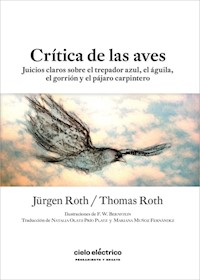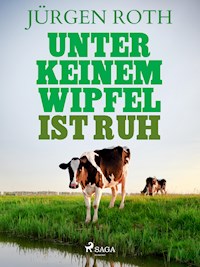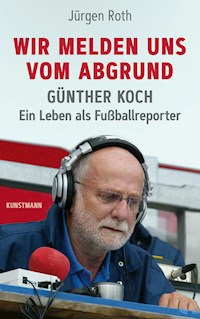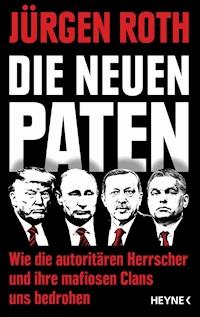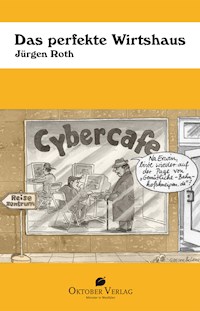
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Monsenstein und Vannerdat
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Eine essayistisch-reportagenhafte Rundreise durch die letzten wahren Wirtshäuser Deutschlands und teilweise der Welt. Was macht ein perfektes Wirtshaus aus? Ein gutes süffiges Bier, eine schmackhafte Speise und geselliges Beisammensein? Ist es ein Ort, an dem die Zeit stehen bleibt, man sie vergisst und ewig sitzen bleiben möchte? Wo das Wort ›Glück‹ noch eine Relevanz hat? Jürgen Roth verbrachte in seinem Leben viele Stunden in mannigfaltigen Wirtshäusern, ob in Franken, wo er geboren ist, oder den anderen berühmten Biergegenden von Belgien bis Tschechien. Nach diversen Bierbüchern errichtet Jürgen Roth endlich auch dem besonderen Ort des Biertrinkens ein eigenes Denkmal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roth Das perfekte Wirtshaus
Jürgen Roth
Das perfekte Wirtshaus
Jürgen Roth, geboren 1968, lebt als Schriftsteller in Frankfurt am Main. Zuletzt sind von ihm im Verlag Antje Kunstmann drei Hörspiel-CDs erschienen (Stoibers Vermächtnis, Der Untergang des Bayernlandes und Mit Verlaub, Herr Präsident … , die ersten beiden zusammen mit Hans Well von der Biermösl Blosn) sowie bei Zweitausendeins der Band Schrumpft die Bundesrepublik! (zusammen mit Michael Rudolf und F. W. Bernstein). Im Oktober Verlag liegen von ihm diverse Titel vor, darunter Anschwellendes Geschwätz, Fußball! (Buch und CD), Rettet das Rauchen! und die zweite, überarbeitete und stark erweiterte Auflage von Die Poesie des Biers.
© 2009 Oktober Verlag, Münster
Der Oktober Verlag ist eine Unternehmung des
Verlagshauses Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster
www.oktoberverlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Claudia Rüthschilling
Umschlag: Linna Grage unter Verwendung einer Zeichnung von Greser & Lenz
Herstellung: Monsenstein und Vannerdat
ISBN 978-3-938568-89-7
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Für V.
Bislang hat der Mensch sich nichts ausgedacht, das so viel
Freude verbreiten könnte wie eine schöne Taverne oder ein
Schankhaus.
Samuel Johnson
Im Wirtshaus allzu subaltern der Gast, im Gasthaus der Wirt;
folglich immer geradewegs in eine Gastwirtschaft.
Thomas Kapielski
Ich trank Bier in gewaltigen Bierhäusern. Eines bestand aus
einer ganzen Flucht von Sälen, und drei Orchester spielten
gleichzeitig. Um elf Uhr morgens waren alle Tische besetzt.
Simone de Beauvoir
Wenn du früher im Wirtshaus schlecht behandelt wurdest, bist
du wenigstens privat schlecht behandelt worden.
Hans Well
Also, wenn das nicht meine Stammkneipe wär’, ich würd’ hier
nicht hingeh’n.
Tresenhocker in der Frankfurter Gastwirtschaft Mampf
Wo ist denn hier die Wirklichkeit?
Tresenhocker in der Frankfurter Gastwirtschaft Kyklamino
Toren bereisen in fremden Ländern die Museen. Weise gehen
in die Tavernen.
Erich Kästner
Inhalt
Vorwort
Unruinierte Universalglückskomponenten
Wege zur Wonne
Wenn Tresen Trauer tragen oder: Zampano der Zunge
Goldener Grüner Baum
Das ideale Wirtshaus
Hinter den Steinen
Gottesgegenbeweise
Kein Ruhetag, keine Ferien
132 Dreier
Blond und blau
Terrassiertes Terrain
Faßbrause und Kühlungsbräu
Krug und Kruzifix
Frikadellengrünfrüchteensemble
Musik
Mühle marsch!
Berwersdorff hat unrecht
Diffuses Wartegebaren
Vergorene Gegenwart
Dialektischer Durst
Beckettistisches Bier
Dänemark verstehen
Trier – Eifel, mehrfach
Wellness contra Wirtshaus?
Wer den Vogel hat
Auffi!
Der Wille zum Bier
Notwendige Zwischenbemerkungen über einige Städte, in denen mitunter auch Wirtshäuser zu finden sind
Dezidierte Gedanken über den Deckel
Die Bestimmung des Containers
Viel Wind
Fürth, Türkei, Washington – Eine Trilogie des Tresens
Die Meister der Zäune
Wasserhäuschenwasserstandsmeldung
Der König von Zimmern
Ausgehorchte Ausländer
Blue Bock Blues
Entbierung schreitet voran!
Der Nil
Der Streit der Religionen
Komische Speisekarte
Ins Dasein geblickt
Wo bleibt Berry?
Im schäbigen Meer
Zum Volkswohl
Geringes Glück
Karpfenbier
In Idiotenland
Anständiges Australien?
Gastronomiegulag Gallus
Normalkneipe
Städtische Strandpromenade
Gemeine Gemeinden – Heute: Stublang
Öd? Ach was!
Das große österreichische Weizenbierschisma
Das Erleben von Lissabon
Andechs oder Bamberg?
Leipziger Nüchternheit
Kneipeneschatologie
Der Zeit die Zunge zeigen
No go
Winzige Wehmut
Der Segen des Elendstrinkens
Das Lexikon der Interjektionen
Beckett und Steinbeck
Der Frankfurter Adi
Das Caio-Evangelium
Rohe Bärte
Die ungeheure Vielfalt der Grüntöne
Habermasianische Kommunikationsinsel
Dunkles Weizen
Franken in Frankfurt
Die Louisa-Fragmente
Nachweise
Vorwort
Dieses Buch ist kein Wirtshausführer. Es ist eine Sammlung von Reisereportagen, von literarischen Feuilletons, von Anekdoten, Geschichten, Glossen, Essays. Allen Texten gemeinsam ist ein Thema oder Motiv: die Beschreibung der Eigentümlichkeiten unterschiedlicher öffentlicher Trinkorte.
Um den möglichen Einwand vorab zu entkräften, es handele sich bei diesem Buch um eine bloße und darob eventuell ja wohlfeile Kompilation bereits erschienener Texte: Zum einen kann es sich ein freier Autor, der nicht über Erbschaftsmillionen oder granatengeile Börsenpakete verfügt, heutzutage bei den lächerlichen Vorschüssen, die Buchverlage zu zahlen bereit oder in der Lage sind, schon aus Gründen der simplen Reproduktion nicht erlauben, ohne Aufträge von Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunkanstalten um die Welt zu reisen und durch die Gegend zu latschen; zum zweiten sind nahezu alle hier zusammengestellten (Auftrags-)Arbeiten aus den vergangenen sechs Jahren vor dem Hintergrund entstanden, sich zu einem Buch zusammenzufügen. Daß ich sie noch einmal sorgfältig durchgesehen und hie und da leicht retuschiert habe, darf ich anmerken.
Den endgültigen Anstoß, sich über einen längeren Zeitraum mit Fragen und Phänomenen der Wirtshauskultur und ihres Niedergangs zu beschäftigen, gab 2004 Tanja Kokoska. Sie ist Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau und war damals verantwortlich für das neue wöchentliche Regionalsupplement plan.F. Angeregt durch ein Interview, das ich mit Achim Greser und Heribert Lenz geführt hatte (siehe Seite 27), sagte Tanja: »Du hockst doch dauernd in Kneipen und Wirtshäusern rum. Schreib doch bitte für mich eine Serie über das perfekte oder ideale Wirtshaus.«
Ich hocke zwar nicht dauernd in Wirtshäusern und Kneipen herum, aber schon recht häufig und gerne. »Gut«, sagte ich, »gehen wir’s an. Titel: ›Das perfekte Wirtshaus‹.« – »Sehr schön.«
Tanja ist freundlich, kundig und – hartnäckig. Bereits nach der zweiten oder dritten Folge forderte der damalige Chefredakteur der Rundschau, Wolfgang Storz, lauthals die sofortige Einstellung der Serie. Das wiederholte sich praktisch jedesmal, wenn neuerlich eine ganze Seite des Serviceblattes mit einer eher verspielt-verwinkelten Abhandlung über das Wirtshauswesen gefüllt worden war.
Tanja ließ sich nicht beirren und nicht einschüchtern, und so hatten wir es schließlich immerhin auf dreizehn Folgen gebracht. Daß kurz nach Erscheinen des letzten Textes plan.F eingestampft wurde, finden wir noch heute fast ungeheuer okay.
Tanja, merci!
Nach dem Ende der Serie wurde sie informell in multipler Aufsplitterung in anderen Zeitungen fortgesetzt. Ich danke vor allem Jörg Hahn, Freddy Langer und Jakob Strobel y Serra von der FAZ, Michael Ringel von der taz und Christof Meueler von der jungen Welt. Sie haben Texte in Auftrag und/oder in Druck gegeben, die ich im Hinblick auf die Fertigstellung des Perfekten Wirtshauses zusammengehauen habe.
Gut möglich, daß das eine oder andere Etablissement, das auf den folgenden Seiten Erwähnung findet, mittlerweile nicht mehr existiert. Das wäre ein weiteres Indiz für das unaufhaltsame Verschwinden der letzten wahren, schönen, guten Wirtshäuser und Trinklokalitäten.
Gut möglich obendrein, daß dem Leser gewisse regionale Einseitigkeiten ins Auge fallen und er im Gegenzug lobenswerte Kneipen etwa im Ruhrgebiet oder im hohen Norden vermißt. Erstens: Ich kann nicht überall sein. Zweitens: Neigung und Gewohnheit spielen in Sachen Gasthausbesuch natürlich keine unbedeutende Rolle. Drittens: Die Auswahl unterliegt auch dem Zufall; wo mich eine Redaktion hinschickt oder wo ich eine Rast einlege, das entscheide nicht ich und plane ich nicht. Viertens: Es geht hier letztlich um das Typische von Orten, an denen es sich lohnt, zu verweilen und – vornehmlich – Bier zu trinken.
Sicher, zur Münsteraner Brauerei Pinkus Müller, in deren Ausschank ich mit Michael Rudolf mal einen hervorragenden Nachmittag verbaselt habe, zu einem ausgezeichneten Lärmladen in der Dresdner Südstadt, dessen Name mir entfallen ist, zum Augustiner-Keller und zum Jennerwein in München (ich bin im Besitz des Jennerwein-Raucherklubausweises Nummer 5.000), zur Gaststätte der Erdinger Weißbräu und zum Raucherclub Möller’s in Hamburg hätte ich durchaus ein paar Worte verlieren können. Aber manchmal habe ich keine Lust, mir Notizen zu machen und zu schreiben. Ich bitte um Nachsicht.
Unruinierte Universalglückskomponenten
Wer durch die Praxis galvanisierte Mitteilungen machen möchte über die letzten wahren Wirtshäuser, über Gaststätten und Lokale, die sich gegenüber dem Perfektibilitätsgedanken der Aufklärung zumindest noch als aufgeschlossen erweisen, der wird zunächst kaum im engeren oder weiteren hessischen Großraum verweilen, sondern voller Verve und maßstabsuchend ins angrenzende Bayern ausreiten und dort aber sofort in eines der gesegneten Segmente der Erdschrunde preschen: in die Fränkische Schweiz.
Der Mensch ist anthropologisch maßgeblich bestimmt durch zweierlei – durch die Sprache und, so legt es der radikale französische Republikaner Claude Tillier in seinem mit Rinderzungen zu preisenden großhumoristischen Roman Mein Onkel Benjamin (1843) überzeugend dar, durch die Fähigkeit, sich zu betrinken. Der Mensch ist im Sinne auch Schillers nur dort voll entwickelt und des weiteren in irgendeiner Weise und Richtung entwicklungsfähig, wo er ohne Arg noch List und ohne störende Umstände herumhocken kann (also beispielsweise in einem Gerhard Poltschen »erdbebensicheren Gebiet« als vornehmlich Biergartengebiet), wo er dann in einem gewissermaßen traulichen Ambiente herumschwatzen darf und zudem eines jederzeit in unerschöpflicher Menge und extraordinärer Qualität vorrätigen Getränks habhaft zu werden vermag, eines Getränks, das sich reziprokproduktiv zur hellen, lichten Sprachlichkeit des Menschen verhält. Es handelt sich hierbei um das Bier.
Alle drei Universalglückskomponenten sind in Heckenhof im Zentrum der Fränkischen Schweiz aufs edel-irdischste miteinander verbunden. Das liegt zum einen an einer waldbuckeligen, von Hohlwegen und Feldgehölzen durchzogenen und tektonisch krisenfreien Landschaft, zum anderen an der Wirtschaft Kathi-Bräu. Der Frankfurter muß lediglich etwa zweihundertdreißig Zug- oder Pkw-Kilometer überwinden, um das im 15. Jahrhundert gegründete Brau- und Schankhaus zu erreichen. Das ist fürs Paradies kein schlechter Wert.
Am besten schlägt man sich östlich von Bamberg via Heiligenstadt nach Aufseß durch und erklimmt anschließend eine kleine Anhöhe über den neuerdings zum »Wellness-Wanderweg« beförderten Treckerpfad. Hinter einer generös arrangierten Baumgruppe eröffnet sich dem himmelblauen Blick zunächst ein gar nicht hinterfotzig genug zu verfluchender Parkplatz für jene Biker, die Kathi-Bräu zum »Szenetreff« erkoren haben und wochenends als »Wheelies« das »hopfige Naß« (www.bikeandmedia.de) in die Lederkörper importieren, um hinterher folgende Bike-and-Beer-Poetry ins virtuelle worldwide Hohlhausen zu pflanzen: »Ich geh nach Heckenhof seitdem ich 10 bin, da bin ich noch mit meinem Vater gefahren. Mittlerweile fahre ich selber und ich werde auch noch mit 60 Jahren dahin fahren, da ist es einfach super und die Kathi Bräu in Heckenhof ist im Sommer schon so ne Art Familie.«
Ist sie, Gott sei es gedankt, unter der Woche nicht – sondern vielmehr ein anarcholibertäres Gemütlichkeitsterrain at its best. Da rasten unter elysischer Laubüberdachung und in archäologisch wertvoller Ruhe um halb elf Uhr morgens junge Müßiggänger, Spazierleut’, Handwerker, festgeschraubte Krugstemmer und gemischte Rentnermannschaften, die frohvollst das malzmuntere, nach »Geheimrezept« der 1993 verstorbenen Braumeisterin Kathi Meyer verfertigte braune Lagerbier einsaugen, das zwischen Plackenschwarz und Lakritzbraun changiert und durch seine kompottartigen Nuancen zuweilen an Schwarzbier oder sonst was erinnert. Eine Katze sieht das ebenfalls für geraten an, sofern sie nicht im wilden Garten neben dem durch und durch unruinierten, weil unrenovierten Gasthaus inklusive finsterem Schankraum, schwankendem Steinboden, Rinnenpissoir und Eistruhe herumtapst oder -fläzt.
Draußen darf es zwar auch eine Brotzeit sein respektive ein Käsekuchen; doch wer »auf den Keller geht«, wie es heißt, wenn man in Oberfranken in den Biergarten marschiert, der hält a) keine »Benzinreden« (s. o.) und bleibt b) »den ganzen Tag sitzen, verdammt!« (K. Sokolowsky), nämlich beim Bier (und höchstens bei einem Zusatzteller Sauerkraut). Er weiß dann, daß auf der hiesigen »Agora reborn« nicht bloß die »unheimliche Macht von Hademar Bankhofer« angemessen erörtert und eine fürwahr fortschrittliche Debatte über Biker geführt werden kann, über Stahlroßdompteure, die im Münchner Englischen Garten den Bärlauchsammler Prof. Sailer in den Wahnsinn treiben. Er erfährt obendrein, daß am Tisch der Wissenden ab Seidla Nummer fünf (0,5 l, 1,60 €) noch weit über Luthers Tischredenidiotien hinaus der diverseste Quark und versierteste Schrott in die Dialogspirale flutscht; so daß er zuletzt volle Kartusche »am Baum der Erkenntnis genascht hat«
(E. Stoiber, 14. März 2003) und es ihm mithin nachgerade vernünftig dünkt, ergänzende drei bis sechs Runden lang den Arsch nicht mehr hochzukriegen.
Oder er schaut klappehaltend einer fingernagelgroßen grünen Raupe zu, die sich über Stunden hinweg stillvergnügt und lässig leuchtend in der Bierpfütze auf dem Holztisch wälzt.
Wege zur Wonne
Wer mit dem Wort »Bierstraße« nicht bloß eine Gasse in Osnabrück oder Chemnitz meint, die genau so heißt, und wer des weiteren unter »Bierstraße« nicht allein die sogenannte mallorquinische Sauf- und Raufmeile Calle de Miquel Pellisa in S’Arenal versteht und dabei verzückt an das degoutante Gebaren in Vorhöllen wie dem Deutschen Eck und dem Almrausch denken muß, der weiß, daß es im Bierwunderland Franken nicht nur Hunderte von kleinen und feinen Brauereien, sondern auch Bierstraßen gibt, die zum Teil sogar ins Niederbayerische und nach Thüringen ausgreifen.
Im Oberfränkischen zentriert bleibt zunächst die Fränkische Bierstraße, eine Fremdenverkehrsinitiative, die mit Brauerei- und Kirchweihbesuchen, Bierwochen und anderen Festivitäten für die Region wirbt. Der Verein Fränkische Bierstraße bietet jedoch darüber hinaus Touren an, die auch Nürnberg, das südliche Mittelfranken oder den Steigerwald einbegreifen.
Eine der Rundreisen startet in Bayreuth, wo sich neben dem Festspielhaus vor allem das Museum der Maisel’s-Brauerei und der Herzogkeller für eine Visite anbieten. Auf der B 85 Richtung Kulmbach erreichen wir dann Altdrossenfeld. Dort hält die Brauerei Schnupp ein gängiges Edelpilsener bereit, das unter beinahe allen Umständen runtergeht. Einige nordöstliche Kilometer entfernt wirft allerdings der Bierbetrieb Haberstumpf in Trebgast das dunkle Kupferkrönla in die Gaumenschale.
Von Trebgast rauschen wir östlich an Bayreuth vorbei Richtung Pegnitz, wo zweimal Bier gefaßt werden kann, um über die B 470 gestärkt in die gesegnete innere Fränkische Schweiz zu gelangen, nach Pottenstein. Ob da mehr die drei Brauereien locken oder eher der Burgberg interessiert, mag Veranlagungssache sein. Entlang des sich gen Westen hinstreckenden Wiesenttals sind im Anschluß End- und Ruhepunkte sonder Zahl anpeilbar – zumal auf dem rechter Hand gelegenen Plateau, auf dem neun hochgradig empfehlenswerte Privatbrauereien logieren.
Während sich die Aischgründer Bierstraße auf den Steigerwald konzentriert und zwischen Bad Windsheim und Uehlfeld auf zirka fünfzig Kilometern mit sieben Familienbrauereien aufwartet, die im näheren Umfeld der B 470 zu finden sind und im Rahmen von 1- bis 3-Tages-Trips inklusive Bierseminar, Brennereiexkursion und Anzapfkurs geprüft werden können, geht die Bier- und Burgenstraße, 1977 in Kulmbach als Arbeitsgemeinschaft gegründet, bei einer Gesamtlänge von 500 Kilometern in die vollen. Hier braucht es nicht nur mehrere Fahrer, hier sind obendrein diverse Rast- und Rekreationsphasen angebracht.
In Passau beginnend, schlängelt man sich auf der B 85 nordwärts und macht beispielsweise in Amberg und Sulzbach-Rosenberg Station. Ein Stopp bei Sperber-Bräu im Zentrum Sulzbach-Rosenbergs (Rosenberger Straße 14) kann nicht schaden. Die Weisheiten der Schafkopfrunden sind unerschütterlich, wie Eckhard Henscheid mehrfach überlieferte. Vorher allerdings zieht bereits das Amberger Rathaus in Bann, ein gotisches Schmuckstück, das einen drei- bis vierfachen Toast mit der legendären Falk-Weiße verdient, einem Hefeweizen, das heute und nicht minder cremig durch die örtliche Brauerei Bruckmüller hergestellt wird.
Die Route führt weiter über Pegnitz, Bayreuth und Kulmbach, dessen unterdessen monopolistischer Großbraubetrieb zugunsten der Plassenburg zu ignorieren wäre, und touchiert Gampert-Bräu in Weißenbrunn und Jahn-Bräu in Ludwigsstadt, beides akzeptable Orte der Erfrischung. Hinter der thüringischen Landesgrenze böte sich ein bierologisches Intermezzo im Bürgerlichen Brauhaus zu Saalfeld an (Pößnecker Straße 55), gleichwohl wir, das Schloß Heidecksburg und das Blankenhainer Schloß grüßend, bei Weimar einen Abstecher nach Apolda favorisieren würden. In der hiesigen Vereinsbrauerei (Am Töpfermarkt 1) darf man sich ein Gambrinus Pils oder den Glockengießer Urtyp gefallen lassen, um die Kraft der zwei Herzen fürs Finale der Bier- und Burgenstraße zu tanken: für das Kyffhäuser-Denkmal bei Bad Frankenhausen. Das Barbarossa Pilsner der Privatbrauerei Artern gibt einem dann den Rest.
Bierstraßen sollen Orientierungsangebote in einer vielfältigen Kulturlandschaft sein und die Erkundung der Bierwelt mit anderweitigen touristischen Zielen, mit Baudenkmälern, Ruinen und Naturparks, verbinden. Da herrscht der Marketinggedanke notgedrungen vor. So empfiehlt es sich, falls einem an der Entdeckung wahrer Kleinode der Braukunst und der Wirtsstubenbehaglichkeit gelegen ist, immer der Nase nach und mit der Fränkischen Brauereikarte von Stefan Mack in der Hand durch Frankens Lande zu stiefeln.
In den östlichen Haßbergen zum Beispiel, etwa zwanzig Kilometer nördlich von Bamberg, sollte der Neugierige im exquisiten Bierstützpunkt der Baunacher Brauerei Sippel, geführt von Baptist Fößel, ein paar Seidel des dunklen, streng rezenten und experimentell gehopften Vollbiers stürzen, während der Stammtisch seine Knollnasen mit Bierschnaps pflegt. Anschließend marschiert man zwei Kilometer weiter in westlicher Richtung, durch ein weiches Tal. Am Ortseingang von Appendorf steht die Brauerei Fößel-Batz, in der nicht bloß eine bittersüße Feinheit kredenzt wird, die in solcher Vollkommenheit selten aufzuspüren ist, sondern Freitag abends ein unglaubliches Tanz- und Musikspektakel stattfindet, an dem Hobbyinstrumentalisten und Walzerwütige aus der ganzen Region teilnehmen, um im schönsten Gewoge die Vermählung von Rausch und hochmodernem Entertainment zu zelebrieren.
Hat man das Remmidemmi halbwegs unbeschadet überstanden, steht am nächsten Tag einer weiteren Tour über die (noch) unbenannte Bierstraße entlang der B 4 nichts im Wege. An demselben werben mit der Brauerei Zum Goldenen Adler in Höfen, der Brauerei Fischer in Freudeneck und der Brauerei Sonnenbräu in Mürsbach kurz hintereinander drei vorbildliche Bierinstitute um die Gästegunst – Pilgerstätten, die durch die dargebotenen glitzernden Getränke nicht weniger für sich einnehmen als durch ihre seraphischen Namen.
Wenn Tresen Trauer tragen oder: Zampano der Zunge
Unlängst ließ der Präsident des Deutschen Brauer-Bundes, Richard Weber, verbreiten, daß auf Grund des in der »Cola-Generation« manifest gewordenen Trends zum »süßen Geschmack« Bier »in Zukunft« wahrscheinlich kein bißchen besser, aber »süßer« werde. »Bier wird in Zukunft süßer und weniger hopfig«, sagte Weber, und man lasse sich das gesagt sein und auf der Zunge zergehen.
Mitte der siebziger Jahre oder etwas später, man wird sich des fraglichen Jahrhunderts noch blaß durch den letzten gauloisesschwarzen Filmriß hindurch erinnern, löste das als »herb« bezeichnete Pilsener das damals marktführende Export als Marktführer auf dem Biermarkt ab. An diesen epochalen Einschnitt müssen wir denken, wenn Weber heute sagt: »Das Schicksal von Export droht nun dem Pils, das sich vor drei Jahrzehnten zur beliebtesten Biersorte in Deutschland aufschwang.« – »Abgelöst«, so Weber weiter, »wird Pils vom Spitzenplatz voraussichtlich von Biermischgetränken oder Biersorten, die weniger herb schmecken.«
»Ein herber Schlag«, raunt es an Deutschlands Tresen vermutlich, ja, »ein harter Schlag, der uns da bevorsteht.« So tragen die Tresen Trauer. Doch so sehr es einem auch die Sprache verschlägt, so sehr wären klare Köpfe zu wünschen, um Einsicht in die Wahrheit der Wirklichkeit zu gewinnen.
Schuld an diesem epochal-ordinären Umwälzungsvorgang ist weder die »Cola-Generation« noch die Generation der »puren Lust am Leben ohne Pils« (Gesundheitszeitschrift Jolie), sondern ein unauffällig am Pestalozziplatz in Frankfurt-Bornheim lebender Mann, seines Zeichens promovierter Schopenhauerianer.
»Ich hab’s doch gesagt, ich hab’s doch schon immer gesagt, ich hab’ doch den Trend erkannt, ja vorausgedacht!« schreit der zwischen Zeitungshaufen, Weinflaschenhalden und Schallplattenstapeln hockende ehemalige Zehnkämpfer und »ausgebildete Humanist«, wie er betont, und justiert die Dieter-Hildebrandt-Brille.
Dr. Heinrich Prömm ist kein Mann des unklaren Wortes. Er liebt die Wahrheit und die Unumwundbarkeit und köpft eine Champagnerflasche Jg. 1943 Südwest-Nigeria per Handkantenschlag. »Ich fackel’ nicht lange, das müssen Sie wissen!« brüllt er wie von sich selbst begeistert, und ein Strahl des goldgelben Saftes ergießt sich fontänengleich in den weit geöffneten Schlund, in dem es gefährlich brodelt.
»Das war doch abzusehen«, Prömm gluckst kurz, »das hab’ ich doch gesagt, tausendmal, ich hab’ doch den Trend schon vor Jahren gesehen!« Prömms Opernbaß schwillt grummelnd an, der bärige Mann greift rasch zu einem Burgunder und rückt den grünen Wodka zurecht. »Seit Jahren hab’ ich im Spitzen Eck, da vorne«, seine rechte Pranke zeigt Richtung Norden, »die Wende propagiert, ja eingeleitet!«
Was er damit meine, fragen wir in einer Atempause. »Das Pils wird abgeschafft! Das Pils wird abgeschafft, weil das Pils ein Scheißgetränk ist! Das ist doch klar!« Was sei klar? »Daß Männer, echte Männer, Export trinken! Männer brauchen Nahrung, Kraft, Prozente! Seit Jahren sage ich das! Und seit Jahr und Tag beweise ich im Spitzen Eck, daß das Pils weg muß!«
Dr. Heinrich Prömm habe im Dienste der Abschaffung des Pilsbiers etliche tausend Hektoliter Export der Brauerei Binding getrunken, beteuert er. Nun sieht er sich bestätigt. Das Pils breche endlich elendig ein, die Süße komme zurück. »Kinder wollen Süßes, weil sie Kopfnahrung brauchen, weil sie denken wollen«, erläutert Dr. Prömm grölend, er wirft die Arme in die Höhe, sein Bauch bebt, »und das bestätigt sich jetzt auf höherem Menschheitsniveau, auf Männerniveau!«
Der Zampano der Zunge kratzt mit dem kleinen Finger den letzten Tropfen Burgunder aus der Flasche. »Wahrscheinlich greifen jetzt die Frauen, schwach, wie sie sind, zum Pils. Zum ›schlanken‹ Pils. Aus Solidarität. Aber ich trinke weiter. Im Auftrag der Welt, wie ich sie mir vorstelle. Die Zeit und das Volk sind auf meiner Seite!«
Der Volkserzieher vom Pestalozziplatz lächelt. »Alles für andere, für sich nichts, oder? Ich bin froh, daß ich jetzt die Früchte meiner Überzeugungsarbeit ernte. Süß wird die Zukunft sein. Ich würde fast von einer Generation Prömm sprechen wollen. Ja, ich spreche von einer Generation Prömm! Komme es, wie ich’s wollte!«
Wir gehen, durstig und sprachlos.
Goldener Grüner Baum
Wenn man es satt hat – und man hat es oft genug satt –: dieses ubiquitäre neumoderne Interieur samt aprikosenfarbenem Feinputz, diese betonte Kühle und genormte pseudomondäne Sachlichkeit und Eleganz, dieses so offenkundig angestrengt Durchdachte und doch nur Abgekupferte all dieser sogenannten Bars und Restaurants und Chill-out-Lokalitäten – dann muß man weg, weg, raus aus der törichten Stadt, raus aufs Land, aufs Kaff, unter Leute, die sich nicht scheuen, anders zu reden, als es ihnen das Fernsehen und das Feuilleton vorplappern. Und dann findet man in der Regel doch nur wieder verhobelte Läden, stilistisch nochmals unbedarftere Adaptionen dieses gähnend öden Kollektivstils, und in denen hocken Leute, die genauso reden, wie es ihnen das Fernsehen und der Sportteil vorschreiben.
Es gibt keine Wirtshäuser mehr, zumindest an den Peripherien der größeren Städte nicht. Wer etwa rund um Stuttgart oder Frankfurt ein normales, einfaches, einladendes Wirtshaus sucht, ist verloren und verratzt. Es ist verflucht, es ist eine Blamage, und insbesondere rund um Frankfurt ist es eine einzige Katastrophe. Im Taunus und im Vordertaunus ein halbwegs anständiges Wirtshaus zu finden ist unmöglich. Der Taunus ist verloren, ein für allemal.
Fast. Oder noch nicht ganz. Denn in Bad Soden-Altenhain steht unweit der Kirche ein Fachwerkhaus, das Gasthaus Zum Grünen Baum. Der Grüne Baum verdient, im Rahmen der immer dringlicher gebotenen hessischen Initiative zur Rettung des Wirtshauses als leuchtendes Beispiel auserkoren zu werden – als zeitloses Vorbild des einladenden, einfachen, normalen Wirtshauses ohne deutsch-romantische Verkleisterung, Verklärung und Verkitschung.
Ein langgezogener Raum; lobenswert lieblose Wanddekorationen, Kinderzeichnungen und Eisenlampen; Resopaltische mit Deckchen; keine Lichteffekte, keine Musik, keine Special Drinks oder Happy Hours. Am Schanktresen lagern die Stammgäste in unsortierten Hosen und kosten mit dem Wirt den neusten Brand. Die Bierbedienung ist zauberhaft zügig, die Beratung bei der Speisenwahl unaufdringlich. Der Grüne Baum ist nichts weiter als: ein Gast-, ein Wirtshaus, und das macht ihn nahezu einzigartig.
Selten zuvor wurden aber auch Steaks gesichtet so groß, daß man mit ihnen Gäule erschlagen könnte – zu Preisen, bei denen der städtische Hip-, Hü- und Hottwirt hysterische Anfälle erlitte. »Das Steak ist Weltklasse«, strahlt der Frankfurter Koch Hans-Dieter K., »das ist eine Sünde wert. Und die Bratkartoffeln sind schon jetzt legendär.«
Der Äppler rinnt aus der eigenen Kälterei, und Rippchen, Markklößchensuppe, Metzelsuppe, Dosenwurst und eine Schinkensülze aus eigener Schlachtung, die, versichert die fränkische Co-Verkosterin, durch ihre säuerlich-fleischkräftige Balance freudentränentreibend wirkt, werden um täglich wechselnde Spezialitäten wie frischgekochte Leiterchen oder Haspeln ergänzt.
Weil jetzt schon alles paßt, spendiert der Wirt einen Calvados oben drauf. Ich spendiere dem Grünen Baum die Goldmedaille der Inkognitovereinigung zur Förderung des Wirtshauswesens und der Gastronomie ohne Gewese.
Das ideale Wirtshaus
Das Zeichnerduo Achim Greser und Heribert Lenz, u. a. tätig für die FAZ, die Titanic und den stern, mietete 1996 in Aschaffenburg das erste gemeinsame Atelier an. Seither verkehren beide mehr oder weniger regelmäßig in der zentral gelegenen Gaststätte Schlappeseppel, die 1631 auf Geheiß von Gustav Adolf von Schweden errichtet wurde und bis heute ein Juwel geblieben ist. Greser & Lenz recherchieren hier und trinken das eine oder andere Bier. Und sie schätzen das Lokal so sehr, daß sie mehrere Schlappeseppel-Bierdeckelserien gezeichnet haben.
Mit der Wirtshauskultur geht es bundesweit bergab, oder?
Achim Greser: Das ist eine Behauptung. Ist die gesichert durch die erfahrenen Hintergrundrecherchen, die wir dir zutrauen, oder ist das nur mal eine provokative Behauptung, um uns herauszufordern?
Es werden ja immer mehr Lokale zu Bistros umgebaut.
Heribert Lenz: Die Leute haben schon vor zwanzig Jahren aus ihren wunderschönen Gasthäusern Bistros gemacht.
Greser: Und ich glaub’ auch nicht, daß man selbst als sentimentaler Anhänger einer uralten Kneipenkultur heute noch zufrieden wär’ mit einem Ausstattungszustand, der einen übern Hof aufs Plumpsklo zwingt. Von daher ist Erneuerung sicher auch notwendig.
Du plädierst für eine Erneuerung in bezug auf die Klos?
Greser: Ja.
Die Kneipenräume selbst haben sich aber auch sehr verändert.
Lenz: Richtig. Es gibt immer weniger Großkneipen – so wie den Schlappeseppel. Statt dessen gibt es immer mehr Eßgaststätten, in denen man zu bestimmten Zeiten nicht mehr Karten klopfen darf.
Greser: Das ist auch ein Phänomen des Regionalkonglomerats Rhein-Main, das sich gerne als dynamisches, international konkurrenzfähiges Wirtschaftszentrum ausweist. Wenn man Geschäfte mit dem Chineserer machen will und dem wie vor hundert Jahren Handkäs’ und sauren Äppler vorführt, ist das vielleicht nicht unbedingt förderlich. Also, man muß es zulassen, daß der Chineserer ein Lokal kriegt, das nach seiner Façon zugeschnitten ist.
Lenz: Der will halt auch hier seinen Schweinsbraten.
Greser: Und das heißt, die Globalisierung schlägt auch hier zurück.
Ist der Schlappeseppel eine Nische?
Lenz: Nee. Das ist einfach ein Gasthaus, das seit Jahrzehnten vernünftig geführt wird, und es marschieren immer noch genug Leute rein.
Greser: Die Wucht der Tradition ist hier natürlich auch gewaltig. Und Gott sei Dank ist das Potential dieses Lokals stark genug, um Kräfte zu mobilisieren gegen diejenigen, die den Schlappeseppel in ein zeitgeistgeprägtes Jugendlokal verwandeln könnten. Es ist ein gutes Zeichen, daß man sich hier nicht vom stringenten Erwerbsgedanken leiten läßt.
Lenz: Die Gästeschar ist so groß und zäh, daß ein Wirtswechsel oder eine Umwandlung nie zur Diskussion stand. Wie wär’ denn das, ein Bistro Schlapp zum Beispiel?
Es gibt einen starken Beharrungswillen …
Greser: Die Menschen sind darauf trainiert, auch schon am Nachmittag in das Lokal reinzuschreiten und die ersten Biere zu trinken. Das Beeindruckende ist tatsächlich, daß bereits am Mittag keine kahle Wirtshausödnis herrscht und dieser wunderbare Rumor aus Gebabbel, exaltierten Kartenspielreaktionssignalen, verfrühtem Suff und Extremäußerungen entsteht.
Lenz: Man sitzt einfach generationenübergreifend zusammen, der eine ist Straßenkehrer, der andere Jurist, und man kann über jedes Thema reden und sich gegenseitig beschimpfen. Vor ein paar Jahren hat übrigens Warsteiner eine Werbung mit weißgekleideten Menschen auf einem Gutshof gemacht – da hat’s angefangen, daß die Bierkultur auf den Hund kam und die alten Lokale verschwanden.
Im Schlappeseppel gibt es keinen Dresscode …
Greser: Hier sind alle gleich. Hier gelten andere Wettbewerbskriterien als draußen.
Welche?
Lenz: Du mußt über jedes Thema reden können.
Greser: Und die Verträglichkeit von Bier muß hoch sein. Die entscheidet über glaubwürdig und unglaubwürdig.
Würdet ihr den Schlappeseppel als das ideale Wirtshaus bezeichnen?
Lenz: Ja.
Greser: Ja. Das beste Wirtshaus im Umkreis von hundert Kilometern. Der Schlappeseppel strahlt eine so einnehmend sympathische Atmosphäre aus, daß man sich ihr nicht widersetzen kann. Und will. Man wär’ ja blöd.
Lenz: Denn es ist einigermaßen schlicht eingerichtet. Wenn man mal ein Vorurteil gegenüber Frauen vorbringen darf: Es ist immer problematisch, wenn eine Wirtsfrau gestalterisch tätig wird – wenn dann Hexen in den Fenstern stehen oder Getreidegarben an der Wand pappen oder das mit den Deckchen anfängt. Das ist der Tod.
Greser: Dieser Keramikkrempel und kunsthandwerkliche Schrott, dieses Überdeckungsgewese … Die Wucht der Patina ist wichtig. Die Bänke müssen alt sein. Das ist ein Wohlfühlfaktor, den man spürt. Außerdem darf keine Musik laufen, genauso, wie in einer guten Kneipe die Möbelhausfarbkombination Pink und Türkis nicht vorkommt.
Lenz: Hut ab, Achim! Hervorragende Beobachtung! Darüber hinaus muß es mittags losgehen, es muß sich langsam steigern. Wenn man eine Kneipe erst um siebzehn Uhr aufmacht, ist alles zu spät.
Greser: Kneipen, die zwischen halb drei und halb sechs schließen, sind Kneipen, die außerhalb der Kategorie des Wohlfühlfaktors liegen.
Der Schlappeseppel ist auch eine lichte Kneipe, keine Kaschemme.
Greser: Weil, wie es sich gehört, beim Bau am richtigen Ort der Sonnenverlauf mitbedacht wurde. Es ist ja auch ein Merkmal des Verschwindens der Kneipenkultur, daß man meint, Kneipe könnte überall sein. Man kann zum Beispiel in die Garage Bierbänke stellen. Aber das ist viel zu kurz gedacht. Das is’ nix. Das ist dumm. Das ist Bezirksliga. Das hier ist Champions League.
Lenz: Wenn das Licht wie hier auf mein Bier fällt, dann geht mir das Herz auf.
Greser: Das ist der theologische Aspekt der Kneipe – einen Platz zu finden, an dem man mit sich völlig im reinen ist und seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Das ist noch Abendland!
Lenz: Ich bin dem Herrgott dankbar, daß ich nicht im Islam aufgewachsen bin und in Teestuben rumhocken muß.
Hinter den Steinen
Es ist nicht leicht in Miltenberg am Main. Wo soll man hin? Die kleine, alte Stadt, für deren wie aus einem Baukasten für überzeitliche Fachwerkharmonie zusammengefügten Marktplatz mit dem berühmten Steinbogendurchgang hinauf zur Burg, dem Schnatterloch, sogar Adorno ein paar lobende Worte übrig hatte, dieses im Fremdenverkehrsjargon zur »Perle« ernannte Städtlein hält einen auf Trab, trotz der allerkürzesten Wege im überwiegend beschatteten Altstadtbereich.
Wo soll man hin? In den Riesen? Jene ehemalige Fürstenherberge, die als ältestes Wirtshaus Deutschlands firmiert und in deren hoher Schwemmenhalle man auf der dunklen, umlaufenden Holzbank das geschätzte Faust-Bier trinkt? Oder in westlicher Richtung die Hauptstraße, die Achsengasse, hinunter, um in der unerbittlich gemütlichen Créperie des politischen Universaldenkers Karl-Heinz Jalufka Seit’ an Seit’ mit den Herren Ramazan, Neubert und Scherer-Wolfgang zu Pfannkuchen mit hausgemachtem Zwetschgenmus das eine oder andere Faust- oder Kalt-Loch-Bräu umzuochsen? Oder vorher erst rasch noch in den wunderbar anheimelnden Hof des Museums am besagten und besungenen Marktplatz, wo die »Stadt aus Holz« Gebäudlichkeiten aus dem 14. Jahrhundert, das grandiose Weinhaus am Markt inklusive polygonem Erker und eine höchst geheimnisvoll erbaute Sandsteinkirche herzeigt? Oder, vierzig Meter retour, doch gleich und den ganzen Tag lang in die Brauerei Kalt-Loch, das Traumpendant zum Jalufkaschen Hammeretablissement?
Ohne irgend jemandem Unrecht zu tun – das darf wohl vorderhand am nachdrücklichsten angeraten sein. Drei bis vier fränkische Mahlzeiten wären da, startend, sagen wir, um 11.37 Uhr, im ein wenig zu putzig benamsten Bräustüble mit der nötigen, heutzutage so verachteten Langsamkeit zu verräumen. Zum Auftakt böte sich der Spessarträuberspieß an, gegen 15 Uhr käme die Schweinshaxe mit Semmelknödeln dran, und um den frühen Abend herum würden die mit Bergkäse überbackenen Lendchen aufgefahren, im Herbst wahlweise mehrere Gänse. Für den Nachtisch, gebongt, alright, d’accord, steht Nachbar Jalufka gerade.
Daß »der Tourismus die Gaststätten versaut«, weiß Kalt-Loch-Brauer Axel Schohe nur zu genau. Die Braustube ist von den Umbauunheiltendenzen der letzten Jahre verschont geblieben. Die Decke zieren Sandsteinbögen, die Tische sind Tische, die Tische sind: groß, schmucklos, blank.
Vernunft heute bemißt sich bisweilen daran, den grunddummen Geist der Zeit einfach nicht mal zu ignorieren. Dieselbe Ratio prägt die hier verfertigten Biere. Die Sudpfanne wird noch mit Holz befeuert, es wird offen vergoren, und die intermahlzeitliche Getränkezufuhrerörterung schwankt alsdann inflammiert zwischen dem Hopfengeniestreich Schloß-Pils, dem zierlich gemalzten und perfekt komponierten, vereinzelt bis in den Frankfurter Raum vorgedrungenen dunklen Landbier oder dem ganzjährig in die Runde spendierten Doppelbock. Hinter diesen Steinen können sie brauen, im emphatischen Sinn – leider lediglich 4.000 hl pro Jahr.
Hinter den Innenhofmauern des verschachtelten Kalt-Loch-Gebäudes verbirgt sich auch die älteste, um 1290, keine sechzig Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt entstandene Synagoge Deutschlands. Im Zentrum der damaligen »Judenstadt«, des heutigen Schwarzviertels, gelegen, diente sie bis 1429, bis zur ersten Vertreibung der Juden aus Miltenberg, als religiöses und soziales Zentrum. Zu besichtigen sind noch das Deckenrippengewölbe und die Spitzfenster. 1877 kaufte die seit 1580 bestehende Brauerei das Gebäude, man zog eine Zwischendecke ein und lagerte hier fortan Hopfen und Malz, während die Kultusgemeinde eine neue Synagoge hinter dem Riesen errichtete. Der dritte Synagogenbau wurde 1938 geschändet und zerstört, 1942 wurden die letzten beiden jüdischen Mitbürgerinnen nach Theresienstadt deportiert.
Hier und jetzt wandeln die Miltenberger übers Kopfsteinpflaster der Hauptstraße. »Sonne in dieser Straße, und wir sind in Italien«, murmelt ein Mann, und das wäre wirklich zu schön, um wirklich und wahr zu sein.
Gottesgegenbeweise
Co-Autor: Michael Tetzlaff
Ein Gott, der zuläßt, daß Männer so sitzen, daß man die hinter ihnen sitzenden blonden, brünetten und schwatten Frauen nicht sieht; der zuläßt, daß dann, wenn die Männer aufstehen, die Frauen, die man nicht hatte sehen können, nicht mehr dasitzen, weil sie inzwischen gegangen sind, und statt dessen dort nur noch Männer, andere, sitzen; ein Gott, der zuläßt, daß der Tisch, der Marmortisch, an dem man sitzt, so dunkelbraun, rot und ocker gemustert ist, daß man glaubt, man sitze an einer Platte Blutwurst, Preßsack und gekochten Schinkens; ein Gott, der zuläßt, daß man anstelle von »Frische Muscheln« »Falsche Muscheln« liest, diese bestellt und dann auch noch falsche Muscheln bekommt; ein Gott, der zuläßt, daß ein Kalender, auf dem die göttlichste Helena aller Zeitalter abgebildet ist, dreißig Euro kostet, man sich ihn beziehungsweise sie daher nicht leisten kann und deshalb nichts mehr hofft, als daß der Preis des Kalenders reduziert werde; der zuläßt, daß ebendieser höllische Kalender nach Monaten dann plötzlich elf Euro kostet und man aber jetzt komplett pleite ist und sich Helena noch weniger leisten kann als je zuvor; ein Gott, der dies und das alles zuläßt, kann nicht sein, darf nicht sein und hat vor allem so oder so von seinem blödesten Geschöpf keine Ahnung.
Denn so glaubt doch kein Mensch.
Kein Ruhetag, keine Ferien
Auf dem Staffelberg, dem heiligen Berg der Franken, zu stehen und hinab ins Maintal zu schauen, auf Lichtenfels und Staffelstein, auf das Kloster Banz auf der anderen Flußseite und, in nordöstlicher Richtung, auf die Basilika Vierzehnheiligen – das stimmt heiter. Noch beflügelter fühlt man sich nach einer kurzen Wanderung hinüber nach Vierzehnheiligen, wo nicht nur ein enervierender touristischer Auftrieb rund um einen kirmesartigen Wallfahrtsnippeshandel herrscht, sondern in der Schankstube der Alten Klosterbrauerei ein segensreicher Rettich und der glorios malzige Nothelfer Trunk serviert werden.
Den Weg dorthin und zu anderen Kleinoden der Kultur und Natur zwischen Fichtelgebirge und Altmühltal weist Helmut Herrmanns Buch Biergartenwanderungen in Franken (Bamberg 2003). Herrmann beschreibt detailliert zwanzig Routen mit Gehzeiten von drei bis fünf Stunden. Jeder Abzweig ist verzeichnet, und erfreulicherweise umschifft Herrmann geschmackssicher dräuende Tücken wie Schäffbräu in Treuchtlingen oder die Nürnberg-Fürther Tucher-Dynastie.
Herrmann macht aus seiner Begeisterung für die stillen, baumbeschatteten Biergärten genausowenig einen Hehl wie aus seinem Abscheu vor »Allerweltsküche und Großbrauereibier«. »Als ideal anzusehen ist es, wenn der Wirt selbst schlachtet und wurstet, braut, Brot bäckt, Schnaps brennt und Butter sowie Frischkäse herstellt«, hängt er die Ansprüche zu Recht hoch, denn es gibt solche vorbildlichen Wirte tatsächlich noch, zumal in Oberfranken, etwa in der einzigartigen Bierkellergegend zwischen Buttenheim und Hirschaid, rund um den Kreuzberg im Aischgrund nahe Forchheim oder auch in dem verlockenden mittelfränkischen Örtchen Suffersheim im Schambachtal, wo man im Gasthaus Zur Sonne »die ganze Palette an Schweinernem« reicht, zu Landbier der Brauerei Wurm.
»Vegetarier werden hier kaum glücklich werden«, weiß der weise Bier- und Landschaftskundschafter, und er weiß obendrein: »Für den Wanderer mit Auto ergeben sich schnell Promilleprobleme.« Deshalb bleibt er, wandern hin, wandern her, vielleicht doch besser und lieber in einem jener Wirtshäuser hocken, über die Herrmann die herrliche Information preisgibt: »Täglich von früh bis abends geöffnet. Kein Ruhetag, keine Ferien.«
132 Dreier
Breiter könnte das Grinsen kaum sein, das M. A. Numminen, hinter einem Billardtisch stehend, zur Schau trägt. Ehrlicher könnte es auch nicht sein. Der »Helge Schneider von Finnland« (SWR), studierter Philosoph und Soziologe, Musiker, Entertainer und Autor, ist, davon durfte ich mich mal einen ganzen Tag lang persönlich überzeugen, ein grundsympathischer, sanftmütiger und an praktisch allen Dingen der Menschenwelt interessierter Komiker. Jede Bosheit, jeder Anflug von Misanthropie scheint ihm fern.
Hier, auf dem Umschlagphoto des endlich auf deutsch erschienenen Buches Der Kneipenmann (Frankfurt/Main 2003), sehen wir jenen Schelm, der nicht nur in Finnland durch eine gnadenlos virtuose Wittgenstein-Suite (jetzt unter dem Titel Numminen sings Wittgenstein ebenfalls bei Zweitausendeins erhältlich) oder den Roman Tango ist meine Leidenschaft zu Ruhm gelangte. Und wir sehen ihn dort, wo er sich offenbar am liebsten rumtreibt: in einer typischen finnischen Bierbar, in der seit 1969, anders als in Norwegen und Schweden, das sogenannte Dreierbier ausgeschenkt werden darf.
Das Dreier hat einen Alkoholgehalt von 4,5%, und es wird von all jenen verschmäht, die meinen, etwas Besseres zu sein, und daher Wein und Starkbier saufen. Numminen hingegen schätzt die kleinen Leute, die Arbeiter, Arbeitslosen und Rentner, die die Dreierbars bevölkern. Deshalb unternahm er eine 20.000 Kilometer lange Exkursion durchs ganze Land und machte sämtlichen 350 finnischen Bierschenken seine Aufwartung.
132 von ihnen widmet sich sein von zärtlicher Anteilnahme und humanem Wohlgefühl durchwehter Bericht. So knapp die Texte gehalten sind, so erwärmend wahrhaftig wirken die Protokolle der teils konfusen, teils anheimelnden Gespräche zwischen Menschen, die in Tankstellenbars und Lokalitäten von fürchterlichem finnischen Aussehen und mit Namen wie Jungrentierbulle oder Himmel-Wald-Einöde einfach schön trinken und sich etwas erzählen.
Numminens soziologische Aufmerksamkeit und sein unermüdlicher Drang auf der Jagd nach der »eisernen Reserve« – Kaffee, Krapfen und Bier – lassen ihn hier nicht so sehr als »anarcho-dadaistisches Gesamtkunstwerk« (Berliner Zeitung) auflaufen, sondern als Parteigänger der staatsfernen Schwadroneure, Kommunisten und Gescheiterten. Und obschon es zu slapstickartigen Situationen kommt (Numminen hobelt trotz schier berstender Blase zunächst ein weiteres Dreier runter, weil er die Schwemmentoilette nicht aufsuchen will, ohne dem Wirt vorher einen anständigen Obolus entrichtet zu haben), enden viele der Geschichten ohne falschen Pointenhackerhabitus, nämlich zum Beispiel vorbildlich so: »Numminen trinkt seinen Krug aus und schiebt eine Pastille hinterher.« Respektive »ein paar Flaschen Dreierbier als Sedativ«. Denn »Numminen trinkt Bier und überläßt sich seinen Gedanken.«
Das genügt.
Blond und blau
Wenn die Schönheit nach der aristotelischen Einheitslehre eine Handlung, einen Ort und eine Zeit braucht, um als solche wirklich zu werden und wahrlich eine wahre Schönheit zu sein, die unser Gemüt läutert und gegebenenfalls, was noch besser wäre, aufreizt und anheizt – dann muß sie, die Schönheit, sich eigentlich nur in den Odenwald begeben oder, das stimmt vielleicht eher, ebenda gewissermaßen ereignen.