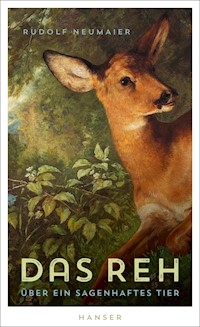
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Verehrt, besungen, gejagt – die faszinierende Kulturgeschichte des Rehs als Inspiration für die Menschen von Hildegard von Bingen bis Franz Marc
Rehe bezaubern. Ihre Anmut hat Maler wie Franz Marc und Dichter wie Christian Morgenstern inspiriert. Und Bambi streift als beliebtester Rehbock durch die Filmgeschichte. Doch jetzt sollen die Rehe an der Misere der Wälder schuld sein. Rudolf Neumaier beleuchtet die Erzählungen und Debatten rund ums Reh über die Jahrhunderte hinweg. Erstmals erzählt er die faszinierende Kulturgeschichte des Rehs vom Wildbret der kleinen Leute zum Emblem von Tattoo-Studios. Eine Hommage an Das Reh und ein Weckruf für alle, denen die sagenhaften Waldwesen am Herzen liegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Verehrt, besungen, gejagt — die faszinierende Kulturgeschichte des Rehs als Inspiration für die Menschen von Hildegard von Bingen bis Franz MarcRehe bezaubern. Ihre Anmut hat Maler wie Franz Marc und Dichter wie Christian Morgenstern inspiriert. Und Bambi streift als beliebtester Rehbock durch die Filmgeschichte. Doch jetzt sollen die Rehe an der Misere der Wälder schuld sein. Rudolf Neumaier beleuchtet die Erzählungen und Debatten rund ums Reh über die Jahrhunderte hinweg. Erstmals erzählt er die faszinierende Kulturgeschichte des Rehs vom Wildbret der kleinen Leute zum Emblem von Tattoo-Studios. Eine Hommage an das Reh und ein Weckruf für alle, denen die sagenhaften Waldwesen am Herzen liegen.
Rudolf Neumaier
Das Reh
Über ein sagenhaftes Tier
Hanser
Für Moni
1
Warum ich mir über Rehe Sorgen mache und über sie schreibe
Rehe sind herrenlos. Genauso wie Füchse, Dachse, Marder und all die anderen Tiere in unseren Wäldern. Sie gehören weder dem Bauern, auf dessen Feldern sie ihre Kitze zur Welt bringen und schmackhafte Kräuterblumen aus den Wiesen zupfen, sofern überhaupt noch Blumen wachsen, weil sehr viele Bauern ihre Wiesen sechs Mal im Jahr mähen und sechs Mal mit Gülle zudecken — wie soll da überhaupt noch eine schmackhafte Knospe zum Sprießen kommen? Noch gehören die Rehe den Förstern, in deren Wälder sie sich zurückziehen, weil es draußen zu ungemütlich geworden ist wegen der Mähmaschinen und der Gülle — und wegen der Jäger. Rehe gehören auch nicht den Jägern, jedenfalls nicht, solange sie leben. Erst wenn ein Jäger ein Reh erlegt hat, darf er es sich aneignen. Als Geschöpfe, denen Paragraf 960 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ihre Herrenlosigkeit garantiert, büßen Rehe ihre Freiheit erst mit dem Tod ein. Bis dahin gehören sie uns allen, sie sind vogelfrei. Wir alle haben ein Recht darauf, dass es Rehe gibt. Und dass wir sie zu sehen bekommen.
Rehe sind die ersten Wildtiere, an die ich mich erinnere. Es gab die Hühner meiner Großmutter, die Hauskatze und die Kühe, Pferde und Schweine der Landwirte in meinem kleinen Dorf und die Spatzen und Schwalben, die ich aber in den Hühner- und Kuhställen als Haustiere wahrnahm. Das Dorf heißt Kulbing und liegt im nördlichsten Zipfel des Berchtesgadener Landes. Als ich in den Siebzigerjahren ein Kind war, wurden die Kühe noch alle auf die Weiden gelassen; ich half manchmal am Abend beim Eintreiben zum Melken. Katzen und Kühe, Hühner und Stallhasen waren okay und lieb und nett, aber nichts Besonderes. Bei Rehen war das anders.
Meine Großeltern hatten in dem vormals kleinen bäuerlichen Anwesen eine Sommerpension eingerichtet. Die Gäste aus Hamburg, Düsseldorf, Wanne-Eickel und München — ich nannte sie »Breißn« (Preußen), auch die Münchner — verbrachten hier ihre Sommerfrische, sie badeten im Abtsdorfer See, und am Abend feierten sie ihren Urlaub mit Bier und Schnaps der Marke Steinhäger. Einer dieser Gäste hatte ein Fernglas dabei. Ich glaube, er hieß Schulze, und bilde mir ein, dass er aus dem Ruhrgebiet kam. Mir klingen noch seine Äußerungen »Dat mussu dir mal ankucken, Rudi« und »Rehe ohne Ende« mit lang gedehnten eeees in den Ohren. Einmal sagte er auch: »Die Rehe stehen da vorm Wald wie der Russe in der Kampflinie.« Mit dem Wald meinte er den Kulbinger Filz, der hinter einer Anhöhe namens Bubenberg vor unserem Haus lag. Nach dem Abendessen, das meine Oma den Gästen kochte und ich oft auftrug, und vorm Steinhäger-Trinken ging Schulze in der Abenddämmerung mit seinem Fernglas Rehe gucken, das war für mich als Sechs-, Siebenjährigen ziemlich spät.
Ob Schulze oder ich meine Mutter überredete, dass ich mitkommen durfte zum »Rehekucken«, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls erinnere ich mich gut, dass mein Großvater, Jahrgang 1903, und meine Großmutter, Jahrgang 1914, es ein wenig irritierte, als ich ihnen von Schulzes Beobachtungen berichtete. »Der Herr Schulze sagt, dass die Rehe vorm Filz stehen wie der Russe in der Kampflinie.« Mein Großvater reagierte interessiert, aber keineswegs erheitert. Er kannte »den Russen« aus dem Zweiten Weltkrieg; an der Ostfront hatte er eine Schussverletzung erlitten. Den Haken an Schulzes Vergleichen kapierte ich erst viel später.
Jedenfalls sah ich die Rehe eines Abends in einem Sommer der Siebzigerjahre vom Bubenberg aus; mit Herrn Schulzes Fernglas. Während ich staunte und zählte, flüsterte Schulze den anderen Begleitern etwas von einem »Battalliong« zu. Ich staunte über Schulze, ich hätte nie gedacht, dass dieser Mann so leise reden kann. Und ich staunte über die Rehe und das Wort Bataillon, das mir neu war. Was es bedeutete, ließ sich ja erschließen. Es waren mehr als zwei Dutzend Rehe. Eine Herde, kann man sagen.
Dieses Bild habe ich nie vergessen. Die Rehe fesselten mich.
Als ich später Werke des Malers Franz Marc sah, musste ich an meine Kindheit denken. An die Tiere vor dem Kulbinger Filz, dieses heilige Idyll, das mir Schulze, der Sommerfrischling, gezeigt hatte.
Wenn ich’s recht bedenke, kam ich mit Franz Marcs Kunst ziemlich genau in den Jahren in Verbindung, in denen ich bei den Besuchen daheim in Kulbing regelmäßig mit meinen Eltern bei Heidi einkehrte, um Reh zu essen. Möglicherweise werden jetzt einige Leserinnen und Leser innehalten und sich fragen, was das soll. Da befasst sich einer jahrelang mit Rehen, er schwärmt von ihnen, er vergöttert sie. Und dann isst er sie auf! Es ist das klassische Dilemma von tierliebenden Fleischessern. Ich bin mit vergleichsweise vielen Vegetariern befreundet, denen ich erspare, ein Schnitzel Wiener Art zu bestellen, wenn ich mit ihnen im Restaurant bin. Besser gesagt, ich erspare es ihnen, weil sie sich empören müssten, und mir erspare ich ihre Blicke. Immerhin achte ich darauf, dass ich kein Billigschwein aus einer Schweinefabrik esse. Pute hat bei mir generell keine Chance; ich habe zu viele Putenhaltungsfilme im Fernsehen gesehen. Gegen Reh haben die meisten Vegetarier allerdings nichts einzuwenden. Es hat sein Leben in absoluter Freiheit verbracht und im besten Fall nicht einmal seine eigene Tötung mitbekommen, weil die Büchsenkugel des Jägers schneller unterwegs ist als der Schall und ein gut getroffenes Reh sofort tot umfällt. Wenn ich bei Heidi ein Schweineschnitzel verzehren würde, wäre das Schweineschnitzelverzehren eine vergleichsweise abstrakte Angelegenheit, weil außer einem panierten oder von Soße bedeckten Stück Fleisch nichts vom Schwein zu sehen ist. Rehe sind präsenter. In vielen bayerischen Gaststätten hängen die Totenschädel von Rehböcken an der Wand. Bei Heidi auch.
Heidi ist Jägerin und Wirtin und Köchin, sie führt ein Gasthaus in Saaldorf nahe Salzburg, aber auf der deutschen Seite. Auf ihrer Speisekarte stehen mindestens sechs Rehgerichte. Rehschnitzel, Rehbraten, Rehmedaillons und und und. Ich nehme Rehragout, nichts anderes. Heidi hatte eine solche Freude an meinem Appetit, dass sie mir immer doppelten Nachschlag gab und einen zweiten Semmelknödel mit gefühlt 15 Zentimetern Durchmesser. Was soll’s, sagte ich mir, Reh hält ganz bestimmt schlank, jedenfalls im Gegensatz zu einer Schweinshaxe. Beim Essen dachte ich nicht an Franz Marc und ausnahmsweise auch nicht an die Rehe vorm Kulbinger Filz, allenfalls kam mir mal das bayerische Volkstanzlied mit dem Titel »Rehragout« in den Sinn. Man kann schon ins Grübeln kommen. War das Rehragout dafür verantwortlich, dass das Lied so bekannt wurde in Bayern? Oder war es umgekehrt — dass dieses Gericht erst durch dieses eingängige Stück aus der traditionellen Volksmusik Popularität erlangte? Der Text ist denkbar schlicht und kurz: »Ja, was gibt’s denn heut auf Nacht? Ja, was gibt’s denn heut auf Nacht? Heut’ gibt’s a Rehragout, a Rehragout, a Rehragout.« Man tanzt im gemütlichen Polkaschritt dazu. Irgendein Spaßvogel dichtete dann eine zweite Strophe dazu, in der die Qualität dieser Speise in Zweifel gezogen und Schweinefleisch als besser oder edler dargestellt wird: »Ich wüsste noch was Feiners, von der toten Sau ein Schweiners.« Klar, über Geschmacksfragen soll man nicht streiten; ich vertrete allerdings die Meinung, dass der beste Schweinebraten nicht mit Rehragout mithalten kann, und schon gar nicht mit dem von Heidi.
Ein Reh zu töten kostet Überwindung. Ich war 47 Jahre alt, als ich die Jägerprüfung absolvierte. Tiere zu töten hatte mir nie Probleme bereitet. Ich war damit aufgewachsen, dass Tiere sterben müssen. Beim Nachbarn auf dem Bauernhof wurde einmal im Jahr die Sau gestochen; wir Kinder waren dabei, und die Nachbarin gab mir den Rüssel und die Ohren des Schweines in einer Schüssel mit nach Hause. Mein Großvater liebte diese knorpeligen Extremitäten, er kaute sie genüsslich mit seinen dritten Zähnen, dass es krachte. Mit sieben oder acht Jahren engagierte mich meine Großmutter zum Hühnerschlachten. Mit dem Hackebeil spaltete ich schon recht versiert Brennholz, da traute sie mir auch das Trennen eines Huhns von seinem Haupt zu. Ich mochte unsere Hühner, aber was sein musste, musste sein: Wenn sie alt waren und keine Eier mehr legten, gehörten sie weg. Oder sagen wir so: Sie waren dann reif für die Suppe. Sentimentalitäten wie ein Gnadenbrot bis zum Lebensende älterer Haustiere konnten oder wollten sich damals noch die wenigsten leisten. Der Nachbarin, die immer mit ihren Speiseresten zum Hühnerfüttern kam und dann immer auch gleich die neuesten Neuigkeiten aus dem Dorf und dem Rest der Welt mitbrachte, dieser Nachbarin schenkten wir immer eine der von mir geschlachteten Hennen als Suppenhuhn. Einem anderen Nachbarn konnte ich problemlos beim Stallhasenschlachten zuschauen, und wenn er mir selbst seinen Knüppel in die Hand gedrückt hätte, dann hätte ich wohl auch einen Stallhasen getötet. Wie man Hasen ausnimmt, hatte ich oft genug bei den Treibjagden gesehen, die im Herbst in unserer Gegend stattfanden, als Hasen und Fasane noch keine Seltenheit waren. Wir Jungs radelten immer hinter dem Sammelwagen her, auf dem über Fichtenzweigen die erlegten Tiere hingen. Und außerdem tötete ich von klein auf Fische, die ich schwarz geangelt hatte. Bis sie an meinem Haken zappelten, waren die Fische auch herrenlos — und bis ich sie mir aneignete, indem ich sie in eine Socke steckte, die ich auszog, um darin die illegal erbeuteten Fische am Haus eines strengen Fischers vorbei nach Hause zu schmuggeln und meine laut Strafgesetzbuch als Fischwilderei zu verfolgende Straftat zu vertuschen. Wir aßen sie freitags. Meine katholischen Großeltern waren selbst noch mit strengen Fastenregeln aufgewachsen, und da gab’s am Freitag Mehlspeise oder Fisch. Einmal wäre mein Großvater fast an einer Gräte erstickt, es war schrecklich. Ich weinte und betete. Man hofft als katholischer Schwarzangler mit acht Jahren, dass es doch bitte keine Strafe Gottes sei, wenn der Großvater nun ausgerechnet wegen der Gräte eines schwarz geangelten Fisches blau anläuft. Allein die Großmutter, die ihren ernsthaft um Luft ringenden Mann auf den Küchentisch legte, blieb völlig gelassen. Der Opa habe ja den Blasius-Segen, da werde schon nichts passieren. Der heilige Blasius ist für Halsprobleme zuständig. Seither gehe ich jedes Jahr am 3. Februar in die Kirche, um mir den Blasius-Segen zu holen.
Hühner, Hasen, Fische — das Töten gehörte zur Selbstversorgung. Es machte mir nie etwas aus. Bei Rehen war und ist es anders. Ich brauchte nach der Jägerprüfung neun Monate, bis ich es übers Herz brachte, das Leben eines Rehs zu beenden. Ich war sehr viel in der Natur beim Jagen, und es hätte viele Möglichkeiten zum Schießen gegeben. Ich ließ es lieber. Die Jägerprüfung hatte ich nicht gemacht, um irgendwann Rehe oder Wildschweine zu jagen. Vielmehr wollte ich all das lernen, was man wissen muss, um jagen zu dürfen — und vor allem um darüber schreiben zu können. Ich hatte da schon fast 30 Jahre als Journalist gearbeitet. In der Schulzeit hatte ich angefangen und mir in der Sportredaktion der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg mit Sportberichten ein hübsches Taschengeld verdient. Nach zehn Jahren — nach dem Studium — ging ich zur Süddeutschen Zeitung, und nach meiner Promotion im Fach Geschichte — weitere zehn Jahre später — wurde ich Leitender Redakteur im Feuilleton. Ich fühlte mich für eher abgelegene Themen zuständig. Und so hatte ich eines Tages die Idee, mehr Natur ins Feuilleton zu bringen. So kam ich zur Landwirtschaft, zu den Tieren, denen sie zusetzt, und letztlich zu den Rehen.
Die Jägerprüfung scheint ein Modetrend zu sein. Jahr für Jahr melden die Verbände neue Höchstzahlen; ein Viertel der Jagdazubis sind inzwischen Frauen. Sie haben unterschiedlichste Motive ermittelt: Die einen wollen sich möglichst einmal selbst mit Wildbret versorgen können, die anderen sich als Natur- und Artenschützer betätigen. Dass wohl auch ein beträchtlicher Teil der Neujäger einfach nur scharf auf Waffen ist, blenden die Verbände eher aus. Ich habe solche Freaks kennengelernt. Ich selbst hatte gerade meine große Recherche zum Wald und zum Wild begonnen, und wahrscheinlich war ich auch so ein Naturtrendfuzzi, der sich als Motiv das Interesse an einem besseren Naturverständnis auf die Fahnen schrieb.
Die Prüfung besteht aus 6 Fächern mit gefühlt 15 Teilfächern. Waffen, Wildbiologie, Recht, Jagdliche Praxis, Hunde und Naturschutz-Landwirtschaft-Forstwesen. Ich hatte nach der Schule den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigert. Man musste diese Entscheidung ausführlich und wasserdicht mit einer schriftlichen Stellungnahme belegen. Wer Zweifel aufkommen ließ, wurde vor ein Gremium von Gewissensprüfern geladen und musste Fragen wie »Was machen Sie, wenn der Russe kommt und ein Soldat Ihre Schwester aus dem Haus zieht?« beantworten. Ich schrieb damals, durchaus aus Überzeugung, dass ich niemals im Leben etwas mit Waffen zu tun haben wolle. Ob ich mir 30 Jahre später schäbig vorgekommen bin, als ich zum ersten Mal in einem Schießstand auf Tontauben schoss? Nein, schäbig nicht. Auch nicht wie Joschka Fischer, der ehedem friedensbewegte Grüne, der dann als Außenminister deutsche Soldaten in Kampfeinsätze schickte. Aber seltsam war es dann doch, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Dementsprechend viel hatte ich zu lernen, um die Schießprüfung zu bestehen. Bei den ersten Übungen fühlte ich mich wie früher in den Mathestunden, in denen ich gar nichts kapierte. Aber es war tausend Mal interessanter.
Die anderen Fächer waren reine Lernsache. Vögel, Schmetterlinge, Bäume und Gräser bestimmen, Tierkrankheiten erkennen, die Jagdverordnungen bis in die Details pauken, die vertrackten Regeln für die Gebrauchshundeprüfungen büffeln.
Wenn man allein die Prüfungsfragen über Rehe studiert, weiß man theoretisch schon jede Menge über diese Tiere.
Welche Aussagen sind richtig?
Stein- und Sikawild zählen zu den Hornträgern
Gamswild ist Wiederkäuer, besitzt aber keine Gallenblase
Schwarzwild hat keinen Pansen
Rehwild hat keinen Netzmagen
Damwild ist ein Wiederkäuer
In welcher zeitlichen Reihenfolge brunften die Schalenwildarten im Jahreslauf?
Damwild — Rehwild — Rotwild — Gamswild
Rehwild — Rotwild — Damwild — Gamswild
Rotwild — Rehwild — Gamswild — Damwild
Gamswild — Damwild — Rotwild — Rehwild
Rehwild — Damwild — Rotwild — Gamswild
Eine exakte Bestandsermittlung von Rehwild ist
durch Zählung nicht möglich
anhand der letzten Abschüsse möglich
aufgrund des Kitzabschusses möglich
nur im April möglich
Welche der nachgenannten Kulturpflanzen eignen sich zur Aussaat auf Wildäckern für die Herbst- und Winteräsung des Rehwilds?
Sommergerste
Rübsen
Raps
Wodurch wird beim Rehbock Perückenbildung ausgelöst?
Laufverletzungen
Verletzung der Brunftkugeln
Borreliose
Vererbung
Perücke? Brunftkugeln? Allein die letzte Frage klingt für Menschen, die sich noch nie mit Rehen beschäftigt haben, geradezu geheimnisvoll. Im Jagdkurs habe ich gelernt, dass früher viel häufiger Rehböcke mit Perückenbildung anzutreffen waren. Das lag an den oft in der Weidetierhaltung eingesetzten Stacheldrähten. Die Böcke blieben mitunter an diesen Zäunen hängen und verletzten sich die Brunftkugeln am Kurzwildbret, was in die Umgangssprache übersetzt nichts anderes heißt als die Hoden am Geschlechtsteil. Diese Verletzung wiederum wirkte sich auf die Testosteronproduktion aus. Sie hörte nicht mehr auf. Das heißt: Das Rehgeweih, das Böcke normalerweise im Spätherbst werfen, fällt nicht mehr herunter, wenn die hormonelle Steuerung ausgefallen ist. Im Gegenteil: Das Gehörn wächst und wächst, es wuchert und wuchert. Wenn es für die Tiere äußerst übel läuft, wuchert das Gehörn sogar die Augen zu, und der Bock erblindet. Zum Glück gibt es kaum noch Stacheldrähte.
Von den 180 angebotenen Unterrichtsstunden war ich in 174 anwesend, statt der 60 vorgeschriebenen Praxisstunden absolvierte ich 155. Extrem spannend war das alles. So kam ich den Rehen immer näher.
In der praktischen Ausbildung hatte ich eine Reihe von Reherlebnissen, die ich ebenso wenig vergessen werde wie die Rehe vom Kulbinger Filz in der Kindheit. Eines Morgens im September kurz nach Sonnenaufgang zog eine Rehgeiß mit ihren beiden Kitzen unter meinen Jägerstand. Wäre ich hinuntergeplumpst, hätte ich sie erschlagen. Die Rehe aber legten sich ins Gras und ruhten sich aus. Ich war gefangen — denn wer will schon eine solche Ruhepause stören? Nach dreieinhalb Stunden, in meinem Jägerstand hatte es inzwischen gefühlt 35 Grad, bequemten sich die drei Rehe aufzustehen und weiterzuziehen.
So etwas passierte mir danach nie wieder. Ich kann nur jeder und jedem empfehlen, sich mal auf einen solchen Stand zu setzen und die Rehe zu beobachten. Es gibt kaum etwas Schöneres, Unterhaltsameres, Entspannenderes. Allerdings muss man dann auch im richtigen Moment absteigen können. Wenn die Rehe stundenlang dort bleiben, versetzt man ihnen den Schock ihres Lebens, wenn man plötzlich die Leiter hinunterrumpelt. Das will keiner. Im Lauf der Zeit habe ich Techniken entwickelt, wie ich die Rehe zum Weiterziehen bewegen kann, ohne sie zu verschrecken. Ich bleibe sitzen und belle erst mal. Wie ein Reh. Das Bellen des Rehs ist dem des Hundes nicht ganz unähnlich, mit ein bisschen Übung kann man es schnell nachmachen. Mit diesem Laut warnen sich Rehe gegenseitig. Oft ziehen sie weiter, wenn sie ein Bellen vernehmen. Dann kann man beruhigt absteigen. Wenn es mit dem Bellen nicht funktioniert, gebe ich schnalzende Laute von mir. Die Rehe denken sich »Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich mich zur Sicherheit mal aus dem Staub mache«. Man will ja vermeiden, dass das Reh auf die Idee kommt, ein Mensch sei in seiner Nähe. Sonst lässt es sich womöglich nicht mehr so gern blicken. Also zündet man erst die dritte Eskalationsstufe, wenn Bellen und Schnalzen ohne Effekt bleiben: reden. Einfach reden. Wie Spaziergänger. Keine Sorge, es ist völlig normal, dass man sich blöd dabei vorkommt, in einer Lichtung fern der Zivilisation Selbstgespräche zu führen oder laut von eins bis hundert zu zählen. Kleiner Tipp: Man kommt sich weniger blöd dabei vor, wenn man Gedichte aufsagt — oder zumindest die paar Brocken, die man noch im Kopf hat. So habe ich den Rehen schon Gedichte von Christian Morgenstern (»Ein Seufzer lief Schlittschuh …«) und H. C. Artmann (»I bin a Ringlgschbübsizza«) zum Vortrag gebracht, oft mit dem Erfolg, dass sie sich trollten. Oft, aber nicht immer. Da fällt mir die Rehgeiß ein, die einen Veitstanz aufführte, als ich mein Programm von einem Jägersitz aus abspulte. Erst bellte ich — sie bellte zurück. Ich bellte noch mal — sie bellte zurück. Noch mal, und viel unheilvoller bellte ich — sie bellte zurück. Da sah ich hinter der Guten, dass sie ein wenige Tage altes Kitz führte. Ich bellte, sie bellte zurück — und plötzlich bellte hinter mir noch ein Reh.
Neumaier (forte): Böäh!
Reh 1: Böäh!
Reh 2: Böäh!
Neumaier (fortissimo): Böäh, äh, ä, ä!
Reh 1: Böäh!
Reh 2: Böäh!
Neumaier (forte fortissimo): Böäh, äh, äh, ä, ä, ä, ä!
Reh 1: Böäh!
Reh 2: Böäh!
Ich hatte zwei Echos, eins vor mir, eins hinter mir. Es brachte nichts. Also schaltete ich auf die Schnalzgeräusche um. Dazu klappe ich im Mund die Zunge um und lasse sie nach vorn katapultieren. Das brachte die Rehgeiß erst in Wallung. Von einer solchen Reaktion hatte ich bis dahin weder gehört noch gelesen. Die Geiß sprang in die Höhe, und beim Aufkommen auf den Boden stampfte sie so heftig auf, dass mir mulmig zumute wurde. Sie merkte: Da ist etwas faul, und womöglich hat es jemand oder etwas auf das Kitz abgesehen. Statt zu flüchten, wählte das Reh die Drohgebärde: »Komm her, du präpotentes Etwas, und ich mach Hackfleisch aus dir mit meinen Hufen!« Ich war ratlos. Wenn ich jetzt abstiege, würde mich das Reh tottrampeln — vielleicht sogar mit Unterstützung des Rehs hinter mir. Also redete ich wieder. »Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis und träumte von« — das Reh sprang weiter auf — »Liebe und Freude. Es war an dem Stadtwall und schneeweiß glänzten die« — das Reh hielt inne — »Stadtwallgebäude. Der Seufzer dacht’ an ein Maidelein und blieb« — das Reh entschied sich jetzt einfach, regungslos stehen zu bleiben und von dem vermeintlichen Spaziergänger in der Dämmerung nicht wahrgenommen zu werden — »erglühend stehen. Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein und er sank und ward nimmer gesehen.« Ich wartete auf eine Reaktion, auf ein »Böäh« vielleicht oder noch einen Sprung oder einen Rehseufzer, wenn es so etwas gibt. Das Reh und sein Kitz standen 40 Meter vor mir wie zwei Porzellanfiguren, als ob sie sich unsichtbar fühlten. Wenn ich jetzt absteige, dachte ich, geht die Trampelei von vorn los, und die Geiß bricht mir das Genick. Es wurde dunkler. Ich ließ es drauf ankommen, wenn das Reh jetzt nicht reagierte, würde ich den Rest meines Lebens auf dem Hochstand verbringen, und irgendwer würde eines Tages einen mumifizierten Jäger finden, der verhungert und verdurstet ist. Also sang ich.
Aber was singt man vor einem Reh? Ohne Instrumentalbegleitung und ohne Noten? Ich dachte an Kurt Moll, den für mich größten Bassisten und unprätentiösesten Weltstar aller Zeiten. Wenn ein Bass wie Kurt Moll sich leicht räuspert, bebt die Erde im Umkreis von fünf Metern, als wenn ein Sattelschlepper den Motor anwirft. Na gut, man kann es ja mal probieren. Ich setzte an: »O Isis und Osiris.« Die Arie des Sarastro aus der »Zauberflöte«. Das Reh blieb stehen und hörte sich die halbe Arie an, dann probierte ich es mit einem Schlager. »Fiesta Mexicana« von Rex Gildo. Ob es an meiner kläglichen Stimme lag oder an einer Aversion des Rehs gegen Schlager — ich weiß es nicht. Bald nach dem zweiten »Hossa« sprang das Reh schon ab, sein Kitz folgte ihm behände. Zu Hause fragte meine Frau, warum ich so spät heimkomme. Ich erzählte ihr von dem Reh, von Kurt Moll und Rex Gildo. Sie fragte, ob ich noch ganz bei Trost sei.
Rehe sind umstritten. Die meisten freuen sich, wenn sie Rehe sehen. Es gibt aber auch Menschen, die Rehe wegen ihres Appetits auf die Knospen junger Bäume als Probleme oder gar als Ungeziefer betrachten. Mich als Journalist hat dieses Thema interessiert. Mehr als drei Jahre lang habe ich zu diesem Thema recherchiert. Ich habe mich mit Jägern unterhalten und mit Förstern, mit Biologinnen und mit Waldbesitzerinnen, mit Politikern und Tierschützerinnen. Und vor allem ließ ich mir Wälder zeigen, in denen es Rehe gibt.
In der letzten Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel stand im Bundestag eine Erneuerung des Bundesjagdgesetzes auf der Tagesordnung. Das Bundeslandwirtschaftsministerium legte einen Entwurf vor, bei dem es für Rehe nicht gut ausgesehen hätte. Diesem Entwurf zufolge hätten die Abschusspläne für Rehe abgeschafft werden sollen. Solche Pläne werden in vielen Bundesländern von Jagdbehörden vorgegeben. Sie regeln, wie viele Rehe innerhalb von drei Jahren zu erlegen sind. Nach drei Jahren kommt ein neuer Abschussplan. Der Gesetzesentwurf ging vom heuchlerischen Mantra der Forstleute aus, es gebe zu viel Wild, das dem Wald schade, weil der Wolf als natürlicher Feind weitgehend fehle. Er sah vor, dass bei Rehen nur noch Mindest-, aber keine Höchstabschusszahlen vorgeschrieben werden sollen. Rehgegner hätten die Bestände völlig unkontrolliert auf ein Minimum dezimieren können. Rehe hätten also für den Klimawandel büßen müssen und dafür, dass Förster jahrzehntelang Monokulturen bewirtschaftet hatten, die jetzt mühevoll in Mischwälder umgebaut werden müssen. Zu einer Gesetzesänderung kam es letztlich nicht, weil die Vertreter der Pflanzen — die Förster — und die Vertreter der Rehe — die Jäger und die Tierschützer — zu unterschiedliche Vorstellungen haben. Und vielleicht auch, weil die Vorträge der Wissenschaftler, die auf tierschutzrechtliche Bedenken und auf die Tatsache verwiesen, dass die in den letzten 50 Jahren stark gestiegenen Abschusszahlen ziemlich uneffektiv blieben, bei der Anhörung im Bundestag den Abgeordneten zu denken gaben. Und mir ebenfalls.
Ich habe bei meinen Recherchen mit vielen Rehgegnern gesprochen. Die meisten waren Forstökonomen — Menschen, die mit Holz Geld verdienen. Von ihnen sind die anderen Rehgegner indoktriniert. So traf ich zum Beispiel einen Naturschützer, der aus einer Försterfamilie stammt. Er arbeitet hauptberuflich bei einem Naturschutzverband. Ich sagte: »Wenn ich in den Wald gehe, nehme ich oft Schafwolle mit. Ich wickle sie um die Triebe junge Bäume, damit den Rehen der Appetit darauf vergeht.« Er fragte: »Warum tun Sie das?« Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. »Warum ich das tue? Na, weil ich den Bäumen beim Wachsen helfen will.« Der Naturschützer reagierte ungehalten. »Das sollen Sie nicht tun! Sie sollen schießen!« Bei diesem Gespräch kamen mir die Schlümpfe in den Sinn. Die Schlümpfe sind eine muntere Truppe, die im Wald lebt und von dessen üppiger Vegetation vor ihrem Widersacher geschützt wird, dem bösen Zauberer Gargamel, assistiert von einem ebenso bösen Kater namens Asraël. Tatsächlich hatte mancher Rehhasser, den ich bei meinen Recherchen kennenlernte, auch äußerlich Ähnlichkeit mit dem verbissenen Gargamel.
In meinem Büro stapeln sich fast schon meterweise Aufzeichnungen, Kopien und Bücher über Rehe. Diese Tiere haben jetzt ein paar Jahre lang meine freie Zeit in Beschlag genommen. Für viele der Menschen, die mir etwas über die Rehe zu sagen hatten, ist es nicht besonders rühmlich, wenn ich sie in meinem Buch erwähne. Um mir juristische Auseinandersetzungen zu ersparen, mache ich sie mit Pseudonymen unkenntlich. Andere Namen sind aber das Einzige, was ich in meinen Rehgeschichten erfunden habe. Ich habe sie recherchiert, wie ich es als Journalist gelernt hatte und wie es der Pressekodex vorgibt.
Erst mal habe ich historische Literatur gewälzt. Schriften aus dem 16. Jahrhundert, Bücher aus dem 18. Jahrhundert, dann einige Bücher von Historikern über die Jagd in früheren Zeiten. Wenn ich diese Bücher zitiere, dann verwende ich der einfacheren Lesbarkeit halber unsere heutige Schreibweise. Abgesehen von wildbiologischen Abhandlungen gab es speziell über Rehe nicht viel, man muss dieses Tier wirklich suchen. Man trifft es eher selten, kann aber viel finden über die Einstellung der Menschen zu Rehen und anderen Wildtieren. Wenn Förster und die von ihnen beeinflussten Politiker heute die sogenannte Wald-Wild-Problematik heraufbeschwören, dann erweist sich das vermeintlich neue Problem skurrilerweise beim Blick in Bücher, die zu Zeiten Goethes und Rilkes geschrieben wurden, als uralt. Diese historische Dimension hat mich selbst ein wenig überrascht. Warum haben alle schon vergessen, dass sich Förster bereits vor 200 Jahren Verbissschutzmaßnahmen sparen wollten?
Es stimmt, solange Adelige ihre alleinigen Jagdprivilegien auslebten, hatten ihre Untertanen bitter darunter zu leiden, weil sie zusehen mussten, wie Hirsche und Wildschweine ihre Feldfrüchte auffraßen. Die Beobachtung aber, dass Rehe und Hirsche in forstwirtschaftlichen Flächen zu Schaden gehen, ist exakt so alt, wie es forstwirtschaftliche Flächen gibt. Jahrtausende und Jahrhunderte lang ließen die Menschen den Wald Wald sein, sie nutzten das Holz zum Bauen und zum Heizen. Erst mit der Erzgewinnung, mit der Vorindustrialisierung, mit wirtschaftlichen Aufschwüngen da und dort wurde Holz zu einem Material, das nicht mehr ausgehen durfte: zu einer erneuerbaren Energieressource. Und genau seit dieser Zeit sind Reh und Hirsch den Verantwortlichen, die für Holznachschub sorgen müssen, den Förstern, ein Dorn im Auge. Sie bauten Wälder, die längst nicht mehr natürlich waren. Das Reh passte sich den neuen Verhältnissen immer an. Sich zu vermehren war die natürliche Reaktion eines Tieres auf eine unnatürliche Entwicklung. Andere Tierarten gingen an dieser Entwicklung fast oder ganz zugrunde. Wo gibt es noch Haselhühner? Birkwild? Auerwild? Den Pirol? Sogar Hasen sind selten geworden.
Jetzt sollen Wälder wieder in einen naturnäheren Zustand umgebaut werden, damit sie den Folgen des Klimawandels besser trotzen. Das Reh wird sich auch damit arrangieren. Ein künstlich hergestellter Wald wird künstlich zu einem vorgeblich naturnäheren Wald umgebaut — bleibt aber unterm Strich künstlich, weil er umgebaut wird und die Menschen kein Vertrauen haben, dass er natürlich aufwächst. Oder weil viele Förster überflüssig wären, wenn man die Natur sich selbst überließe. Man überlässt sie aber nicht sich selbst, sondern man pflanzt und sät zum Teil exotische Baumarten wie Libanonzedern an und will sich Schutzmaßnahmen sparen, die einst selbstverständlich waren. Und deswegen, meinen die Förster, muss die natürliche Vermehrung der Rehe mit aller Gewalt eingedämmt werden.
Wenn ich heute zu Hause bei meiner Mutter auf die Anhöhe Bubenberg gehe und nach Rehen schaue, habe ich ein eigenes Fernglas. Die Gläser sind sicher besser als das Exemplar von Herrn Schulze. Ein Teil des Waldes, aus dem die Rehe damals zum Äsen auf die Wiese gezogen waren, gehört heute meiner Mutter, sie hat ihn einer Nachbarin abgekauft. Aber die Wiesen davor bleiben Abend für Abend leer.
Warum? Das habe ich Christian gefragt. Christian kam im Jahr 1939 zur Welt, er wuchs als Bauernjunge an und in dem Wald auf, den ich später mit dem Sommerfrischler Schulze beobachtete. In seiner Kindheit waren es 60 bis 70 Rehe. Auf den Wiesen vor dem Kulbinger Filz. Jeden Abend.
Ich kannte Christians Vater, den alten Bergerbauern. Der saß jeden zweiten Nachmittag bei meinem Großvater, er hatte nur noch ein Auge und kam immer mit einem Gehstock. Einmal spazierten der Berger, der Opa und ich nach Pfaffing und setzten uns auf eine Bank, hinter der es stank. Für mich jedenfalls. Ein totes Reh lag da im Wald, und wenn es nicht so fürchterlich nach Verwesung gestunken hätte, dann hätte ich es gestreichelt. Opa und der Berger mit ihren weltkriegserprobten Nasen gaben sich nicht damit ab. Der Bergerbauer politisierte gern und heftig, daran erinnere ich mich gut. Christian hat ein völlig anderes Temperament als sein Vater, er ist viel ruhiger. Er heiratete von dem exponierten Bauernhof ins Dorf hinein und hat es über Jahrzehnte hinweg als Einzelhändler mit Lebensmitteln versorgt. Anfang der 1960er-Jahre wurde er Jäger.
Christian ist ein besonnener und rechtschaffener Mann. Manchmal stifte ich Messen für meine Großeltern oder für meinen Vater. Man zahlt einen Fünfer an die Pfarrei, und bei einem Gottesdienst wird dann für die Person gebetet, für die man gezahlt hat. Wenn ich dann diesen Gottesdienst besuche, sehe ich oft Christian mit seiner Frau. Menschenskinder, denke ich mir, jetzt ist der auch schon 80 — und schaut gut aus. An seinen politisierenden Vater erinnert wirklich sehr wenig.
Ich musste Christian wegen der Rehe fragen, um meine Kindheitserinnerungen zu verifizieren: »Du schaust vom Buamberg hinunter und siehst kein Reh, keinen Fasan und gar nichts. Komme ich nur an Tagen, an denen sie im Wald bleiben, oder was ist da los?«
»Da ist nichts mehr los. Egal wann du kommst.«
»Als ich klein war, standen da noch 20, 30 Stück herum. Oder?«
»Ja. Und als ich klein war, da waren es zwischen Eschlbach und Berg 60 bis 70 Stück. Die gleiche Fläche. Da hast du nie in den Wald gehen können, ohne ein Reh zu sehen.«
»Und jetzt?«
Christian rechnet. Aber er kommt auf keine Zahl. »Wenn ich sage, es hat bei uns damals zehn oder fünfzehn Mal so viele Rehe wie heute gegeben, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen.«
In den 1960ern mussten die Jäger ungefähr vier Rehe pro hundert Hektar ihrer Pachtfläche erlegen. Für jedes zu erlegende Reh gab die Jagdbehörde im Landratsamt eine Plombe aus, mit der das Stück dann markiert werden musste — damit ja nicht zu viele Rehe geschossen wurden. »Wenn du ein Reh mehr als erlaubt geschossen hättest, dann wärst du wie ein Verbrecher dagestanden«, sagt Christian.
Und heute fordern manche Bauern meiner Heimatgemeinde noch höhere Abschusszahlen. Christian und sein Sohn, ebenfalls Christian, haben Wildkameras aufgestellt. Manchmal, eher selten, lassen sich darauf nachts Rehe blicken. »Vor 20 Jahren hast du noch keine Kamera gebraucht, wenn du ein Reh sehen wolltest.« Die Jäger haben damals Salzsteine aufgestellt und vor diesen sogenannten Salzlecken den Boden so glattgetreten, dass sie an den Spuren der salzleckenden Tiere erkannten, was gerade unterwegs ist. Heute bleiben platt getretene Flächen vor Salzlecken tage- und wochenlang unberührt.
Die Rehpopulation ist in den letzten 40 Jahren empfindlich abgeknallt worden, und die Tiere, die es noch gibt, verstecken sich bis in die Nacht. Sie haben gelernt, dass es lebensgefährlich ist, vor den Wald zu treten. Die Jäger meines Heimatdorfes mussten immer mehr Rehe erlegen. Abschusszahlen werden von der Jagdbehörde vorgegeben. Wo früher pro Revier 20 Stück im Jahr zu schießen waren, sind es heute 60.
Greifen wir das Schlümpfe-Bild noch mal auf. Die Gargamels, die gegen die Rehe kämpfen, die Rehgegner haben derzeit Oberwasser. Sie setzen immer höhere Abschusszahlen durch, einige von ihnen besorgen sich selbst den Jagdschein, weil ihnen die herkömmlichen Jäger nicht genug schießen. Die Rehgegner besetzen entscheidende Positionen in den entscheidenden Behörden und Naturschutzverbänden, die meisten von ihnen sind Förster. Verbiss, Verbiss, Verbiss, man hört von ihnen immer nur Verbiss. Die Einzigen, die mir zu verbissen vorkommen, sind diese Gargamels.
2
Das Reh und die Kunst
Das Reh als Identifikationsgestalt und Objekt der Bildenden Kunst
Tiergedichte kommen gut an. Und Rehgedichte besser als Vogelgedichte. Das ist meine sehr subjektive Erfahrung. Nach der Schule stand ich vor der Wahl, ob ich Jura studiere, nur noch lerne und es den anderen überlasse, das Leben zu genießen — oder ob ich irgendwas studiere, bei der Zeitung als Journalist und in einer Kneipe jobbe. Dieses Irgendwas wurde dann Geschichte und Germanistik. Wenn ich das Leben genoss, saß ich nachts mit anderen jungen Menschen in verrauchten Lokalen, und wenn keinem mehr etwas einfiel, versuchte ich sie mit Gedichten zu betören. Seitdem sage ich: Mit Tiergedichten ist man immer vorn dabei, mit Rehgedichten ein Held. Schnabeltiere zum Beispiel sind nett, aber zu ausgefallen, Möwen sind auch nett, aber verzaubern nicht. Rehe hingegen liebt jeder. Sie evozieren beim Auditorium ein Augenleuchten: Flugs haben alle einen Bambi-Blick. Ich bewundere heute noch jeden Juristen, der tüchtig studiert hat, und gönne ihm jeden Cent, den er mehr verdient als ich. Die Germanistik war der bessere Zeitvertreib, sie hat mir die Augen für die Lyrik geöffnet, ich habe ihr viel Schönes zu verdanken.
Das Reh ist wie gemacht für Künstler und Schwärmer. Es ist schön, scheu und schamhaft. Diese Attribute dichten ihm die Menschen an, seit sie dieses Tier mit Reimen besingen. Für manche Künstler ist es gar der Inbegriff der Anmut. Wer Rehe eine längere Zeit beobachtet hat, wird aber zugeben müssen, dass kaum einer von ihnen dem Wesen des Rehs näher gekommen ist als Heinz Erhardt. Sein Zweizeiler
»Das Reh springt hoch, das Reh springt weit.
Warum auch nicht? Es hat ja Zeit.«
bringt es auf den Punkt. Das Reh mag ja liebreizend aussehen, aber wenn man es in Ruhe und ungestört vor sich hinleben lässt, hört es den Vögeln beim Zwitschern, es schaut dem Gras beim Wachsen zu und vertreibt sich den Ennui durch gelegentliche Sprünge hier- und dorthin. Es ist: unbekümmert. Treffender als Heinz Erhardt, einer der komischsten Spaßvögel unter allen deutschen Dichtern, hätten es Verhaltensbiologen und Zoologinnen nicht formulieren können. Nebenbei bringen diese beiden Verse die enormen sportlichen Fähigkeiten dieses Tieres zum Ausdruck, die von den Reh-Melancholikern unter den Malern und Poeten oft unterschlagen werden. So gesehen, kann man Heinz Erhardts Pointe fast schon als Universalbeschreibung durchgehen lassen. Das Reh vermag wirklich sehr hoch und sehr weit zu springen, der Sprung des Bockes ist mit einem eigenen Fachterminus ins Vokabular der Dressurreiter eingezogen. Dieser Begriff ist eng mit dem zoologischen Namen des Rehes verwandt: Kapriole. Ein Pferd so weit zu bekommen, dass es in vollkommenster Eleganz springt wie ein Rehbock, erfordert Geschick und beharrliches Training. Nur die besten Pferde schaffen das mit ihren Reiterinnen und Reitern.
Wer mal einen Film mit Heinz Erhardt gesehen hat, wird dem Witzbold des deutschen Wirtschaftswunders schwerlich surrealistische Anwandlungen zutrauen. In seinem Gedicht »Der Hirschkäfer« aber kreiert er ein Szenario, das an die kuriosesten Einfälle von Salvador Dalí





























