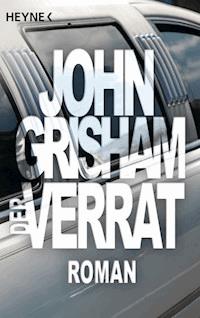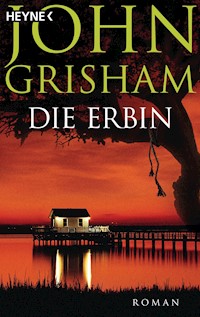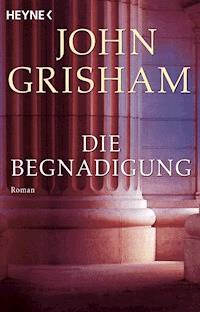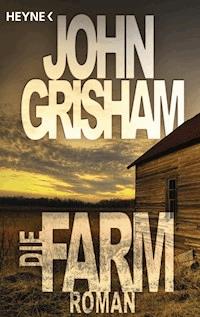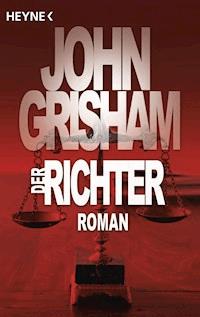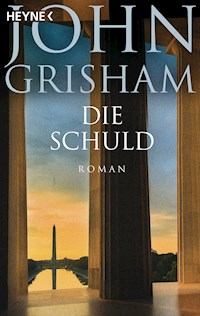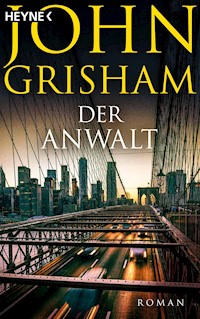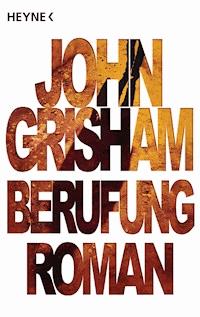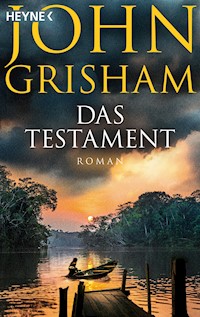
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Sein letzter Auftritt
Ein milliardenschwerer, lebensmüder Geschäftsmann, eine gierig lauernde Erbengemeinschaft, eine im brasilianischen Regenwald arbeitende Missionarin und ein ehemaliger Staranwalt, der es noch einmal wissen will - das sind die Akteure im Testament. Es geht um Geld, Macht und Ehre, und es geht um Leben und Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Ähnliche
Das Buch
Die raffgierige Erbengemeinschaft sitzt erwartungsvoll beisammen, als der milliardenschwere Exzentriker Troy Phelan sein Testament zu unterzeichnen gedenkt. Doch zu aller Überraschung enterbt der lebensmüde Greis seine verhaßten Nachkommen, überträgt das gesamte Vermögen seiner bis dato völlig unbekannten Tochter Rachel und stürzt sich dann unvermittelt aus dem 13. Stock in die Tiefe. In der Phelan-Familie bricht ein Sturm der Entrüstung los, und es wird sofort alles in Bewegung gesetzt, um das Testament anzufechten: War dieser Mann noch zurechnungsfähig und damit sein letzter Wille gültig? Während die Schlammschlacht um die elf Milliarden Dollar entbrennt, versucht der ehemals brillante Prozeßanwalt Nate O’Riley die rechtmäßige Erbin Rachel Lane im brasilianischen Regenwald aufzutreiben, wo sie seit Jahren als Missionarin arbeitet. Nach vielen Hindernissen gelingt es ihm schließlich, Rachel in den Tiefen der Pantanal-Region zu finden. Allerdings nur um festzustellen, daß die Missionarin nicht das geringste Interesse an ihrem Erbe hat, dafür umso mehr für die Lebensgeschichte von Nate. Doch die Zeit drängt. Wenn O’Rileys es nicht schafft, Rachel umzustimmen, fällt das gesamte Vermögen in die Hände des unersättlichen Phelan-Clans.
Inhaltsverzeichnis
EINS
Das dürfte der letzte Tag sein, und wohl auch die letzte Stunde. Niemand liebt mich, ich bin alt, einsam und krank, habe Schmerzen und bin des Lebens müde. Ich bin für das Jenseits bereit. Dort kann es nur besser sein als hier.
Mir gehören neben dem gläsernen Verwaltungshochhaus, in dem ich sitze, auch 97 Prozent des Unternehmens in den Stockwerken weiter unten, außer den zweitausend Menschen, die hier arbeiten, auch die zwanzigtausend, die es nicht tun, sowie aller Grund und Boden fast einen Kilometer weit in drei Himmelsrichtungen um das Gebäude herum mitsamt der darunter verlaufenden Rohrleitung, durch die mein Erdgas aus Texas hierher gepumpt wird, nicht zu vergessen die Freileitung, die den Strom liefert. Der Satellit viele Kilometer über mir, mit dessen Hilfe ich früher Befehle in mein die Welt umspannendes Reich gebellt habe, ist geleast. Mein Vermögen beläuft sich auf mehr als elf Milliarden Dollar. Ich besitze nicht nur Silberbergwerke in Nevada und Kupferbergwerke in Montana, sondern auch Kohlezechen in Angola, Kaffeepflanzungen in Kenia, Kautschukplantagen in Malaysia, Erdgas-Lagerstätten in Texas, Ölfelder in Indonesien und Stahlwerke in China. Mein Firmenimperium umfaßt Kraftwerke, Unternehmen, die Computer produzieren, Staudämme bauen, Taschenbücher drucken und Signale an meinen Satelliten schicken, und es verfügt über Tochterunternehmen mit Geschäftsbereichen in mehr Ländern, als irgendein Mensch aufzuspüren vermag.
Früher einmal besaß ich alles an Spielzeug, was das Leben schöner macht: Jachten, Privatjets, Blondinen, Wohnsitze in Europa, große Güter in Argentinien, eine Insel im Pazifik, reinrassige Rennpferde, Vollblüter, und sogar eine Eishockeymannschaft. Aber ich bin inzwischen zu alt für Spielzeug.
Die Wurzel meines Elends ist das Geld.
Dreimal habe ich eine Familie gegründet. Meine drei Ehefrauen haben mir sieben Kinder geboren, von denen sechs noch leben und tun, was sie nur können, um mich zu quälen. Soweit ich weiß, habe ich sie alle sieben selbst gezeugt, und einen Sohn habe ich beerdigt. Eigentlich müßte ich sagen, daß ihn seine Mutter beerdigt hat. Ich war damals nicht im Lande.
Ich habe mich mit meinen drei ehemaligen Frauen und sämtlichen Kindern auseinandergelebt. Sie alle sind heute hier zusammengekommen, weil ich bald sterben werde und es an der Zeit ist, das Geld zu verteilen.
Ich habe diesen Tag lange im voraus geplant. Gleich einem großen Hufeisen umschließen die drei langgezogenen und tiefen Gebäudeflügel meiner vierzehnstöckigen Firmenzentrale einen schattigen, nach hinten offenen Hof, auf dem ich einst im Sonnenschein Mittagsgesellschaften gegeben habe. Ich wohne und arbeite im Dachgeschoß auf gut tausend Quadratmetern, deren üppige Ausstattung manch einer obszön findet, was mich aber nicht im mindesten stört. Ich habe mein gesamtes Vermögen mit meinem Schweiß, meinem Verstand und mit Glück selbst erarbeitet, und das gibt mir das Recht, das Geld so auszugeben, wie ich es für richtig halte. Es ist mein gutes Recht, es zu verschenken, und trotzdem werde ich von allen Seiten bedrängt.
Warum sollte ich mir den Kopf darüber zerbrechen, wer es bekommt? Ich habe alles Erdenkliche mit dem Geld getan. Während ich hier allein in meinem Rollstuhl sitze und warte, kann ich mir nichts vorstellen, was ich kaufen oder sehen möchte. Mir fällt kein einziger Ort ein, an den ich reisen, und kein weiteres Abenteuer, das ich bestehen möchte.
Ich habe alles hinter mir, und ich bin sehr müde.
Es geht mir nicht darum, wer das Geld bekommt. Es geht mir darum, wer es nicht bekommt.
Jeden Quadratmeter dieses Gebäudes habe ich selbst entworfen und weiß daher genau, wo jeder bei dieser kleinen Zeremonie seinen Platz hat. Sie sind alle da und warten geduldig. Das macht ihnen nichts aus – für das, was ich zu erledigen habe, würden sie sich sogar nackt in einen Schneesturm stellen.
Da ist als erstes Lillian und ihre Brut – vier meiner Nachkommen hat eine Frau zur Welt gebracht, die sich kaum je von mir hat anfassen lassen. Wir haben jung geheiratet – ich war vierundzwanzig und sie achtzehn –, und daher ist jetzt auch Lillian alt. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen und werde sie auch heute nicht sehen. Ich bin überzeugt, daß sie nach wie vor die Rolle der bedauernswerten pflichtgetreuen ersten Gattin spielt, die gegen ein jüngeres Modell ausgetauscht worden ist. Sie hat nie wieder geheiratet, und ich bin überzeugt, daß sie in den letzten fünfzig Jahren nichts mit einem Mann gehabt hat. Ich weiß selbst nicht, wie wir zu unseren Kindern gekommen sind.
Der Älteste, Troy Junior, ist inzwischen siebenundvierzig, ein nichtsnutziger Trottel, der meinen Namen wie einen Fluch trägt. Als Junge hat man ihn TJ gerufen, und dieser Spitzname ist ihm nach wie vor lieber als Troy. Von meinen sechs hier versammelten Nachkommen ist er der dümmste, allerdings mit knappem Vorsprung.
Er mußte das College mit neunzehn Jahren wegen Drogenhandels verlassen und hat, wie alle seine Geschwister, zum einundzwanzigsten Geburtstag fünf Millionen Dollar bekommen. Wie allen anderen ist auch ihm das Geld durch die Finger gelaufen, als wäre es Wasser.
Ich bringe es nicht über mich, alle entsetzlichen Geschichten von Lillians Kindern hier auszubreiten. Der Hinweis mag genügen, daß sie alle bis über die Ohren verschuldet und praktisch nicht vermittelbar sind. Da nur wenig Hoffnung besteht, daß sich etwas daran ändert, ist die Teilnahme am feierlichen Akt der Unterzeichnung meines Letzten Willens das einschneidendste Ereignis in ihrem Leben.
Zurück zu meinen einstigen Ehefrauen. Von Lillians Frigidität habe ich mich in die heiße Leidenschaftlichkeit Janies geflüchtet. Sie war ein hübsches junges Ding, das als Sekretärin in der Buchhaltung arbeitete, aber rasch aufstieg, als ich das Bedürfnis empfand, sie auch auf Geschäftsreisen um mich zu haben. Nach einer Weile habe ich mich von Lillian scheiden lassen und Janie geheiratet. Sie war zweiundzwanzig Jahre jünger als ich und entschlossen, mich stets zufriedenzustellen. So rasch es ihr möglich war, hat sie zwei Kinder in die Welt gesetzt und sie dazu benutzt, mich an sie zu ketten. Rocky, der jüngere, ist mit zwei Kumpeln in einem Sportwagen ums Leben gekommen. Es hat mich sechs Millionen gekostet, die Folgen dieses Unfalls außergerichtlich zu regeln.
Mit vierundsechzig habe ich Tira geheiratet. Sie war dreiundzwanzig und von mir schwanger. Dem von ihr in die Welt gesetzten kleinen Ungeheuer hat sie aus Gründen, die mir nie klargeworden sind, den Namen Ramble gegeben, was von Strolch bis Schwafler alles mögliche bedeuten kann. Obwohl der Junge erst vierzehn ist, hat er bereits zweimal vor dem Jugendrichter gestanden – einmal wegen Ladendiebstahls und das andere Mal, weil er im Besitz von Marihuana war. Das Haar, das ihm bis auf den Rücken fällt, klebt ihm am Nacken, so fettig ist es, und er trägt Ringe an Ohrmuscheln, Augenbrauen und in der Nase. Ich habe gehört, daß er zur Schule geht, wenn er gerade Lust dazu hat.
Der Junge schämt sich, daß sein Vater fast achtzig Jahre alt ist, und sein Vater schämt sich, daß sich sein Sohn die Zunge hat piercen lassen.
Wie alle anderen erwartet Ramble, daß ich mein Testament unterschreibe und ihm damit ein angenehmes Leben verschaffe. So groß mein Vermögen auch ist, diese Dummköpfe werden nicht lange etwas davon haben.
Wer kurz vor dem Sterben steht, sollte nicht hassen, aber ich kann es nicht ändern. Sie sind ein elender Haufen, alle miteinander. Die Mütter hassen mich und haben daher ihren Kindern beigebracht, daß sie mich ebenfalls hassen sollen.
Sie sind Geier, die mit scharfen Krallen, spitzen Schnäbeln und gierigen Augen über mir kreisen, benommen von der Vorfreude auf unendlich viel Geld.
Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Alle sind überzeugt davon, daß ich einen Gehirntumor habe, weil ich sonderbare Dinge sage. Bei Sitzungen und am Telefon rede ich zusammenhangloses Zeug, und meine Mitarbeiter flüstern hinter meinem Rücken, nicken einander bedeutungsvoll zu und denken: Ja, es stimmt. Es ist der Tumor.
Ein Testament, das ich vor zwei Jahren verfaßt habe, sah als Universalerbin meine letzte Gespielin vor, die damals in Hosen mit Leopardenmuster und sonst nichts am Leibe durch meine Wohnung getänzelt ist. Ja, vermutlich bin ich verrückt nach zwanzigjährigen Blondinen mit all den Kurven. Sie ist aber später ausgezogen, und das Testament ist in den Reißwolf gewandert. Ich hatte einfach keine Lust mehr.
Vor drei Jahren habe ich einfach so zum Spaß ein Testament gemacht, in dem ich alles wohltätigen Einrichtungen hinterlassen habe, über hundert. Eines Tages habe ich TJ angebrüllt, er hat zurückgebrüllt, und dann habe ich ihm von diesem neuen Testament erzählt. Daraufhin haben seine Mutter und seine Geschwister ein ganzes Rudel von Winkeladvokaten angeheuert und sind vor Gericht gezogen, um zu erreichen, daß ich in eine Anstalt gesteckt werde, wo man mich behandeln und auf meinen Geisteszustand untersuchen sollte. Das war eigentlich ziemlich gerissen von ihren Anwälten, denn wenn man mich für unzurechnungsfähig erklärt hätte, wäre mein Testament ungültig gewesen.
Aber ich beschäftige viele Anwälte, denen ich tausend Dollar die Stunde dafür zahle, daß sie das Recht so drehen, wie es meinen Bedürfnissen entspricht. Daher wurde ich nicht in eine Anstalt eingewiesen, obwohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, daß ich damals wirklich nicht ganz dicht war.
Ich habe meinen eigenen Reißwolf, in den ich all die früheren Testamente gesteckt habe. Jetzt sind alle weg, von einer kleinen Maschine zerschnippelt.
Ich trage lange weiße Gewänder aus Thaiseide, rasiere mir den Schädel kahl wie ein Mönch und esse kaum etwas, so daß mein Körper ganz eingefallen ist. Man hält mich für einen Buddhisten, aber in Wirklichkeit beschäftige ich mich mit der Lehre Zarathustras. Sie kennen den Unterschied nicht. Ich kann fast verstehen, warum sie glauben, daß meine geistigen Kräfte nachgelassen haben.
Lillian und ihre Kinder befinden sich im Konferenzzimmer der Geschäftsleitung im zwölften Stock, unmittelbar unter mir. Es ist ein großer Raum mit Marmor und Mahagoni, dicken Teppichen und einem langen, ovalen Tisch in der Mitte, und im Augenblick ist er voller sehr nervöser Menschen. Es überrascht niemanden, daß mehr Anwälte als Familienangehörige da sind. Lillian hat einen eigenen Anwalt, wie auch jedes ihrer vier Kinder. Nur TJ hat drei mitgebracht – einmal, um zu zeigen, wie wichtig er ist, aber auch, um sicherzugehen, daß für alle Eventualitäten die richtige Lösung gefunden wird. Er steckt in größeren juristischen Schwierigkeiten als die meisten Insassen einer Todeszelle. An einem Ende des Tisches befindet sich ein großer Bildschirm, auf dem man verfolgen kann, was hier oben vor sich geht.
TJs Bruder, mein zweiter Sohn, Rex, ist vierundvierzig und zur Zeit mit einer Stripperin namens Amber verheiratet, ein armes hirnloses Geschöpf mit gewaltigen Silikonbrüsten. Sie ist seine zweite oder dritte Frau – einerlei, wer bin ich, daß ich mich zum Richter darüber aufschwingen dürfte? Jedenfalls ist sie da, ebenso wie die anderen gegenwärtigen Ehegatten und/oder Lebensgefährt(inn)en, und rutscht unruhig auf dem Stuhl hin und her, während sie darauf wartet, daß elf Milliarden aufgeteilt werden.
Libbigail ist Lillians erste Tochter, meine älteste. Ich habe das Kind abgöttisch geliebt, bis sie aufs College ging und mich vergessen hat. Als sie dann einen Afrikaner geheiratet hat, habe ich sie in meinen Testamenten nicht mehr berücksichtigt.
Das letzte Kind, das Lillian zur Welt gebracht hat, war Mary Ross. Sie ist mit einem Arzt verheiratet, der gern superreich sein möchte, aber sie stecken bis zum Hals in Schulden.
In einem Raum im neunten Stock wartet Janie mit den Kindern aus meiner zweiten Ehe. Sie hat seit unserer viele Jahre zurückliegenden Scheidung zweimal geheiratet. Ich beschäftige Privatdetektive, die mich auf dem laufenden halten, und bin fast sicher, daß sie im Augenblick allein lebt, aber nicht einmal das FBI wäre imstande, mit ihren Bettgeschichten Schritt zu halten. Wie ich schon gesagt habe, lebt ihr Sohn Rocky nicht mehr. Ihre Tochter Geena ist mit ihrem zweiten Mann, Cody, hier, einem Schwachkopf mit einem Diplom in Betriebswirtschaftslehre; ihm ist durchaus zuzutrauen, daß er eine halbe Milliarde innerhalb von drei Jahren gekonnt auf den Kopf haut.
Dann ist da noch Ramble, der sich im vierten Stock auf einem Sessel fläzt und an dem goldenen Ring leckt, den er im Mundwinkel trägt. Er fährt sich mit den Fingern durch das klebrige grüne Haar und knurrt seine Mutter an, die doch tatsächlich die Frechheit besessen hat, mit einem behaarten kleinen Gigolo hier aufzutauchen. Ramble ist überzeugt, daß ihm heute ein Vermögen übertragen wird, einfach deshalb, weil ich ihn gezeugt habe. Auch er hat einen Anwalt mitgebracht, einen radikalen Hippie, den Tira im Fernsehen gesehen und engagiert hat, gleich nachdem sie mit ihm im Bett war. Sie warten wie alle anderen.
Ich kenne diese Leute. Ich beobachte sie.
Jetzt taucht Snead hinten aus meiner Wohnung auf. Er ist seit etwa dreißig Jahren mein Faktotum, ein rundlicher, umgänglicher Mann in weißer Weste, duldsam und demütig, stets in der Hüfte abgeknickt, als verbeuge er sich vor einem König. Er bleibt vor mir stehen, die Hände wie immer auf dem Bauch gefaltet, den Kopf zur Seite geneigt, und fragt mit schiefem Lächeln und einem affektierten Tonfall, den er sich angewöhnt hat, als wir vor Jahren miteinander in Irland waren: »Wie geht es Ihnen, Sir?«
Ich sage nichts, denn weder habe ich es nötig, ihm zu antworten, noch rechnet er damit.
»Etwas Kaffee, Sir?«
»Mittagessen.«
Snead zwinkert mit beiden Augen und verbeugt sich noch tiefer. Dann watschelt er hinaus, wobei seine Hosenaufschläge über den Boden schleifen. Auch er rechnet damit, reich zu werden, wenn ich sterbe, und vermutlich zählt er die Tage wie alle anderen.
Wenn jemand Geld hat, möchten alle etwas davon haben. Nur ein winziges Scheibchen. Was bedeutet eine Million einem Mann, der Milliarden besitzt? Gib mir eine Million, alter Junge, und du merkst den Unterschied nicht einmal. Leih mir was, und wir können es beide vergessen. Quetsch meinen Namen irgendwo in dein Testament mit rein; da ist bestimmt Platz dafür.
Snead ist entsetzlich neugierig, und ich habe ihn vor Jahren dabei ertappt, wie er in meinem Schreibtisch herumgestöbert hat. Wahrscheinlich hat er nach dem gerade gültigen Testament gesucht. Er möchte, daß ich sterbe, weil er mit ein paar Millionen rechnet.
Welches Recht hat er, überhaupt mit etwas zu rechnen? Ich hätte ihn vor Jahren rauswerfen sollen.
Sein Name taucht in meinem neuen Testament nicht auf.
Er stellt ein Tablett vor mich hin: eine ungeöffnete Packung Ritz-Kekse, ein Gläschen Honig, dessen Deckel noch versiegelt ist, und eine kleine Dose Fresca auf Zimmertemperatur. Bei der kleinsten Abweichung würde Snead sofort gefeuert.
Ich sage ihm, daß er gehen kann, und tauche die Kekse in den Honig. Meine Henkersmahlzeit.
ZWEI
Ich sitze da und starre durch die getönten Glaswände. An klaren Tagen kann ich die Spitze des Washington-Denkmals sehen, das zehn Kilometer von hier entfernt ist. Aber heute ist der Himmel bedeckt. Es ist unfreundlich, kalt und windig, kein schlechter Tag, um zu sterben. Der Wind reißt das letzte welke Laub von den Zweigen und weht es unten über den Parkplatz.
Warum mache ich mir Sorgen wegen der Schmerzen? Was ist gegen ein bißchen Leiden einzuwenden? Ich habe mehr Elend verursacht als zehn beliebige andere Menschen.
Ich drücke auf einen Knopf, und Snead kommt herein. Er verbeugt sich und schiebt meinen Rollstuhl aus der Wohnungstür in die mit Marmor ausgekleidete Empfangshalle und von dort durch eine andere Tür. Es kommt näher, aber ich spüre keine Beklemmung.
Ich habe die Psychiater über zwei Stunden warten lassen.
Wir kommen an meinem Büro vorüber, und ich nicke Nicolette zu, meiner letzten Sekretärin, einem niedlichen jungen Ding, das ich recht gut leiden kann. Wenn mir Zeit bliebe, könnte sie die Nummer vier werden.
Aber mir bleibt keine Zeit. Es sind nur noch Minuten.
Die Meute wartet – ganze Rudel von Anwälten und drei Psychiater, die darüber befinden werden, ob ich bei klarem Verstand bin. Sie drängen sich um einen langen Tisch in meinem Besprechungszimmer. Als ich hereinkomme, hört ihr Gespräch schlagartig auf. Alle starren mich an. Snead schiebt mich an eine der Längsseiten des Tisches neben meinen Anwalt Stafford.
Kameras zeigen in alle Richtungen, und die Techniker sind eifrig mit ihnen und den Mikrophonen beschäftigt. Jeder geflüsterte Laut, jede noch so geringe Bewegung, jeder Atemzug wird aufgezeichnet, denn es geht um ein Vermögen.
Im letzten von mir unterschriebenen Testament waren meine Kinder kaum bedacht worden. Wie immer hatte es Josh Stafford aufgesetzt. Ich habe es heute morgen in den Reißwolf gesteckt.
Ich sitze hier, um aller Welt zu beweisen, daß meine Geisteskräfte ausreichen, ein neues Testament abzufassen. Sobald dieser Beweis erbracht ist, kann niemand die Verfügungen anfechten, die ich über mein Vermögen treffe.
Mir unmittelbar gegenüber sitzen drei Psychofritzen – jede der Familien hat einen benannt. Auf geknickten Karteikarten, die sie vor sich gestellt haben, hat jeder in Großbuchstaben seinen Namen geschrieben – Dr. Zadel, Dr. Flowe und Dr. Theishen. Ich sehe mir ihre Augen und Gesichter aufmerksam an. Da ich als normal gelten will, muß ich Blickkontakt herstellen.
Sie sind überzeugt, daß ich ein bißchen wirr im Kopf bin, dabei stehe ich im Begriff, sie im großen Stil reinzulegen.
Stafford wird die ganze Sache deichseln. Als alle Platz genommen haben und die Kameras bereit sind, sagt er: »Ich heiße Josh Stafford und bin der von Mr. Troy Phelan, der rechts neben mir sitzt, bevollmächtigte Anwalt.«
Ich nehme mir einen der Psychofritzen nach dem anderen vor, Auge in Auge, bis sie blinzeln oder den Blick abwenden. Alle drei tragen sie dunkle Anzüge. Zeidel und Flowe haben Zottelbärte, Theishen, der eine Fliege um den Hals hat, sieht aus, als wäre er höchstens dreißig. Jede der Familien hatte das Recht, einen Psychiater ihres Vertrauens zu benennen.
Jetzt redet wieder Stafford. »Zweck dieser Zusammenkunft ist es, Mr. Phelan von einer psychiatrischen Kommission untersuchen zu lassen, die seine Testierfähigkeit feststellen soll. Vorausgesetzt, sie erkennt ihm den Vollbesitz seiner geistigen Kräfte zu, beabsichtigt er, eine letztwillige Verfügung zu unterzeichnen, mit der er für den Fall seines Todes die Verteilung seines Vermögen regelt.«
Stafford klopft mit dem Bleistift auf den gut zweieinhalb Zentimeter dicken Papierstapel, der vor uns liegt: das Testament. Bestimmt fahren jetzt die Kameras mit ihren Gummilinsen zu einer Nahaufnahme darauf zu, und bestimmt läuft meinen Kindern und ihren Müttern, die im ganzen Gebäude verteilt sind, bei seinem bloßen Anblick ein Schauer über den Rücken.
Sie haben es bisher nicht gesehen und haben auch keinen Anspruch darauf. Eine letztwillige Verfügung ist ein privatrechtlicher einseitiger Vertrag, dessen Inhalt erst nach dem Tode des Erblassers bekanntgegeben wird. Diejenigen, die als Erben in Frage kommen, können darüber lediglich spekulieren. Meine Erben haben Hinweise bekommen, von mir sorgfältig in Umlauf gesetzte Falschinformationen.
Daher sind sie überzeugt, daß der größte Teil meines Nachlasses mehr oder weniger gerecht zwischen den Kindern aufgeteilt wird und die Ex-Frauen ebenfalls großzügig bedacht werden. Das wissen sie; sie können es spüren. Seit Wochen, ja Monaten, beten sie inbrünstig darum, daß das Testament, das jetzt vor mir liegt, sie reich macht und dem Gezänk ein Ende bereitet. Stafford hat es aufgesetzt und mit meiner Erlaubnis dessen angeblichen Inhalt im Verlauf von Gesprächen mit ihren Anwälten in groben Zügen dargelegt. Jedes der Kinder darf mit einem Betrag in der Größenordnung von drei- bis fünfhundert Millionen rechnen, und die drei Ex-Frauen mit jeweils fünfzig Millionen. Ich habe bei jeder Scheidung gut für die jeweilige Frau gesorgt, aber das ist selbstverständlich in Vergessenheit geraten.
Der für die Angehörigen ausgesetzte Betrag beläuft sich insgesamt auf rund drei Milliarden Dollar. Was übrigbleibt, nachdem sich die Regierung mehrere Milliarden unter den Nagel gerissen hat, geht an wohltätige Einrichtungen. Man kann also verstehen, warum sich alle herausgeputzt haben und nüchtern (jedenfalls die meisten) hergekommen sind und, den Blick begierig auf die Bildschirme gerichtet, warten und hoffen, daß mir, dem alten Mann, mein Vorhaben gelingt. Bestimmt haben sie ihren Psychoheinis gesagt: »Haben Sie etwas Nachsicht mit dem Alten. Wir möchten, daß er bei klarem Verstand ist.«
Wenn alle so rundum zufrieden sind, warum dann überhaupt diese psychiatrische Untersuchung? Weil ich sie alle ein letztes Mal reinlegen möchte, und zwar nach Strich und Faden.
Die Sache mit den Psychiatern war meine Idee, und meine Kinder und ihre Anwälte haben nicht gemerkt, was dahintersteckt.
Zadel spricht als erster. »Mr. Phelan, können Sie uns sagen, welchen Tag wir heute haben, wieviel Uhr es ist und wo wir uns befinden?«
Ich komme mir vor wie ein Erstkläßler, lasse mein Kinn wie ein Trottel auf die Brust sinken und denke so lange über die Frage nach, bis sie sich an den Rand ihres Sessels vorschieben und flüstern: »Los, du verrückter alter Mistkerl! Du weißt doch bestimmt, welchen Tag wir heute schreiben.«
»Montag«, sage ich leise. »Es ist Montag, der 9. Dezember 1996. Wir befinden uns in meinem Büro.«
»Und wie spät ist es?«
»Gegen halb drei«, sage ich. Ich trage keine Uhr am Arm.
»Und wo befindet sich Ihr Büro?«
»In McLean, im Staat Virginia.«
Flowe beugt sich über sein Mikrophon. »Können Sie uns Namen und Geburtstage Ihrer Kinder sagen?«
»Nein. Die Namen vielleicht, aber die Geburtsdaten nicht.«
»Na schön, dann die Namen.«
Ich lasse mir Zeit. Noch ist nicht der richtige Augenblick gekommen zu zeigen, wie sehr ich auf Draht bin. Sie sollen ruhig schwitzen. »Troy Phelan jun., Rex, Libbigail, Mary Ross, Geena und Ramble.« Ich sage die Namen, als falle mir schon der bloße Gedanke an sie schwer.
Flowe hat Anspruch auf einen Nachschlag. »Es gab ein siebtes Kind, nicht wahr?«
»Ja.«
»Wissen Sie seinen Namen?«
»Rocky.«
»Und was ist mit ihm geschehen?«
»Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.« Ich sitze aufrecht in meinem Rollstuhl, den Kopf hoch erhoben, lasse den Blick von einem der Psychoheinis zum nächsten wandern und demonstriere für die Kameras geistige Klarheit. Bestimmt sind meine Kinder und meine Ex-Frauen stolz auf mich, während sie in kleinen Gruppen vor den Bildschirmen sitzen, ihrem gegenwärtigen Ehegespons die Hand drücken und ihren gierigen Anwälten zulächeln, weil der alte Troy die Einleitung hingekriegt hat.
Schon möglich, daß meine Stimme leise und hohl klingt, schon möglich, daß ich mit meinem weißen Seidengewand, meinem runzligen Gesicht und dem grünen Turban aussehe wie verstört, aber ich habe ihre Fragen beantwortet.
Vorwärts, alter Junge, fordern sie mich auf.
Theishen fragt: »Wie ist derzeit Ihr körperlicher Zustand?«
»Ich hab mich schon besser gefühlt.«
»Es heißt, daß Sie einen bösartigen Tumor haben.«
Na, du redest aber nicht lange um den heißen Brei herum, was?
»Ich war der Ansicht, daß es sich hier um eine psychiatrische Untersuchung handelt«, sage ich mit einem Blick auf Stafford, der sich ein Lächeln nicht verkneifen kann. Aber die Vorschriften lassen jede beliebige Frage zu. Wir sind hier nicht vor Gericht.
»So verhält es sich auch«, sagt Theishen höflich. »Aber dieser Punkt ist sachdienlich.«
»Aha.«
»Wollen Sie also die Frage beantworten?«
»Welche?«
»Die nach dem Tumor.«
»Natürlich. Ich habe einen inoperablen Gehirntumor von der Größe eines Golfballs, und mein Arzt gibt mir höchstens noch zwei Monate.«
Ich kann förmlich die Champagnerkorken unter mir knallen hören. Der Tumor ist bestätigt!
»Stehen Sie im Augenblick unter dem Einfluß irgendeines Medikaments, einer Droge oder von Alkohol?«
»Nein.«
»Besitzen Sie irgendein schmerzstillendes Mittel?«
»Noch nicht.«
Wieder Zadel: »Mr. Phelan, vor drei Monaten hat die Zeitschrift Forbes Ihr Nettovermögen mit acht Milliarden Dollar beziffert. Kommt diese Zahl der Wirklichkeit nahe?«
»Seit wann steht Forbes für Genauigkeit?«
»Die Angabe entspricht also nicht der Wahrheit?«
»Der Wert meines Vermögens liegt zwischen elf und elfeinhalb, je nach Marktlage.« Ich sage das betont langsam, aber meine Worte klingen scharf, meine Stimme hat Gewicht. Niemand zweifelt daran, daß meine Angabe stimmt.
Flowe beschließt, die Frage nach dem Geld noch ein wenig zu vertiefen. »Mr. Phelan, können Sie ganz allgemein den Aufbau Ihres Unternehmens skizzieren?«
»Ich denke schon.«
»Wollen Sie das tun?«
»Nun ja.« Ich mache eine Pause und lasse sie weiter schwitzen. Stafford hat mir versichert, daß wir nicht ins Detail zu gehen brauchen. Nur ein Gesamtbild, hat er gesagt.
»Die Phelan-Gruppe ist eine privatrechtliche Gesellschaft, in deren Besitz sich siebzig verschiedene Firmen befinden, von denen einige an der Börse notiert werden.«
»Ein wie großer Anteil der Phelan-Gruppe befindet sich in Ihrem Besitz?«
»Etwa siebenundneunzig Prozent. Der Rest gehört einer Handvoll Firmenangehöriger.«
Auch Theishen nimmt jetzt die Fährte auf. Lange hat er dazu nicht gebraucht. »Mr. Phelan, ist Ihr Unternehmen an der Firma Spin Computer beteiligt?«
»Ja«, sage ich langsam, während ich Spin Computer im Dschungel meiner Unternehmungen einzuordnen versuche.
»Wieviel davon besitzen Sie?«
»Achtzig Prozent.«
»Und Spin Computer ist eine Aktiengesellschaft?«
»So ist es.«
Theishen macht sich an einem Stapel amtlich aussehender Papiere zu schaffen, und ich kann von hier aus sehen, daß er den Jahres-Abschlußbericht und einige Vierteljahresberichte vor sich liegen hat, Dokumente, die sich jeder des Lesens und Schreibens halbwegs kundige College-Student beschaffen kann.
»Wann haben Sie Spin erworben?« fragt er.
»Vor etwa vier Jahren.«
»Wieviel haben Sie dafür bezahlt?«
»Zwanzig Dollar pro Aktie, insgesamt dreihundert Millionen.« Eigentlich möchte ich diese Fragen langsamer beantworten, bringe es aber nicht fertig. Ich brenne mit meinen Blicken Löcher in Theishen, so ungeduldig warte ich auf seine nächste Frage.
»Und was ist das Unternehmen jetzt wert?«
»Nun, gestern bei Börsenschluß wurden die Aktien mit dreiundvierzigeinhalb notiert, sie waren gegenüber dem Vortag um einen Punkt zurückgegangen. Seit ich das Unternehmen gekauft habe, ist es zweimal zu einem Aktiensplit gekommen, so daß es inzwischen rund achtfünfzig wert ist.«
»Achthundertfünfzig Millionen?«
»Richtig.«
An dieser Stelle ist die Befragung im großen und ganzen vorüber. Wenn es mir meine geistigen Fähigkeiten erlauben, die gestrigen Schlußkurse an der Aktienbörse mitzubekommen, sind meine Widersacher sicherlich zufrieden. Ich kann schon fast ihr dämliches Grinsen sehen und ihr gedämpftes Hurragebrüll hören. Gut gemacht, Troy, gib ihnen Saures!
Zadel greift in die Vergangenheit zurück. Damit will er wohl die Grenzen meines Gedächtnisses ausloten. »Mr. Phelan, wo sind Sie zur Welt gekommen?«
»In Montclair, im Staat New Jersey.«
»Wann?«
»Am 12. Mai 1918.«
»Wie war der Mädchenname Ihrer Mutter?«
»Shaw.«
»Wann ist sie gestorben?«
»Zwei Tage vor dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor.«
»Und Ihr Vater?«
»Was ist mit dem?«
»Wann ist er gestorben?«
»Das weiß ich nicht. Er hat sich aus dem Staub gemacht, als ich ein kleiner Junge war.«
Zadel sieht zu Flowe hinüber, der auf einem Notizblock eine ganze Reihe Fragen stehen hat. Flowe fragt. »Wer ist Ihre jüngste Tochter?«
»Aus welcher Familie?«
»Äh, der ersten.«
»Das müßte Mary Ross sein.«
»Stimmt –«
»Natürlich stimmt es.«
»Und welches College hat sie besucht?«
»Tulane, in New Orleans.«
»Was hat sie studiert?«
»Irgendwas Mittelalterliches. Dann hat sie schlecht geheiratet, wie die anderen auch. Das Talent dazu haben sie wohl von mir geerbt.« Ich kann richtig sehen, wie sie erstarren und alle Stacheln ausfahren. Und ich kann fast sehen, wie die Anwälte und die derzeitigen Lebensgefährten und/oder Ehepartner ein leichtes Lächeln unterdrücken, weil niemand bestreiten kann, daß ich in der Tat schlecht geheiratet habe.
Und mit meinem Nachwuchs habe ich mich noch schlimmer in die Nesseln gesetzt.
Auf einmal ist Flowe mit dieser Runde fertig. Theishen, der erkennbar ins Geld verliebt ist, fragt: »Besitzen Sie eine Mehrheit am Unternehmen Mountain Com?«
»Ja. Bestimmt haben Sie es da in Ihrem Papierstapel vor sich. Es ist eine Aktiengesellschaft.«
»Wieviel haben Sie ursprünglich investiert?«
»Zehn Millionen Aktien zu rund achtzehn das Stück.«
»Und jetzt ist –«
»Der gestrige Schlußkurs war einundzwanzig. Nach einem Aktientausch und einem Aktiensplit in den letzten sechs Jahren ist das Unternehmen inzwischen rund vierhundert Millionen wert. Ist Ihre Frage damit beantwortet?«
»Ich glaube schon. In wie vielen Aktiengesellschaften besitzen Sie die Anteilsmehrheit?«
»In fünf.«
Flowe sieht zu Zadel hinüber, und ich frage mich, wie lange das noch dauern soll. Mit einem Mal bin ich müde.
»Weitere Fragen?« möchte Stafford wissen. Wir werden die andern auf keinen Fall unter Zeitdruck setzen, weil wir möchten, daß sie mit mir rundum zufrieden sind.
Zadel fragt: »Haben Sie die Absicht, heute eine neue letztwillige Verfügung zu unterzeichnen?«
»Ja.«
»Handelt es sich dabei um die vor Ihnen auf dem Tisch liegenden Papiere?«
»Ja.«
»Haben Sie in diesem Testament einen beträchtlichen Anteil Ihres Vermögens für Ihre Kinder vorgesehen?«
»So ist es.«
»Sind Sie bereit, das Testament jetzt zu unterzeichnen?«
»Ja.«
Zadel legt seinen Stift auf den Tisch, faltet bedächtig die Hände und sieht nachdenklich Stafford an. »Meiner Meinung nach ist Mr. Phelan zur Zeit hinreichend testierfähig, um in gültiger Weise über sein Vermögen zu verfügen.« Er sagt das mit großem Nachdruck, als seien sie sich ihrer Sache aufgrund meiner Vorstellung nicht so recht sicher.
Die beiden anderen stimmen ihm rasch zu. »Ich habe keinen Zweifel, daß er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist«, sagt Flowe zu Stafford. »Er scheint mir geradezu unglaublich auf dem Damm zu sein.«
»Irgendwelche Zweifel?« fragt Stafford.
»Nicht die geringsten.«
»Dr. Theishen?«
»Wir wollen uns nichts vormachen. Mr. Phelan weiß genau, was er tut. Sein Verstand ist weit schärfer als unserer.«
Vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Ihr seid eine Bande von Psychoheinis, die sich abstrampeln müssen, um hunderttausend im Jahr zu verdienen. Ich habe Milliarden verdient, trotzdem tätschelt ihr mir den Kopf und sagt mir, wie klug ich bin.
»Ihr Votum ist also einstimmig?« fragt Stafford.
»Ja. Absolut.« Sie können gar nicht schnell genug nicken.
Stafford schiebt mir das Testament herüber und gibt mir einen Stift. Ich sage: »Das ist das Testament von Troy L. Phelan, mit dem alle früheren letztwilligen Verfügungen und Testamentsnachträge hinfällig werden.« Der Stapel umfaßt neunzig Seiten, die von Stafford und einem seiner Mitarbeiter aufgesetzt worden sind. Ich verstehe, worum es im großen und ganzen geht, kenne aber nicht alle Einzelheiten. Ich habe sie nicht gelesen und werde es auch nicht tun. Ich blättere nach ganz hinten, kritzele einen Namenszug, den niemand lesen kann, und lege dann erst einmal meine Hände darauf.
Die Geier werden das nie zu sehen bekommen.
»Die Sitzung ist geschlossen«, sagt Stafford, und alle packen rasch zusammen. Gemäß meinen Anweisungen werden die drei Familien aus ihren jeweiligen Räumen geleitet und aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.
Eine Kamera bleibt auf mich gerichtet, die Bilder, die sie aufnimmt, sind ausschließlich für das Archiv bestimmt. Die Anwälte und Psychiater verlassen den Raum unverzüglich. Ich fordere Snead auf, sich an den Tisch zu setzen. Stafford und einer seiner Sozii, Durban, bleiben da, sie sitzen ebenfalls. Als wir allein sind, greife ich unter mein Gewand und hole einen Umschlag hervor, den ich öffne. Ich nehme drei Bogen gelbes Stempelpapier heraus und lege sie vor mich auf den Tisch. Nur noch einige Sekunden, und ein leichter Schauer der Furcht durchläuft mich. Das wird mehr Kraft kosten, als ich in Wochen aufgebracht habe.
Stafford, Durban und Snead starren verblüfft auf die gelben Blätter.
»Das ist meine letztwillige Verfügung«, erkläre ich und nehme einen Stift zur Hand. »Ein eigenhändiges Testament, das ich Wort für Wort erst vor wenigen Stunden verfaßt habe. Es trägt das heutige Datum und wird unter diesem Datum von mir unterzeichnet.« Ich kritzele meinen Namen. Stafford ist so baff vor Staunen, daß er kein Wort herausbringt.
»Hiermit widerrufe ich alle früheren Testamente, einschließlich dessen, das ich vor weniger als fünf Minuten unterzeichnet habe.« Ich falte die Blätter und stecke sie wieder in den Umschlag.
Ich beiße die Zähne zusammen und denke daran, wie sehr ich mich danach sehne zu sterben.
Ich schiebe den Umschlag über den Tisch Stafford zu und erhebe mich im selben Augenblick aus dem Rollstuhl. Meine Beine zittern. Mein Herz hämmert. Nur noch Sekunden. Bestimmt werde ich tot sein, bevor ich auf dem Boden lande.
»He!« ruft jemand, vermutlich Snead. Aber ich entferne mich von ihnen.
Der Lahme geht, rennt beinahe an der Reihe von Ledersesseln vorüber, an einem meiner Porträts, einem schlechten Gemälde, das eine meiner Frauen in Auftrag gegeben hat, an allem vorüber, zu den Schiebetüren, die nicht abgeschlossen sind. Ich weiß das, weil ich das Ganze vor ein paar Stunden geprobt habe.
»Halt!« schreit jemand, und jetzt sind sie hinter mir her. Seit einem Jahr hat mich niemand gehen sehen. Ich greife nach der Klinke und öffne die Tür. Die Luft ist bitterkalt. Ich trete barfuß auf die schmale Terrasse im obersten Stockwerk meines Gebäudes. Ohne nach unten zu sehen, stürze ich mich über das Geländer.
DREI
Snead war zwei Schritte hinter Mr. Phelan und nahm eine Sekunde lang an, er werde ihn einholen. Er war so entsetzt gewesen, als er den alten Mann nicht nur aufstehen und gehen, sondern praktisch zur Tür sprinten sah, daß er förmlich erstarrt war. Schon seit Jahren hatte sich Mr. Phelan nicht so schnell bewegt.
Snead erreichte das Geländer gerade noch rechtzeitig, um einen Entsetzensschrei auszustoßen, mußte dann aber hilflos mit ansehen, wie Mr. Phelan lautlos fiel, mit Armen und Beinen um sich schlug und immer kleiner wurde, bis er auf dem Boden aufschlug. Snead krallte sich am Geländer fest, während er ungläubig nach unten sah. Dann begannen ihm die Tränen über das Gesicht zu laufen.
Josh Stafford erreichte die Terrasse einen Schritt hinter Snead und bekam den Sturz zum größten Teil mit. Es geschah so schnell, zumindest der Sprung; der anschließende Sturz in die Tiefe schien eine Stunde zu dauern. Zwar fällt ein Mann von knapp siebzig Kilo in weniger als fünf Sekunden aus einer Höhe von neunzig Metern, aber Stafford erzählte später allen Leuten, der alte Mann habe eine Ewigkeit lang in der Luft geschwebt, wie eine Feder, die im Wind dahintreibt.
Tip Durban, der unmittelbar hinter Stafford das Geländer erreichte, bekam lediglich den Aufprall des Körpers auf der mit Ziegelsteinen gepflasterten Fläche zwischen dem Haupteingang und einer kreisförmigen Auffahrt mit. Aus irgendeinem Grund hielt Durban den Umschlag in der Hand, den er, ohne es zu merken, vom Tisch genommen hatte, während sie dem alten Troy nachsetzten. Er fühlte sich sehr viel schwerer an, als Durban in der beißend kalten Luft dastand und auf eine Szene aus einem Horrorfilm hinabsah, der sich die ersten Zuschauer näherten.
Troy Phelans Sturz verlief nicht so dramatisch, wie er es sich gewünscht hatte. Er flog weder wie ein Engel der Erde entgegen, mit einem vollkommenen Kopfsprung, bei dem das Seidengewand hinter ihm flatterte, noch landete er genau in dem Augenblick tot vor den Augen seiner entsetzten Angehörigen, in dem sie das Gebäude verließen. Lediglich ein untergeordneter Angestellter aus der Lohnbuchhaltung, der nach einer sehr langen Mittagspause in einer Bar über den Parkplatz eilte, wurde Zeuge des Sturzes. Er hörte eine Stimme, hob den Blick zum obersten Stockwerk und sah entsetzt einen blassen, nackten Körper, um dessen Hals etwas wie ein Bettlaken flatterte. Wie nicht anders zu erwarten, landete er mit einem dumpfen Aufschlag auf dem Boden.
Gerade als der Angestellte zu dem Punkt rannte, wo der Körper mit dem Rücken aufgeprallt war, merkte ein Angehöriger des Werkschutzes, daß etwas nicht in Ordnung war, und verließ seinen Posten neben dem Haupteingang des Phelan-Turms. Da weder der Wachmann noch der Angestellte Mr. Troy Phelan je gesehen hatte, wußte keiner von beiden zunächst, wessen blutigen, aberwitzig verdrehten und nackten Leichnam sie da betrachteten, den in Höhe der Arme ein Laken umgab. Mit Sicherheit wußten sie nur, daß der Mann tot war.
Dreißig Sekunden später hätte sich Troys Wunsch erfüllt. Da sich Tira und Ramble im vierten Stock befunden hatten, verließen sie zusammen mit Dr. Theishen und ihrem Aufgebot von Anwälten als erste das Gebäude und erreichten daher auch als erste den Ort des Schreckens. Tira kreischte, nicht aus Schmerz, Liebe oder unter dem Eindruck eines Verlustes, sondern einfach wegen des Schocks, den der Anblick des alten Troy auf den Ziegelsteinen in ihr auslöste. So durchdringend war der Schrei, daß ihn Snead, Stafford und Durban dreizehn Stockwerke höher deutlich hören konnten.
Ramble fand den Anblick ziemlich stark. Da er mit dem Fernsehen aufgewachsen und süchtig nach Video-Spielen war, lockte ihn jede Schreckensszene geradezu magnetisch an. Er löste sich von seiner kreischenden Mutter und kniete sich neben seinen toten Vater. Der Wachmann legte ihm die Hand fest auf die Schulter.
»Das ist Troy Phelan«, sagte einer der Anwälte, während er sich über den Leichnam beugte.
»Sagen Sie bloß«, sagte der Wachmann.
»Ist ja’n Ding«, sagte der Angestellte.
Weitere Menschen kamen aus dem Gebäude gerannt.
Die nächsten waren Janie, Geena und Cody mit ihrem Psychiater Dr. Flowe und ihren Anwälten. Aus ihrem Mund hörte man keine Schreie, niemand brach zusammen. Sie drängten sich dicht aneinander, hielten Abstand von Tira und ihrer Gruppe und glotzten wie alle anderen zu dem armen Troy hinüber.
Funkgeräte knisterten, als ein weiterer Wachmann eintraf und die Sache in die Hand nahm. Er rief nach einem Rettungswagen.
»Welchen Sinn soll das haben?« fragte der Angestellte aus der Lohnbuchhaltung, der sich in den Vordergrund spielte, weil er als erster am Ort des Geschehens eingetroffen war.
»Wollen Sie ihn etwa in Ihrem eigenen Wagen wegbringen?« fragte der Wachmann.
Ramble sah zu, wie das Blut die Mörtelfugen zwischen den Steinen füllte und in vollkommenen rechten Winkeln ein leichtes Gefälle hinablief, auf einen eingefrorenen Springbrunnen und einen Fahnenmast in der Nähe zu. Ein Aufzug voller Menschen hielt in der Eingangshalle. Die Türen öffneten sich, und Lillian trat mit ihren Kindern und deren Begleitern heraus. Die ganze Gruppe wandte sich nach links einem Nebenausgang entgegen, denn TJ und Rex hatten hinter dem Gebäude geparkt, weil sie sich auskannten: Beide hatten einst ein eigenes Büro in dem Gebäude besessen. Mit einem Mal rief jemand vom Haupteingang des Gebäudes her: »Mr. Phelan ist gesprungen!« Sie änderten ihre Richtung und eilten zum gepflasterten Vorplatz in der Nähe des Springbrunnens, wo sie ihn fanden.
Jetzt brauchten sie doch nicht auf den Gehirntumor zu warten.
Es dauerte rund eine Minute, bis sich Joshua Stafford von seinem Entsetzen erholt hatte und wieder wie ein Anwalt denken konnte. Er wartete, bis die Angehörigen der dritten und letzten Familie unten zu sehen waren, dann bat er Snead und Durban in den Raum zurück.
Snead stellte sich vor die immer noch eingeschaltete Kamera, und nachdem er geschworen hatte, die Wahrheit zu sagen, berichtete er, was er soeben mit angesehen hatte. Dabei mußte er gegen seine Tränen ankämpfen. Stafford öffnete den Umschlag und hielt die gelben Blätter so nahe vor die Kamera, daß die Schrift lesbar war.
»Ich habe gesehen, wie er diese Blätter vor wenigen Sekunden unterschrieben hat«, bestätigte Snead.
»Und erkennen Sie das als seine Unterschrift?« fragte Stafford.
»Ja, ja, das ist sie.«
»Hat er erklärt, daß es sich dabei um seine letztwillige Verfügung handelt?«
»Er hat es als sein Testament bezeichnet.«
Stafford nahm die Blätter wieder an sich, bevor Snead lesen konnte, was darauf stand. Er ließ Durban dieselbe Aussage machen, stellte sich dann selbst vor die Kamera und erklärte, was er zum Ablauf der Ereignisse zu sagen hatte. Die Kamera wurde abgeschaltet, und die drei fuhren nach unten, um Mr. Phelan die letzte Ehre zu erweisen. Der Fahrstuhl war voller Angestellter der Firma, die zwar tief betroffen waren, es sich aber auf keinen Fall entgehen lassen wollten, den Alten ein letztes Mal zu sehen, noch dazu in dieser sonderbaren Situation. Allmählich leerte sich das Gebäude. In einer Ecke hörte man Snead erstickt schluchzen.
Wachmänner hatten die Menge abgedrängt. Man hörte eine Sirene näherkommen. Jemand machte letzte Erinnerungsfotos von Troy Phelan, der in einer Blutlache lag, dann wurde eine schwarze Decke über den Leichnam ausgebreitet.
Bei den Angehörigen überlagerte schon bald leichter Kummer das Entsetzen über den Tod. Gesenkten Hauptes standen sie da, den Blick betrübt auf die Decke gerichtet, und dachten an das, was zu erledigen sein würde. Es war unmöglich, Troy anzusehen und nicht an das viele Geld zu denken. Die Trauer um einen Verwandten, dem man entfremdet ist, hält nicht lange an, wenn man damit rechnen darf, eine halbe Milliarde Dollar zu erben – auch nicht, wenn es der eigene Vater ist.
Bei den Angestellten trat Verwirrung an die Stelle des Entsetzens. Zwar hieß es, er wohne da oben über ihnen, aber kaum jemand hatte ihn je gesehen. Er galt als exzentrisch, verrückt und krank – aber alles gründete sich auf Gerüchte, auch, daß er ein Menschenfeind sei. Wichtige Mitglieder der Unternehmensspitze sahen ihn einmal im Jahr. Wenn die Firma ohne sein Eingreifen so erfolgreich war, durften die Angestellten ihre Arbeitsplätze getrost für sicher halten.
Die Psychiater – Zadel, Flowe und Theishen – sahen sich mit einem Mal in einer beklemmenden Lage. Da erklärt man, jemand sei bei klarem Verstand, und gleich darauf geht er hin und springt in den Tod. Doch auch ein Verrückter hat gelegentlich einen lichten Augenblick – diese rettende Formel wiederholten sie unaufhörlich, während sie inmitten der Menge zitterten. Während so jemand kurzzeitig bei klarem Verstand ist, kann er ohne weiteres ein gültiges Testament errichten. Von dieser Position würden sie auf keinen Fall abrücken. Gott sei Dank war alles auf Band aufgenommen worden. Der alte Troy war ein Fuchs, und er war bei klarem Verstand gewesen.
Und die Anwälte überwanden ihren Schock rasch und ohne Kummer zu empfinden. Mit entschlossener Miene betrachteten sie, neben ihren Mandanten stehend, das klägliche Bild, das sich ihnen bot. Das Honorar würde gewaltig sein.
Ein Rettungswagen fuhr auf die gepflasterte Fläche und blieb in unmittelbarer Nähe des Leichnams stehen. Stafford kroch unter dem Absperrband durch und flüsterte den Wachmännern etwas zu.
Rasch wurde Troy auf eine Bahre geladen und fortgebracht.
Zwanzig Jahre zuvor hatte Troy Phelan seinen Firmensitz in den Norden des Staates Virginia verlegt, um der hohen Besteuerung in New York zu entgehen. Die vierzig Millionen, die er für das Grundstück und das Hochhaus hatte aufwenden müssen, hatte er durch den Wechsel des Firmensitzes nach Virginia mehrfach eingespart.
Den aufstrebenden Washingtoner Anwalt Joshua Stafford hatte er im Zusammenhang mit einem üblen Prozeß kennengelernt, den er verloren hatte. Stafford hatte die Gegenseite vertreten und gewonnen. Troy, der seine Art des Vorgehens und seine Beharrlichkeit bewunderte, hatte ihn fortan mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt. Im zurückliegenden Jahrzehnt hatte Stafford die Größe seiner Kanzlei verdoppelt und mit den Einnahmen aus den juristischen Scharmützeln, die er für Troy führte, ein Vermögen gemacht.
Niemand hatte Troy Phelan in seinen letzten Lebensjahren nähergestanden als Josh Stafford. Er kehrte jetzt mit Durban ins Konferenzzimmer im dreizehnten Stock zurück, verschloß die Tür und schickte Snead mit der Anweisung fort, sich hinzulegen.
Vor laufender Kamera öffnete Stafford den Umschlag und entnahm ihm die drei gelben Bogen. Der erste enthielt eine für ihn bestimmte Mitteilung Troys. Er sagte in die Kamera: »Dieser an mich gerichtete handschriftliche Brief Troy Phelans trägt das Datum des heutigen Tages, Montag, 9. Dezember 1996. Er besteht aus fünf Absätzen. Ich lese ihn im Wortlaut vor:
›Lieber Josh, ich bin jetzt tot. Nachstehend meine Anweisungen, die ich Sie genau zu befolgen bitte. Ich möchte, daß meine Wünsche ausgeführt werden. Notfalls müssen Sie vor Gericht gehen, um sie durchzusetzen.
Erstens soll aus Gründen, deren Bedeutung sich später zeigen wird, eine baldige Autopsie durchgeführt werden.
Zweitens will ich keinerlei Beisetzungsfeierlichkeit, Gedenkgottesdienst oder eine ähnliche Veranstaltung. Man soll mich verbrennen und meine Asche aus der Luft über meiner Ranch in Wyoming verstreuen.
Drittens möchte ich, daß der Inhalt meines Testaments bis zum 15. Januar 1997 vertraulich bleibt. Dem Gesetz nach sind Sie nicht verpflichtet, es sogleich offenzulegen. Halten Sie es also einen Monat zurück.
Bis dann. Troy.‹«
Bedächtig legte Stafford das erste Blatt auf den Tisch und nahm das zweite zur Hand. Er überflog es und sagte dann in die Kamera: »Das hier ist ein aus einer Seite bestehendes Dokument, das als Letzter Wille des Troy L. Phelan gekennzeichnet ist. Ich lese es im Wortlaut vor:
›Letztwillige Verfügung von Troy L. Phelan. Ich, Troy L. Phelan, widerrufe hiermit im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte nachdrücklich jedes früher von mir abgefaßte Testament sowie alle Nachträge dazu und verfüge über mein Vermögen wie folgt:
Meinen Kindern Troy Phelan jun., Rex Phelan, Libbigail Jeter, Mary Ross Jackman, Geena Strong sowie Ramble Phelan hinterlasse ich einen Geldbetrag, der ausreicht, ihre jeweiligen Schulden in der Höhe zu begleichen, die sie am heutigen Tag aufweisen. Nach dem heutigen Datum anfallende Schulden werden davon nicht gedeckt. Sollte einer der genannten Nachkommen den Versuch unternehmen, dieses Testament anzufechten, entfällt das für ihn vorgesehene Geldgeschenk vollständig.
Meine ehemaligen Ehefrauen Lillian, Janie und Tira bekommen nichts. Sie sind bei der Scheidung jeweils angemessen versorgt worden.
Mein verbleibendes Vermögen hinterlasse ich meiner am 2. November 1954 im katholischen Krankenhaus von New Orleans, Louisiana, geborenen Tochter Rachel Lane. Ihre Mutter, eine Frau namens Evelyn Cunningham, ist zwischenzeitlich verstorben.‹«
Keinen dieser beiden Namen hatte Stafford je gehört. Er mußte Luft holen, bevor er mit dem Vorlesen fortfuhr.
»›Zum Verwalter meines Nachlasses setze ich den Anwalt meines Vertrauens, Josh Stafford, ein und lasse ihm weitgehende Entscheidungsfreiheit in der Frage, wie er dabei vorgeht.
Es handelt sich um ein eigenhändiges Testament, das ich Wort für Wort selbst verfaßt habe und nachstehend unterschreibe.
Unterschrieben am 9. Dezember 1996 um drei Uhr nachmittags von Troy L. Phelan‹.«
Stafford legte das Blatt auf den Tisch und blinzelte in die Kamera. Obwohl er das Bedürfnis hatte, um das Gebäude herumzugehen, sich vielleicht ein wenig von der frischen Luft durchblasen zu lassen, fuhr er fort. Er nahm das dritte Blatt zur Hand und sagte: »Hierbei handelt es sich um eine aus einem Absatz bestehende Mitteilung, die wieder an mich gerichtet ist. Ich lese sie vor: ›Josh: Rachel Lane ist an der Grenze zwischen Brasilien und Bolivien als Missionarin einer Organisation namens World Tribes Missions tätig. Sie arbeitet in einer als Pantanal bezeichneten abgelegenen Gegend unter Indianern. Die nächstgelegene Stadt ist Corumbá. Ich habe seit zwanzig Jahren keine Verbindung zu ihr gehabt und sie auch jetzt nicht auftreiben können. Gezeichnet Troy Phelan‹.«
Durban schaltete die Kamera ab und ging zweimal um den Tisch herum, während Stafford das Dokument immer wieder las.
»Wußten Sie, daß er eine uneheliche Tochter hatte?«
Stafford sah abwesend auf eine Wand. »Nein. Ich habe für Troy elf Testamente aufgesetzt, und er hat sie in keinem von ihnen auch nur einmal erwähnt.«
»Vermutlich dürfte uns das nicht überraschen.«
Stafford hatte häufig gesagt, Troy Phelan könne ihn nicht mehr überraschen. Im Geschäftsleben wie auch in seinen privaten Angelegenheiten war er launisch und sprunghaft gewesen. Obwohl Stafford Millionen damit verdient hatte, sich um diesen Mandanten zu kümmern und brisante Angelegenheiten für ihn zu entschärfen, war er wie vor den Kopf geschlagen. Er war soeben Zeuge eines recht dramatischen Selbstmords geworden, bei dem ein an den Rollstuhl gefesselter Mann mit einem Mal aufgesprungen und losgerannt war. Jetzt hatte er ein gültiges Testament vor sich, das in einigen knappen Absätzen eins der bedeutendsten Vermögen auf der Welt einer unbekannten Erbin hinterließ, ohne den geringsten Hinweis darauf, was mit dem Geld geschehen sollte. Die Erbschaftssteuer würde exorbitant sein.
»Ich brauche was zu trinken, Tip«, sagte er.
»Es ist ein bißchen früh dafür.«
Sie gingen nach nebenan in Phelans Büro, wo sie alles unverschlossen vorfanden. Seine gegenwärtige Sekretärin und alle anderen im dreizehnten Stock Beschäftigten waren noch unten.
Die beiden Männer schlossen die Tür hinter sich ab und gingen eilig daran, alles zu durchsuchen. Offensichtlich hatte Troy damit gerechnet, sonst hätte er nie und nimmer Schubladen und Aktenschränke unverschlossen gelassen, die private Papiere enthielten. Offenbar war ihm klar gewesen, daß Josh sofort handeln würde. In der mittleren Schublade seines Schreibtischs fanden sie einen fünf Wochen zuvor unterschriebenen Vertrag mit einem Krematorium in Alexandria. Darunter lag eine Akte über die World Tribes Missions.
Sie suchten zusammen, was sie tragen konnten, holten dann Snead und veranlaßten ihn, das Büro abzuschließen. »Was steht in dem Testament, dem letzten?« fragte Snead, blaß und mit geschwollenen Augen. Unmöglich konnte Mr. Phelan einfach so sterben, ohne ihm etwas zu hinterlassen, wovon er leben konnte. Immerhin hatte er ihm dreißig Jahre lang treu gedient.
»Das kann ich nicht sagen«, antwortete Stafford. »Ich komme morgen wieder, um alles zu inventarisieren. Lassen Sie keinen Menschen hier rein.«
»Natürlich nicht«, flüsterte Snead und brach erneut in Tränen aus.
Stafford und Durban brachten eine halbe Stunde mit einem Polizeibeamten zu, der routinemäßig gekommen war. Sie zeigten ihm die Stelle, an der Troy über das Geländer geklettert war, nannten ihm die Namen von Zeugen, beschrieben den letzten Brief und das letzte Testament, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Sie versprachen ihm eine Kopie des Autopsieberichts. Der Beamte betrachtete den Fall schon als abgeschlossen, bevor er das Gebäude verließ.
Sie fuhren zum Büro des Gerichtsmediziners, wo der Leichnam bereits eingetroffen war, und veranlaßten die Autopsie.
»Wozu soll die dienen?« fragte Durban flüsternd, während sie auf Formulare warteten, die ausgefüllt werden mußten.
»Sie soll den Beweis liefern, daß weder Drogen noch Alkohol im Spiel waren, nichts, was seine geistigen Fähigkeiten hätte beeinträchtigen können. Er hat an alles gedacht.«
Erst kurz vor sechs konnten sie eine Bar im Willard Hotel aufsuchen, das in der Nähe des Weißen Hauses zwei Querstraßen von ihrem Büro entfernt lag. Nach einem kräftigen Schluck brachte Stafford zum ersten Mal ein Lächeln zustande. »Er hat wirklich an alles gedacht, nicht wahr?«
»Er ist sehr grausam«, sagte Durban, tief in Gedanken versunken. Zwar ließen die Auswirkungen des Schocks langsam nach, dafür aber meldete sich die Wirklichkeit zu Wort.
»Sie meinen wohl, er war grausam.«
»Nein, Troy ist noch immer da. Er bestimmt nach wie vor die Regeln, nach denen gespielt wird.«
»Können Sie sich vorstellen, wieviel Geld diese Dummköpfe im nächsten Monat ausgeben werden?«
»Es kommt mir wie ein Verbrechen vor, es ihnen nicht zu sagen.«
»Wir dürfen nicht. Wir haben unsere Anweisungen.«
Angesichts der Tatsache, daß es sich um Anwälte handelte, deren Mandanten nur selten miteinander sprachen, war die Sitzung ein seltener Fall von Kooperationsbereitschaft. Das ausgeprägteste Ego im Raum gehörte Hark Gettys, einem auf Prozesse geradezu erpichten Anwalt, der seit mehreren Jahren Rex Phelan vertrat. Hark hatte diese Sitzung einberufen, kurz nachdem er in seine Kanzlei an der Massachusetts Avenue zurückgekehrt war. Er hatte sogar TJs und Libbigails Anwälten seinen Vorschlag zugeflüstert, während sie zusahen, wie man den Alten in den Rettungswagen lud.
Der Einfall war so gut, daß seine Kollegen nichts dagegen vorbringen konnten. Gemeinsam mit Flowe, Zadel und Theishen trafen sie nach fünf Uhr in Gettys Kanzlei ein. Ein Gerichtsstenograph und zwei Videokameras warteten bereits.
Verständlicherweise machte sie der Selbstmord nervös. Die drei Psychiater wurden einzeln beiseite genommen und ausführlich über alles befragt, was sie an Mr. Phelan unmittelbar vor seinem Ende wahrgenommen hatten.
Keiner der drei hatte den geringsten Zweifel daran, daß er genau gewußt hatte, was er tat, daß er bei klarem Verstand und mehr als nur testierfähig gewesen war. Sie wiesen mit Nachdruck darauf hin, daß man nicht verrückt zu sein braucht, um sich das Leben zu nehmen.
Als alle dreizehn Anwälte jede nur denkbare Meinung aus den Anwesenden herausgefragt hatten, beendete Gettys die Sitzung. Es war fast acht Uhr abends.
VIER
Forbes Magazine hatte Troy Phelan als zehntreichsten Amerikaner bezeichnet. Sein Tod war auf jeden Fall ein berichtenswertes Ereignis; die Art und Weise, wie er gestorben war, machte es zur Sensation.
Auf der Straße vor Lillians Villa in Falls Church wartete eine Schar Reporter darauf, daß sich ein Sprecher der Familie zu der Angelegenheit äußerte. Sie filmten Bekannte und Nachbarn, die kamen und gingen, und stellten ihnen allgemeine Fragen über die Familie.
Im Innern des Hauses hatten sich Phelans vier älteste Nachkommen mit ihren Ehepartnern und Kindern versammelt, um Beileidsbekundungen entgegenzunehmen. Die Stimmung war gedämpft, solange sich Außenstehende in der Nähe befanden. Als sie fort waren, änderte sich die Stimmung schlagartig. Da auch Troys Enkel anwesend waren – insgesamt elf –, sahen sich TJ, Rex, Libbigail und Mary Ross gezwungen, ihre Hochstimmung zumindest ansatzweise zu unterdrücken. Es fiel ihnen schwer. Erlesene Weine und Champagner flossen in Strömen. Der alte Troy würde ja wohl nicht wollen, daß sie vor Kummer vergingen, oder? Die älteren Enkel tranken mehr als ihre Eltern.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!