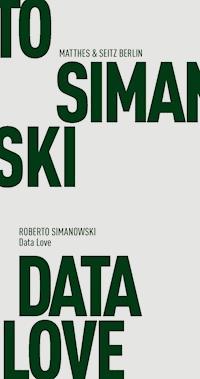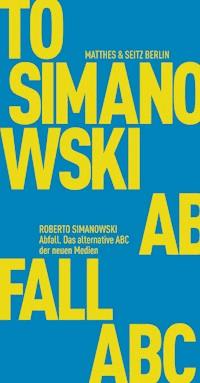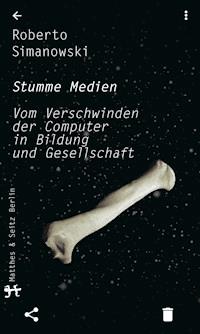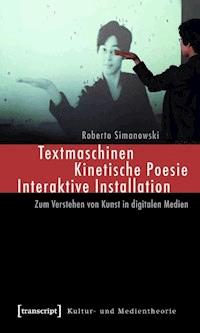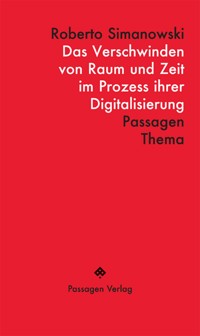
15,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Passagen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Passagen Thema
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Was sind das für Zeiten, in denen Menschen mit dem Blick aufs Handy wie Zombies durch die Straßen irren und das Internet Sklaven der Sofortbelohnung aus uns allen macht? Wir erleben das Ende des Gehens und des Wartens, den Verlust der Öffentlichkeit und der Impulskontrolle. Raum und Zeit verfangen sich im Netz ihrer digitalen Verhältnisse und werden uns seltsam fremd. Wir sind Zeugen einer Welt im Umbruch, bedrohlich und verheißungsvoll zugleich und mit ungewissem Ausgang. Wäre das Metaverse oder das Sozialkreditsystem die Rettung? Höchste Zeit, den Symptomen dieses Umbruchs nachzuspüren, über ihre offensichtliche Bedeutung hinaus hin zu ihren geheimsten Plänen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Ähnliche
Was sind das für Zeiten, in denen Menschen mit dem Blick aufs Handy wie Zombies durch die Straßen irren und das Internet Sklaven der Sofortbelohnung aus uns allen macht? Wir erleben das Ende des Gehens und des Wartens, den Verlust der Öffentlichkeit und der Impulskontrolle. Raum und Zeit verfangen sich im Netz ihrer digitalen Verhältnisse und werden uns seltsam fremd. Wir sind Zeugen einer Welt im Umbruch, bedrohlich und verheißungsvoll zugleich und mit ungewissem Ausgang. Wäre das Metaverse oder das Sozialkreditsystem die Rettung? Höchste Zeit, den Symptomen dieses Umbruchs nachzuspüren, über ihre offensichtliche Bedeutung hinaus hin zu ihren geheimsten Plänen. Zeit für eine Betrachtung zur kulturstiftenden Wirkung des Internets mit dem Mut zur Vermutung, für eine Diskussion versteckter Kausalketten, geheimer Sachzwänge und verführerischer Versprechen der Digitalisierung. Zeit für eine Medienphilosophie der Überraschung.
Roberto Simanowski lebt nach Professuren als Kultur- und Medienwissenschaftler in den USA, Hongkong und der Schweiz als Publizist in Berlin und Rio de Janeiro. Sein Buch Todesalgorithmus. Das Dilemma der künstlichen Intelligenz erhielt 2020 den Tractatus-Preis für philosophische Essayistik.
DAS VERSCHWINDEN VON RAUM UND ZEITIM PROZESS IHRER DIGITALISIERUNG
PASSAGEN THEMA
Deutsche Erstausgabe
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-7092-0560-0
eISBN 978-3-7092-5074-7 (EPUB)
© 2023 by Passagen Verlag Ges. m. b. H., Wien
http://www.passagen.at
Grafisches Konzept: Gregor Eichinger
Satz: Passagen Verlag Ges. m. b. H., Wien
Inhalt
VorwortDie Weltbetrachtung des Verdachts
Punktzeit
Raumverlust
Verdachtskritik
Verschwendung des öffentlichen RaumesÜber Smartphone-Zombies
Rivalitäten
Spazierengehen
Raumzeit
Raumöffnung
Fremdbestimmung
Sichtbarkeitsgebühr
Zufallsangst
Zufallskontrolle
Reisestopp
Crowdsourcing
Vermessungsparadigma
Cyber- City
Daten-Allmende
Flaneur
Raumentsorgung
Metaverse
Zeitfrage
Einsamkeit der PunktzeitÜber Impulskontrolle
Mangelnde Impulskontrolle
Dialektik der Wunscherfüllung
Generation Schneeflocke
Zeitalter des Ich
Ende der Geschichte/n
Nudging
Moral der Selbstkontrolle
Numerischer Herdentrieb
Gutes Gängeln
Mängelwesen Mensch
Verhaltenskonditionierung
Ehrliche Daten
Behavioral Sequencing
Algocracy
Gamification
Social Credit System
Ex Oriente Lux
Dekontextualisierung
Wiedergutmachung
Web3-Institutionalismus
Letzte Meistererzählung
Anmerkungen
VorwortDie Weltbetrachtung des Verdachts
Punktzeit
Die Zeit vergeht jetzt schneller. Jetzt, da wir soviel von ihr im Internet verbringen, daheim am Computer oder unterwegs am Smartphone. Da ist immer etwas los. Immer ist man im Kontakt: mit dem Wissen der Welt, mit seinen sozialen Netzwerken, mit den Tweets, Instagrams, Blogs, TikToks oder Videos der Lieblings-Twitterer, -Instagramer, -Blogger, -Vlogger … Das Ende der downtime, wie die Zeit ohne konkrete Beschäftigung auf Englisch heißt. Das Ende der Langeweile, dieser Gewähr, dass man noch „zu sich gelange“, bei all der Verführung, die die Welt für uns bereithält, wie schon Siegfried Kracauer, Kulturphilosoph der Goldenen Zwanziger Jahre, notierte.1
Andere meinen, die Zeit vergeht jetzt langsamer.
Weil sie aus der Distanz auf die Fülle schauen.
Wenn viel passiert, wird der Tag kürzer und das Jahr länger. So wie Leere und Monotonie die Stunde länger und den Tag kürzer erscheinen lassen. Sagt Thomas Manns Erzähler im „Zeitroman“ Der Zauberberg.2
Wir ahnen, dass er Recht hat. Erscheint uns ein beliebiges Jahr unserer Jugend etwa nicht länger als ein Jahr Berufsalltag?
Wieviel passiert wirklich, wenn das Leben als Sequenz intensiver Augenblicke verläuft? Eilt man nicht von einem Moment zum nächsten, von einem Ereignis zum anderen? Fügt sich all dies überhaupt noch zu einer sinnvollen Geschichte zusammen?
So jedenfalls wird unsere „flüchtige Moderne“ nicht erst seit gestern beschrieben. Als „Punktzeit“. Punkte statt Linie. Ist die Gegenwart noch das Vorpreschen der Vergangenheit in die Zukunft, wie der französische Philosoph Henri Bergson es vor hundert Jahren beschrieb? Jedenfalls tritt die Gegenwart nicht mehr dreifach auf, wie es der Kirchenlehrer Augustinus vor sechzehnhundert Jahren sah: als Erinnerung des Vergangenen, als Erwartung der Zukunft und als erlebtes Jetzt – praesens de praeteritis memoria, praesens de futuris expectatio, praesens de praesentibus contuitus.3
Die Gegenwart der Punktzeit ist einsam – und in einem tieferen Sinne unmenschlich.
Denn wenn Paul Ricoeur, der französische Philosoph des Narrativen, sagt: nur erzählte Zeit ist menschliche Zeit,4 meint er nicht isolierte Episoden – Instagram-Stories etwa und andere Foto- und Video-Posts. Er zielt auf deren Verbindung zu einer sinnvollen Geschichte. Diese Verbindung, dieser Sinn ist abhandengekommen. Das wird selten bedauert, und eigentlich zu Recht: Es ist ja auch eine Befreiung aus Geschichten, die gar nicht unsere sind.
Aber wir beginnen, uns verloren zu fühlen in der Zeit. Irgendwas fehlt.
So kommt es zur ersten These: Wir leben immer im Jetzt.
Ganz gleich, wie schnell der Tag vergeht und das Jahr, wir sind dem aktuellen Moment verfallen, den wir ungern an die Zukunft verpfänden, per Verzicht, Geduld und Ausdauer, als Lustaufschub und Impulskontrolle.
Die Langzeitfolgen dieser Kurzsichtigkeit gefährden, das ist die zweite These, nicht nur uns selbst. Sie setzen auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und, ja!, die Zukunft des Planeten aufs Spiel. Wenn niemand heute zu Verzicht bereit ist, damit es ein lebenswertes Morgen gibt, für ihn oder sie und für künftige Generationen, dann wird das unbedingte Jetzt zum unbedingten Ich, an dem alle Hoffnung zerbricht: ein Trump-Ich, wie zu sehen sein wird.
Die Schuld an diesem Trend liegt zum Großteil beim Internet, das uns die Geduld und den Lustaufschub austrieb. Zugleich entstehen mit dem Internet – dritte These – die Mittel der Korrektur.
In Kooperation mit dem Smartphone produziert das Internet jene Daten zu gesellschaftlichen Vorgängen, die sich mit Algorithmen koppeln lassen, um das richtige Verhalten zu fördern und zu forcieren. Durch diese Hintertür wird jedes Jetzt schließlich doch noch zum Teil einer Geschichte, an der sich das Ich messen lassen muss, im Bewertungswesen des Westens ebenso wie in Chinas Sozialkreditsystem.
Die Selbstdisziplin kehrt zurück mit dem Score, der jedem Augenblick eine Bedeutung weit über sich hinaus gibt. In der Erzählung der Zahl liegt der Sinn, den das Subjekt der Punktzeit so lang gesucht hatte, wenn es denn etwas suchte, das über es hinausgeht. Das letzte grand narrative ist numerisch.
Davon handelt der zweite Teil in diesem Buch.
Raumverlust
Die Zeit vergeht online schneller, wo der Raum dünner ist. Es gibt keine Wege von A nach B, nur einen Link. Verloren der Zwischenraum, der Zeit kosten könnte.
Was in der digitalen Welt der Link ist, ist in der analogen das Smartphone. Es tilgt nicht die Zeit, wohl aber den Raum, dem diese nun nicht länger gehört: den Raum zwischen A und B. Die Zeit wird – im Gang durch den Raum – verbracht in der eigenen Parallelwelt: in Videogames, sozialen Netzwerken, Kommunikationsforen.
Verliert – eine weitere These – der Raum die Zeit, verliert der Mensch den Raum. Denn wie soll der Raum die Menschen noch bestimmen, wenn sie ihn wie Zombies mit den Augen aufs Smartphone blind durchqueren? Der psychologische und politische Schaden hinter diesem Verlust ist Thema im ersten Teil des Buches.
Das Problem erschöpft sich keineswegs im banalen und zugleich schamlosen Umstand, dass die Smartphone-Zombies ihr Umfeld ignorieren und von den anderen erwarten, ihnen auszuweichen. Sie verändern zugleich den öffentlichen Raum, und zwar für alle und auch dann, wenn sie ihn nicht am Smartphone ignorieren, sondern nur noch durch dieses wahrnehmen: nach den Gesetzen des Internets, crowd-sourced und app-geleitet.
Der öffentliche Raum wird immer mehr durch die Brille des Digitalen wahrgenommen, durch Maps und Apps, die anderswo codiert werden und von dort den Blick aufs Hier bestimmen. Es ist das Ende des Zufalls, von dem man sich einst überraschen ließ, als man technologiefrei unterwegs war. Es ist die digitale Kolonisierung des Raumes und des Smartphone-Zombies selbst: Beide werden des politischen Potenzials beraubt, das sich andernfalls in ihnen bilden könnte.
Das Smartphone ist das Trojanische Pferd einer Zukunft, an der wir längst alle beteiligt sind, selbst dann, wenn wir ohne es unterwegs sind.
Das ist die finale These im ersten Teil.
Verdachtskritik
Nein, dieses Buch ignoriert nicht all das Gute, das uns das Internet gebracht hat.
Natürlich haben wir nun viel leichter Zugang zum Wissen – und wer wollte sagen, sie oder er profitierte nicht davon, dem Internet schnell mal eine Frage stellen zu können. Ebenso erleichtert das Internet, sich mit Gleichgesinnten oder Andersdenkenden – je nach persönlicher Präferenz – zu verbinden. Auch stimmt es natürlich, dass wir per WhatsApp und Zoom – oder wie immer die App heißt, die wir bevorzugen – viel besser in Kontakt bleiben als zuvor: mit den Eltern, mit den Schulfreunden, mit wem auch immer. Und dann ist da natürlich Wikipedia, das Erfolgsmodell der kollektiven Wissensproduktion, das Lieblingskind der Internet-Optimisten, ganz zu schweigen von Chatbots wie GPT, die noch ganz andere Versprechen mit sich bringen.5
All das ist unbestritten, wie hier für jene betont sei, die sich bei jeder Kritik des Internets veranlasst fühlen, lauthals an dessen Vorteile zu erinnern. Es geht nicht um die Aufrechnung der Vor- und Nachteile. Kaum jemand wünscht sich wohl ernsthaft das Leben vor dem Internet zurück, obwohl es natürlich stimmt, dass auch damals das Leben schon lebenswert war, so wie ja auch vor der Erfindung des Fernsehens und des Autos Menschen sich glücklich wähnten.
Inzwischen kennen wir allerdings auch all die Negativbegriffe, die das Internet hervorgebracht hat: Filterblase, Hassreden, Fake-News, mangelnde Privacy, prekäre Arbeitsverhältnisse, Narzissmus, Identitätskrise, Suchtverhalten …
Drei Jahrzehnte nach seiner Popularisierung als WWW ist das Internet für viele kein „gutes Medium“ mehr, und nicht wenige sehen darin gar eine Gefährdung der Demokratie, die man einst gerade beim Internet in guten Händen sah. Kein Wunder also, dass vormalige „Cyber-Utopisten“ zu vehementen Kritikern des Internets geworden sind6 und die Pioniere des Cyberspace, wie das Internet einmal hieß, sich nun vom Staat Hilfe bei dessen Regulierung erhoffen.
Darum geht es in diesem Buch: nicht um pauschale Medienschelte, sondern um den geschärften Blick auf bestimmte Prozesse und deren mögliche Langzeitfolgen. Man will ja nicht erneut derart überrascht werden.
Es geht um die Rückkehr des Misstrauens.
Es geht um die Rückkehr des Misstrauens, zu dem Ende der 1960er Jahre der gleiche Paul Ricoeur mit seiner Hermeneutik des Verdachts aufrief, unter Verweis auf Marx, Freud und Nietzsche, die alle auf ihre Weise den verborgenen Sinn hinter den Phänomenen unseres Daseins freigelegt hatten.
Dieses hermeneutische Misstrauen wurde damals zum Paradigma der Moderne, als Ergänzung und Gegenspieler zu ihrem ersten Paradigma: der Vermessung. Nichts, so hieß die neue Annahme, ist, was es zu sein schien. Das gilt heute auch fürs Internet.
Gewiss, das hermeneutische Misstrauen geriet in Verruf, als es „paranoid“ und aktivistisch wurde und Interpretation als heroischen Befreiungskampf für die Unterdrückten verstand.7 Eine Reaktion darauf war die Forderung, das Enthüllen zugunsten der Beschreibung aufzugeben8 oder zumindest auf Fakten zu beschränken, die sich mit algorithmischen Analysemethoden tief unten in der Datenmenge der Texte finden ließen. Die neuen Modelle hießen „surface reading“ und „distant reading“.9 Letzteres war Bestandteil des Computational Turn in den Geisteswissenschaften, der diese in eine verlässliche Wissenschaft überführen wollte, die ihre Erkenntnisse nicht auf wilden Theorien aufbaut, sondern auf empirischen Daten.
Der Kritiker war nun „nicht mehr wie ein Detektiv, der dem Verdächtigen nicht traut, sondern eher der Sozialwissenschaftler, der die manifesten Aussagen eines Textes beschreibt“.10 Statistische Tiefenbohrung statt hermeneutischen Misstrauens. Man war bescheiden geworden, positivistisch statt detektivisch, Erbsenzähler statt Kaffeesatzleser, wie die gegenseitigen Schimpfworte lauten. Aus den theorieversessenen bissigen Pitbulls waren Golden Retriever geworden, die fleißig Daten sammelten und visualisierten.11
Auch das Projekt der Digital Humanities erwies sich als Sackgasse und wird inzwischen gerade von einer ihrer Galionsfiguren als gescheitert erklärt.12 Zeit, vom Zählen zur Theoriebildung zurückzukehren. Zeit auch, den Computer, der in den digitalen Geisteswissenschaften nur als Erkenntnismittel vorkam, zu einem Erkenntnisobjekt zu erheben: den Computer, das Internet, das Smartphone, die Algorithmen, Künstliche Intelligenz. Denn gerade dies ist dringend nötig: eine medien- und kulturwissenschaftliche und schließlich auch politische Kritik der Digitalisierung der Gesellschaft, statt selbst unkritisch auf den Zug der Digitalisierung aufzuspringen.
Geboten ist eine kritische Analyse der Textur der digitalen Gesellschaft; kritisch nicht wie ablehnend, sondern wie achtsam. Notwendig ist eine Analyse, die skeptisch – und lieber paranoid als gutgläubig – den mehr oder weniger etablierten Phänomenen unserer digitalen Lebenswelt ihre paradoxe Logik ablauscht, ihre geheimen Bezüge und verdeckten Effekte, mit dem Misstrauen des Detektivs, also verdachtskritisch.
Das Misstrauen beginnt mit der Frage, welches Verbrechen eigentlich vorliegt, wenn denn eines vorliegt.
Die Ausgangspunkte in diesem Buch – das Smartphone-Zombie und das Marshmallow-Experiment – sind zunächst nur harmlos wirkende Alltagsphänomene der Digitalisierung, lebensweltliche Selbstverständlichkeiten, die aber – von dieser Voraussetzung lebt das Buch – verborgene Welten in sich tragen: Welten, die in einen anderen Raum führen oder in künftige Zeit. Welten, die es phänomenologisch zu erschließen gilt, „in mutwillig erhöhter Rezeptivität“13 oder eben detektivischer Verdächtigungsbereitschaft.
So wird die Betrachtung all das an Stoff und Ideen einbeziehen, was auf ihrem Weg trotz scheinbarer Abwegigkeit auf Entdeckung hofft, mit der Logik des nächsten Schrittes und dem „Mut zur Vermutung“,14 der am Ende auch vor Toten nicht Halt macht.
Verschwendung des öffentlichen RaumesÜber Smartphone-Zombies1
Eine Straße, an einem Sommerabend. Kinder, die den Fremden nach der Zeit fragen. Wie lang ist das her? Und worum ging es da?
Der Dichter Botho Strauß beschreibt es so: „Die allgemeine Gewöhnung unter uns Städtern, dem anderen kaum mehr ins Auge zu blicken, ihn möglichst nicht zu beachten, scheint diese Kinder zu stören. Sie merken doch, wie die freundliche Neugier, ihr ureigenes Element, ohne das sie nichts werden können, ringsum wenig bedeutet. Dagegen regen sie sich und fragen an den Leuten entlang; es drängt sie, den Fremden kurz zu berühren, und sei es nur, um von ihm die Stunde zu hören.“
Als Strauß dies schrieb, 1984, in der Einleitung zu seinem Roman Der junge Mann, hatte alles gerade erst begonnen. Der Schlachtruf, den Strauß nicht im Sinn hatte, der hier aber zu erinnern ist, kam von einem Computer-Unternehmen in Kalifornien am Anfang des gleichen Jahres; er wurde ausgestrahlt während des Super Bowls, dem Finale der US-Football-Liga: „On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you’ll see why 1984 won’t be like 1984.“
Die Kampfansage gegen Orwells Big Brother-Dystopie, die Apple mit seinem Produkt verband, hat sich nicht erfüllt. Wir leben in einer Überwachungsgesellschaft; und zwar nicht trotz, sondern als Ergebnis dessen, was jener Macintosh, den Apple-Chef Steve Jobs am 24. Januar 1984 einem begeisterten Publikum vorstellte, als Losung ausgab: „Never trust a computer you can’t lift.“
Die Stimme, die das sprach, glich einem Frosch in der Metallbox. Heute sprechen Computer mit der Geschmeidigkeit von Siri, Alexa und LaMDA. Auch die Größenverhältnisse haben sich drastisch verändert. Seit dem iPhone, 23 Jahre nach 1984, heißt es eher: Traue keinem Computer, der nicht in deine Hand passt.
Genau darin liegt das Problem.
Das Smartphone ist nicht Big Brothers Gegenspieler, es ist sein Komplize. Apples Emanzipationsversprechen führt schließlich in vielerlei Hinsicht zur Entmündigung des Subjekts. Ein Treppenwitz der Technikgeschichte, der allen klar wird, die sich die aktuelle Nutzung dieser Technik einmal genauer ansehen.
Rivalitäten
Inzwischen gehört es zur täglichen Erfahrung: Passanten, die auf ihr Handy starren, nicht nur in der U-Bahn, sondern auch beim Gehen in der Stadt. Menschen, deren ambient attention nicht weiter reicht als bis zum nächsten Hindernis. Widerstand, gar ein trotziges In-den-Weg-Stellen, wenn diese „Smartphone Zombies“ – oder „Smombies“ – durch überfüllte Straßen schleichen, wirkt da hilflos aggressiv: Sie weichen einem aus, ohne aufzublicken. Da bleibt nur die Schadenfreude, wenn sie vor lauter Nicht-hier-Sein den Fahrstuhl zu früh verlassen oder die falsche Toilette aufsuchen.
In Hongkong war es schon 2016 ein Massenphänomen. Nirgendwo anders sah man so viele Menschen mit dem Blick aufs Handy durch die Stadt gehen wie dort, obwohl gerade dort sich viel zu viele Menschen auf viel zu schmalen Bürgersteigen drängeln. Da kamen nicht einmal die Warnungen hinterher.
„Please hold the hand rail. Don’t keep your eyes only on the mobile phone!“ So lautete die Audio-Schleife an den Rolltreppen der U-Bahn. Dabei ist dies der einzige Ort, wo der Blick der Passanten aufs Handy ungefährlich ist. Anderswo konnte es das Leben kosten. Ein trauriges Beispiel ist die 28-jährige Wang, die am 29. Dezember 2015 nicht auf den Weg achtete und im Fluss ihres Heimatortes Whenzhou in Ostchina ertrank.2
Aber selbst in beschaulichen Orten der Schweiz ist das Problem längst angekommen. Die Lausanner Polizei erregte im Mai 2015 mit einer Warnung vor dem Texten im Gehen Aufsehen. „Zaubertrick mit dem Smartphone im Strassenverkehr“ heißt das Video über Jonas, 24 Jahre alt, Rap- und R&B-Fan, der, wie es hieß, unterwegs gern mit seinen Freunden textet. „Jonas hat keine Erfahrung mit Magie“, so der verschlagen lächelnde Erzähler, „und doch wird er gleich vor euren Augen verschwinden. Schauen wir genau hin!“
Dann tritt Jonas textend an den Rand der Straße, blickt kurz in die falsche Richtung und wird, als er die Straße betritt, von der anderen Seite her rasant durch ein Auto aus dem Bild gestoßen. Es folgt Geschrei und Entsetzen der Passanten und der verschmitzte Gruß des Erzählers, der sich als Bestattungsunternehmer erweist: „Hey, bis bald!“3
Die Polizei dramatisiert das Phänomen natürlich in betriebseigener Logik als Unfalltod. Man kann allerdings auch durch eine Kugel zu Tode kommen, wenn man nur Blicke fürs Handy hat und jedes Gefühl für die Umgebung verliert. Dies geschah im weniger beschaulichen, weit gefährlicheren Rio de Janeiro gleich mehreren Touristen, die ihrem Navi in eine Favela folgten, wie die Slums in Brasilien heißen, wo weniger der Staat herrscht als bewaffnete Banden.
November 2008 kamen so drei Norweger unter Beschuss, als ihr Navi sie auf eine Abkürzung durch eine Favela schickte. Anfang Dezember 2016 wurde ein italienischer Motoradfahrer erschossen, der seinem Navi in eine Favela folgte, wo man ihn für einen Polizisten hielt, weil sein Helm eine Kamera enthielt, mit der er wahrscheinlich Echtzeitfotos an sein soziales Netzwerk schickte. Im Februar 2017 starb eine Argentinierin, die mit Freunden auf dem Weg zu Rios berühmter Christus-Statue die vorgeschlagene Route durch eine Favela nahm, wo sie einer Gruppe bewaffneter Männer begegneten, die schließlich wahllos ins Auto schoss.4
Das sind Sonderfälle des „Death by GPS“, wie das Phänomen heißt, wenn Menschen unkritisch den Vorgaben ihres Navis folgen, ohne auf ihr tatsächliches Umfeld zu achten. In weniger gewalttätigen, aber ebenso tödlichen Fällen, endet man dann plötzlich in unwirtlicher Gegend, ohne Benzin und Wasser.
Ein zweiter Fachbegriff dafür lautet automation bias: die Neigung, der App mehr zu vertrauen als dem eigenen Gefühl. Ein Bias, das jeder kennt, der einmal entgegen der eigenen Intuition der App folgte, in der Annahme, sie werde schon wissen, was sie tut, wenn sie diesen statt jenen Weg vorschlägt, immerhin verfügt sie über weit mehr Daten als man selbst.
Nicht immer geht von diesem Bias Gefahr aus, und in den meisten Fällen mag die App auch wirklich schneller ans Ziel bringen. Selbst dann aber ist es symptomatisch für die Rivalität der Räume: Smombies glauben weniger dem Raum, in dem sie sich befinden, als dem kybernetischen Raum, in dem die Informationen über den physischen Raum zusammenfließen, um per Smartphone an alle ausgegeben zu werden, die sich in diesem befinden.
Damit nicht der Verdacht eines Anti-App-Bias entsteht, sei auch erwähnt, dass unter bestimmten Bedingungen das Smartphone ein Mittel sein kann, sich physische Räume überhaupt erst einmal zu erschließen. Nicht weil es den Weg zu ihnen anzeigen oder andere wichtige Informationen liefern würde. Das Gerät muss nicht einmal zum Einsatz kommen. Es genügt schon seine Existenz, es genügt schon die bloße Möglichkeit seiner Existenz.
So war es in Rio de Janeiro noch Ende des 20. Jahrhunderts ein Wagnis, die Avenida Lúcio Costa am Strand in Barra in Richtung Prainha soweit hinauszufahren, dass man alle Häuser hinter sich ließ. Man musste mit Polizei rechnen, die garantiert immer etwas fand, was nicht in Ordnung war, und erst dann von einem ließ, wenn man sie mit Geld vom Gegenteil überzeugt hatte. Seit man mit dem Handy vor Ort seinen Anwalt anrufen kann, ist dieser Raum problemlos befahrbar.
Das Verschwinden des Subjekts aus seinem Umfeld beginnt allerdings lange vor der Kollision mit einem Auto oder der Begegnung mit Bewaffneten. Es beginnt, wenn man auf dem Weg von A nach B den Raum dazwischen nur noch als Zeit betrachtet und sich in die Parallelwelt des Internets begibt.
Man ist schon verschwunden, wenn man noch da ist. Smombies sind nicht Untote, die zurückkamen, sondern Abwesende, die ihre Körper zurückließen. Es sind, so ein anderer Koffer-Neologismus zur Beschreibung des digitalen Zeitalters, „Inforgs“: „informationelle Organismen“, die „aus ihrem newtonschen, materiellen Raum in die Infosphäre“ migrieren.5 Sie sind dem hiesigen Raum entzogen, weil sie sich einem anderen verbunden fühlen.
Konnektivität der Trennung.
Das Phänomen ist keineswegs neu. Seit der Erfindung des Telefons fiel es dem Raum immer schwerer, sich gegen Abwesende zu behaupten. Ein Anruf genügte und die Außenwelt brach herein. Zunächst nur zaghaft, wenn die Angerufene dem Raum ans Telefon im Hausflur entzogen wurde. Dann, mit dem kabellosen Haustelefon, platzte die Außenwelt mitten in die gute Stube. Seit dem Handy geschieht diese Invasion auch im öffentlichen Raum. Seit dem Smartphone sogar ohne Anruf. Der abwesende Raum macht dem aktuellen jederzeit das Vorrecht der Präsenz streitig, mit Leichtigkeit, denn er ist naturgemäß immer in der Überzahl.
Ist es dies, was uns ärgert (falls es uns ärgert), wenn wir ringsum Menschen in ihre Geräte versunken sehen? Hofften wir auf Gesprächspartner und sind nun enttäuscht, dass sie den Cyberspace vorziehen? Verübeln wir ihnen die Einsamkeit, in die sie uns stoßen? Oder verstimmt uns nur, mit welcher Frechheit sie erwarten, dass wir aus dem Weg gehen?
Das Smartphone vollendet ein Verschwinden des Raumes, das spätestens mit den modernen Verkehrsmitteln begann. Während die Landschaft an der Eisenbahn immerhin noch vorbeizog, war sie mit dem Flugzeug ganz verschwunden. Nun konnte man um die halbe Welt reisen, ohne etwas anderes von ihr zu sehen als Flughäfen. Und ohne zu bemerken, wie die Temperatur sich mehr und mehr ändert. Wegbewältigung hieß nicht mehr Raumbegegnung – eine Erfahrung, die man im Kleinen täglich mit der U-Bahn macht.
Spazierengehen
Historisch betrachtet war schon die Kutsche, ohne Klimaanlage und Lärmschutz, Verrat am Raum. Darauf verweist Günther Anders in seiner philosophischen Betrachtung über Rundfunk und Fernsehen Die Welt als Phantom und Matrize, die 1956 in seinem Buch Die Antiquiertheit des Menschen erschien und mit dieser „Kindergeschichte“ beginnt:
Da es dem König aber wenig gefiel, dass sein Sohn, die kontrollierten Straßen verlassend, sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. „Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen“, waren seine Worte. „Nun darfst du es nicht mehr“, war deren Sinn. „Nun kannst du es nicht mehr“, deren Wirkung.
„Der Mensch desertiert ins Lager seiner Geräte“, ist einer von Anders’ berühmten Sätzen. Die Kutsche ist ein solches Gerät. Der Rundfunk, um den es Anders in diesem Text geht, auch. Von ihm ist es kein allzu langer Weg zum Smartphone. Aber bleiben wir noch einen Moment bei der Kutsche, die schon 150 Jahre vor Anders Stein des Anstoßes war.