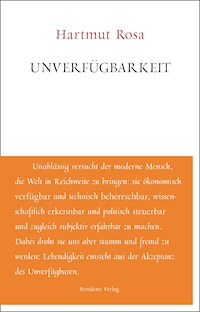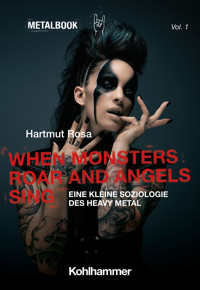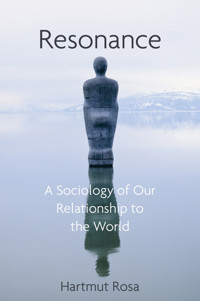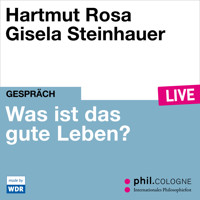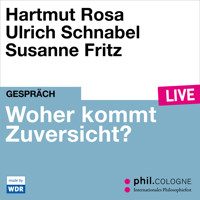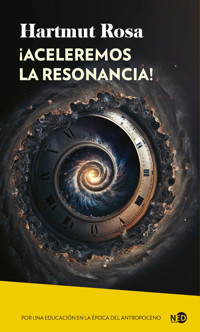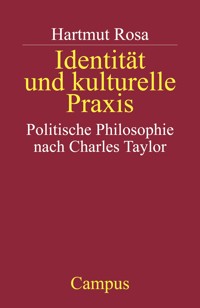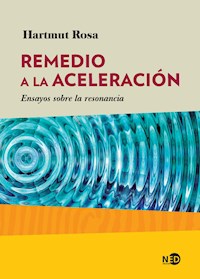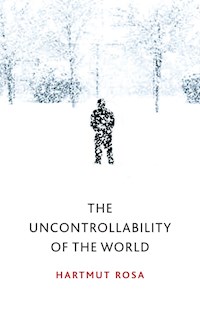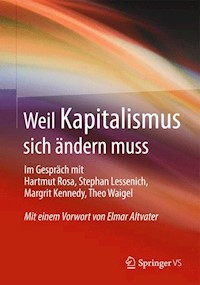7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Was wäre die Moderne ohne Religion?
Welche Position nimmt Religion im Gefüge unserer modernen Gesellschaft ein? Ist sie nur ein Anachronismus, der den Wachstumskurs im globalen Wettkampf stört? Nur eine Spielart des Aberglaubens, der man privat gerne nachgehen darf, die man öffentlich aber bitte verschweigen soll? Dass die christlichen Kirchen hierzulande – auch unabhängig der aktuellen Skandale – ein massives Problem haben, ist kein Geheimnis. Nicht nur der Mitgliederschwund belegt dieses Resonanzproblem. Was aber, wenn Religion insgesamt keine Resonanz mehr in der demokratischen Gesellschaft erzeugt?
Der renommierte Soziologe Hartmut Rosa stellt die Frage, die nicht weniger als zukunftsweisend für die Entwicklung unserer Moderne sein wird: Was verliert die Gesellschaft, was verliert die Demokratie, wenn die Religion darin keine Rolle mehr spielt? Worin liegt das Potenzial der Religion für unsere Zukunft als Demokratie? Ist es wirklich so klug, auf den reichen Schatz des Religiösen zu verzichten?
In gewohnt messerscharfer Manier analysiert Rosa unsere Moderne und wagt das Gedankenspiel, was geschieht, wenn das Ideenreservoir jahrhundertealter Religionen in einer hochmodernen Gesellschaft verloren geht. Ein leidenschaftlicher Text, der auf Rosas Vortrag beim Würzburger Diözesanempfang am 17. Januar 2022 beruht.
Mit einem Vorwort von Gregor Gysi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 52
Ähnliche
Welche Position nimmt Religion im Gefüge unserer modernen Gesellschaft ein? Ist sie nur ein Anachronismus, der den Wachstumskurs im globalen Wettkampf stört? Nur eine Spielart des Aberglaubens, der man privat gerne nachgehen darf, aber öffentlich bitte davon schweigen soll? Dass die christlichen Kirchen hierzulande – auch unabhängig der aktuellen Skandale – ein massives Problem haben, ist kein Geheimnis. Nicht nur der Mitgliederschwund belegt dieses Resonanzproblem. Was aber, wenn Religion insgesamt keine Resonanz mehr in der demokratischen Gesellschaft erzeugt?
Der renommierte Soziologe Hartmut Rosa stellt die Frage, die nicht weniger als zukunftsweisend für die Entwicklung unserer Moderne sein wird: Was verliert die Gesellschaft, was verliert die Demokratie, wenn die Religion darin keine Rolle mehr spielt? Worin liegt das Potenzial der Religion für unsere Zukunft als Demokratie? Ist es wirklich so klug, auf den reichen Schatz des Religiösen zu verzichten?
In gewohnt messerscharfer Manier analysiert Rosa unsere Moderne und wagt das Gedankenspiel, was geschieht, wenn das Ideenreservoir jahrhundertealter Religionen in einer hochmodernen Gesellschaft verloren geht. Ein leidenschaftlicher Text, der auf Rosas Vortrag beim Würzburger Diözesanempfang am 17. Januar 2022 beruht. Mit einem Vorwort von Gregor Gysi.
HARTMUT ROSA
DEMOKRATIE BRAUCHT RELIGION
über ein eigentümliches resonanzverhältnis
Basierend auf einem Vortrag beim Würzburger Diözesanempfang 2022
Mit einem Vorwort von Gregor Gysi
Kösel
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit konnte eine gendergerechte Schreibweise nicht durchgängig eingehalten werden. Bei der Verwendung entsprechender geschlechtsspezifischer Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung jedoch ausdrücklich alle Geschlechter angesprochen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2022 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: zero-media.net, München
ISBN 978-3-641-30185-9V001
www.koesel.de
Inhalt
VORWORT
DEMOKRATIEBRAUCHTRELIGION
VORWORT
VON GREGOR GYSI
Hartmut Rosa hat ein Buch vorgelegt, in dem er eines der zentralen Themen der Moderne aufgreift und bearbeitet. Ich werde hier nicht vorgreifen und beurteilen, was in dem Buch erst zu lesen ist; das muss schon der Leserin und dem Leser selbst überlassen bleiben. Ich möchte mich eher dazu äußern, was andere Autoren zum Thema »Gott«, Religion usw. zu sagen haben.
Unschwer ist zu sehen, dass Hartmut Rosa mit dem Begriff der »Resonanz« auf Praxisformen abzielt, die man als »gelungene Praxis« bezeichnen könnte. In ihnen gibt es das Kommunikative, das Gemeinsame, das Kooperative. Viele Menschen werden schon erlebt haben, was das heißen kann, wenn man mit anderen in »gelingender« Weise interagiert, welche tiefe Befriedigung das bedeuten kann. Aber, und das ist das eigentliche Problem, erleben wir viel öfter das Gegenteil dessen. Und dafür hat sich ein Begriff etabliert: die Entfremdung.
Immer, wenn man die unterschiedlichen Theorien der Entfremdung genauer betrachtet, wird man feststellen, dass es einen Bezug zur Religion gibt, obwohl Entfremdung eigentlich kein religiöses Thema ist. Es gibt einige Philosophen, die das Thema der Entfremdung in je spezifischer Weise bearbeitet haben: Hegel, Feuerbach, Marx und Benjamin.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat das Entfremdungsproblem in ironischer Manier aufgegriffen, indem er auf das theologische Theodizee-Problem aufmerksam macht. Dort ging es darum, Gott zu rechtfertigen trotz einer scheinbar so unvollkommenen Schöpfung. Ähnlich sieht Hegel auch die Aufgabe der Rechtsphilosophie darin, uns bewusst zu machen, wie das Vernünftige im Staat angesichts der gesellschaftlichen Widersprüche dennoch zum Ausdruck kommt. Der Staat stellt Freiheit gerade dadurch her, dass seine Institutionen die Reflexion auf das gesellschaftliche Ganze und die Kritik daran überhaupt erst möglich machen. Auch wenn die Wahl des Ausdrucks der Theodizee etwas ironisch wirken mag, so schreibt er der Religion wie auch der Kunst einen besonderen Wert zu. Nicht alle Menschen sind Philosophen. Aber in Kunst und Religion thematisieren wir uns alle und gewinnen so Möglichkeiten der gemeinsamen Praxis.
Ludwig Feuerbach konzentriert sich auf die Religion und sieht in ihr ein spezielles Entfremdungsproblem. Über die Idee Gottes würden die Menschen sich gegenseitig als Mitglieder ein und derselben Gemeinschaft, der menschlichen Gattung, anerkennen. Überwunden werden könne diese Entfremdung, die Abtrennung des Gattungswesens vom realen Menschen, nur dadurch, dass die Gottesidee säkularisiert wird.
Karl Marx geht einen Schritt weiter. Er fragt, warum eigentlich die Menschen sich von sich als »Gattungswesen« abspalten und getrennt voneinander repräsentieren: Sei es nun der Staat oder Gott. Etwas in der konkreten Verfasstheit des realen Lebens verhindert die Bezugnahme der Menschen aufeinander als »Gattungswesen«. Die reale Kooperation ist eine verkehrte, die das Bedürfnis nach einer vernünftigen Kooperation in entfremdeter Gestalt zum Ausdruck bringt.
In wiederum anderer Weise hält Walter Benjamin Motive religiösen Denkens in säkularer Form für wichtig, um die Idee einer befreiten Gesellschaft auszuloten. Seine »geschichtsphilosophischen Thesen« liefern das Bild einer Menschheitsgeschichte, die von Unterdrückern, Siegern und Herrschenden geschrieben wird, nie jedoch von den Unterdrückten. Der »Engel der Geschichte« will die »Trümmer«, die Opfer von Gewalt und Unterdrückung, aufrichten, mit der Hoffnung auf ein Paradies, eine Erlösung. Aber was man wirklich sieht, als vom Paradies Weggetriebener, ist die Geschichte als Herrschaftsgeschichte. Zur Aufgabe einer wirklichen Befreiung gehört auch eine andere Geschichte. Aber diese andere Geschichte ist eine Art Auferstehung. Zur Sprache müssen also jene kommen, die in der Geschichte der Herrschenden nicht vorkommen. Erst so kann eine mit sich versöhnte Gesellschaft gedacht werden.
Wie auch immer: Das Denken einer vernünftigen Praxis hat einen »geheimen« Bezug zur Religion.
Als jemand, der nicht an Gott glaubt, ist es mir wichtig, dass der befreiende Gehalt religiöser Ideen, auch wenn er erst in einer Religionskritik sichtbar werden sollte, nicht verloren geht. Auch wenn Demokratie immer einen formalen Verfahrenskern hat, verkümmert sie, wenn sie ausschließlich als eine Ansammlung von Verfahren zur Herrschaftslegitimation begriffen wird. Letztlich geht es immer um die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Eine gesellschaftliche Realität, die sich allzu weit von demokratischen Ideen einer Gemeinschaft von Freien und Gleichen entfernt, in der es um die vernünftige Auseinandersetzung um ein gemeinsames Wohl geht, entfremdet die Demokratie von ihrem emanzipatorischen Gehalt.