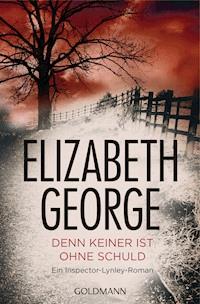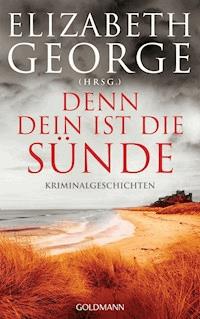
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Hochmut, Gier, Wollust, Neid, Zorn, Trägheit, Völlerei – seit jeher waren es die sieben Todsünden, die die Menschen zu den abscheulichsten Taten verleiteten. Bestsellerautorin Elizabeth George widmet sich den beiden tödlichsten – Wollust und Gier. Neben einer eigenen, bisher unveröffentlichten Geschichte hat sie Beiträge der talentiertesten amerikanischen Krimiautorinnen wie Laura Lippman, Nancy Pickard und anderer im vorliegenden Band versammelt. Diese Geschichten dringen tief in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele vor, sie schockieren, fesseln, faszinieren und nehmen oft unerwartete Wendungen. Kurzum: Gänsehaut garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 789
Ähnliche
Elizabeth George
Denn dein ist die Sünde
Kriminalgeschichten
Ins Deutsche übertragen
von Charlotte Breuer und
Norbert Möllemann
COPYRIGHT-HINWEISE
Vorwort, Copyright © by Susan Elizabeth George
»Bitterschokolade« (»Dark Chocolate«), Copyright © 2009 by Nancy Pickard
»Das Angebot« (»The Offer«), Copyright © 2009 by Patricia Smiley
»E-Male«, Copyright © 2009 by Kristine Kathryn Rusch
»Genug, um den Winter über zu bleiben« (»Enough to Stay the Winter«), Copyright © 2009 by Gillian Linscott
»Machtspiele« (»Playing Powerball«), Copyright © 2009 by Elizabeth Engstrom
»Verstehst du mich jetzt?« (»Can You Hear Me Now?«), Copyright © 2009 by Marcia Talley
»Goldfieber« (»Gold Fever«), Copyright © 2009 by Dana Stabenow
»Du bist dran« (»Your Turn«), Copyright © 2009 by Carolyn Hart
»Mord im Kapitol« (»A Capitol Obsession«), Copyright © 2009 by Allison Brennan
»Vorübergehender Wahnsinn« (»Contemporary Insanity«), Copyright © 2009 by Pronzini-Muller Family Trust
»Die Geigerin« (»The Violinist«), Copyright © 2009 by Wendy Hornsby
»Pumaweibchen« (»Cougar«), Copyright © 2009 by Laura Lippman
»Die Gier nach der umgekehrten Jenny« (»Lusting for Jenny, Inverted«), Copyright © 2009 by Susan Elizabeth George
»Anderer Leute Kleider« (»Other People’s Clothing«), Copyright © 2009 by Susan Wiggs
»Poltergeist« (»Bump in the Night«), Copyright © 2009 by Stephanie Bond
»Invasion«, Copyright © 2009 by Julie Barrett
»Nackte, nüchterne Tatsachen« (»Cold, Hard Facts«), Copyright © 2009 by S.J. Rozan
»Hold dir den Tod« (»Catch Your Death«), Copyright © 2009 by Linda Barnes
»Ein Ausbrechendes Kamel« (»The Runaway Camel«), Copyright © 2009 by Barbara Fryer
»Wahnsinn zu zweit« (»A Madness of Two«), Copyright © 2009 by Peggy Hesketh
»Alles hilft« (»Anything Helps«), Copyright © 2009 by Elaine Medosch
»Ferienaufsatz« (»Back to School Essay«), Copyright © 2009 by Patricia Fogarty
»Paddy O’ Gradys Schenkel« (»Paddy O’Grady’s Thigh«), Copyright © 2009 by Lisa Alber
VORWORT
Motiv. Wenn ein Verbrechen begangen oder auch nur in Erwägung gezogen wird, liegt der Tat oder dem Gedanken an die Tat etwas zugrunde, und das ist das Motiv. Bei der Untersuchung einer Gewalttat ist die Polizei nicht verpflichtet, ein Motiv zu ermitteln und der Staatsanwaltschaft zu präsentieren. Die Ermittler müssen lediglich Beweise – oder Indizien – zusammentragen, die belegen oder nahelegen, wer die Schuld an einer strafbaren Handlung trägt. Aber die Geschworenen, beeinflusst von True-Crime-Fernsehsendungen und leidenschaftlichen Plädoyers von Staatsanwälten und Verteidigern, interessieren sich sehr wohl für das Motiv. Auch die Leser von Kriminalromanen interessieren sich für das Motiv, und der Erfolg eines Krimis hängt häufig davon ab, wie glaubwürdig es ist.
Es gab eine Zeit, als man in der Literatur ein Tatmotiv irgendwoher nehmen konnte, als die Moral- und Wertvorstellungen noch viel starrer waren als heutzutage, als es noch durchaus vorstellbar war, dass jemand einen Mord begehen würde, um ein uneheliches Kind zu verheimlichen, um seine Alkohol- oder Drogensucht seinem Arbeitgeber oder der Öffentlichkeit gegenüber zu verbergen oder um zu verhindern, dass eine Geliebte ihre Geschichte an die Boulevardpresse verkaufte. Dinge, die heute mit einem Kopfschütteln oder Achselzucken hingenommen oder in mitternächtlichen Talkshows bespöttelt werden, konnten früher ganze Regierungen stürzen, Karrieren ruinieren und Familien zerstören. Viele, die zu anderen Zeiten einen echten Grund gehabt hätten, Informationen über ihre Person zurückzuhalten, gehen heutzutage von sich aus an die Öffentlichkeit und »übernehmen die volle Verantwortung« für ihre Taten, wedeln häufig mit einer Bibel und berichten von einer wundersamen Bekehrung. Oder aber sie begeben sich »in Behandlung«, um das Problem in den Griff zu bekommen, und tauchen später verjüngt, erholt und mit neuem Image wieder auf. Und das gilt für alle – von Popstars bis hin zu Politikern.
Weil die Welt toleranter geworden ist – zumindest in Bezug auf bestimmte Aspekte des alltäglichen Lebens –, ist es kniffliger geworden, sich für einen fiktiven Täter ein glaubwürdiges Motiv auszudenken. Ein uneheliches Kind zu bekommen ist keine Schande mehr, und diejenigen, die von halbseidenen Sternchen in die Welt gesetzt werden, verhelfen diesen oft zu einem Titelfoto in einer Boulevardzeitung. Politiker, die eine außereheliche Affäre haben, geraten vielleicht vorübergehend in die Schusslinie der Kritik, aber den meisten gelingt es, sich wieder reinzuwaschen und wie Phönix aus der Asche aufzusteigen und bei den nächsten Wahlen zu kandidieren oder, noch wahrscheinlicher, einen Vorstandssitz zu ergattern und Aktienanteile einzuheimsen wie Konfetti bei einem Karnevalsumzug. Sportler, die Frauen, Tiere oder ihren eigenen Körper misshandeln, werden nicht nach der Schwere ihrer Tat beurteilt, sondern ob sie ihr Team in die Playoffs führen können.
Wie soll ein Autor da eine Figur entwickeln und ein Motiv konstruieren? Meine Verlegerin hat einmal zu mir gesagt: »Letztlich geht es doch immer um Sex, Macht und Geld«, und vielleicht hatte sie recht. Tatsächlich lassen sich viele Motive der Grande Dame der Kriminalliteratur, Agatha Christie, auf diese Weise interpretieren. Aber ich glaube, die sieben Todsünden bieten einen fruchtbaren Boden, auf dem sich eine Menge Motive finden lassen – schließlich heißen sie nicht umsonst Todsünden.
Zorn, Neid, Völlerei, Faulheit, Wollust, Habgier und Hochmut. Läuft es nicht darauf hinaus, dass jedem schweren Verbrechen eine der Todsünden zugrunde liegt?
In dieser Sammlung geht es um zwei davon: Wollust und Habgier. Als Herausgeberin war das meine Herausforderung an die Autorinnen: eine Geschichte zu schreiben, in der es entweder um Wollust oder Habgier oder um beides geht. Einige derjenigen, die eine Geschichte zu der Sammlung beigetragen haben, sind Autorinnen von Kriminalromanen. Andere nicht. Außerdem enthält diese Sammlung etwas Neues. Der zweite Teil des Buchs trägt die Überschrift: »Darf ich vorstellen …«. Dort sind Geschichten von Autorinnen zu finden, die noch weitgehend unbekannt sind oder bisher noch nie etwas veröffentlicht haben. Diese Frauen kommen aus unterschiedlichen Bereichen – sie sind Journalistinnen, Lehrerinnen, Ingenieurinnen –, und sie alle waren irgendwann einmal meine Schülerinnen. Ich habe sie um einen Beitrag gebeten, weil ich sie meinen Lesern vorstellen und vielleicht auch Verlage auf sie aufmerksam machen möchte. Die Verlagswelt ist ein raues Pflaster geworden, und interessante Autoren werden häufig nicht beachtet.
Alle Autorinnen, die einen Beitrag zu dieser Kurzgeschichtensammlung geleistet haben, beleuchten die Frage, was Wollust und Habgier bedeuten und zu welchen Extremen diese Sünden einen Menschen treiben können, und sie tun das jeweils aus einem anderen Blickwinkel. Unter den Figuren in den Geschichten gibt es Gute, Böse und Gestalten dazwischen. Es geht um Geheimnisse, Fehler, Missverständnisse und Mord, beschrieben von lauter wunderbaren Schriftstellerinnen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Elizabeth George
Whidbey Island, Washington
NANCY PICKARD
Bitterschokolade
In der Mitte achtzehn Zentimeter dick und zum Rand hin rundherum abfallend, das war ihr Kuchen.
»Mein Kuchen«, flüsterte Marcie, allein in ihrer Küche.
Er gehörte ihr. Der ganze Kuchen. Jeder. Einzelne. Bissen.
»Meiner.«
Fehlte nur noch die Glasur. An der Seite zog sich rundum ein filigranes weißes Muster, Spuren von dem Mehl, mit dem sie die Form nach dem Einfetten eingepudert hatte. Kuchen back ich, Nüsse hack ich. Sie reimte, sie sang, während sie den Küchenspachtel kreisen ließ und reichlich Schokoladenguss an den Rändern und auf der Oberseite ihres dicken, dunklen, köstlichen Prachtstücks verteilte.
Nachdem die Glasur aufgetragen war, trat Marcie einen Schritt zurück und begutachtete ihr Werk.
Hinter ihr summte der Kühlschrank zur Begleitung ihres Singsangs.
Schokoguss, Haselnuss, Schokoguss, Haselnuss.
»Perfekt«, flüsterte sie so leise, als fürchtete sie, die Toten zu wecken.
Perfekt, perfekt, perfekt, summte der Kühlschrank.
Jetzt hineinschneiden. Das war immer knifflig. Immer eine Herausforderung. Es machte sie nervös. Es konnte so leicht schiefgehen, selbst nach so viel Planung und Arbeit. Nach dem Mischen, Rühren, Backen, Abkühlen, Mit-Schokoladenguss-Bestreichen konnte in allerletzter Minute immer noch alles schiefgehen. Der Kuchen konnte in sich zusammenfallen. Er konnte misslungen sein, zu lange gebacken, zu trocken oder nicht durchgebacken. Sie hatte am Ende der Backzeit, als die Formen noch im Ofen standen, mit Zahnstochern in die Mitte beider Böden gepikst, und es war nichts daran hängengeblieben. Sie war begeistert gewesen, denn das bedeutete, dass sie diesmal den perfekten Kuchen gebacken hatte. Und doch konnte immer noch etwas schiefgehen. Er konnte immer noch zusammenfallen, in der Mitte einsinken, als hätte jemand mit der Faust hineingeschlagen. Sie hoffte, dass das nicht passieren würde. Sie wollte, dass dieser Kuchen, ihr Kuchen, dieser spezielle Kuchen an diesem speziellen Tag perfekt war.
Marcie nahm ihr Kuchenmesser.
Ein versilbertes Hochzeitsgeschenk, von wem, wusste sie nicht mehr.
Irgendein Gast,
geliebt oder gehasst.
Sie hielt das Messer über den Kuchen, zögernd, ängstlich, aus Furcht, etwas falsch zu machen. Es war schwer, es richtig zu machen. Leicht, es zu vermasseln. Schwer, ein perfektes Dreieck auf einen blitzblanken Teller zu befördern. Teller, Teller, Mäuse im Keller.
Mit angehaltenem Atem senkte sie das Messer.
Es tat weh. Es tat regelrecht weh, das zu tun, den Schokoguss einzuritzen, das Messer hindurchgleiten zu lassen und die festere Masse darunter, den Kuchen, zu durchschneiden. Sie wollte sich beeilen, es schnell hinter sich bringen, damit sie es nicht spüren musste, den Schmerz, in ihren Kuchen zu schneiden. Nicht drücken, nicht pressen, das reimt sich auf Essen. Wenn sie den ersten Schnitt gemacht hatte, gab es kein Zurück mehr. Sie konnte ihn nicht ungeschehen machen, sie konnte es sich nicht mehr anders überlegen.
Das Messer glitt durch den Kuchen, bis es auf die Glasplatte darunter traf.
So weit, so gut, dachte Marcie und begann wieder zu atmen.
Der nächste kritische Moment würde kommen, wenn sie das Messer herauszog, und sie zögerte erneut. Sie stand in der Küche, die Hand um den versilberten Messergriff, die Schneide immer noch bis zum Schaft im Kuchen. Tot, tot, Morgenrot. Wenn sie das Messer aus dem Kuchen zog, konnte es passieren, dass zu viel Teig und Schokoladenguss daran klebten und ein unsauberer Schnitt zurückblieb.
Langsam, ganz vorsichtig, löste sie das Messer heraus.
Ein sauberer Schnitt. Nur ein paar Kuchenkrümel und etwas Guss klebten an der Klinge.
Marcie atmete erleichtert auf. Das konnte ein perfektes Stück werden.
Der zweite Schnitt war noch kniffliger als der erste, aber sie hatte alles genau geplant. Sie hatte ein Glas Wasser bereitgestellt. Sie tauchte die klebrige Klinge in das Wasser und streifte erst die eine, dann die andere Seite sorgfältig am Glasrand ab. Dann wischte sie die Klinge mit einem frischen Geschirrtuch ab, damit sie für den nächsten Schnitt ganz sauber war.
Blitzeblank, tausend Dank, wer ist nett, und wer macht Zank?
Ich könnte Kinderreime schreiben, dachte sie.
Sie hatte weiß Gott genug davon gelesen.
Schließlich lag das erste Kuchenstück auf ihrem perfekten Teller.
Marcie nahm ihre Gabel.
Sie aß den ersten Bissen, den sie von der vorderen Spitze nahm.
Wie köstlich! Es war der beste Kuchen, den sie je gebacken oder gegessen hatte.
Braves Kind spurt geschwind.
Während sie den Bissen noch eine Weile genüsslich im Mund hielt, dachte sie an den Zeitungsartikel, den sie neulich gelesen hatte. Wissenschaftler hatten angeblich nachgewiesen, dass der erste Bissen von etwas immer der beste war. Sie behaupteten, danach sei jeder weitere Bissen weniger schmackhaft. Marcie konnte sich nicht erinnern, wie sie das begründet hatten, aber sie glaubte es sowieso nicht. Als sie den zweiten Bissen von ihrem Kuchen aß, schmeckte er genauso gut wie der erste, vielleicht sogar noch besser. Er war so köstlich, dass sie vor Wonne feuchte Augen bekam. Es war ein unglaublich gutes Gefühl an den Zähnen, am Gaumen und in der Kehle.
»Ach«, flüsterte sie mit einem Stöhnen. »Ist das gut.«
Jeder weitere Bissen war ebenso lecker.
Lecker, lecker,
die Menschen und ihr Gemecker.
Das zweite Stück schnitt sie nicht größer als das erste. Sie hatte keine Eile. Kein Grund, was die Familie übrig gelassen hatte herunterzuschlingen, so wie sie es immer tat, wenn sie nach dem Essen die Teller in die Spülmaschine räumte. An diesem Nachmittag hatte sie alle Zeit der Welt, oder zumindest bis sechs Uhr, wenn Mark von der Arbeit kam. In diesen zweieinhalb Stunden war Platz für eine ganze Welt, ein ganzes Leben. Und sie wollte jeden Bissen davon genießen.
Das zweite Stück war noch besser als das erste, und nachdem sie es aufgegessen hatte, hatte sie immer noch Hunger. Heißhunger. Nur ein großes Stück konnte ihren Hunger stillen, sagte sie sich, aber das dritte, größere Stück schien sie nur noch hungriger zu machen. Gut, gut, Übermut. Sie war froh, dass sie längst noch nicht satt war. Das war ihr Kuchen, und sie wollte ihn ganz.
Marcie genoss ihr viertes Stück.
Das Telefon schwieg und störte sie nicht.
Natürlich störte es sie nicht, dachte Marcie, schließlich hatte sie den Stecker herausgezogen. An einem Apparat. Aber das reichte, um sie alle stillzulegen.
Ein Geräusch, vielleicht ein Lachen, vielleicht auch ein Schluchzen, drängte in ihren Mund.
Sie musste husten, woraufhin sie sich an dem Bissen verschluckte, den sie gerade hatte herunterschlucken wollen, als das Lachen oder Schluchzen hochgekommen war und herausgewollt hatte. Marcie geriet in Panik, fürchtete, sie könnte an ihrem eigenen Kuchen ersticken, so dass jemand anders die Reste vorfinden und womöglich sogar essen würde.
Sie lief an die Spüle, um den Bissen auszuspucken.
Sie trank einen großen Schluck Wasser, um den Hustenreiz loszuwerden.
Das Wasser füllte ihren Magen ein wenig, was der Kuchen bisher nicht vermocht hatte.
Marcie stellte das Glas weg. Mehr wollte sie nicht trinken.
Dann setzte sie sich wieder auf den Küchenhocker vor dem Tresen, auf dem der Kuchen stand, und schnitt das letzte Stück der ersten Kuchenhälfte ab.
Vielleicht war es jetzt an der Zeit, das Telefon wieder einzustöpseln?
Damit niemand sich Sorgen machte, wenn sie nicht erreichbar war. Damit niemand herüberkam, um nach ihr zu sehen, bevor Mark wieder zu Hause war. Man würde sich Sorgen machen, dachte sie, wenn nicht einmal der Anrufbeantworter ansprang.
Sie stand auf und stöpselte das Telefon ein, das mit dem Anrufbeantworter verbunden war.
»Hallo!«, flüsterte sie in gutgelauntem Ton. »Sie sind mit der Familie Barnes verbunden!« Dann sagte sie noch leiser: »Mark!« Dann mit ihrer normalen Stimme: »Marcie!« Und dann ahmte sie die Kinder nach, in der Reihenfolge, in der sie ihre Namen sagten, das älteste zuerst. »Luke!«, er war sechs. »Ruth!«, sie war fünf. Und dann die dreijährigen Zwillinge »Matthew!« und »Mary!«. Dann rief sie fröhlich: »Wir rufen zurück!«, wie sie es auf dem Band alle im Chor taten. Nur John, das Baby, war nicht zu hören. Das Baby war still.
Es erschreckte Marcie, ihre eigene Stimme so laut in dem stillen Haus zu hören.
Ihre Mutter sagte immer, sie sollten keine Ansage auf dem Anrufbeantworter haben, die den Leuten in die Ohren brüllte. Ihr Vater fand, es sei lästig, sich jedes Mal die ganze Nachricht anhören zu müssen. Die Frau des Pfarrers fand sie wunderbar.
Marcie nahm die zweite Kuchenhälfte in Angriff.
Ihr gläserner Teller war jetzt nicht mehr makellos sauber.
Die beiden Badewannen waren nicht mehr sauber.
Einige Betten waren nicht mehr sauber.
»Du solltest dich was schämen«, schalt sie sich mit der Stimme ihrer Mutter.
»Was hast du den ganzen Tag gemacht?«, fragte die Stimme ihres Vaters.
»Du hast so ein Glück, dass du zu Hause bleiben kannst«, sagte ihre Schwester.
»Habt ihr heute was Schönes unternommen?«, wollte Mark wissen.
»Wir haben Sie beim Bibelkreis vermisst«, sagte die Pfarrersfrau.
Ehefrau, grün und blau.
Mutterglück, mich erdrückt.
»Haltet die Klappe«, flüsterte sie. »Haltet die Klappe. Haltet alle die Klappe.«
Mit zitternden Händen tauchte sie das Kuchenmesser in das Wasser, das inzwischen ganz trüb war, und wischte es an dem mit Schokolade verschmierten Geschirrtuch ab. Dann schnitt sie den Rest des Kuchens in gleichgroße Stücke, damit sie parat waren, wenn sie bereit war, sich darüber herzumachen. Die Zeit lief ihr davon. Es würde nicht mehr lange dauern, bis Mark durch die Tür kam.
Zumindest war das Kuchenmesser wieder sauber.
Sie hielt es hoch, um es im Licht, das durch das Fenster fiel, aufblitzen zu lassen.
Ja, es war blitzblank. Und spitz.
Das Wort »spitz« erinnerte sie an den Hund, der nicht bellte. Hieß nicht so eine Geschichte? Die von einem Hund handelte, der nicht bellte? Es war irgendwie wichtig, dass der Hund nicht bellte. Ein Hinweis. Aber worauf? Vielleicht wüsste sie es, wenn sie ihr Studium abgeschlossen hätte. Marcie fragte sich, ob Mark den Hinweis verstehen würde. Wenn er auf das Haus zuging, wenn er den Schlüssel ins Schloss steckte, würde er es als ein Hinweis verstehen, wenn der Hund nicht bellte?
Mark war klug, aber für ganz so klug hielt sie ihn doch nicht.
Wahrscheinlich würde es weiterer Hinweise bedürfen, ehe er merkte, dass etwas nicht stimmte.
Marcie aß das erste Stück der zweiten Kuchenhälfte auf und tat sich das nächste auf den Teller.
Sie schätzte, dass jetzt noch etwas mehr als ein Viertel von ihrem Kuchen übrig war. Wenn es mehr als ein Viertel war, war es dann ein Drittel? Sie war sich nicht ganz sicher. Sie war noch nie gut in Mathe gewesen oder darin, etwas über den Daumen zu peilen.
Warst nie brav,
wirst bestraft.
Sie hatte viel zu früh geheiratet.
Hatte früher Kinder bekommen, als man ihr geraten hatte – aber nicht so viele, wie man ihr geraten hatte. (»Glaubst du, unsere Babysachen halten noch für eins mehr?«, hatte Mark sie am Abend zuvor gefragt.)
Hatte zu viel geputzt.
Rein, rein, Fensterlein.
Hatte es nicht genug geputzt.
Dein Vergehen musst gestehen.
Zu viel Geld ausgegeben.
Nie genug Geld gehabt.
Zu laut gesungen. Zu viel geredet.
Die falschen Dinge gesagt.
Die falschen Kleider angezogen.
Konnte es niemandem recht machen.
Eine Freude machen. »Please«, flüsterte Marcie, als ihr der Beatles-Song einfiel. »Please, please, please me.«Jemand sollte mir mal eine Freude machen.
Sie glaubte nicht, dass es jemand anderen freuen würde festzustellen, dass sie einen kompletten Kuchen aufgegessen hatte, aber es machte sie glücklich. Es war einfach wunderbar, den letzten Bissen zu essen. Zu ihrer Überraschung verlangte es sie immer noch nach mehr.
Sie warf einen Blick auf die Küchenuhr.
Noch Zeit genug, einen zweiten anzurühren. Wenn sie nicht mehr dazukam, ihn zu backen, konnte sie vielleicht den Teig essen, die Schüssel auslecken, die ganze Schüssel, ganz allein.
Wenn Mark nach Hause kam, konnte sie ihm einen Schokoladenkuss geben.
Sie wollte eine Schachtel Backmischung aus dem Schrank nehmen, stellte jedoch bestürzt fest, dass kein Schokoladenkuchenmix mehr da war. Nur Vanille. Sie war zutiefst enttäuscht, vollkommen am Boden zerstört. Kein Schokoladenkuchen! Nur Vanille! Aber dann dachte sie: Nein! Das ist in Ordnung. Das ist prima. Das ist sogar großartig! Sie war die Einzige in der Familie, die hellen Kuchen mochte. Sie war die Einzige, die übrig war, die ihn mochte …
Marcie griff nach der Schachtel.
Vanille hatte ihren eigenen Reiz, fand sie. Vanille war würzig, duftete herrlich, sah so rein aus. Und man konnte alles Mögliche damit machen. Einem Vanillekuchen konnte man jeden beliebigen Geschmack beifügen, man konnte jede beliebige Glasur auftragen. Man konnte ihn mit Liebesperlen bestreuen. Mit Rosen aus Zuckerguss garnieren. Ein Vanillekuchen passte zu einer Hochzeit, einem Geburtstag und zu besonderen Tagen wie diesem.
Bei dem Gedanken an den Teig, der ganz ihr allein gehören würde, lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Plötzlich überkam sie ein Heißhunger, als hätte sie ein riesiges Loch im Bauch. Einen gigantischen Hohlraum. Ihr war, als fiele sie in diesen Hohlraum, als könnte sie ewig weiterfallen, ohne ein Geräusch zu hören, während der Raum immer größer und weiter wurde, bis nichts mehr existierte außer ihr und dem Raum.
Vielleicht konnte ein zweiter Kuchen den Hohlraum füllen, wenn es ihr nur gelang, ihn aufzuessen, bevor Mark in ihr stilles Haus zurückkehrte.
PATRICIA SMILEY
Das Angebot
Mari Smith humpelte auf die Rolltreppe, die zur Gepäckausgabe des Los Angeles International Airport hinunterführte, und begann ihren Abstieg in die Hölle. Sie war ohnehin schon niedergeschlagen, aber die Massen an Reisenden, die alle durcheinanderredeten und in der Ankunftshalle an ihr vorbeidrängelten, machten sie so nervös, dass sie eine Viertelstunde oben an der Rolltreppe gestanden und gewartet hatte. Erst als die Menge sich einigermaßen aufgelöst hatte, wagte sie sich ins Untergeschoss, um ihren Koffer vom Gepäckband zu holen.
Als wäre das noch nicht genug, war ihr auch noch beim Einsteigen in das Flugzeug in Seattle auf der Gangway der Absatz an einem ihrer Pumps abgebrochen. Der Flug hatte schon eine Stunde Verspätung gehabt, und so war ihr keine Zeit geblieben, um wieder die Stufen hinunterzugehen und auf dem Asphalt nach dem Absatz ihres armen alten Schuhs zu suchen. Jetzt musste sie eine Möglichkeit finden, den Schuh reparieren zu lassen, wenn sie am nächsten Morgen nicht hinkend wie Quasimodo zu ihrem Vorstellungsgespräch erscheinen wollte.
Sie war nach Los Angeles gekommen, um sich auf eine Marketingstelle bei einem Drive-in-Haustierwaschservice zu bewerben, der an der Westküste eine Filiale eröffnet hatte. Aber selbst wenn sie den Job bekam, war ihre finanzielle Situation nicht gesichert. Die Firma befand sich noch in der Aufbauphase und konnte ihr weder die Flugkosten noch die Kosten für das Hotelzimmer erstatten. Mari hatte ihre Visa-Karte bis zum Anschlag überzogen, um den Flug zu bezahlen, und jetzt war auch noch ihr einziges Paar Schuhe nicht mehr zu gebrauchen, eine Zwangslage, die sie an den Rand der Verzweiflung brachte.
Am Fuß der Rolltreppe stolperte Mari durch die Drehtür, die zur Gepäckausgabe führte. Als sie nach einem Schild Ausschau hielt, das ihr sagte, wo sich Band 5 befand, sah sie sich plötzlich einem stämmigen Mann gegenüber, dessen abstehende platinblonde Haare sie an die Stacheln eines Albinostachelschweins erinnerten. Er stand vor einer Reihe öffentlicher Fernsprecher und trug einen für die Augusthitze zu schweren schwarzen Anzug, als wollte er zu einer Beerdigung. Er hielt ein Schild hoch, das teilweise von seinen Händen verdeckt war. Alles, was Mari entziffern konnte, waren die Buchstaben MARI und SMI.
Fieberhafte Aufregung ergriff sie. Es war, als würde in ihrem Kopf eine wildgewordene Flipperkugel herumspringen. Vielleicht hatte die Tierwaschfirma in ihrem Budget ja doch noch einen Spielraum entdeckt, um sie in einer Limousine zum Hotel chauffieren zu lassen. Einen flüchtigen Moment lang wagte sie zu hoffen, dass ihr wider Erwarten ein kleines bisschen Glück beschieden war.
Denn in Wirklichkeit war der abgebrochene Absatz nur eine von diversen Katatastrophen, die in letzter Zeit über sie hereingebrochen waren. Ihre Pechsträhne hatte mit einem Brief angefangen, der aus heiterem Himmel vom nigerianischen Erziehungsminister gekommen war. Offenbar hatte er ein Problem damit, die Mittel für die Studiengebühren seines Sohnes rechtzeitig zu den Einschreibfristen ins Land zu überweisen. Wenn das Geld aber nicht pünktlich eintraf, würde der Lebenstraum des jungen Mannes, an der University of Washington zu studieren, zerplatzen. Ob Mari ihm helfen könne?
Der Plan war denkbar einfach. Der Minister würde ihr einen Scheck über dreißigtausend Dollar schicken, den sie auf ihr Sparkonto gutschreiben lassen sollte. Anschließend würde sie fünfundzwanzigtausend Dollar an seinen Sohn überweisen. Die restlichen fünftausend Dollar sollte sie als Aufwandsentschädigung behalten. Das Geld konnte sie weiß Gott gut gebrauchen, denn ihr Auto brauchte neue Reifen, und die Mahnungen wegen ihrer Zahnarztrechnungen hatten inzwischen einen unhöflichen Ton angenommen.
Zu spät erkannte sie, dass es ein Fehler gewesen war, das Geld zu überweisen, bevor sie sich vergewissert hatte, ob der Scheck bereits auf ihrem Konto gutgeschrieben war. Dass sie zu den Ersten gehörte, die auf den Betrug hereingefallen waren, war nur ein schwacher Trost. Der Schwindler hatte sie um ihre gesamten Ersparnisse gebracht, ein Schlag, von dem sie sich immer noch nicht erholt hatte. Zwei Monate später hatte sie ihren Job im Büro eines Autoteilehändlers verloren und trotz intensiver Suche keinen neuen gefunden. Die Stelle bei dem Haustierwaschsalon war ihre einzige Hoffnung auf finanzielle Rettung.
Mari schaute den Limousinenchauffeur an und lächelte. Er trat einen Schritt vor. Dabei verrutschte das Schild in seinen Händen, so dass der volle Name darauf lesbar wurde – MARION SMITHSON. Enttäuschung legte sich auf Maris Brust. Wie hatte sie bloß so dumm sein können, Hoffnung zu schöpfen.
»Ms. Smithson?«, sagte der Mann. »Ich bin hier, um Sie in die Innenstadt zu bringen.«
In die Innenstadt? Aber genau da wollte Mari ja hin. Sie hatte ein Zimmer in einem einfachen Hotel gebucht, das billigste, das sie hatte finden können. Man hatte sie gewarnt, dass die Taxifahrt sie mindestens vierzig Dollar kosten würde, und um an anderer Stelle Kosten zu sparen, hatte sie einige Lebensmittel eingepackt: ein paar Dosen Tunfischsalat, die sie noch im Kühlschrank gehabt hatte, und ein paar Schachteln Kräcker, die sie sich in einem Supermarkt gekauft hatte.
»Ich hatte gar nicht damit gerechnet, abgeholt zu werden«, sagte sie.
Der Fahrer warf einen Blick auf sein Klemmbrett. »Sie stehen hier auf meiner Liste. Hier steht, ich soll Sie zu Ihrem Hotel bringen. Die Firma hat im Voraus bezahlt, Sie haben also Glück.«
Glück hatten Leute wie Marion Smithson, sie nicht. Sie wollte den Fahrer schon über seinen Irrtum aufklären, doch dann zögerte sie und sah sich um. Keine Frau in Sicht, die nach einer Ms. Smithson aussah. Vielleicht hatte sie ja ihr Flugzeug verpasst. Wenn ja, war der Mann vergebens zum Flughafen gekommen, und das wäre doch eine Schande. Mari musste in die Innenstadt. Der Mann brauchte einen Fahrgast. Es käme ihnen beiden zupass.
Einen Moment lang malte Mari sich aus, wie es wäre, sein Angebot anzunehmen. Sie hatte schon immer davon geträumt, einmal in einer Limousine zu fahren, aber sie hatte noch nie das Vergnügen gehabt, nicht einmal beim Abschlussball der Highschool. Wahrscheinlich würde der Fahrer seinen Irrtum gar nicht bemerken, und sie würde wertvolle vierzig Dollar sparen. Notfalls würde sie den Irrtum aufklären, sobald sie an ihrem Zielort eintraf. Die arme Marion Smithson würde mit einem Taxi zu ihrem Hotel fahren müssen, aber wenn diese Firma es sich leisten konnte, ihr eine Limousine samt Chauffeur zu schicken, dann konnte sie es sich sicher auch leisten, ihr die Kosten für die Taxifahrt zu erstatten. Mari fragte sich, ob die Limousine wohl getönte Scheiben hatte wie die, in denen die Filmstars fuhren.
»Sie können im Wagen warten, während ich mich um Ihr Gepäck kümmere«, sagte der Mann. »Er steht direkt vor dem Eingang.«
Mari gab ihm ihren Gepäckabschnitt und folgte ihm nach draußen. Als sie aus der Tür trat, schlug ihr der Lärm von Autohupen und Busmotoren entgegen, und giftige Abgase brannten ihr in der Lunge. Hitze legte sich ihr aufs Gesicht, als sie sich anschickte, in den Wagen zu steigen, ihre zerschlissene Reisetasche unterm Arm. Im Vergleich dazu war die angenehme Kühle in der klimatisierten Limousine ein Gottesgeschenk.
In einem Eiskübel lag eine offene Flasche Champagner, daneben stand eine Sektflöte. Auf dem Etikett stand Krug, Clos du Mesnil 1995. Mari kannte sich mit Champagner nicht aus, aber das aufwendige Etikett vermittelte ihr den Eindruck, dass es sich um ein erstklassiges Getränk handelte.
»Soll ich Ihnen ein Glas einschenken, ehe ich Ihr Gepäck hole?«, fragte der Fahrer.
Mari zögerte. Sie hatte Marion Smithsons Fahrservice akzeptiert, aber auch noch ihren Champagner zu trinken, käme ihr schon fast wie Diebstahl vor.
»Eigentlich sollte ich das nicht tun«, sagte sie mit einem Seufzer.
Der Chauffeur lächelte sie an. »Ich habe schon ein paar von Ihren Mitbewerberinnen abgeholt. Die haben alle den gleichen Service bekommen. Das Leben ist kurz. Genießen Sie es!«
Mari sah ihn interessiert an. »Mitbewerberinnen?«
»Sie haben hoffentlich nicht angenommen, Sie wären die Einzige, die zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde.«
Mari war verblüfft über den Zufall. Marion Smithson war ebenfalls zu einem Vorstellungsgespräch hergekommen. Aber Mari war davon überzeugt, dass es bei dem Job, um den Ms. Smithson sich bewarb, nicht darum ging, für eine finanzschwache, junge Firma widerspenstige Hunde und Katzen einzuseifen. Sie betrachtete das leere Glas. Nach dem anstrengenden Tag konnte sie eine kleine Stärkung gebrauchen. Die Flasche war sowieso schon offen, und bis Marion Smithson in der Stadt ankam, würde der Champagner längst schal sein.
»Ein Gläschen kann bestimmt nicht schaden«, sagte sie.
Der Fahrer füllte das Glas bis zum Rand, dann machte er sich auf den Weg, um ihren Koffer zu holen. Nachdem er ihr Gepäck im Kofferraum verstaut hatte, setzte er sich ans Steuer und reichte Mari einen azurblauen Stoffbeutel mit einer Kordel, die so weich war wie Seide.
»Ein Willkommensgeschenk«, sagte er. »Alle Bewerberinnen bekommen eins. Den Inhalt dürfen Sie behalten, auch wenn Sie nicht genommen werden.«
Mari betrachtete den Beutel. Die Farbe erinnerte sie an Wasser in einer tropischen Lagune. Am liebsten hätte sie sich ausgezogen und wäre hineingesprungen, um sich zu erfrischen. Sie hatte große Lust, den Beutel zu öffnen und sich anzusehen, was er enthielt, aber ihre Gewissensbisse zwangen sie, ihn ungeöffnet neben sich auf den Sitz zu legen.
Auf dem Weg vom Flughafengelände fuhr die Limousine durch einen Ring aus hohen, zylindrischen Säulen, die von innen bunt erleuchtet waren. Sie kamen Mari vor wie eine moderne Los-Angeles-Version eines heidnischen Steinkreises. Sie legte ihre Wange an das kühle Leder der Rückenlehne und ließ den Champagner in ihrer Nase kribbeln.
Die Limousine fuhr an kitschigen Reklametafeln, staubigen Palmen und Mobilfunkmasten vorbei, die auf lächerliche Weise als Koniferen getarnt waren. Mari nahm kaum davon Notiz. Sie betrachtete immer noch den blauen Stoffbeutel. Neugier war ihr immer als eine Tugend erschienen, und so fragte sie sich, was es schaden konnte, wenn sie nur einen kurzen Blick hineinwarf und nachsah, was der Beutel enthielt. Schließlich hatte sie nicht vor, das, was sich darin befand, zu behalten.
Mit zitternden Fingern zog sie den Beutel auf, griff hinein und brachte eine Flasche Hervé-Léger-Parfüm, ein Hermès-Halstuch und ein schmales Etui mit einer goldenen Cartier-Uhr zum Vorschein. Sie nahm die Uhr aus dem Etui und fuhr zärtlich mit den Fingerspitzen darüber. Das glänzende Goldarmband war geschmeidig und zu schön, um wahr zu sein. Sie fragte sich, wie die Uhr sich an ihrem Handgelenk anfühlen würde.
Sie streifte ihre Timex ab und schob sich die Cartier-Uhr über die Hand, spürte, wie sie ihre Haut liebkoste. Sie würde die Uhr wieder ablegen müssen, bevor sie vor dem Hotel hielten, aber bis dahin wollte sie ihr Glück noch ein wenig auskosten.
Während die Limousine über den Freeway in Richtung downtown Los Angeles glitt, sprühte Mari sich etwas Parfüm aufs Dekolletee, legte sich das seidene Halstuch um die Schultern und zählte die Minuten ihres Glücks an der Cartier-Uhr ab.
Sie wartete, bis die Limousine am Ende der gewundenen Auffahrt eines Luxushotels mit französischem Namen hielt, dann legte sie die Uhr wieder in den blauen Beutel zurück. Der Gedanke, sich davon trennen zu müssen, machte sie so neidisch, dass ihr Entschluss beinahe ins Wanken geriet. Als der Fahrer die Tür öffnete und Mari mit ihrer Handtasche und ihrer Reisetasche ausstieg, fühlte sie sich, als wäre sie gerade bei etwas Ungehörigem erwischt worden.
»Danke fürs Mitnehmen«, sagte sie und gab dem Fahrer ein bescheidenes Trinkgeld.
Er lächelte. »War mir ein Vergnügen.«
Mari sah sich um und hoffte inständig, dass ihr Hotel sich in der Nähe befand. Sie wollte keinen langen Fußweg auf sich nehmen, denn vom Humpeln tat ihr jetzt schon die Hüfte weh.
Als sie auf die Eingangshalle des Luxushotels zuging, um sich nach dem Weg zu erkundigen, kam eine Frau mittleren Alters auf sie zu. Die Frau trug ein schickes Kostüm und wirkte angespannt, als hätte sie alle Sorgen dieser Welt in den Falten zwischen ihren Brauen gespeichert.
»Willkommen in Los Angeles, Marion«, sagte die Frau. »Ich bin Lisa Beaudry, die Chefassistentin von Weylin Prince. Wir haben miteinander telefoniert.«
Mari hatte nicht damit gerechnet, bei ihrer Ankunft am Hotel begrüßt zu werden. Ihre Nervosität legte sich jedoch, als ihr klar wurde, dass Lisa Beaudry Marion Smithson ja noch nie persönlich begegnet war, denn anderenfalls hätte sie Mari sofort als Hochstaplerin entlarvt. Dennoch fand sie, dass das alles allmählich zu weit ging. Sie musste die Situation aufklären.
Mari machte einen Schritt auf die Frau zu. »Danke, Ms. Beaudry, aber ich muss Ihnen sagen …«
Lisa runzelte die Stirn, als sie Maris humpelnden Gang bemerkte. »Was ist mit Ihrem Bein?«
Mari fragte sich, ob es sich um eine unbefangene Frage handelte, oder ob der Job, um den es hier ging, körperlich anstrengende Tätigkeiten verlangte, die jemand mit einem kranken Bein nicht ausführen konnte. Aber das brauchte sie ja eigentlich nicht zu interessieren, und so erklärte sie der Frau, wie ihr auf der Gangway beim Einsteigen ins Flugzeug ein Absatz abgebrochen war. Lisa wirkte erleichtert. Sie nahm Mari am Ellbogen und führte sie zum Eingang des Hotels.
»Ihr Zimmer ist noch nicht fertig«, sagte Lisa, »deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, für Sie einen Termin im Wellnesszentrum zu buchen. Lassen Sie sich nach Herzenslust verwöhnen, die Kosten übernehmen wir. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um Ihre Schuhe.«
Mari wurde beinahe schwindlig. Ein warmes Bad und eine Massage wären wahrer Balsam nach so einem stressigen Tag. Mit ein bisschen Glück konnte sie sich nach der Wellnessbehandlung hinausschleichen und in ihr billiges Hotel verschwinden, ohne dass Lisa Beaudry etwas davon mitbekam. Und falls Lisa den Schwindel durchschaute, konnte sie immer noch behaupten, sie sei genauso wie Marion wegen eines Vorstellungsgesprächs nach Los Angeles gekommen und habe den Namen auf dem Schild des Fahrers falsch gelesen. Ein simpler Irrtum. So etwas konnte schließlich jedem passieren.
»Ein bisschen Wellness wäre wunderbar«, sagte Mari.
Nach der Massage ging Mari unter die Dusche und zog sich an. Von dem Champagner war sie ein bisschen beschwipst, aber die Hände des Masseurs hatten ihre angespannten Muskeln weichgeknetet und sie auf eine langsame Reise ins Nirwana geschickt. Außerdem hatte er ihr den Weg zu ihrem Hotel erklärt, das nur sechs Straßen entfernt lag.
Die Handtasche über der Schulter und die Reisetasche in der Hand wollte Mari sich gerade auf den Weg machen, als ihr plötzlich der Schreck in die Glieder fuhr. Ihr Koffer. Sie hatte ihn völlig vergessen. Er musste sich immer noch in der Limousine befinden. Aber sie hatte sich weder das Kennzeichen noch den Namen des Unternehmens gemerkt. Wenn sie den Koffer zurückhaben wollte, würde sie den Schwindel aufdecken müssen. Dann würde Lisa nicht nur von ihr verlangen, dass sie die Kosten für die Fahrt vom Flughafen zum Hotel erstattete, sondern auch, dass sie den Aufenthalt im Wellnesscenter bezahlte, was ihr gesamtes restliches Geld verschlingen und sie mittellos in downtown Los Angeles stranden lassen würde.
Mari eilte zum Aufzug und betete, dass der Limousinenchauffeur ihren Koffer beim Portier abgegeben hatte. Kaum hatte sie die Eingangshalle betreten, hörte sie, wie eine Frau ihren Namen rief. Sie drehte sich um und sah Lisa Beaudry auf sich zukommen. Vor Schreck brach ihr der Schweiß aus, was den Duft des Parfüms verstärkte, das sie sich zwischen die Brüste gesprüht hatte.
»Ah, da sind Sie ja«, sagte Lisa. »Raten Sie mal, was ich gefunden habe.«
Mari hoffte, dass es nicht Marion Smithson war.
Stattdessen reichte Lisa ihr eine Einkaufstüte, die ein Paar Wildlederschuhe enthielt – acht Zentimeter Absatz, apfelrot mit einer marineblauen Schleife, die zu ihrem marineblauen Kostüm passte.
Mari betrachtete die Schuhe voller Bewunderung. »Die sind … wunderschön.«
Lisa gab ihr eine Schlüsselkarte aus Plastik. »Dachte ich’s mir doch, dass die Ihnen gefallen. Hören Sie, Ihr Koffer steht in Ihrem Zimmer. Um halb sieben gibt es für alle Teilnehmerinnen eine Cocktailparty mit anschließendem Abendessen. Ich habe mir die Kleidung angesehen, die Sie mitgebracht haben. Offenbar hat Ihnen niemand gesagt, dass festliche Garderobe gewünscht wird. Aber keine Sorge, ich habe etwas Passendes für Sie gefunden.«
Mari war einerseits erleichtert darüber, dass ihr Koffer in Sicherheit war, andererseits war sie beunruhigt. Lisa Beaudry hatte ihren Koffer nicht nur auf ihr Zimmer gebracht, sondern auch dessen Inhalt durchgesehen. Ihr Name stand deutlich lesbar auf dem Adressanhänger, und wenn Lisa den Koffer überprüft hatte, dann wusste sie jetzt, dass Mari eine Hochstaplerin war. Womöglich wartete die Polizei bereits in ihrem Zimmer auf sie, um sie zu verhaften und ins Gefängnis zu stecken. Die Situation geriet allmählich außer Kontrolle. Ihr einziger Gedanke war, dass sie unbedingt ihren Koffer holen und dann möglichst schnell verschwinden musste.
Mari nahm die Schlüsselkarte entgegen. Vor ihrem Zimmer angekommen legte sie ein Ohr an die Tür und lauschte. Stille. Sie öffnete die Tür. Es befand sich niemand im Zimmer, aber auf dem Bett lagen ihr Koffer und der azurblaue Stoffbeutel. Hastig inspizierte sie ihren Koffer und stellte fest, dass der Adressanhänger fehlte. Wahrscheinlich war er während des Flugs verlorengegangen. Ausnahmsweise beklagte sie sich diesmal nicht über die Unachtsamkeit, mit der offenbar mit anderer Leute persönlichem Eigentum umgegangen wurde.
Ihr Puls beruhigte sich wieder, und ihre Bereitschaft zum Aufbegehren ließ nach. Sie drückte den azurblauen Beutel an sich wie einen Geliebten, von dem sie lange getrennt gewesen war. Ihr Herz pochte, als sie die Cartier-Uhr ein letztes Mal um ihr Handgelenk legte und die Glut des Begehrens spürte.
Als sie aufblickte, sah sie ein glänzendes, marineblaues Cocktailkleid im Schrank hängen. Die Seidenrose an der Korsage besaß denselben Rotton wie ihre neuen Schuhe. Sie hielt das Kleid ins Licht. Es war schöner als alles, was sie je besessen hatte. Sie beschloss, es wenigstens einmal anzuprobieren, nur um zu sehen, wie es ihr stand. Wenn es ihr passte, würde sie sich vielleicht von dem ersten Gehalt, das sie bei dem Haustierwaschservice verdiente, genau so eins kaufen können. Sie zog sich aus und streifte das Kleid über, ohne dabei die Zimmertür aus den Augen zu lassen. Falls Marion Smithson auftauchte, würde sie ihr erklären, sie hätte sich im Zimmer geirrt, und dann schleunigst das Weite suchen.
Mari bewunderte sich im Spiegel. Sie hatte ein unscheinbares Gesicht, aber einen wohlproportionierten Körper mit mädchenhaften Brüsten. Ihre Haut und ihre Lockenpracht strahlten Gesundheit aus. Sie hatte nichts Mondänes an sich, aber sie besaß einen natürlichen, jugendlichen Charme, der seine Wirkung nur selten verfehlte.
Als sie sich vom Spiegel abwandte, fragte sie sich, wie es wohl sein mochte, für ein Unternehmen zu arbeiten, das diejenigen, die sich um eine Stelle bewarben, mit so teuren Geschenken überhäufte. Sie überlegte, was für Zeugnisse Marion Smithson wohl haben mochte. Offenbar bewarb sie sich für eine sehr hohe Position, dass man sie mit solcher Zuvorkommenheit behandelte. Vielleicht musste man für den Job über spezielle Kenntnisse verfügen wie Ingenieurwesen oder Informatik. Falls der Job etwas mit Vertrieb oder Marketing zu tun hatte, würde Mari mit ihrem abgeschlossenen Kunststudium vielleicht nicht einmal schlechte Chancen haben.
Da Marion Smithson offenbar immer noch nicht im Hotel eingetroffen war, entschloss sich Mari, zu der Cocktailparty zu gehen, ein Gläschen zu trinken und ein paar Häppchen zu essen und etwas mehr über die Stelle herauszufinden, für die Marion Smithson sich beworben hatte. Schließlich hatte sie für den Abend nichts geplant, außer sich in ihrem Hotelzimmer ein paar Kräcker mit Tunfischsalat einzuverleiben. Eigentlich hatte sie überhaupt keine Pläne bis zum kommenden Vormittag um halb elf, wenn sie zu dem Vorstellungsgespräch bei dem Haustierwaschservice erwartet wurde. Bisher hatte Lisa das Spiel noch nicht durchschaut. Und das würde sich bestimmt auch nicht ändern, wenn Mari es noch ein paar Stunden länger betrieb. Vielleicht, sagte sich Mari, konnte sie sogar bei Mr. Prince ein bisschen punkten und als Marions Mitbewerberin das falsche Spiel aufgeben. Der Gedanke amüsierte sie.
Um Punkt halb sieben stand Mari in ihrem glänzenden blauen Cocktailkleid, ihren apfelroten Schuhen mit den marineblauen Schleifen und mit der Cartier-Uhr am Handgelenk vor dem Eingang zum großen Ballsaal des Hotels. Sie kam sich mondän und sexy vor.
»Wie schön Sie sind, Marion«, flötete Lisa Beaudry, als sie sie in den Saal bugsierte. »Kommen Sie. Einige Leute würden Sie gern kennenlernen.«
Mari war nicht schön, und sie hatte nie vorgegeben, schön zu sein, aber das Wort allein machte ihr Mut. Sie folgte Lisa in einen Raum voller Leute, die Smokings, elegante Kleider und glitzernde Diamanten trugen. Es war eine Mischung aus Paaren und Einzelpersonen aller möglichen Altersgruppen, aber die meisten waren um die fünfzig und älter, und alle wirkten reich.
Am anderen Ende des Saals hatte ein dicker Mann, dessen Gesicht einer Kraterlandschaft glich, gerade mit einer Gabel eine Erdbeere aufgespießt, die er unter eine Düse hielt, die flüssige Schokolade ausspuckte. Lisa gab ihm ein Zeichen. Er nickte und kam auf die beiden Frauen zugewatschelt.
»Das ist Mr. Dolan«, flüsterte Lisa Mari ins Ohr. »Er gehört dem Vorstand an. Seien Sie nett zu ihm.«
Mari war sich nicht ganz sicher, was Lisa damit meinte. Natürlich würde sie nett zu ihm sein. Schließlich war sie zu einem Vorstellungsgespräch hier. Sie würde zu allen nett sein.
Mr. Dolan biss die Spitze seiner mit Schokolade überzogenen Erdbeere ab. »Sie kommen also aus der Werbebranche.«
Während ihres Studiums hatte Mari einmal eine Zeitlang per Telefon Werbeanzeigen angeboten, es war also nicht direkt gelogen, wenn sie ja sagte.
Dolan leckte sich die letzten Schokoladenreste von den Lippen. »Erzählen Sie mir von Ihrer Familie.«
Mari war verdattert. Es war ungehörig und wahrscheinlich sogar verboten, jemanden, der sich um eine Stelle bewarb, nach seiner Familie auszufragen. Ein Mitglied des Vorstands müsste das doch wissen. Sie wollte sich nicht ihre Chancen vermasseln, aber sie war nicht bereit, über ihr Privatleben zu sprechen.
»Ich bin Waise«, sagte sie.
Mari wusste nicht, wie sie darauf gekommen war. Vielleicht war sie abgelenkt gewesen durch Mr. Dolans hektisches Blinzeln, das sein Gesicht immer wieder in eine groteske Grimasse verwandelte. Sie war gar keine Waise. Ihre Eltern und ihre vier Geschwister fänden diese Lüge vermutlich weniger lustig; andererseits bezweifelte sie, dass ihre Angehörigen über irgendetwas an dieser seltsamen Eskapade lachen könnten.
Dolan fuhr mit seinen klebrigen Fingern über ihren Arm, als würde er gleich hineinbeißen. »Wie tragisch für so eine hübsche junge Frau.«
Er fragte sie weiter nach ihrem Leben und ihrem beruflichen Werdegang aus, bis Lisa ihn zu einer anderen jungen Frau hinüberwinkte, einer weiteren Bewerberin, wie Mari vermutete. Sie wartete, bis Dolan sich wieder über einen Tisch mit Hors d’œuvres hermachte, dann ging sie langsam auf die junge Frau zu.
»Wann ist Ihr Vorstellungsgespräch?«, fragte Mari.
»Morgen früh um zehn. Und Ihres?«
»Um halb elf. Ich wollte mir heute Abend die Stellenbeschreibung noch mal durchlesen, aber anscheinend habe ich sie zu Hause liegen lassen. Sie haben nicht vielleicht eine Kopie, die Sie mir leihen können?«
Die Frau wirkte überrascht. »Ich habe gar keine bekommen. Lisa hat mir erklärt, das Aufgabenfeld sei so neu, dass sie noch gar nicht dazu gekommen sind, etwas zu formulieren. Aber es spielt auch eigentlich keine Rolle. Vertreterjobs sind doch überall gleich. Man besucht Kunden, schließt Verträge ab und schreibt Berichte. Wir werden wohl viel unterwegs sein, ich nehme also an, dass sie jemanden suchen, der nicht verheiratet ist. Bei dem Vorstellungsgespräch werden sie uns bestimmt mehr erzählen. Was machen Sie denn zur Zeit?«
Mari hatte das Gefühl, als würde ihr das Blut in den Adern gefrieren. Sie konnte der Frau unmöglich erzählen, dass sie schon seit Monaten arbeitslos war und nach Los Angeles gekommen war, um sich auf einen aussichtslosen Job bei einer Firma in der Gründungsphase zu bewerben, vor allem, wo sie sich in dem Kleid und den Schuhen und mit der Cartier-Uhr am Handgelenk erfolgreicher vorkam, als sie es je gewesen war.
Mari lächelte. »Ich leite die Abteilung Verkauf und Marketing einer französischen Dessous-Firma namens C’est bon.«
Sie hatte keine Ahnung, wie ihr das in den Sinn gekommen war. Ihre Unterhosen waren meist von der »vernünftigen« Sorte: Baumwolle. Strapazierfähig. Zuverlässig. Vielleicht hatten das Cocktailkleid und die Uhr ihre DNS verändert, denn sie fühlte sich inzwischen, als könnte sie tatsächlich eine Führungskraft bei einem internationalen Dessous-Hersteller sein.
Im Verlauf der nächsten Stunde unterhielt Mari sich mit mehreren Bewerberinnen. Sie waren fast alle schön. Sie erfuhr, dass die Firma sich Pleasure Club nannte und dass es sich um ein exklusives Unternehmen handelte, das sich auf Abenteuerreisen spezialisiert hatte. Nur für Mitglieder. Mari wunderte sich. Die anwesenden Gäste schienen über das Alter hinaus zu sein, in dem man Abenteuer suchte, aber sie bewunderte Menschen, die auf ihre alten Tage weiterhin aktiv waren. Der Name des Unternehmens klang irgendwie zweideutig. Wenn die Mitglieder nicht so einen wohlhabenden und eleganten Eindruck gemacht hätten, hätte sie hinter dem Namen eine Art verbotenen Sexclub vermutet.
Die Cocktailparty war schon seit einer Weile im Gange, aber Marion Smithson war immer noch nicht eingetroffen. Wahrscheinlich hatte ihr Flug Verspätung, dachte Mari, und sie würde erst zum Abendessen da sein. Da sie nicht riskieren wollte, ihr zu begegnen, verließ sie den Ballsaal und machte sich auf den Weg zu ihrem Zimmer.
»Marion? Wo wollen Sie hin?«
Als sie herumfuhr, sah sie sich Lisa Beaudry gegenüber.
»In meiner Firma gibt es Probleme«, stammelte sie. »Ein Notfall. Eine Ladung Seide aus China wird im Hafen festgehalten, ein großer Auftrag. Sie wissen nicht, was sie tun sollen.«
Zu spät wurde Mari klar, dass sie einen Fehler begangen hatte. Marion Smithson arbeitete ja gar nicht für einen französischen Dessous-Hersteller.
»Vielleicht erklärt das die Nachricht, die ich eben an der Rezeption erhalten habe«, erwiderte Lisa. »Darauf stand, Sie würden sich verspäten, aber rechtzeitig für das Vorstellungsgespräch morgen früh hier sein. Das kam mir merkwürdig vor, wo ich mich doch erst kurz vorher mit Ihnen unterhalten hatte.«
Schweißperlen bildeten sich auf Maris Oberlippe. »Ja. Merkwürdig. Da muss jemand etwas missverstanden haben. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich ein paar Telefonate erledigen muss und es vielleicht nicht rechtzeitig zum Abendessen schaffe.«
Lisa runzelte die Stirn. »Okay. Aber arbeiten Sie nicht bis spät in die Nacht. Ihr Vorstellungsgespräch ist morgen früh um neun. Mr. Prince wird gegen Mittag seine Wahl bekannt geben.«
Das Adrenalin verlor seine Wirkung, und Mari fühlte sich ausgelaugt und ängstlich. Um ein Haar wäre sie aufgeflogen. Sie war fast am Ende mit den Nerven.
»Hören Sie, Lisa. Es gibt etwas, das Sie über mich wissen sollten. Ich gehöre hier nicht …«
»Ich hoffe, Mr. Dolan hat Sie nicht eingeschüchtert. Leute wie er sind der Leim, der die Organisation zusammenhält. Wenn er Gefallen an Ihnen findet, ist das wie ein Lottogewinn.« Lisa Beaudry lächelte und tätschelte Maris Schulter. »Sehen Sie zu, dass Sie genug Schlaf bekommen. Dann fühlen Sie sich morgen schon wieder viel besser.«
Das war der reine Wahnsinn. Mari musste sich aus der Situation befreien, bevor sie die imaginäre Linie überschritt, von der aus es kein Zurück mehr gab. Sie ging zu ihrem Zimmer und lauschte eine Ewigkeit an ihrer Tür. Als alles still blieb, trat sie ein, zog sich wieder ihr marineblaues Kostüm an und steckte die Uhr zurück in den azurblauen Beutel. Ihr blieb nichts anderes übrig, als die Schuhe zu behalten. Sie hatte nicht vor, zu ihrem eigentlichen Vorstellungsgespräch am nächsten Morgen zu humpeln, wenn es eine Alternative gab. Sie würde schon eine Möglichkeit finden, dem Pleasure Club die Kosten zu erstatten.
Mari packte ihre Sachen und verließ das Zimmer. Als sie den Korridor hinunter zum Aufzug ging, hörte sie Lisa Beaudrys Stimme in einiger Entfernung. Sie lugte um die Ecke. Lisa kam in ihre Richtung, begleitet von einem hochgewachsenen dunkelhäutigen Mann mit spitzer Nase. Er hatte auffallend kleine Ohren, und sein schwarzes Haar war mit Pomade so eng an den Kopf geklatscht, dass er aussah wie ein Seehund. Mari fragte sich flüchtig, ob er auf seiner spitzen Nase einen Ball balancieren konnte. Da sie nicht dabei erwischt werden wollte, wie sie sich aus dem Hotel stahl, drückte sie sich in eine Nische neben einem Eiswürfelspender und ließ die beiden vorbeigehen.
»Was ist mit Marion Smithson?«, fragte der Mann. »Dolan gefiel sie.«
»Ich weiß nicht, Mr. Prince. Das Foto, das sie uns geschickt hat, muss schon Jahre alt sein. Ich habe sie kaum erkannt. Außerdem wirkt sie nervös. Ich weiß nicht, ob sie die Richtige ist.«
»Wer kommt denn sonst noch in Frage?«
Mari konnte die Antwort nicht hören, aber sie fühlte sich tief getroffen, weil Lisa sie nicht verteidigt hatte. Lisa, die ihr so warmherzig und beruhigend eine Hand auf den Arm gelegt hatte, Lisa, die sie als schön bezeichnet hatte. Wie konnte sie nur an Maris Fähigkeiten zweifeln? Noch ehe sie sich überhaupt um die Stelle beworben hatte, hatte sie Dolans Prüfung bestanden. Das zählte doch sicherlich.
Mari wäre durchaus an dem Job als Vertreterin für Pleasure Club interessiert. Mittlerweile war sie sogar davon überzeugt, dass sie nicht nur für den Job qualifiziert war, sondern dass sie ihn auch verdiente. Wenn es ihr nur gelang, Weylin Prince zu beeindrucken, ehe Marion Smithson eintraf, könnte sie vielleicht sogar Glück haben. Außerdem hatte sie nichts zu verlieren. Mari konnte um neun zu dem Gespräch mit Prince gehen und immer noch rechtzeitig zu dem anderen Termin um halb elf erscheinen.
Es war schon spät, und die Vorstellung, ihren schweren Koffer sechs Straßen weiter zu ihrem eigentlichen Hotel zu schleppen, war niederschmetternd. Es war gefährlich, nachts allein zu Fuß durch die Straßen einer fremden Stadt zu gehen, aber es war auch gefährlich, in einem Hotelzimmer zu übernachten, das für jemand anderen reserviert war. Was, wenn Marion Smithson mitten in der Nacht hier auftauchte?
Und wenn Mari sich tatsächlich für den Job bei Pleasure Club bewerben wollte, dann musste sie sich ein bisschen über die Reisebranche schlaumachen. Sie gab ihren Koffer beim Portier ab und eilte in den Computerraum, um im Internet zu recherchieren. Bis in die späte Nacht hatte sie eine beachtliche Datenmenge zusammengetragen. Sie druckte ihre Rechercheergebnisse aus, dann schlich sie sich in einen leeren Konferenzsaal, schob ein paar Stühle zu einem Bett zusammen und schlief ein.
Nachdem sie sich am nächsten Morgen in einer Hoteltoilette gewaschen und geschminkt hatte, drückte Mari sich vor dem Zimmer herum, in dem die Vorstellungsgespräche geführt wurden, und wartete darauf, dass Marion Smithson aufkreuzte. Als sie um fünf nach neun immer noch nicht eingetroffen war, betrat Mari das Zimmer, den Kopf voller Fakten, mit denen sie Weylin Prince zu beeindrucken gedachte. Auch wenn er ihr während des Gesprächs immer wieder auf die Brüste starrte, schienen ihr Wissen und ihr Enthusiasmus ihn zu überzeugen. Nach zwanzig Minuten lehnte er sich in seinem Sessel zurück.
»Sie haben den Job«, sagte er.
Mari fühlte sich selbstsicher und energiegeladen. Sie hatte gerade einen Job bekommen, für den sie sich nicht einmal beworben hatte. Natürlich würde sie den Irrtum bezüglich ihres Namens aufklären müssen, sobald sie den Vertrag unterschrieb, aber das erschien ihr im Moment weit weg und unwichtig.
»Wie hoch ist das Anfangsgehalt?«, fragte sie.
Prince hob eine Braue. »Wie sehen denn Ihre Vorstellungen aus?«
Er nahm sie auf den Arm. Das klang ja gerade so, als forderte er sie auf, ihm ihren Preis zu nennen. Auch wenn die Stelle neu war, hatte das Unternehmen doch sicherlich ein paar Richtlinien hinsichtlich des Gehalts ausgearbeitet. Sie überlegte krampfhaft, was sie sagen sollte, schließlich hatte sie nicht einmal eine Stellenbeschreibung gelesen. Fünfzigtausend erschien ihr zu wenig, auch wenn sie noch nie im Leben so viel verdient hatte. Fünfzigtausend passte nicht zu der Cartier-Uhr.
»Eine Viertelmillion.« Sie musste ein Kichern unterdrücken, nachdem sie es ausgesprochen hatte.
»Das ist aber eine Menge Geld«, sagte Weylin Prince mit einem wölfischen Grinsen.
Mari wollte ihm gerade sagen, das sei ein Scherz gewesen, als er hinzufügte: »Was würden Sie denn von hunderttausend halten?«
Mari war wie vom Donner gerührt. Welche Gegenleistung würde Prince für hunderttausend Dollar erwarten?
»Wann fange ich an?«
Wieder lächelte er. »Heute Abend. Wir beginnen mit einer Dinnerparty. Genießen Sie bis dahin Ihre Freiheit.«
Zweifel meldeten sich, als sie über seine Worte nachdachte. Das war doch bestimmt ein Scherz gewesen. Er meinte sicherlich nur, dass sie würde hart arbeiten müssen, dass sie den Mitgliedern würde Honig um den Bart schmieren und neue anwerben müssen. Bei einem so hohen Gehalt musste man natürlich mit langen Arbeitszeiten rechnen, aber die Aussicht, sich von ihren Schulden befreien zu können, war den Preis wert.
»Ich nehme den Job an«, sagte sie.
Nach dem Vorstellungsgespräch ging Mari ins Wellnesscenter, um sich drei Freuden zu gönnen: Gesichtsmassage, Visagistin und Maniküre. Nach der Verschönerungskur glich Mari eher einer Göttin als einer Vertreterin für einen Reiseclub.
Um sechs Uhr schlüpfte sie in das glänzende, marineblaue Cocktailkleid und die apfelroten Schuhe mit den marineblauen Schleifen und legte die Cartier-Uhr an. Als sie die Hotelhalle durchquerte, um zu der Limousine zu gehen, die sie zu der Dinnerparty bringen würde, sah sie eine ungepflegte junge Frau an der Rezeption stehen.
»Verzeihung«, sagte die Frau gerade. »Mein Name ist Marion Smithson. Ich hätte eigentlich schon gestern Abend hier eintreffen sollen, aber ich habe mein Flugzeug verpasst und konnte keinen anderen Flug mehr bekommen. Ich habe für Lisa Beaudry eine Nachricht hinterlassen, bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sie auch bekommen hat. Ich muss sie unbedingt sprechen. Könnten Sie sie auf ihrem Zimmer anrufen?«
Der Mann an der Rezeption schien etwas in seinen Computer einzutippen.
»Tut mir leid«, sagte er. »Ms. Beaudry ist schon abgereist.«
Marion Smithson tat Mari leid, doch sie dachte, c’est la vie, wie ihre Mutter zu sagen pflegte. Mari hatte für den Job vorgesprochen und ihn verdienterweise bekommen. Sie war gegen jede Menge Konkurrentinnen angetreten und hatte sie alle aus dem Feld geschlagen.
Mari verließ das Hotel, stieg in die Limousine und machte es sich auf dem Ledersitz bequem. Ein Glas Champagner erwartete sie. Diesmal war es für sie bestimmt.
Bald verschwanden die Lichter von Los Angeles im Rückspiegel, und die Nacht wurde nur noch von den Scheinwerfern der Limousine erleuchtet. Nach einer Fahrt, die Mari ziemlich lang erschien, hielt der Wagen vor einem ländlichen Hotel mitten im Niemandsland.
Der Fahrer begleitete Mari in das von Kerzen erleuchtete Foyer, wo sie mit spontanem Applaus begrüßt wurde. In dem schummrigen Licht konnte sie nicht alles erkennen, aber sie schätzte, dass sich zwanzig bis dreißig Leute im Raum befanden, die ihr den Rücken tätschelten und Glückwünsche aussprachen.
Von dem Champagner war sie leicht beschwipst. Sie hätte es bei einem Glas belassen sollen. Sie fühlte sich unsicher auf den Beinen und war erleichtert, als Lisa Beaudry sie am Ellbogen fasste und in einen Saal führte, der mit Lianen und seltsamen Bäumen dekoriert war. Zuerst dachte Mari, es handelte sich um künstliche Pflanzen, aber als sie eine berührte, stellte sie fest, dass sie echt war.
Nachdem ihre Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten, sah sie, dass sie sich in einer Nachbildung einer alten Steinpyramide befand. Maya vielleicht. Einige der Leute im Raum trugen Masken, andere steckten in lächerlichen Kostümen – Lendenschurz und Federn. Mari erinnerte sich, dass die Clubmitglieder ihr zu alt erschienen waren für Abenteuerreisen. Vielleicht spielten sie die Abenteuer nur auf solchen Themenpartys, oder vielleicht handelte es sich um eine Werbeveranstaltung für eine geplante Reise nach Belize.
»Sind Sie bereit für die Präsentation?«, fragte Lisa.
»Selbstverständlich.«
Maris Gedanken rasten. Niemand hatte ihr etwas von einer Präsentation gesagt. Erwartete man von ihr einen Vortrag mit Diagrammen und PowerPoint-Bildern? Wie sollte sie vor diese Leute treten und über ihre Verkaufs- und Marketingstrategie sprechen, solange sie nicht mal genau wusste, was sie verkaufen sollte?
Sie fühlte sich benommen und träge. Sie kniff die Augen zusammen, aber immer noch sah sie alles wie durch einen Schleier. Einen Augenblick später spürte sie, wie jemand sie am Handgelenk packte und die Cartier-Uhr abstreifte. Etwas Raues berührte ihre Haut. Ein Seil. Jemand fesselte ihr die Hände auf den Rücken. Nein. Das konnte nicht stimmen. Wahrscheinlich hatte sie einfach zu viel von dem Champagner getrunken und fing schon an zu halluzinieren. Es fiel ihr schwer, Sätze zu formulieren, aber sie versuchte es trotzdem.
»Was machen Sie da? Lassen Sie mich los.«
Panik überkam sie, als zwei kräftige Männer sie ans andere Ende des Raums zerrten. Die roten Schuhe schleiften über den Boden. Ihre Zehen schmerzten, als hätte die Schlange aus dem falschen Dschungel hineingebissen. Vor sich erblickte sie etwas, das aussah wie ein riesiger, steinerner Altar auf einem Podest. Sie dachte über das Dschungelmotiv der Party nach, die Maya-Ruinen und die Lendenschurze, und hoffte inständig, dass das alles nur eine Art schräges Initiationsritual war.
Mari hatte sehr wenig Zeit zum Nachdenken. Ihre Füße wurden hochgehoben, und die roten Schuhe fielen auf den Boden. Sie roch etwas Metallisches und sah dunkle Flecken auf der Steinplatte. Ihre Lider flatterten, dann fielen sie zu. Sie spürte kühle Luft an ihrer Haut, als hätte man sie nackt ausgezogen. Das Letzte, was sie hörte, war Mr. Dolans Stimme.
»Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot angenommen haben, Marion.«
KRISTINE KATHRYN RUSCH
E-Male
Jeden Morgen machte Gavin sich nach dem Aufstehen einen Mocha Grande mit Schokostreuseln und trottete barfuß zu seinem Computer, der in dem anderen Zimmer seiner mietpreisgebundenen Wohnung stand. Es war kaum größer als ein Wandschrank, aber Gavin war nicht anspruchsvoll. Eigentlich war das Apartment, verglichen mit den meisten Wohnungen in Manhattan, die meist nicht größer als ein Schuhkarton waren, ziemlich groß, er bezahlte jedoch nur ein Viertel von dem, was in der Gegend sonst üblich war. Er wohnte hier, seit er mit dem Studium begonnen hatte, nur dass er die Wohnung damals mit drei anderen Leuten hatte teilen müssen.
Jetzt hatte er sie für sich allein – für sich und seine Katze –, und das war ihm nur recht. Er hatte seinen Tagesablauf und seine Rituale, und die waren ihm wichtig. Sie sorgten dafür, dass er mittags mit seiner Arbeit begann, und das hieß schon etwas für einen Mann, der sich die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens als Freiberufler durchgeschlagen hatte.
Er stellte die Kaffeetasse wie jeden Tag auf der oberen Ablagefläche des Computertischs ab, schaltete den Rechner ein und überprüfte als Erstes grundsätzlich die Firewalleinstellung und den Virenschutz. Dann lud er seine E-Mails herunter, darunter hartnäckige Spams (Große Brüste – in dreißig Tagen) und auch die noch hartnäckigeren geschäftlichen Nachrichten (Brauche die Zeichnungen für das Peterson-Projekt bis Freitag. Haben Sie schon Entwürfe? Bitte keine Überraschungen.) Manchmal gab es einen Brief von seiner Schwester voller Neuigkeiten über seine Nichte (erste Klasse, wo sie gern hingeht), seinen Neffen (Überflieger in der zweiten Klasse) und ihren Mann, der die ungewöhnlich praktische Veranlagung hatte, zu Hause zu bleiben und das Jüngste großzuziehen.
Gavin beantwortete, was er konnte, löschte, worauf er keine Antwort hatte, und dann wandte er sich seinem morgendlichen Vergnügen zu: Stellas E-Mail-Account.
Stella, seine Beinahefrau.
Stella, seine derzeitige Exfreundin.
Stella, die ihn fast so innig hasste wie er sie.
Stellas E-Mails waren gespickt mit Metaphern, aber es fehlte darin an Liebe. Damit hatte Stella ohnehin nie viel am Hut gehabt. Stella bevorzugte Wollust. Gute, altmodische, Ich-will-nichts-als-das-eine-Baby-Geilheit.
Nicht ihre, natürlich.
Seine.
Aber er war sowieso nur selten in der Lage, ihr diese Wollust zu zeigen – jedenfalls auf positive Weise. Zumindest hatte Stella das dem Richter gesagt, als sie das Kontaktverbot durchgesetzt hatte.
Gavin scheint zu glauben, er würde mich besitzen. Er beobachtet mich die ganze Zeit. Ich habe Angst vor ihm, Herr Richter.
Gavin ballte eine Faust, dann entspannte er sie langsam wieder. Sie war so eine Schauspielerin. Eine miserable Schauspielerin. Aber der Richter war darauf hereingefallen.
Die Männer fielen immer auf sie herein.
Selbst dieser Richter.
Als Gavin Stellas E-Mail-Account überprüfte, erinnerte er sich wieder daran, wie er ihr selbst verfallen war. Stella hatte einen ganzen Haufen von Brieffreunden, die meisten männlich und schon etwas älter, obwohl die Kerle in der Regel vorgaben, jünger zu sein.
Ihre Ausdrucksweise verriet sie immer. Sie schrieben: »Hey, Baby« oder: »Du siehst aus wie ein cooles Weibsbild«. Sie schrieben in Hauptsätzen mit Großbuchstaben und korrekter Interpunktion anstatt in E-Mail-Kurzschrift. Es wirkte seltsam, dass jemand »meiner unmaßgeblichen Meinung nach« ausschrieb, anstatt das Kürzel mumn zu benutzen.
Gavin fragte sich, ob Stella helle genug war, derart feine Unterschiede überhaupt mitzubekommen, oder ob sie davon ausging, dass all diese Männer, die ihr schrieben, jung, gutaussehend und interessant waren. Ganz im Gegenteil zu ihm, wie sie ihm oft genug gesagt hatte.
»Wirklich? Und was bin ich dann?«, hatte er gefragt, und erst später ging ihm auf, dass das der Anfang vom Ende gewesen war.
Sie hatte tatsächlich über die Antwort nachgedacht. Dann hatte sie noch mal überlegt und es sich erneut durch den Kopf gehen lassen. Es war wie bei einem Loch im Zahn, das sich nicht ignorieren ließ.
Zuerst hatte sie gesagt: »Du bist gut im Bett.«
Dann hatte sie präzisiert: »Du bist ein Künstler.«
Und schließlich hatte sie noch hinzugefügt: »Und du hast Geld.«