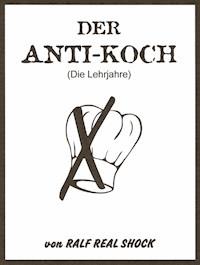
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Der Koch als Traumberuf, das leben uns Lafer, Lichter, Mälzer und Co. vor. Aber war das auch früher schon so? Als 1978 der kleine, ahnungslose, völlig weltunerfahrene Ralfi seine Lehre beginnt, kennt er weder Pfefferpotthast noch Krokantparfait und ist von der feinen Sterneküche meilenweit entfernt. Und dank seiner grenzwertigen Ausbildung soll das in den nächsten Jahren auch so bleiben. Ralfi schlägt sich durch die herstellende Welt der käuflichen Speisen, kämpft mit Lebensmitteln und Vorgesetzten und deckt Vorgehensweisen auf, nach denen sich heute jedes Gesundheitsamt die Finger lecken würde. Ein Blick hinter die Kulissen, skurril und aberwitzig, als der Beruf Koch längst noch nicht so populär war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Real Shock
Der Anti-Koch
Die Lehrjahre
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Augen zu bei der Berufswahl
Der Ernst des Lebens beginnt
Der Pudding-Junkie
Wundertüte Frikadelle und die Odyssee des Sonntagsbratens
Der Fluch der Mittagskarte
Umziehstress
Stan Laurels Geist
Petze Irmchen
Das Eskimoküsschen und der geschmierte Lehrling
Geheimes Koteletttreffen in der Trockenzeit
Ein Wasserbad ist was für Weicheier
Die Wildschwein-Mafia
Unverhoffter Geldsegen und des Schnitzels doppelter Boden
Der Gurken-Krimi
Teildienst-Monotonie und Blut an der Klinge
Unbekannte Küchenwelt
Chaos-Sonntag
Der tyrannische Herr Tyrach
Danke Junior!
Mordfall gelöst und der erste Gelbe
Ein fast perfekter Wellness-Tag
Höhenflug
Berufsschule mit Schuss
Herrn Grothes Auszeit und die Nachwirkungen
Alles geht den Bach runter
Des Lehrlings Masterplan und Minipli trifft Horror
Nachschlag
Impressum neobooks
Augen zu bei der Berufswahl
„Ralfchen“, meinte meine Mutter, „wäre das nichts für dich?“
Wie die Orgelpfeifen aufgereiht standen mein Vater, meine Mutter und ich vor dem Einkaufsmarkt Schätzlein. Alle eifrig an einem Eishörnchen am Schlecken, was uns mein Vater vorher auf unserem Sonntagsspaziergang durchs Städtchen an der Eisdiele ums Eck großzügig spendiert hatte. Mein Vater Haselnuss und Vanille, meine Mutter Vanille und Erdbeere und ich Schleckermäulchen hatte drei Bällchen Schokolade.
Gemeinsam schauten wir auf den Aushang im Schaufenster, der ungefähr das Format von einem Zeichenblock hatte. Das Unternehmen bot für den Beruf Einzelhandelskaufmann Ausbildungsplätze an.
„Ich will aber Koch werden“, kam es trotzig aus meinem schokoladeneisverschmierten Mund.
„Aber denk daran, Ralfchen, du musst dann bestimmt immer Samstag und Sonntag arbeiten. Auch abends. Und schlimmstenfalls an allen Feiertagen“, redete mir meine Mutter zum gefühlten tausendsten Male ins Gewissen.
Es half nichts. Alle Argumente, die vielleicht dagegen sprachen, prallten an mir wie sonst was ab.
Schon seit Wochen führten meine Mutter und ich endlose Gespräche über meine Berufswahl. Und die liefen immer nur auf einen Beruf hin. Koch!
Ich verhielt mich dabei, wie ungefähr der Suppenkasper, der da so lange auf seinem Stuhl wippte, bis er schließlich hinterrücks umfiel und dabei ständig am Maulen war: „Nein, meine Suppe ess ich nicht! Nein, meine Suppe ess ich nicht! Nein, ich will Koch werden! Nein, ich will Koch werden!“
Zu der Zeit wusste ich selbstverständlich noch nicht, auf welch einen aberwitzigen Trip ich mich da bald begeben würde, wenn die strahlend weiße Kochmütze meine minderjährige Matschbirne begrub.
Mit Ach und Krach hatte ich gerade den Hauptschulabschluss gepackt, befand mich mitten in den großen Ferien und stand nun also, wie aus dem Nichts, vor der ersten großen Entscheidung meines Lebens.
Was willste mal werden? Groß und stark vielleicht? Oder eher Feuerwehrmann, Bäcker, Bürohengst, Schlachter, Auftragskiller, Straßenarbeiter oder Polizist? Ich hatte absolut keine Ahnung! Nichts was mich wirklich interessierte. Außer, ja, außer vielleicht eben Koch. Warum eigentlich? Weil mir nichts auf die Schnelle einfiel? Weil ich mir überhaupt keine ernsthaften Gedanken darüber machte, welche schwerwiegenden Folgen das haben könnte? Oder weil ich mitten in der Pubertät steckte und solche Gedanken mich schlichtweg einfach überforderten?
In den 70ern hatte man noch keinen Plan. Als 15-jähriger wollte man sich noch unbekümmert durch die Weltgeschichte schlängeln. Da war der Gedanke zur Berufswahl einfach völlig absurd. Eben lag ich noch faul auf der heimatlichen Couch mit einem Comic in der Hand und von heute auf morgen sollte dieses so sorglose Teenagerleben jäh einen Abbruch erleiden? Ich sollte den Ernst des Lebens kennen lernen? Häh? Wie jetzt? Darauf hatte mich doch keiner vorbereitet. Das ging alles viel zu schnell. Gab es das Wort Plan überhaupt schon zu der Zeit? Ich hatte meine Bedenken. Ich hatte Angst. Ich hatte eine Brille. In meiner begriffsstutzigen schieren Verzweiflung klammerte ich mich an den Begriff Koch fest. Das war das einzige, was ich bisher aus dem Berufsleben kannte.
Alles andere sagte mir ja nichts. Ich hatte keine Erfahrungen als Feuerwehrmann, Bäcker, Bürohengst, Schlachter, Auftragskiller, Straßenarbeiter oder Polizist, aber als Koch hatte ich zumindest einen winzigkleinen Ansatz gefunden, da wir im letzen Jahr das Fach „Hauswirtschaftslehre“ hinzubekommen hatten. Um ehrlich zu sein, machte mir das Fach aber so gar keinen Spaß. Ich war heilfroh, wenn die Doppelstunde vorbei war.
Die zuständige Lehrerin teilte uns in Grüppchen auf, die jeweils aus zwei Mädchen und zwei Jungen bestand. Zu viert saßen wir an einem Tisch und mussten in den kommenden 90 Minuten die Lebensmittel verarbeiten, die uns zugeteilt waren.
Keiner von uns hatte eine Ahnung. Lebensmittel? Verarbeiten? Nun ja, so schmeckte dann auch meist das Endresultat. Obwohl unsere Gruppe noch im gediegenen Mittelfeld lag und wir kleinere Dramen am Herd geschickt kompensieren konnten, waren in einer anderen Gruppe zwei Totalausfälle dabei.
In einer dieser Stunden stand auf dem Essensplan als Nachtisch Bananenquark. Gut, Bananenquark kenne ich, da wird ein Pfund Magerquark aus der Verpackung in die Rührschüssel geworfen, Milch dazu und mit einem Handschneebesen cremig gerührt und, ja, Zucker für die Süße durfte auch nicht fehlen. Dann die Bananen schälen und in nicht so dicke Scheiben schneiden und dem Quark zugeben. Gesagt, getan, wir waren schnell fertig und linsten zu der Katastrophengruppe rüber, wo die beiden Künstler dazu auserkoren waren, den Nachtisch zuzubereiten. Erst sah deren Vorgehensweise ganz normal aus, so wie bei uns eben. Der Quark wurde lieblos und ohne echtes Gefühl in die Schüssel geklatscht, dann goss einer dieser traumatisierten Feinmotoriker Vollmilch über den noch völlig arglosen Quark. Zucker wurde achtlos hinterher gekippt. In der Zwischenzeit hatte der zweite heranwachsende Emporkömmling des Chaos-Teams die Bananen geschält und schmiss sie bedenkenlos beide am Stück hinein. Auch der Lehrerin war dieser Vorfall nicht entgangen.
„Und nu?“, fragte sie etwas kühn die beiden angehenden Küchenhelden. „Da brauchen wir jetzt einen Mixer, sonst müssen wir ja so lange mit einem Schneebesen rühren“, tönte einer der Schlaumeier.
„Ja, dann macht das mal“, ermunterte die Lehrerin die Beiden in einem ganz ruhigen Ton, vielleicht im Glauben, dass einer von ihnen noch rechtzeitig das Licht der Welt erblickt und dabei das zugegebenermaßen noch nicht voll funktionstüchtige Hirn anschalten würde.
Aber nichts dergleichen geschah. Und so schaltete der Neunmalkluge, der uns soeben mit seiner geistreichen Aussage auf einen noch völlig unerforschten Küchenpfad winkte, ohne große Überlegung den Mixer direkt auf volle Stufe ein und fuhrwerkte wie ein Weltmeister in der Schüssel herum. Der Quark wusste nicht, wie ihm geschah, hilflos war er dem Treiben des mixerschwingenden Grenzdebilen ausgeliefert. Die Bananen versuchten in Todesangst nach links und rechts an den Rand der Schüssel zu fliehen, doch nach und nach, als die Milch sich mit dem schwindlig gerührten Quark verbündete, fiel auch die letzte Banane völlig zerfetzt ins Koma und versank in den Fluten einer nicht schön anzusehenden Suppe mit, na ja, eben Bananengeschmack.
Die Lehrerin und die restlichen Gruppen hatten sich das Schauspiel von dem brutalen Gemetzel zweier schutzlos ausgelieferten Bananen aus sicherer Entfernung angeschaut. Die Lehrerin war während dieser fragwürdigen Zeremonie auffällig gelassen geblieben, aber am Ende konnte sie ihre Fassungslosigkeit dann doch nicht mehr verbergen. Sicher, sie hatte die Barbaren ins offene Messer laufen lassen und die Bananenmörder bekamen hinterher auch für ihre Tat eine glatte sechs, aber am Ende dieses verhängnisvollen Tages wussten sie selbst, dass ihre Technik nicht so ganz in Ordnung war.
Und die beiden Bananen? Sie kamen in Frieden in dieses ihr so fremde Land, in der Absicht von schlecht angezogenen Hauptschülern in Scheiben geschnitten zu werden, um dann vorsichtig im Quark untergehoben zu werden. Doch dieses Paradies haben sie nie erleben dürfen.
Der Ernst des Lebens beginnt
Das Telefon klingelte. Meine Mutter nahm ab und es klang wichtig. Wichtig für mich. Ich sollte mein erstes Vorstellungsgespräch haben. Der gutbürgerliche Gasthof Heinrich suchte einen Kochlehrling.
Am frühen Abend des nächsten Tages standen wir Drei auf der Matte. Werner Heinrich, der Inhaber, begrüßte uns und bat uns in das Gesellschaftszimmer. Herr Heinrich war für mich schmaler Hering eine imposante Erscheinung. Eine kräftige Gestalt, etwas jünger als meine Eltern, tierisch groß mit einem nicht zu übersehenden Bauch im Anschlag, und einer Stimme, die mir auf der Stelle gleichermaßen Furcht sowie einen Heidenrespekt einflößte. Ich war verwirrt, hatte richtig Bammel. Und bekam erst einmal eine Limo vorgesetzt.
Wie das Gespräch dann im Einzelnen verlaufen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich saß vermutlich völlig apathisch auf meinem Stuhl, nickte hier und da brav in die Kamera, wenn ich etwas gefragt wurde, und am Schluss sagte ich wahrscheinlich ganz tapfer und gequält lächelnd: „Ja, ich will.“
Denn nach einer knappen halben Stunde saßen wir wieder im Auto, auf dem Weg nach Hause und ich hatte die zunächst mündliche Zusage, dass in zwei Tagen meine Kochlehre beginnen würde. Was für ein Schock! Dabei hatte ich doch noch drei Wochen Sommerferien vor mir! Pah, das war so unfair!
Meine Eltern hingegen waren ganz aus dem Häuschen! Oh, Gasthof Heinrich, eine gute Adresse! „Die haben viel zu tun, Ralfchen“, sagte meine Mutter in ihrer etwas übertriebenen Fröhlichkeit und drehte sich mit leuchtenden Augen zu mir um, „da stehen immer Autos auf dem Parkplatz.“
Ich wusste nicht wie mir geschah! Ich fühlte mich wie von einer Dampfwalze platt gedrückt. So rasant schnell hatte ich mir meinen Einstieg ins Berufsleben sicherlich nicht vorgestellt. Ich hatte mir so rein gar nichts vorgestellt. Aber jetzt sollte sich mein pubertäres Gefasel tatsächlich rächen.
Zwei Tage später im selben Theater! Mit dem Fahrrad wäre ich, wenn ich, wie normalerweise bei mir üblich, wie ein Irrer in die Pedale getreten hätte, in knapp einer Viertelstunde da gewesen. Nach guten 30 Minuten stieg ich also vom Sattel, lehnte mein Fahrrad links neben den Eingang und betrat kurz nach zehn Uhr morgens die gute Stube. Mir war unendlich flau. Jetzt gab es kein Zurück mehr!
Es war der erste Tag nach dem dreiwöchigen Betriebsurlaub. Herr Heinrich stand hinter der Theke und begrüßte mich sofort laut einladend mit den Worten: „Na, Jung!“
Ich zuckte augenblicklich zusammen. Ein von mir gestottertes „’n Morgen“ folgte.
„Na, dann komm mal mit.“
An der Theke saßen auch schon die ersten Frühschoppengäste, vereint mit ihrem Bier und vor sich hinbrabbelnd. Ich ging um die Theke herum und folgte meinem zukünftigen Chef verschüchtert in die Küche. Mit einem ordentlichen Ruck stieß der die Schiebetür zur Seite und schon standen wir an dem Ort, der in den nächsten Jahren mein zweites Zuhause sein würde.
Zuerst erblickte ich, unmittelbar rechts neben uns, einen Mann in leicht gebückter Haltung über einer großen roten Schüssel stehend, der seine beiden Händen in Hackfleischmasse begraben hatte. Der Mann, Anfang 40 schätze ich mal, war wie ein echter Koch gekleidet. Diese noch frisch blütenweiße Kochjacke machte sofort mächtig Eindruck auf mich. Sah irgendwie sehr nobel aus. Nur, er hatte keine Kochmütze auf und so hatte man einen freien Blick auf sein Haupthaar, oder besser formuliert, auf seine glänzende Halbglatze. Das schien dann wohl mein zweiter Chef zu werden.
„So, Herr Grothe, das ist unser neuer Kochlehrling. Gell, Jung?“ Heinrich schaute erst seinen Koch an und dann mich.
Herr Grothe richtete sich etwas auf, nahm seinen rechten Arm aus der Schüssel, wischte sich die Hackfleischmasse notdürftig von der Hand ab und streckte sie mir mit einem kurzen knappen, aber freundlichen „Hallo“ entgegen. Ich nahm seine Hand und jetzt wusste ich schon mal so ungefähr, wie sich Hackfleisch am Körper anfühlt. Dann war Herr Grothe wieder in seine Arbeit vertieft.
Heinrich unternahm den Versuch, mich durch die Küche zu führen. Aber schon an der Durchreiche brach er ab, weil vorne an der Theke das Telefon läutete. „Machen Sie das“, bellte Herr Heinrich in Richtung seines Kochs und war auch schon wieder hinter der Theke verschwunden. Herr Grothe brummelte was vor sich hin, was ich nicht verstand.
Plötzlich hörte ich hinter mir Geräusche. Ich drehte mich um und bemerkte nun erst, dass im Gang von der Theke in die Küche noch eine Treppe nach oben ging, wo im Eiltempo die drei Söhne des Hauses herunterlärmten. Dahinter die Gemahlin von Werner, Frau Roswitha Heinrich. Ah, dachte ich bei mir, die haben also da oben ihre Wohnung.
Ich trat manierlich einige Schritte weit in die Küche rein, um den Herrschaften Platz zu machen. Die Söhne nahmen eigentlich kaum Notiz von mir und rauschten ohne einen Ton vorbei. Frau Roswitha Heinrich hingegen blieb vor mir stehen und begrüßte über meine Schulter hinweg zunächst ihren Koch und dann mich. Sie sah bei meinem Anblick nicht wirklich erfreut aus, sondern musterte mich geringschätzig, um nicht zu sagen: von oben herab. Sie schien mir ganz schön eingebildet zu sein. Das komplette Gegenteil von ihrem Mann, der laut polternd, etwas tapsig und bodenständig daherkam. Sie hingegen vermittelte sofort in Wort und Bild den Eindruck der Grande Madame.
Madame schritt nun erhobenen Hauptes, wie die Königin Mutter von England, an die Theke und nickte flüchtig, als wenn sie es überhaupt nicht nötig hätte, der eingefleischten Frühschoppenschar zu.
Was für ein Auftritt! Kaum zehn Minuten hier und ich war fix und alle! Mit solch einer arroganten Pute als Chefin hatte ich nicht gerechnet.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich arme Wurst selbstverständlich noch nicht, dass ich mit meiner Unterschrift unter dem Lehrvertrag auf einem Sklavenschiff angeheuert hatte. Rettungswesten? Fehlanzeige an Bord! Die nächsten Jahre stand ich immer kurz vorm Ertrinken!
Der Pudding-Junkie
Bisher hatte ich eine glückliche und unbekümmerte Kindheit genossen und was richtig Schlimmes hatte ich auch noch nicht erlebt. Für mich war die Welt nicht nur am Morgen in Ordnung, sondern den lieben langen Tag. Und so schlitterte ich zutraulich, wie ein kleiner Hundewelpe, leichtgläubig und ohne jegliche Vorahnung ungebremst in meine berufliche Misere!
Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Dieses eine Mal nur! Konnte ich denn ahnen, dass der Koch zu dieser Zeit als der zweitschwerste Beruf durchging, direkt hinter dem Bergmann?
Keiner hatte mich vorher über die Arbeitszeiten informiert. Oder vielleicht doch und ich hatte einfach nicht zugehört? Die Bezeichnung Teildienst war mir vorher nicht bekannt. Das bedeutete, dass der gesamte Tag futsch war. Morgens ab 10:00 Uhr ging es los bis mittags um 14:00 Uhr. Und abends erneut antreten von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Das zunächst fünfeinhalb Tage lang. Montags war Ruhetag. Dienstags ab 16:30 Uhr begann dann wieder unser Dienst.
Der Begriff Jugendarbeitsschutzgesetz hatte in den Räumlichkeiten des Gasthofs Heinrich noch nicht die Runde gemacht. Meine Eltern schien das Thema auch kalt zu lassen. Woher sollte ich sonst bitteschön etwas in der Richtung erfahren, wenn nicht von den Erwachsenen? Aber die hielten sich alle schön bedeckt und ich dachte natürlich, das hätte alles seine Richtigkeit. Meine Güte, ich war gerade mal fünfzehn, noch tiefgrün hinter den Ohren und hätte das erste Jahr in meiner Ausbildung nur bis 20.00 Uhr arbeiten dürfen. Außerdem hätte mir in der ersten Zeit auch ab und zu mal ein freies Wochenende zugestanden. Aber nichts dergleichen geschah.
Und was war mit Pausen? Die lernte ich während meiner Lehrzeit auch nicht persönlich kennen. Nur aus der Entfernung winkten sie mir mal kurz zu. Die Herrschaften von der Frühstückspause, Kaffeepause, Mittagspause, Essenspause, Zigarettenpause, Pinkelpause hatten während der Arbeitszeiten absolute Funkstille und waren wie ein rotes Tuch für Fürstin von und zu Heinrich.
Herr Grothe und ich arbeiteten an einem Stück durch. Ich habe es seit dem Tage, als ich das erste Mal in meiner nigelnagelneuen Kochgarnitur steckte, nicht anders kennengelernt. Und dachte natürlich, das wäre auch alles völlig normal! Wenn man dann aber tatsächlich mal so draufgängerisch war, um nur mal für einige wenige Sekunden innehielt, um seinen arg geplagten Füßen ein wenig Ruhe zu gönnen, und die Königin Mutter genau in diesem Augenblick die Küche betrat, wurde man sofort von ihr mit einem äußerst gefährlich schrägen Blick bestraft. Jahrhunderte zuvor wären wir mit Sicherheit direkt an die Wand für, in ihren Augen, unverzeihliches Vergehen gestellt worden. Rübe ab, der nächste Koch bitte!
Nach und nach lernte ich die drei Wüstensöhne des Herrn und Frau Sultan ein wenig besser kennen. Das waren, wie konnte es anders sein, richtige Paschas.
Den Ältesten, Werner junior, kannte ich schon vom Sehen aus der Parallelklasse an der Hauptschule. Während ich aus der Neunten abgegangen war, machte er noch das zehnte Schuljahr voll. Sonderlich viel Kontakt hatten wir sowieso nie gehabt. Optisch kam er seinen Vater sehr nahe, aber ansonsten war er ganz wie die Mutter Kaiserin, hochnäsig und sich als was Besseres fühlen.
Der Mittlere, Thomas, war noch am normalsten von den Dreien geraten. Er hatte zwar auch eine ganz schön freche Klappe, aber er war in seiner Art nie so anmaßend oder selbstgefällig wie die anderen beiden. Eigentlich, bis auf mehrere Abstriche, ein prima Junge, mit dem ich mich unter anderen Gegebenheiten sogar hätte anfreunden können.
Frank, der Jüngste, war der ungekrönte Liebling der Königin Mutter. Er durfte alles, er bekam alles! Mutti ließ ihm alles, wirklich gottverdammt alles durchgehen! So ein richtig unverschämtes, hoffnungslos verzogenes und verwöhntes Muttersöhnchen. Der bereitete uns in der Küche nur Ärger und zusätzlichen Stress. Und wehe dem, Herr Grothe vergriff sich mal ein ganz klein wenig im Ton oder richtete gar ein winziges Wort des Widerstands an diesen rotzfrechen Bengel. Dann wurde sofort losgeheult, zur Mami gelaufen und gepetzt. Ein ganz niederträchtiges Kind war das! Furchtbar! Dieses Geschreie, dieses Geheule in der Küche! Es war nicht zu ertragen! Und das fast jeden Tag!
Wenn Frank aus der Schule kam, so gegen zwölf, halbeins, stürmte er zunächst die Küche. Wir waren gerade mittendrin im Mittagsgeschäft. Nun ja, eigentlich ja nur Herr Grothe, ich half so gut ich konnte mit leichten Handreichungen. Natürlich hatte da ein Achtjähriger nichts zu suchen. Aber trotzdem, die königliche Pute Roswitha, die am Mittag meist den Thekendienst übernahm, sah sich nicht in der Pflicht, ihre Brut aus der Küche zu verbannen. So lief er meist schreiend um uns rum und suchte wie im Wahn nach dem Nachtisch.
Wenn es Pudding gab – und der stand in der Woche mindestens drei bis vier Mal auf der Karte – brannten bei dem kleinen undankbaren Geschöpf alle erdenklichen Sicherungen durch. Er nahm seine ganze Kraft zusammen, um mit seinen kleinen Patschehändchen die große Kühlschranktür zu öffnen. Das schaffte er auch meist tatsächlich. Dann versuchte er, die Schale mit dem Pudding aus dem Regal zu bugsieren. Bei Herrn Grothe schrillten dann natürlich direkt sämtliche Alarmglocken, denn er wusste ja schon, was kommt. Alle Anstrengungen, den durchgedrehten Knirps zu beruhigen halfen nicht. Der ließ einfach nicht los. Und schrie dabei wie am Spieß. Das war ein Bild! Ein völlig entnervter Koch und ein kleiner Brüllaffe mit hochrotem Kopf zerrten gemeinsam an der Schüssel. Das war dann meist das Zeichen, dass die Schiebetür aufgerissen wurde und Madame höchstpersönlich in die Küche rauschte. Fehlte nur noch der ausgerollte rote Teppich! Das ausgepumpte, schrill jammernde Etwas ließ augenblicklich los, lief völlig erschöpft vom hart umkämpften Wettstreit und tränenüberströmt zur Königin des Hauses. Sie schaute daraufhin sehr streng ihren Koch an, als ob er für diesen ganzen Budenzauber höchstpersönlich verantwortlich wäre, und es allein seine Schuld wäre, dass die Knalltüte sich nun an ihrem Rockzipfel die Augen ausheulte. Dann nahm sie ihr plärrendes Früchtchen unterm Arm und verschwand mit ihm nach vorne. Wir konnten kurz aufatmen. Bis zum nächsten Tag halt! Dann begann das Drama wieder von vorne.
Aber das war beileibe noch nicht alles! Denn wenn Mutti mal nicht da war, ging so richtig die Kuh fliegen! Da gab es dann überhaupt kein Halten mehr! Alle Hemmungen wurden über Bord geworfen! Mehrmals wurde ich fassungslos Zeuge, wie der kleine gewissenlose Pudding-Junkie sich die Schale aus dem Kühlschrank griff und mit einem Esslöffel darin rummatschte. So schnell konnten wir manchmal gar nicht gucken. Oft genug kamen wir viel zu spät, um ihm sein Kampfgerät aus der Hand zu reißen, da war er schon drei bis vier Mal damit abgetaucht. Er war dann meistens überall vollgekleckert mit Pudding, der bis oben hin zu seinen glühend roten Wangen reichte und von seiner speckigen kleinen Lederhose abtropfte, die er im Sommer fast jeden Tag trug.
Wenn es z. B. zur Erdbeerzeit Quark gab und wir ihn schon draußen fertig stehen hatten, ging der kleine Pflaumenaugust wie selbstverständlich einfach mit seiner Hand in die Schüssel, schleckte sich die Finger einzeln ab und grinste uns dabei frech an. Da kannte der keine Verwandten! Ich glaube, dass ein Schuss aus einem Betäubungsgewehr oder ein Fangnetz, so wie ich das aus Daktari kannte, wenn Dr. Marsh Tracy kranke Tiere untersuchen musste, auch nichts genutzt hätten. Wir bekamen diesen kleinen Schisser nicht gebändigt, was ja auch gar nicht unsere Aufgabe war. Wir waren schließlich hier zum Kochen und nicht zur Kinderbeaufsichtigung! Aber für die Chefin schien das alles seine Ordnung zu haben und so waren wir diesem kleinen Schmutzbuckel auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Ab und zu gelang es uns zwar, die Schüssel noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, wie etwa oben auf dem Kühlschrank, wo er ja nicht dran kam. Das war aber auch der einzig sichere Ort vor ihm. Und natürlich war der Palaver dann auch hier riesengroß! Es kam gelegentlich vor, dass er sich einen Stuhl aus dem Nebenraum schnappte, ihn bis zum Kühlschrank hinter sich herzog, dann auf ihn draufkletterte und verzweifelt versuchte, an die Schüssel zu gelangen. Seine ungewaschenen Händchen ruderten dabei unkontrolliert in der Luft rum, und als der kleine Idiot endlich begriffen hatte, dass er da nie und nimmer, auch nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren, herankommen würde, wurde eine andere Taktik gewählt. Dann stieg er brav vom Stuhl herunter, schaute Herr Grothe mit großen unschuldigen Kinderkulleraugen an und piepste im freundlichsten Ton, ob er denn nicht ein wenig Pudding oder Quark haben dürfte. Und was machte Herr Grothe? Der war in so einem Augenblick völlig schmerzfrei und holte doch tatsächlich die Schüssel vom Kühlschrank und schöpfte ein, zwei Kellen in eine Dessertschale und gab sie dem plötzlich so lammfromm gewordenen kleinen Zombie. Da bedankte der sich ganz artig und verschwand nach vorne. Ja, das kam auch mal vor, wenn auch nur höchst selten. Und in diesen lichten Momenten begann ich wieder, an das Gute im Menschen zu glauben. Aber diese Erinnerung verblasste ganz schnell wieder, spätestens dann, wenn am nächsten Tag zu High Noon die Schiebetür mit einem lauten Gepolter aufgerissen wurde, der kleine Frank sich wieder in Mr. Hyde verwandelt hatte und sich auf die fieberhafte Puddingsuche begab.
Dabei hätte er einfach nur mal so richtig zusammengefaltet werden müssen, dann wäre endlich Ruhe im Karton gewesen! Das war einfach so unglaublich lächerlich, dass wir in der Küche fast jeden Tag auf unsere Nachspeise aufpassen mussten. Vielleicht hätten wir einen Extrasicherheitsschutz dafür beauftragen sollen. Aber Herr Grothe war ein Mensch, der sich einfach nicht durchsetzen konnte. In der Zeit, als er mein „Küchenmeister“ war, sprach er nicht ein einziges Mal ein Machtwort oder bezog so was wie Stellung. Als ich dort meine Lehre begann, waren die Fronten geklärt und er hatte sich von der gesamten Bagage Heinrich schon längst unterbuttern lassen. Das waren ja die besten Voraussetzungen für eine schöne, unbeschwerte Lehrzeit.
Wundertüte Frikadelle und die Odyssee des Sonntagsbratens
„Als Koch stehst du immer mit einem Bein im Knast“, sagte Herr Grothe zu mir, als ich das erste Mal auf den undefinierbaren Berg starrte, den der Fleischwolf soeben unter ächzenden Geräuschen ausgespuckt hatte. „Und besonders hier in dem Laden“, fügte er beschwörend mit gedämpfter Stimme hinzu.
„Wie? Waren Sie schon mal im Gefängnis???“
„Ja, fast. Ich hatte aber noch mal Glück. Bekam acht Jahre auf Bewährung!“
„Wie??? Und warum???“
„Verletzung des Lebensmittelgesetzes.“
„Echt???“
„Natürlich nicht!“
„Aber warum sagen Sie dann so etwas???“
Er hob seinen Kopf, schaute sichtlich amüsiert, wie ich auf der Stelle aufgeregt von einem Bein aufs andere hüpfte, versuchte dabei vergeblich, meinen nervös zuckenden Augen zu folgen, gab es schließlich auf und sagte keinen Ton mehr. Er wusste nur zu gut, dass diese fragwürdig schimmernde Masse gegen jede Vorschrift der Hackfleischverordnung verstieß.
Frikadellen waren in den 70ern der willkommene Abfallkorb der Küche. Was nicht im Schweineeimer geworfen wurde, landete als allerletzte Chance, ähnlich wie beim Re-Call, in der Frikadellenmasse. Der Fleischwolf war die Jury. Er allein entschied darüber, ob alles durchging oder ob öfters mal was vor der groben Scheibe hängen blieb, weil zu viel Knorpel oder zu fettiges Fleisch einen Stau verursachten. Dann drehte der böse Wolf sein doofes Pseudo-Fleisch nicht mehr durch und streikte! Eine zutiefst unappetitliche Angelegenheit, wenn man den Wolf dann zerlegen musste.
Na ja, manchmal hatte Herr Grothe und ich auch Glück und der Fleischwolf winkte alles und jeden in den Re-Call durch.
Morgens war das die erste Amtshandlung überhaupt. Schließlich musste die schon zahlreich anwesende Frühschoppenschar mit Frikadellen und Koteletts versorgt werden.
Bei den Koteletts standen wir immer auf der sicheren Seite von Gesetz und Ordnung. Die Frikadelle hingegen war jedes Mal eine kleine Wundertüte für sich. Alles was nicht niet- und nagelfest war, kam in den Fleischwolf. Wiederverwertung war das Zauberwort.
An Wochenenden und an Feiertagen waren die beiden Gesellschaftszimmer gewöhnlich für Hochzeiten, Geburtstags-, Betriebs- oder Kommunionsfeiern ausgebucht.
In der Regel gab es dann das klassische Standardmenü. Eine klare Suppe, dann als Hauptgericht Schweine- und Rinderbraten, Gemüseplatten und Salate sowie verschiedene Kartoffelbeilagen. Und danach natürlich Pudding!
Bei diesen festlichen Gesellschaften wurde immer reichlich aufgetischt, denn genau dafür war der Gasthof Heinrich bekannt. Unsere allseits beliebte Chefin hielt da den Finger drauf, denn ihr war es besonders wichtig, sich keine peinliche Blöße zu geben.
Was auf den Platten liegen blieb, kam natürlich wieder in die Küche zurück.
Normalerweise hätte das vom Gesetz her alles im Schweineeimer enden müssen, weil es eine gewisse Zeit im Saal bei den gelegentlich sich räuspernden und hüstelten Gästen auf den Tischen stand. Nicht so bei Frau Heinrich! Wenn sie absehen konnte, dass abgeräumt wurde, flitzte sie von der Theke in einem Affenzahn direkt in die Spülküche zur Durchreiche, wo die Kellnerinnen alles abstellten.
Dann begann das große Aussortieren! Ob Suppe, Braten, Gemüse, Kartoffeln und sogar der Pudding, alles wurde auf abenteuerlichste Art und Weise wieder verwertet. Von den zurückgekommenen Kartoffeln wurden schnöde Bratkartoffeln geschnippelt, Suppe und Pudding mussten auf ihren zweiten Einsatz bis zum nächsten Tag auf der Mittagskarte im Kühlschrank ausharren. Dem Gemüse, meist Erbsen und Möhren aus der Dose, ging es direkt wieder an den Kragen und wurden in den Gemüsebehälter, der im Wasserbad stand, ohne großartige Diskussion zurückgekippt. Das sah dann aber von der farblichen Abstimmung von Minute zu Minute unterschiedlicher aus. Die Erbsen und Möhren, die schon mal am Tisch laut „Mahlzeit“ gerufen hatten, wurden ganz schön unansehnlich, verloren schnell ihre Farbe und waren am Ende fast schon grau. Dieser Mix aus Alt und Neu wurde dann dreisterweise auf Wunsch einer einzelnen Dame dem nächsten Gast untergejubelt. Ein Klecks von der guten Sc. Hollandaise wirkte da wahre Wunder und bedeckte geschickt das Märchen von dem frischen Gemüse, was sich im Wald verlaufen hatte und in einer Konservendose endete.
Mit den Bratenscheiben war ebenfalls nicht zu spaßen. Die gingen in der Woche auf der Mittagskarte als Hamburger Zwiebelfleisch durch. Dafür wurden jede Menge grob geschnittener Zwiebelscheiben angebraten, der schöne Braten in Würfel entstellt und dazugegeben, zum Schluss mit dicker, aber leckerer brauner Grundsoße aufgefüllt und noch ein wenig mit Salz und Pfeffer nachgeschmeckt. Fertig war das Geistergericht. Dazu gab es oben drauf ein Spiegelei und als Beilage Kartoffeln.
Maximal zwei Tage war es auf der Karte. Wenn am dritten Tag noch ein Rest übrig war, begann der unaufhaltsame Abstieg des einstigen Gaumenschmauses. Alles kam in ein großes Sieb. Die Soße hatte noch ein wenig Zeit, sich vom ehemals festlich aufgetischten und nun leider massakrierten Sonntagsbraten zu verabschieden, ehe sie dann im Abfluss auf Nimmerwiedersehen verschwand. Nur noch die Zwiebelscheiben hingen treu an dem ehemalig so majestätischen Braten, der sonntags in der guten Stube bei vielen Familien der Republik als Ausdruck von Wohlstand galt. Unter dem Wasserhahn wurden sie dann kalt abgespült und anschließend kommentarlos in den Fleischwolf gestampft. So erging es vielen kulinarischen Zusammenkünften in der Teufelsküche Heinrich.
Auch Frikadellen, die am Vortag nicht von den lustigen Frühschoppengesellen verputzt worden waren, sahen sich mit dem humorlosen Ungetüm erneut konfrontiert.
Und nicht zu vergessen, der Hackbraten oder auch der Leberkäse, die auch öfters mal auf der Mittagskarte standen und deren Reste auch zum Schluss unter die Räder kamen. Durch den intensiven Eigengeschmack des Leberkäses wurde am Ende den fertig gebratenen Frikadellen noch eine höchst ungewöhnliche bayerische Note verpasst.
Der größte Teil der Masse machten aber Parüren aus. Das sind lästige und überflüssige Fleischabschnitte, die bei der Zerlegung eines Schweineschinkens zum Beispiel anfallen, aus dem Schnitzel und Braten geschnitten werden.
Gelagert wurden die gesammelten Abschnitte in 5-Liter-Eisdosen im Gefrierhaus, unten im Keller. Je nach Bedarf holte ich abends zuvor eine Dose zum Auftauen raus.
Morgens am Fleischwolf war die Wiedersehensfreude jedes Mal riesengroß. Und jede einzelne Komponente hatte was zu erzählen. Nur die Parüren nicht. Die lagen die ganzen Tage gelangweilt aufeinandergestapelt im bittereisigen Gefrierhaus und warteten sehnsüchtig darauf, dass ich sie aus ihrem frostigen Gefängnis befreite.
Ohne es zu wissen, war ich Minderjähriger nach nur zwei Tagen auf die schiefe Bahn geraten und war praktisch auf Augenhöhe mit einem Crack-Dealer aus einer amerikanischen Großstadt. Nur mit dem Unterschied, dass bei unseren Delikten keiner bei draufging. Das höchste der Gefühle war vielleicht mal eine kleine Magenverstimmung bei einem Kollegen von dem Frühschoppentrupp. Ich konnte das manchmal ganz gut beobachten, wenn die Schiebetür einen Spalt aufstand und einer von der Theke, der etwas blass um die Nase aussah, sich vorzeitig mit leicht wankenden Schritten verabschiedete.
Der eigentliche Big Boss, unser Herr Heinrich, war selbst Metzgermeister und wusste natürlich genau, was wir da manchmal Haarsträubendes in der Küche anstellen mussten, damit der Rubel der Zarenfamilie Heinrich rollte. Das waren Zustände wie bei der Mafia. Alle wissen, was gespielt wird, aber schweigen wie ein Grab. Und wenn wirklich mal einer aus der Reihe getanzt wäre und bei der Lebensmittelkontrolle gesungen hätte, wäre der bestimmt am nächsten Tag auch im Fleischwolf gelandet.
Der Fluch der Mittagskarte
„Hast du schon mal auf einer Schreibmaschine geschrieben, Jung?“, posaunte mich Herr Heinrich direkt am ersten Tag mit seiner tiefen bedrohlichen Stimme an.
Ein gepresstes fragendes „Ja?“, war meine unsichere, aber wahrheitsgetreue sowie im Nachhinein leichtsinnig dahergesagte Antwort, denn ich hatte in der Tat zuhause auf Opas Erbstück gelegentlich als blutiger Anfänger nur so aus Jux und Tollerei mit dem Einfinger-Such-System drauf rumgeklimpert.
Die Erleichterung war im Gesicht von Sir Heinrich deutlich zu erkennen. Ich dachte mir nichts weiter dabei, denn schließlich wollte ich meine Lehre nicht mit einer Falschaussage beginnen.
Am nächsten Morgen zuckte mir der Schreck durch alle Gliedmaßen, als Herr Heinrich die Schiebetür mit einem donnernden Ruck aufriss, sodass sie fast aus den Angeln flog, und er breitbeinig, wie Django höchstpersönlich in der Küche stand. An dieses Spektakel musste ich mich erst einmal gewöhnen.
„So Jung, heute machen wir gemeinsam die Karte, gell?“
„Welche Karte?“
„Die Mittagskarte. Die wird jeden Tag neu geschrieben.“
„Aber gestern gab es auch keine Mittagskarte.“
„Ja, gestern war auch der erste Tag nach dem Urlaub. Da hatten wir dafür keine Zeit. Das ist jedes Jahr so. Aber heute läuft alles wieder normal an. Gell, Herr Grothe?“
„Sicher, Chef, sicher“, pflichtete Herr Grothe eiligst seiner Durchlaucht bei.
„So, Herr Grothe. Was haben wir denn heute alles Leckeres?“
Herr Heinrich schritt äußerst geschäftig die drei bis vier Schritte zur Durchreiche, stützte sich darauf mit seinen massigen Ellenbogen ab, sodass sie unter seinem Gewicht quietschend nachgab, nahm das Blatt Papier, was er die ganze Zeit über in der Hand gehalten hatte und legte es fein säuberlich vor sich hin. Erwartungsvoll blickte er zu Herrn Grothe.
Der schoss sofort aus allen Rohren.
„Als Suppe machen wir Blumenkohlcreme. Nachtisch: Vanillepudding mit frischen Erdbeeren.“
Herr Heinrich nahm flink den Kugelschreiber von seinem rechten Ohr und schrieb fleißig mit.
„Gericht eins. Möhreneintopf „Bürgerlich“ mit gebratener Blutwurst.“
„Wie teuer?“
„7,00 DM?“





























