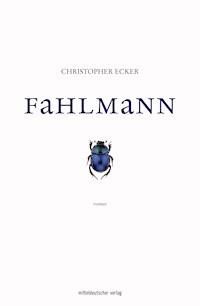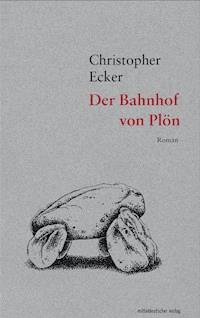
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zusammen mit seinem trollähnlichen Diener haust der anfangs noch namenlose Ich-Erzähler in einem schäbigen New Yorker Apartment und führt dubiose Aufträge für eine Person durch, die sich »der Lotse« nennt. Gegenwärtig soll eine höchst befremdliche Fracht transportiert werden, doch die Arbeit erweist sich als so kraftraubend und sinnentleert, dass der Erzähler beginnt, nicht nur an seiner Aufgabe, sondern auch an sich selbst zu zweifeln. Wer ist er wirklich? Warum ist sein Leben eine Lüge? Und wieso ist er in der Lage, von den USA aus mit der U-Bahn nach Paris, Amsterdam und Kiel zu fahren? Mit »Der Bahnhof von Plön« legt Christopher Ecker sein bislang kühnstes Buch vor – eine verstörende Tour de Force, die gleichermaßen Zeitanalyse, Entwicklungsroman, spannender Thriller, literarische Fantasy und ein philosophischer Exkurs der düstersten Sorte ist. Im Mittelpunkt des ebenso virtuosen wie doppelbödigen Spiels um Trug und Wirklichkeit steht ein schmerzhafter Selbstfindungsprozess: Wenn wir diejenigen sind, die durch unsere Erinnerungen geformt werden, wer sind wir dann, wenn diese Erinnerungen falsch sind?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christopher Ecker
Der Bahnhof
von Plön
Roman
mitteldeutscher verlag
Inhalt
Cover
Titel
Der Bahnhof von Plön
Pressestimmen
Impressum
Eigentlich wollte ich mit dem Hotelzimmer voller Leichen beginnen. Aber das ist kein Roman. Das ist die Wahrheit. Und da ich mich nicht der Qual unterziehe, dies alles niederzuschreiben, um jemandem zu gefallen oder um das Niedergeschriebene als Buch gedruckt zu sehen, spricht nichts dagegen, den ursprünglich geplanten Anfang zu verwerfen, der mir im Übrigen auch ein wenig zu effekthascherisch zu sein scheint. Stattdessen werde ich mit einem Vergleich beginnen, der sich mir eben aufdrängte, als ich– bereits mehrere Minuten lang über dem weißen Papier brütend– die Stirn auf die Tischplatte sinken ließ und die Augen im verzweifelten Bemühen schloss, mein Leben aus der Vogelperspektive der Abgeklärtheit zu betrachten.
Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, schenkten mir meine Pflegeeltern ein Meerschweinchen. Ich erinnere mich noch gut an die Kinderhand, die den Deckel des Käfigs aufklappt, der in der Zimmerecke auf dem grauen Teppich steht. Das Meerschweinchen, das zuvor geschäftig in seinem Häuschen aus Pappe geraschelt hat, scheint die Luft anzuhalten. Die Hand senkt sich in den Käfig, hebt blitzschnell das Häuschen hoch– das Tier duckt sich erschrocken im Licht. Brächte man nun seine Nase nahe an das gesträubte Fell, röche man feuchte, kreatürliche Angst. Und jetzt kommt der Vergleich: Als man mir den Umschlag mit den drei Hotelzimmerschlüsseln aushändigte und ich mir nie hätte träumen lassen, irgendwann einmal als Lehrer zu arbeiten, führte ich mein Leben wie dieses plötzlich seines Hauses beraubte Tier. Und ähnlich dem sich schreckensstarr in die Streu duckenden Meerschweinchen versuchte ich, mir niemals anmerken zu lassen, bar jeglichen Schutzes zu sein. Ich war– und bin es vielleicht noch immer– die ohnmächtige Spielfigur gewisser unbarmherziger Kräfte oder Parteien, über die später, sofern mir das gelingt, Genaueres zu berichten sein wird. Und viel mehr als heute war ich, um es pathetisch auszudrücken, ein aus Zeit und Sinn Gefallener, der unentwegt, ohne es sich selbst eingestehen zu wollen oder zu können, das barmherzige Niedersinken des Häuschens aus Pappe herbeisehnt, einem traumlosen Schlaf vergleichbar, der Frieden schenkt.
Menschen mit einer derartigen, wahrscheinlich auf früheste Kränkungen zurückzuführenden Einstellung sind die geborenen Untergebenen. Mit solchen Soldaten gewinnt man jede Schlacht: Sie befolgen widerspruchslos selbst die abseitigsten Anweisungen und würden es nie wagen, Fragen zu stellen, die ihnen irgendwer, dessen Macht sie fürchten oder dessen bloße Anwesenheit sie in lähmende Starre versetzt, als Schwäche oder Kritik auslegen könnte. Und ganz allein aus diesem Grund unterbrach ich nicht die Verbindung, als ich an einem bleiernen Oktobernachmittag, den ich am liebsten rauchend und trinkend im Bett verbracht hätte, den Befehl erhielt, mich unverzüglich ins East Village zu begeben. Dort sollte ich ein japanisches Restaurant Ecke East 9th Street und Stuyvesant Street aufsuchen und auf weitere Weisungen warten. »Sie dürfen sich gerne etwas zu essen bestellen«, sagte die mit einem Computerprogramm zur Unkenntlichkeit verzerrte Stimme. Dann lachte sie, was klang, als würde am anderen Ende der Leitung ein Blatt Papier in kleine Stückchen zerrissen, und fügte mit unverhohlenem Spott hinzu: »Oder etwas Nichtalkoholisches zu trinken.«
Organisationen wie diejenige, für die ich seinerzeit arbeitete, kennzeichnet seit jeher eine gewisse Melodramatik in der Art der Auftragsvergabe. Doch in diesem Fall gestaltete sich alles mit einer Umständlichkeit, ja Albernheit, die mir heute mehr als nur abstrus erscheint. Den wehenden, bei jedem Schritt aufklaffenden Mantel vor der Brust mit der Hand zusammenhaltend, in der anderen einen warmen Pappbecher mit Kaffee, überquerte ich die 3rd Avenue. Blickkontakt mit niemandem, hupende Taxis, Dampfsäulen aus den Kanaldeckeln. In der East 9th Street blieb ich vor einer Buchhandlung stehen, um den Mantel zuzuknöpfen. Das durchscheinende Spiegelbild im Schaufenster war unrasiert und ungekämmt, und in einem Anflug jäher Erkenntnis begriff ich, dass meine merkwürdig schiefe Körperhaltung an die eines Seemanns erinnerte: Viele Monate lang war sein Schiff in widrigen Gewässern unterwegs gewesen, und nun hat er endlich abgemustert und strebt im Sonntagsstaat dem Heuerbüro entgegen, der Schritt staksend und unsicher, die Beine die muskulösen Seiten eines Dreiecks, das einen leicht vornübergeneigten, bedächtig hin und her pendelnden Leib trägt.
Nun denn! Das Phantom inmitten der bunten Neuerscheinungen streckte sich, strich die Haare aus der Stirn und trank einen Schluck nach Pappe schmeckenden Kaffees. Dabei fiel mir auf, dass mich von seinem Verkaufsstand an der Straßenecke, höchstens drei oder vier Meter vom Schaufenster der Buchhandlung entfernt, ein schwarzer Hotdogverkäufer in alarmierender Dreistigkeit beobachtete. Ich erwiderte den Blick und zog, wie ich es von meinem Pflegevater gelernt hatte, teils drohend, teils fragend die Brauen zusammen. Sofort senkte der Mann den Kopf und rieb die in fingerlosen Handschuhen steckenden Pranken energisch gegeneinander. Er trug eine lächerliche Wollmütze und die Gerüche, die von seinem Stand zu mir rüberwehten, drehten mir den Magen um: Sauerkraut, gekochte Wurst, verbrannte Zwiebelringe. Ich wusste nicht, wann ich zum letzten Mal etwas gegessen hatte. Vielleicht würde ich nachher tatsächlich eine Kleinigkeit beim Japaner zu mir nehmen. Und dazu ein kaltes Reisbier trinken. Gegen ein Bier dürfte wohl kaum jemand etwas einzuwenden haben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!