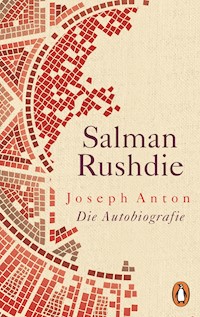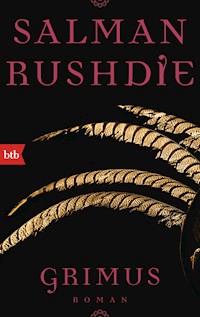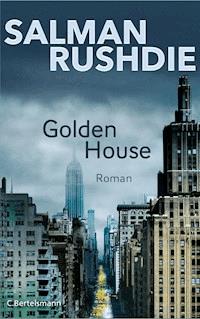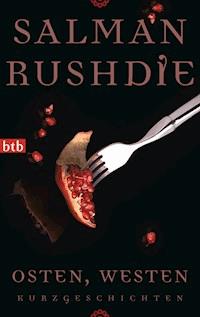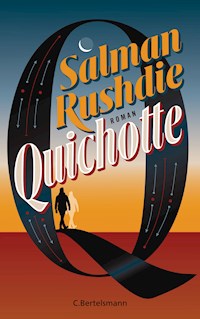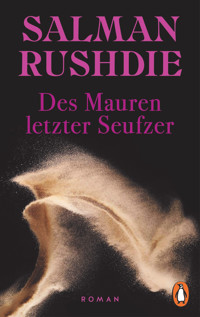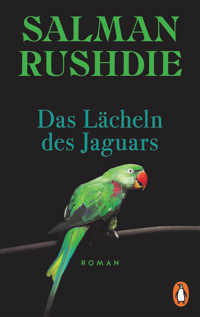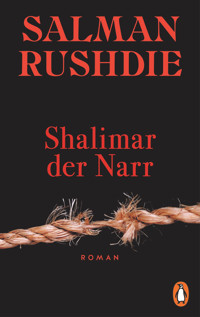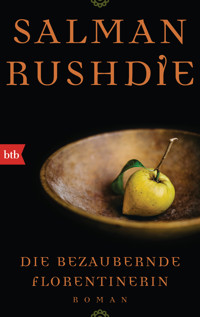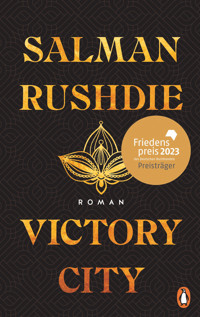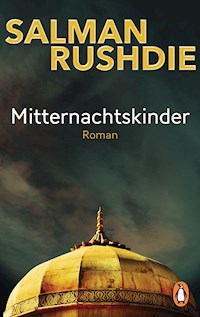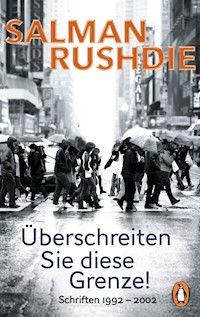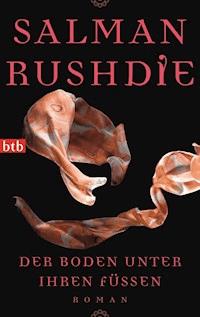
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Bombay, Ende der 1950er Jahre: Der junge Gitarrist und Komponist Ormus Cama trifft auf die wilde und lebenshungrige Sängerin Vina Apsara. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick, und doch finden sie erst Jahre später zueinander. Fortan ist ihre Liebe ein ständiges Auf und Ab, geprägt von Trennung, Versöhnung, Affären - die Vinas anderer Liebhaber, der Fotograf Rai, kommentiert und erzählt. Ormus lässt die Sehnsucht nach Vina in seine Musik fließen, in Lieder, die die Sängerin und ihn zu weltweit gefeierten Ikonen des Musikbusiness machen. Und so ist ihre außergewöhnliche Liebesgeschichte gleichzeitig eine Geschichte der Popkultur, die von den Swinging Sixties in London bis zum Sex, Drugs & Rock‘n‘Roll im New York der späten Siebziger über Jahrzehnte hinweg erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1180
Ähnliche
Bombay, Ende der 1950er Jahre: Der junge Gitarrist und Komponist Ormus Cama trifft auf die wilde und lebenshungrige Sängerin Vina Apsara. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick, und doch finden sie erst Jahre später zueinander. Fortan ist ihre Liebe ein ständiges Auf und Ab, geprägt von Trennung, Versöhnung, Affären – die Vinas anderer Liebhaber, der Fotograf Rai, kommentiert und erzählt. Ormus lässt die Sehnsucht nach Vina in seine Musik fließen, in Lieder, die die Sängerin und ihn zu weltweit gefeierten Ikonen des Musikbusiness machen. Und so ist ihre außergewöhnliche Liebesgeschichte gleichzeitig eine Geschichte der Popkultur, die von den Swinging Sixties in London bis zum Sex, Drugs & Rock‘n‘Roll im New York der späten Siebziger über Jahrzehnte hinweg erzählt.
SALMAN RUSHDIE, 1947 in Bombay geboren, studierte in Cambridge Geschichte. Mit seinem Roman »Mitternachtskinder« wurde er weltberühmt. Seine Bücher erhielten renommierte internationale Auszeichnungen, u.a. den Booker Prize, und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. 1996 wurde ihm der Aristeion-Literaturpreis der EU für sein Gesamtwerk zuerkannt. 2008 schlug ihn die Queen zum Ritter.
Salman Rushdie
Der Boden unter
ihren Füßen
Roman
Deutsch von Gisela Stege
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel The Ground beneath her Feet bei Jonathan Cape, London.
1. Auflage
Genehmigte Taschenbuchausgabe Mai 2014
Copyright © 1999 Salman Rushdie
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg.
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotive: © GalleryStock / Shimon and Tammar
MI · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-13157-9www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlagBesuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de
Für Milan
Errichtet keinen Denkstein. Laßt die Rose
nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühn.
Denn Orpheus ists. Seine Metamorphose
in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühn
um andre Namen. Ein für alle Male
ists Orpheus, wenn es singt.
R. M. Rilke, Die Sonette an Orpheus
Der Bienenhalter
Am Valentinstag 1989, dem letzten Tag ihres Lebens, erwachte die legendäre und beliebte Sängerin Vina Apsara schluchzend aus einem Traum – dem Traum von einer Menschenopferung, bei der sie selbst das Opfer sein sollte. Männer mit entblößtem Oberkörper, die dem Schauspieler Christopher Plummer ähnelten, packten sie bei den Hand- und Fußgelenken. Ausgebreitet lag sie nackt auf einem polierten Stein, in den das Bild des Schlangenvogels Quetzalcoatl geschnitten war, und wand sich qualvoll. Das weit aufgesperrte Maul der gefiederten Schlange umfing ein finsteres Loch, das man aus dem Stein geschlagen hatte, und obwohl ihr eigener Mund von ihrem Schreien weit aufgerissen war, bestand das einzige Geräusch, das sie vernahm, im Plop der Blitzlichter; doch bevor sie ihr die Kehle aufschlitzen konnten, bevor ihr Lebensblut in dieses grässliche Gefäß strömen konnte, erwachte sie um zwölf Uhr mittags in der Stadt Guadalajara, Mexiko, in einem fremden Bett, neben sich einen halb toten Fremden, einen nackten Mestizen Anfang zwanzig, der aufgrund der endlosen Presseberichte, welche die Katastrophe nach sich zog, als Raúl Páramo identifiziert wurde, Playboy und Erbe eines bekannten Baulöwen, dem unter anderem das Unternehmen gehörte, das als Eigentümer dieses Hotels zeichnete. Sie hatte sehr stark geschwitzt, und die durchnässte Bettwäsche stank nach dem sinnlosen Elend dieser nächtlichen Begegnung. Raúl Páramo war bewusstlos; seine Lippen waren schneeweiß, sein Körper wurde, wie Vina bemerkte, alle paar Sekunden von ganz ähnlichen Krämpfen geschüttelt wie sie in ihrem Traum. Nach einer Weile kamen erschreckende Geräusche aus seiner Luftröhre, fast so, als schlitze ihm jemand die Kehle auf, als fließe sein Blut durch das scharlachrote Grinsen einer unsichtbaren Wunde in ein Phantomgefäß. Von Panik gepackt, sprang Vina aus dem Bett und riss ihre Kleider an sich, die Lederhose und das goldbestickte Oberteil, die sie am Abend zuvor bei ihrem letzten Auftritt auf der Bühne im Tagungszentrum der Stadt getragen hatte. Voller Verachtung, verzweifelt, hatte sie sich diesem Niemand hingegeben, diesem Knaben, kaum halb so alt wie sie, hatte ihn mehr oder weniger willkürlich aus der Menge am Bühnenausgang herausgegriffen, den Lounge Lizards, den aalglatten, blumenbewehrten Verehrern, den Industriemagnaten, dem Aristomüll, den Drogen-Underlords, den Tequila-Fürsten, allesamt mit Limousinen, Champagner, Kokain und womöglich sogar Brillanten bewehrt, um den Star des Abends damit zu überschütten.
Der Mann hatte damit begonnen, dass er sich vorstellte, hatte geprahlt und ihr geschmeichelt, aber sie wollte weder seinen Namen wissen noch die Höhe seines Bankkontos. Sie hatte ihn gepflückt wie eine Blume, und jetzt wollte sie die Zähne in ihn schlagen, sie hatte ihn sich bestellt wie ein Schnellgericht, das man nach Hause mitnimmt, und jetzt beunruhigte sie ihn mit der Zügellosigkeit ihrer Gier, weil sie sich auf ihn stürzte, kaum dass sich die Tür der Limousine hinter ihnen geschlossen hatte und bevor dem Chauffeur Zeit blieb, die Glastrennwand zu schließen, die den Fahrgästen Zurückgezogenheit verschaffte. Später berichtete der Chauffeur ehrfürchtig von ihrem nackten Körper; während die Zeitungsleute ihm Tequila aufnötigten, sprach er flüsternd von ihrer überwältigenden, raubgierigen Nacktheit, als handle es sich um ein Wunder; wer hätte gedacht, dass sie sich schon weit auf der falschen Seite der vierzig befand, ich glaube, irgendjemand da oben wollte sie genauso erhalten, wie sie war. Für eine solche Frau hätte ich alles getan, seufzte der Chauffeur, für sie wäre ich zweihundert Stundenkilometer schnell gefahren, wenn sie es von mir verlangt hätte, für sie wäre ich gegen eine Betonmauer gerast, wenn es ihr Wunsch gewesen wäre zu sterben.
Erst als sie, halb bekleidet und völlig verwirrt, in den zehnten Stock des Hotels hinauswankte und dabei über die unbeachteten Tageszeitungen stolperte, deren Schlagzeilen über französische Atombombentests im Pazifik und politische Unruhen in der südlichen Provinz Chiapas ihr mit ihrer dicken Druckfarbe die nackten Fußsohlen beschmutzten – erst da begriff sie, dass die Hotelsuite, die sie verlassen hatte, ihre eigene war; sie hatte die Tür hinter sich zugeschlagen und stand ohne Schlüssel da, aber zu ihrem Glück war derjenige, mit dem sie in diesem Augenblick der Schwäche zusammenstieß, Mr. Umeed Merchant, Fotograf, a. b. a. ›Rai‹: ich selbst, seit der alten Zeit in Bombay sozusagen ihr Kumpel und der einzige Fotograf im Umkreis von tausend Meilen, der nicht im Traum daran denken würde, sie in diesem köstlichen und skandalösen Aufzug, da sie vorübergehend aus der Fasson geraten war und – viel schlimmer noch – so alt aussah, wie sie wirklich war, ablichten würde, der einzige Imagedieb, der ihr niemals diesen entsetzten, gejagten Gesichtsausdruck stehlen würde, diese verquollene und eindeutig tränensackgeschwollene Hilflosigkeit mit der zerzausten Fontäne drahtigrot gefärbter Haare, die in einem spechtartigen Knoten auf dem Kopf aufgetürmt waren, mit dem bezaubernden Mund, der unsicher zitterte, mit den winzigen Fjorden gnadenloser Jahre, die sich am Saum der Lippen vertieften, der Archetypus einer wilden Rockgöttin, die sich auf dem besten Weg in den Abgrund der Trostlosigkeit und des Ruins befand. Sie hatte beschlossen, für diese Tour rothaarig zu werden, weil sie im Alter von vierundvierzig Jahren einen Neuanfang machte, eine Solokarriere ohne IHN; zum ersten Mal seit Jahren war sie ohne Ormus unterwegs, daher war es wirklich nicht überraschend, dass sie fast ständig desorientiert und aus dem Gleichgewicht geraten war. Und einsam. Das muss man zugeben. Leben in der Öffentlichkeit oder Privatleben, das spielt keine Rolle, ehrlich: Wenn sie nicht bei ihm sein konnte, war es gleichgültig, mit wem sie zusammen war – sie war allein.
Desorientierung: Verlust des Ostens. Und des Ormus Cama, ihrer Sonne.
Und es war kein reiner Zufall, dass sie auf mich stieß. Denn ich war immer für sie da. Ständig hielt ich Ausschau nach ihr, ständig wartete ich auf ihren Anruf. Hätte sie es gewollt, so wären Dutzende von uns da gewesen, Hunderte, Tausende. Aber ich glaube, es gab nur mich. Doch als sie mich das letzte Mal um Hilfe bat, konnte ich sie ihr nicht geben, und sie starb. Mitten in der Geschichte ihres Lebens kam das Ende, sie war ein unfertiges Lied, zurückgelassen vor der Brücke, des Rechts beraubt, den Versen ihres Lebens bis zum letzten, vollendenden Reim zu folgen.
Zwei Stunden nachdem ich sie aus dem bodenlosen Abgrund ihres Hotelkorridors gerettet hatte, flog uns ein Hubschrauber nach Tequila, wo Don Ángel Cruz, Eigentümer der größten Agavenplantage und der namhaften Ángel-Brennerei, berühmt für die liebliche Fülle seiner Countertenorstimme, die mächtige Rotunde seines Bauches und die verschwenderische Großzügigkeit seiner Gastfreundschaft, zu ihren Ehren ein Bankett geben wollte. Vinas Playboy-Liebhaber war inzwischen ins Krankenhaus gebracht worden, aber die drogeninduzierten Krämpfe waren dann so extrem geworden, dass sie sich letzten Endes als tödlich erwiesen, und so wurde die Welt wegen dem, was Vina zustieß, noch tagelang mit den detaillierten Analysen dessen eingedeckt, was das Blut des Toten, sein Magen, seine Därme, sein Skrotum, seine Augenhöhlen, sein Blinddarm, seine Haare, ja einfach alles enthalten hatten, bis auf sein Gehirn, von dem man annahm, dass es nur wenig von Interesse enthalte. Es war von den Narkotika so gründlich verwüstet worden, dass niemand seine letzten Worte verstand, gesprochen im letzten, komatösen Delirium. Einige Tage später jedoch, als die Information ihren Weg ins Internet gefunden hatte, erklärte ein Fantasy-Fiction-Spinner mit dem Net-Namen [email protected] aus dem Castro-Viertel von San Francisco, Raúl habe Orkisch gesprochen, die infernalische Sprache, die der Autor Tolkien für die Diener des Dunklen Lord Sauron erfunden hatte: Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul. Von da an verbreiteten sich unaufhaltsam Gerüchte über satanische – oder vielleicht sauronische – Praktiken über das Web. Die Idee kam auf, der Mestizenliebhaber sei ein Teufelsanbeter gewesen, ein Blutsdiener der Unterwelt, und habe Vina Apsara einen kostbaren, aber Unheil bringenden Ring geschenkt, der die nachfolgende Katastrophe herbeigeführt und sie in die Hölle hinabgezogen habe. Mittlerweile wurde Vina jedoch bereits zum Mythos, zu einem Gefäß, das jeder Schwachsinnige mit seinen Idiotien füllen konnte, oder sagen wir lieber, zum Spiegel der Kultur, und wir vermögen das Wesen dieser Kultur am besten zu begreifen, wenn wir sagen, dass es seinen wahrhaftigsten Spiegel in einem Leichnam fand.
Ein Ring, sie zu knechten – sie alle zu finden, / Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Hubschrauber saß ich direkt neben Vina Apsara, aber ich sah keinen Ring an ihrem Finger, bis auf den Mondsteintalisman, den sie immer trug, ihre Verbindung zu Ormus Cama, ihre Erinnerung an seine Liebe.
Sie hatte ihre Entourage per Auto vorausgeschickt und mich als ihren einzigen Flugbegleiter gewählt; »von euch Bastarden ist er der einzige, dem ich vertrauen kann«, hatte sie die anderen angefaucht. Sie waren eine Stunde vor uns aufgebrochen, der ganze verdammte Zoo, ihr Tourmanager, die Schlange, ihre persönliche Assistentin, die Hyäne, die Sicherheitsgorillas, der Friseur, dieser Pfau, der PR-Drachen, aber jetzt, als der Hubschrauber über der Autokolonne dahinknatterte, schien sich die Dunkelheit, die sie seit unserem Abflug gefangen hielt, aufzuhellen, und sie befahl dem Piloten, ein paar Mal tief über die Autos unten hinwegzufliegen, tiefer und immer tiefer; ich sah, wie er die Augen vor Angst aufriss, mit Pupillen, die schwarzen Stecknadelköpfen glichen, aber genau wie wir alle stand er in ihrem Bann und tat, was sie von ihm verlangte. Ich war der Einzige, der höher, geh endlich höher! in das Mikrophon schrie, das an unsere Ohrenschützer angeschlossen war, während ihr Lachen in meinen Ohren dröhnte wie eine Tür, die im Wind schlägt, und als ich zu ihr hinübersah, um ihr zu sagen, dass ich Angst hatte, entdeckte ich, dass sie weinte. Die Polizisten waren überraschend behutsam mit ihr umgegangen, als sie am Schauplatz von Raúl Páramos Überdosis auftauchten, und hatten sich damit begnügt, ihr warnend mitzuteilen, dass sie selbst ebenfalls Gegenstand einer Untersuchung werden könnte. An diesem Punkt hatten ihre Anwälte das Gespräch unterbrochen, anschließend jedoch hatte sie überfordert, instabil gewirkt, viel zu aufgedreht, fast so, als stehe sie kurz davor, zu explodieren wie eine zerplatzende Glühbirne, wie eine Supernova, wie das Universum.
Dann ließen wir die Wagenkolonne hinter uns und flogen über Täler und Hügel dahin, die von den Agavenpflanzungen rauchgrau wirkten, und wieder veränderte sich ihre Stimmung, sie kicherte ins Mikrophon und behauptete, dass wir sie an einen Ort bringen wollten, den es nicht gebe, einen Ort der Phantasie, ein Wunderland, denn wie konnte es sein, dass es einen Ort gab, der Tequila hieß. »Das ist doch genauso, als würde man sagen, der Whisky kommt aus Whisky oder Gin wird in Gin hergestellt«, rief sie. »Ist der Wodka ein Fluss in Russland? Wird Rum in Rum produziert?« Und dann, während ihre Stimme leiser wurde, fast unverständlich beim Lärm der Rotoren: »Und Heroin kommt von den Heroen, und Crack vom Crack, dem Blitzschlag der Verdammnis.« Es ist möglich, dass ich Zeuge der Geburt eines Songs wurde. Später, als der Pilot und der Copilot über ihren Hubschrauberflug befragt wurden, weigerten sie sich sehr loyal, irgendwelche Einzelheiten über den Monolog preiszugeben, bei dem sie ständig zwischen Hochstimmung und Verzweiflung schwankte. »Sie war bester Laune«, sagten sie, »aber sie hat Englisch gesprochen. Deswegen konnten wir nichts verstehen.«
Nicht nur Englisch. Denn einzig mit mir konnte sie im Mumbai ki kachrapati baat-cheet, dem Gossenargot von Bombay, drauflos schwatzen, in dem ein Satz etwa in einer Sprache begann, durch eine zweite und sogar eine dritte lief und dann wieder zur ersten zurückschwang. Unser Akronym dafür lautete Hug-me. Hindi Urdu Gujarati Marathi Englisch. Bombayaner wie ich waren Menschen, die fünf Sprachen schlecht und keine einzige gut beherrschten.
Auf dieser Reise ohne Ormus Cama hatte Vina die musikalischen und verbalen Grenzen ihrer eigenen Fähigkeiten erkannt. Um ihre gefeierte Stimme vorzuführen, diese oktavenreiche Yma-Sumac-Himmelsleiter von einem Instrument, das, wie sie nunmehr behauptete, von Ormus’ Kompositionen niemals wirklich gefordert worden war, hatte sie neue Songs geschrieben. In Buenos Aires jedoch, in São Paulo, Mexico City und Guadalajara vernahm sie selbst die lauwarme Reaktion des Publikums auf diese Songs, und zwar trotz ihrer drei wahnsinnigen brasilianischen Schlagzeuger und ihrer zwei konkurrierenden argentinischen Gitarristen, die jeden Auftritt mit einer Messerstecherei zu beenden drohten. Sogar der Gastauftritt des mexikanischen Superstar-Veterans Chico Estefan vermochte ihr Publikum nicht zu begeistern; stattdessen lenkte sein geliftet-glattes Gesicht mit dem Mund voll falscher Zähne die Aufmerksamkeit nur auf ihre eigene dahinwelkende Jugend, die sich im Durchschnittsalter der Zuhörer spiegelte. Die Kids waren nicht gekommen, jedenfalls nicht genug von ihnen, bei weitem nicht genug.
Doch jeder einzelne der alten Hits aus der VTO-Backlist wurde von frenetischem Beifall gefolgt, und die unwiderlegbare Wahrheit war, dass der Wahnsinn der Schlagzeuger bei diesen Nummern der Vollkommenheit am nächsten kam, die konkurrierenden Gitarren sich zu sublimen Höhen emporschraubten und selbst der alte Roué Estefan von den grünen Weiden hinter dem Hügel zurückzukehren schien. Wenn Vina Apsara Texte und Musik von Ormus Cama sang, begann die Minderheit der Jugendlichen im Publikum sofort aufzumerken und aus dem Häuschen zu geraten, während Tausende von Händen sich gemeinsam bewegten, um in Zeichensprache den Namen der großen Band nachzuformen, genau im Takt ihrer donnernden Jubelrufe:
V!T!O!
V!T!O!
Kehr zu ihm zurück, sagten sie. Wir wollen euch beide zusammen. Werft eure Liebe nicht einfach weg. Statt euch zu trennen, wünschen wir uns, dass ihr euch wieder versöhnt.
Vertical Take-Off. Oder Vina To Ormus. Oder ›We two‹, auf Hug-me als V-to übersetzt. Oder als Hinweis auf die V2-Rakete. Oder V für Frieden, nach dem sie sich sehnten, und T für two, die zwei, und 0 für Liebe, ihre Liebe. Oder eine Hommage für eines der großen Gebäude in Ormus’ Heimatstadt: Victoria Terminus Orchestra. Oder ein Name, vor langer Zeit erfunden, als Vina eine Neonreklame für den alten Soft Drink Vimto sah, bei der nur noch drei Buchstaben leuchteten, Vimto ohne das im.
V … T … Ohh.
V … T … Ohh.
Zwei Aufschreie und ein Seufzer. Der Orgasmus der Vergangenheit, dessen Klang sie an ihrem Finger trug. Zu dem sie, wie sie vielleicht wusste, mir zum Trotz zurückkehren musste.
Die Nachmittagshitze war trocken und glühend, wie Vina es liebte. Bevor wir landeten, hatte der Pilot Informationen über leichte Erdbeben in der Region erhalten, aber die seien vorüber, versicherte er uns, es gebe also keinen Grund, die Landung abzubrechen. Dann schimpfte er auf die Franzosen. »Nach jedem dieser Tests kann man genau fünf Tage abzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, und die Erde bebt.« Er setzte den Hubschrauber auf einem staubigen Fußballfeld mitten in der kleinen Ortschaft Tequila auf. Das, was vermutlich die gesamte Polizeitruppe des Ortes war, hielt die einheimische Bevölkerung zurück. Als Vina Apsara in majestätischer Haltung die Maschine verließ (schon immer eine Prinzessin, wirkte sie jetzt eher königinnenhaft), stieg ein Schrei empor, nur ihr Name, Viiinaaa, die Vokale voll Sehnsucht lang gezogen, und ich erkannte – nicht zum ersten Mal –, dass man trotz all der hyperbolischen Ausschweifungen und der öffentlichen Zurschaustellung ihres Lebens, trotz all ihrer Starallüren, ihrer nakhras, ihr niemals grollen würde, dass irgendetwas an ihrer Art die Menschen entwaffnete und dass das, was die Leute von sich gaben, statt Gift und Galle eine wunderbare, vorbehaltlose Zuneigung war, als sei sie das neugeborene Kind der ganzen Welt.
Man könnte es Liebe nennen.
Kleine Jungen durchbrachen den Kordon, gejagt von schwitzenden Cops, und dann kam Don Ángel Cruz mit seinen beiden Silber-Bentleys, die genau zu seiner Haarfarbe passten. Er entschuldigte sich dafür, dass er uns nicht mit einer Arie begrüße, aber der Staub, dieser unglückselige Staub, er ist immer ein Problem, doch jetzt, bei diesem Erdbeben, ist die ganze Luft davon voll, bitte, Señora, Señor – mit einem kleinen Huster gegen seinen Handrücken geleitete er uns in den vorderen Bentley –, wir werden sofort abfahren, bitte sehr, und mit dem Programm beginnen. Mit riesigen Taschentüchern tupfte er sich den Schweiß von der Stirn und nahm mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht, das er mit großer Willenskraft dort festhielt, im zweiten Wagen Platz. Unter der Oberfläche des perfekten Gastgebers konnte man fast die schwer atmende Erregung sehen. »Dies ist ein Mann, der Sorgen hat«, sagte ich zu Vina, als unser Wagen den Weg zur Plantage nahm. Sie zuckte die Achseln. Im Oktober 1984 hatte sie für eine Werbekampagne in Vanity Fair mit einem Luxuswagen die Oakland Bay Bridge in westlicher Richtung überquert; auf der anderen Seite hielt sie an einer Tankstelle, stieg aus dem Wagen und sah, wie er mit allen vier Rädern vom Boden abhob und in der Luft hing wie ein Ding aus der Zukunft oder Zurück in die Zukunft. In diesem Moment brach die Bay Bridge wie ein Kinderspielzeug in sich zusammen. Deswegen sagte sie: »Komm mir bloß nicht mit Erdbeben«, sagte es mit ihrer hart-breiten, katastrophenerfahrenen Stimme, als wir auf der Plantage eintrafen, wo Don Ángels Angestellte uns mit Sombreros aus Stroh empfingen, um uns vor der Sonne zu schützen, und Machete-Maestros nur darauf warteten, zu demonstrieren, wie man eine Agavenpflanze zu einer großen, blauen ›Ananas‹ zurechthackte, die in den Pulper passte. »Komm mir bloß nicht mit Richter, Rai, Liebling. Ich bin früher schon gemessen worden.« Die Tiere waren unruhig. Scheckige Straßenköter rannten kläffend im Kreis, Pferde wieherten. Orakelhaft erscheinende Vögel kreisten lärmend am Himmel. Unter der immer krasser werdenden Leutseligkeit von Don Ángel Cruz nahm auch die subkutane seismische Aktivität allmählich zu, während er uns durch die Brennerei schleppte, das sind unsere traditionellen Holzfässer, und dies sind unsere glänzenden, neuen technologischen Wunder, unsere Kapitalanlage für die Zukunft, unsere enorme Investition, ein unbezahlbares Investment. Die Angst begann ihm in dicken, stinkenden Schweißtropfen zu entströmen. Geistesabwesend tupfte er mit seinen nassen Taschentüchern an dieser anrüchigen Flut herum, doch in der Abfüllabteilung wurden seine Augen vor Kummer noch größer, als er die Zerbrechlichkeit seines Glücks betrachtete, Flüssigkeit, in Glas gebettet, und die Angst vor einem Erdbeben begann ihm feucht aus den Augenwinkeln zu rinnen.
»Der Absatz französischer Weine und Spirituosen hat seit dem Beginn der Tests stark nachgelassen, vermutlich um etwa zwanzig Prozent«, murmelte er kopfschüttelnd. »Die chilenischen Weinkellereien wie auch unsere Leute hier in Tequila haben davon profitiert. Die Exportnachfrage ist so sehr in die Höhe geschossen, dass Sie es nicht glauben würden.« Mit dem Rücken seiner zitternden Hand wischte er sich die Augen. »Warum sollte Gott uns ein solches Geschenk machen, nur um es uns wieder zu nehmen? Warum muss ER unseren Glauben auf die Probe stellen?« Er musterte uns, als seien wir tatsächlich in der Lage, mit einer Antwort aufzuwarten. Als er begriff, dass keine präsent war, umklammerte er plötzlich Vina Apsaras Hände und verwandelte sich in einen Bittsteller an ihrem Hof, von schierer Not zu dieser Geste überschwänglicher Intimität getrieben. Sie machte keinen Versuch, sich aus seinem Griff zu befreien.
»Ich bin kein schlechter Mensch«, beschwor Don Ángel Vina flehenden Tones, als spreche er ein Gebet. »Ich war immer gerecht zu meinen Angestellten und liebenswürdig zu meinen Kindern, und sogar meiner Frau war ich treu, allerdings bis auf ein paar kleinere Zwischenfälle, ehrlich gesagt, aber das ist bestimmt schon zwanzig Jahre her, Señora, Sie sind eine erfahrene Lady, Sie verstehen die Schwächen des mittleren Alters. Warum sollte ich also von einem solchen Tag heimgesucht werden?« Demütig neigte er den Kopf vor ihr und ließ ihre Hände los, um gleich darauf die seinen zu falten und sie angstvoll an seine Zähne zu heben.
Sie war daran gewöhnt, Absolution zu erteilen. Also legte sie ihm ihre befreiten Hände auf die Schultern und begann mit ›Der Stimme‹ auf ihn einzureden, leise murmelnd, als seien sie Liebende, tat das gefürchtete Erdbeben ab wie ein ungezogenes Kind, das zur Strafe in der Ecke stehen muss, und verbot ihm, dem großartigen Don Ángel Kummer zu machen; und so wundervoll war ihre Sprachgewalt, der Klang ihrer Stimme weit mehr als das, was sie sagte, dass der verzweifelte Mann tatsächlich aufhörte zu schwitzen, mit einem zögernden, unsicheren Wiederauftauchen seiner Zuversicht den kindlichen Kopf hob und lächelte. »Gut«, sagte Vina Apsara. »Und jetzt gehen wir zum Lunch.«
Auf der alten Hazienda der Familie, die heutzutage nur noch für große Dinners wie dieses benutzt wurde, fanden wir unter den Arkaden, mit Blick auf einen Innenhof mit Springbrunnen, eine lang gestreckte Festtafel, und als Vina eintrat, begann eine Mariachi-Band zu spielen. Dann tauchte die Fahrzeugkolonne auf, der kreischend und hektisch die gesamte, schreckliche Menagerie der Rockwelt entstieg, um den alten Tequila des Gastgebers in sich hineinzuschütten, als wäre es Bier aus einem Partyfass oder Wein-in-der-Schachtel, und mit ihrer Fahrt durch die Erdstöße zu prahlen, wobei der persönliche Assistent seinen Hass auf die unsichere Erde hinauszischte, als habe er vor, sie zu verklagen, der Tourmanager mit einer Schadenfreude lachte, die er gewöhnlich nur an den Tag legte, wenn er wieder mal einen Vertrag zu schändlich ausbeuterischen Bedingungen unterzeichnete, der Pfau eitel und geräuschvoll schillerte, die Gorillas monosyllabisch grunzten, die argentinischen Gitarristen einander, wie immer, an die Gurgel gingen und die Drummer – ach, die Drummer! – die Erinnerung an ihre Panik abblockten, indem sie sich in eine Tequila-geölte Serie lautstarker Kritiken an der Mariachi-Band stürzten, deren Leader, prächtig in schwarzsilberner Tracht, den Sombrero zu Boden schleuderte und gerade nach dem silbernen Sechsschüssigen greifen wollte, den er an der Hüfte trug, als Don Ángel eingriff und, um eine gesellige Atmosphäre herzustellen, freundlich erklärte: »Bitte, wenn Sie erlauben, möchte ich zu Ihrer Zerstreuung etwas zum Besten geben.«
Ein echter Countertenor bringt alle Diskussionen zum Schweigen, beschämt mit seiner siderischen Süße wie Sphärenmusik all unsere Kleinlichkeiten. Don Ángel Cruz schenkte uns Gluck, Trionfi Amore, und die Mariachis machten ihre Sache als Chor zu seinem Orfeo recht gut.
Trionfi Amore!E il mondo intieroServa all’imperoDella beltà.
Das unglückliche Ende der Orpheus-Geschichte – Eurydice auf ewig verloren, weil Orfeo sich umblickt – war von jeher ein Problem für Komponisten wie auch für Librettisten. – He, Calzabigi, was soll dieser Schluss, den du mir da geliefert hast? So ein Downer, soll ich die Leute mit ellenlangen Gesichtern nach Hause schicken? Hallo? Mach’s mir ’n bisschen fröhlicher, ja? – Aber klar doch, Herr Gluck, seien Sie nicht so agitato. Kein Problem! Liebe ist mächtiger als der Hades. Liebe stimmt die Götter gnädig. Wie wär’s, wenn die sie ohnehin zurückschicken würden? »Verschwinde, Kleine, der Kerl ist verrückt nach dir! Was ist schon ein kurzer Blick?« Dann schmeißen die Liebenden eine Party, und was für eine! Tanz, Wein, alles, was drin ist. So kriegen Sie Ihr großes Finale, alle Welt geht fröhlich summend nach Haus. – Find ich gut. Bravo, Raniero. – Aber gern doch, Willibald. Keine Ursache.
Und da war es, das Showstopper-Finale. Triumph der Liebe über den Tod. Die ganze Welt gehorcht dem Befehl der Schönheit. Zur allgemeinen Überraschung, auch der meinen, erhob sich Vina Apsara, der Rockstar, und sang beide Sopranstimmen, Amore sowohl als Eurydice, und obwohl ich kein Experte bin, klang sie wort- und notenperfekt, stieg ihre Stimme schließlich zu einer Ekstase der Vollendung empor, als wolle sie sagen, jetzt hast du herausgefunden, wozu ich da bin.
… E quel sospettoChe il cor tormentaAl fin diventaFelicità.
Das gequälte Herz findet nicht nur das Glück, es wird das Glück. So heißt es jedenfalls in der Story. So heißt es im Lied.
Gerade als sie endete, begann die Erde zu beben, applaudierte ihrer Leistung. Das große Stillleben des Banketts, die Platten mit Fleisch, die Schalen mit Obst, die Flaschen voll bestem Cruz-Tequila und sogar die Banketttafel selbst begannen auf Disney-Art zu tanzen und zu springen, leblose Objekte, belebt vom kleinen Zauberlehrling, dieser anmaßenden Maus; oder als seien sie durch die schiere Macht ihres Gesangs dazu bewegt, sich der letzten chaconne anzuschließen. Wenn ich versuche, mir die genaue Folge der Ereignisse ins Gedächtnis zu rufen, muss ich feststellen, dass meine Erinnerung zum Stummfilm geworden ist. Es muss Geräusche gegeben haben. Das Pandaimonion, die Stadt der Teufel und ihrer Qualen, kann kaum lärmender gewesen sein als diese mexikanische Stadt, als Sprünge an den Mauern der Gebäude entlanghuschten wie Eidechsen, mit ihren langen Spinnenfingern die Mauern von Don Ángels Hazienda aufrissen, bis sie einfach in sich zusammenfiel wie eine Illusion, eine Filmfassade, und die aufsteigende Staubwolke dieses Zusammenbruchs uns auf die buckelnden, schwankenden Straßen hinaustrieb, wo wir um unser Leben liefen, ohne zu wissen, wohin, und doch immer weiter davonliefen, während es Ziegel von den Dächern regnete, Bäume in die Luft geschleudert wurden, Müll von den Straßen emporschoss, Häuser explodierten und Koffer, seit Ewigkeiten auf Dachböden versteckt, vom Himmel herabprasselten.
Ich aber erinnere mich nur an Stille, die Stille tiefsten Entsetzens. Um genau zu sein, die Stille der Fotografie, denn das war mein Beruf, und so griff ich in dem Moment, in dem das Erdbeben begann, natürlich darauf zurück. Meine Gedanken galten nur noch den kleinen Filmquadraten, die durch meine alten Kameras liefen, Voigtländer Leica Pentax, den Formen und Farben, die durch die Zufälle von Bewegung und Ereignis darauf festgehalten wurden, und natürlich durch die Gewandtheit oder den Mangel daran, mit der es mir gelang, das Objektiv zur richtigen oder falschen Zeit in die richtige oder falsche Richtung zu halten. Hier wurde das ewige Schweigen von Gesichtern, Körpern und Tieren, ja, der Natur selbst eingefangen – jawohl, von meiner Kamera –, eingefangen aber auch vom Griff der Angst vor dem Unvorhersehbaren und der Verzweiflung des Verlustes, vor den Fängen dieser verhassten Metamorphose, dieser entsetzlichen Stille einer Lebensart im Augenblick ihrer Vernichtung, ihrer Verwandlung in eine goldene Vergangenheit, die nie wieder gänzlich aufgebaut werden kann, denn wenn man ein Erdbeben miterlebt hat, weiß man, auch wenn man keinen Kratzer davonträgt, dass es, genau wie ein Herzschlag, in der Brust der Erde bestehen bleibt, eine entsetzliche Möglichkeit, die ständig wiederzukehren droht, um mit noch weit verheerenderer Gewalt abermals zuzuschlagen.
Eine Fotografie ist eine moralische Entscheidung, getroffen in einer Achtelsekunde, oder Sechzehntel-, oder Einhundertachtundzwanzigstelsekunde. Einmal mit den Fingern schnippen: Ein Schnappschuss ist schneller. Auf der Mitte zwischen Voyeur und Augenzeuge, großem Künstler und miesem Abschaum – so habe ich mein Leben verbracht, habe ich in Sekundenbruchteilen Entscheidungen getroffen. Das ist okay, das ist cool. Ich lebe noch, ich bin bloß ein paar hundert Mal angespuckt und beschimpft worden. Mit den Schimpfwörtern kann ich leben. Es sind die Männer mit der schweren Artillerie, die mich beunruhigen. (Und es sind Männer, fast immer – all diese Arnolds, die Terminatoren tragen, all diese selbstmörderischen Eiferer mit ihren Klobürstenbärten und keinem Haar auf der babynackten Oberlippe; aber wenn Frauen diese Arbeit verrichten, sind sie oft schlimmer.)
Ich war immer ein Event-Junkie, ich. Action war das Stimulans meiner Wahl. Ich habe meine Nase immer gern in die heiße, schweißnasse, aufgebrochene Oberfläche dessen gesteckt, was sich abspielte, mit offenen Augen, saufend, alle anderen Sinne abgeschaltet. Es war mir immer egal, wenn es stank, wenn ich bei dem schleimigen Gefühl der Berührung kotzen musste, wenn ich nicht wusste, was es meinen Geschmacksknospen antun würde, wenn ich daran leckte, ja sogar, wie laut es schrie. Wichtig war nur, wie es aussah. Darin habe ich eine sehr lange Zeit Gefühl und Wahrheit gesucht.
Was Wirklich Geschieht: Es gibt nichts Aufregenderes, als wenn man direkt mit der Nase draufgestoßen wird, solange man dabei nicht die Nase verliert. Kein größerer Kick auf Erden.
Vor langer Zeit habe ich für mich eine Art Unsichtbarkeit entwickelt. Sie macht es mir möglich, direkt an die Akteure im Drama der Welt heranzugelangen, die Kranken, die Sterbenden, die Wahnsinnigen, die Trauernden, die Reichen, die Gierigen, die Ekstatischen, die Waisen, die Zornigen, die Mörderischen, die Heimlichen, die Bösen, die Kinder, die Guten, die Berichtenswerten; mich in ihre verbotenen Zonen einzuschleichen, mitten ins Zentrum ihrer Wut, ihres Kummers oder ihrer transzendenten Erregung, um genau den Moment ihres Auf-der-Welt-Seins definieren und mein verdammtes Foto schießen zu können. Viele Male hat mir diese Gabe der Dematerialisierung das Leben gerettet. Wenn die Leute zu mir sagten, fahren Sie nicht diese von Heckenschützen beherrschte Straße entlang, betreten Sie bloß nicht die Festung dieses Kriegsherrn, um das Areal dieser Miliz sollten Sie lieber einen Bogen machen, fühlte ich mich sofort unwiderstehlich davon angezogen. Da ist noch niemand je mit einer Kamera hineingegangen und lebend wieder herausgekommen, warnte mich irgendjemand, und schon war ich auf und davon, über den Checkpoint ohne Wiederkehr hinaus. Wenn ich zurückkehrte, musterten die Leute mich so seltsam, als sei ich ein Geist, und fragten mich, wie ich das geschafft hätte. Ich schüttelte den Kopf. Ehrlich gesagt, oft genug wusste ich es selbst nicht. Wenn ich es gewusst hätte, so hätte ich es vielleicht nie wieder tun können, und dann wäre ich in irgendeiner unausgegorenen Kampfzone umgebracht worden. Möglich, dass es eines Tages noch dazu kommt.
Am besten kann ich es beschreiben, wenn ich sage, dass ich mich klein machen kann. Nicht körperlich klein, denn ich bin eher hoch gewachsen und kräftig, sondern psychisch. Ich setze einfach mein unterwürfiges Lächeln auf und schrumpfe bis zur quantité négligeable. Durch mein Verhalten überzeuge ich den Heckenschützen, dass ich seine Kugel nicht verdiene, meine Haltung überzeugt den Kriegsherrn, dass er seine schwere Axt nicht beschmutzen muss. Ich lasse sie wissen, dass ich ihrer Gewalttätigkeit nicht würdig bin. Vielleicht funktioniert das, weil ich aufrichtig bin, denn ich bemühe mich tatsächlich, unterwürfig zu sein. Es gibt Erlebnisse, die ich mit mir herumtrage, Erinnerungen, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich mir meinen minderen Wert ins Gedächtnis rufen will. So ist es mir dank einer Art angelernter Bescheidenheit, Ergebnis meines frühen Lebens und früherer Missetaten, gelungen, mich selbst am Leben zu erhalten.
»Schwachsinn«, fand Vina Apsara. »Nur eine weitere Variante deiner alten Methode, Mädchen aufzureißen.«
Bescheidenheit wirkt auf Frauen, das stimmt. Doch bei den Frauen spiele ich sie nur. Mein nettes, schüchternes Lächeln, meine zurückhaltende Körpersprache. Je mehr ich mich in meiner Wildlederjacke und den Kampfstiefeln zurückziehe und unter meinem Kahlkopf (wie oft habe ich mir sagen lassen, welch schönen Kopf ich habe!) schüchtern lächle, desto heftiger werden ihre Avancen. In der Liebe kommt man voran, indem man sich zurückzieht. Aber was ich unter Liebe verstehe und was – zum Beispiel – Ormus Cama unter demselben Wort verstand, waren zwei völlig verschiedene Dinge. Für mich war sie immer eine Kunst, die ars amatoria: die erste Annäherung, das Zerstreuen von Befürchtungen, das Erregen von Interesse, das Vortäuschen von Abkehr, die zögernde, doch unabwendbare Wiederkehr. Die gemächliche, einwärts gekehrte Spirale des Begehrens. Kama. Die Kunst der Liebe.
Während sie für Ormus Cama nichts anderes war als eine Frage von Leben und Tod. Liebe dauerte ein Leben lang und währte über den Tod hinaus. Liebe war Vina, und nach Vina gab es nichts als die absolute Leere.
Für die winzigen Lebewesen dieser Welt war ich jedoch nie unsichtbar. Diese sechsbeinigen Zwergterroristen hatten sich auf mich eingeschossen, so viel steht fest. Zeigen Sie mir (oder tun Sie es lieber nicht) eine Ameise, führen Sie mich (lieber nicht) zu einer Wespe, einer Biene, einem Moskito, einem Floh. Sie werden mich alle zum Frühstück verspeisen; und zu anderen, weitaus kräftigeren Mahlzeiten. Alles, was klein ist und beißt, beißt mich. So wurde ich in einem bestimmten Moment mitten im Zentrum des Erdbebens, als ich gerade ein verlassenes Kind fotografierte, das nach seinen Eltern schrie, einmal so schmerzhaft, als sei es beabsichtigt, in die Wange gestochen, und als ich mein Gesicht von der Kamera losriss, geschah das gerade rechtzeitig (dafür muss ich mich wohl bei diesem grässlichen aguijón-bewehrten Ding bedanken; nicht aus Gewissensgründen, sondern der sechste Sinn eines Schnappers), um den Beginn der Tequila-Flut mitzukriegen. Die vielen, riesigen Vorratsfässer der Stadt waren geborsten.
Die Straßen wirkten wie Peitschen, schlängelten sich und knallten. Die Ángel-Brennerei war eine der ersten, die unter den Schlägen zusammenbrach. Altes Holz splitterte, neues Metall buckelte und platzte. Der urinöse Tequila-Strom schäumte seinen Lauf in die Gassen der Stadt, die erste Woge der Sturzflut überholte die fliehenden Bewohner und riss sie kopfüber von den Füßen, und so stark war das Gebräu, dass jene, die einige Mund voll von dieser himmlischen Brandung schluckten, nicht nur nass und keuchend daraus auftauchten, sondern auch betrunken. Als ich Don Ángel Cruz das letzte Mal sah, hastete er, eine Kasserolle in der Hand und um den Hals zwei Kessel an Schnüren, auf den in Tequila ertrinkenden Plätzen umher und machte den jämmerlichen Versuch zu retten, was er retten konnte.
So verhalten sich die Menschen, wenn ihre Alltäglichkeit zerstört wird, wenn sie für wenige Momente klar und deutlich eine der großen formenden Gewalten des Lebens erfahren. Das Unheil fixiert sie mit wie hypnotisiertem Blick, derweil sie in den Trümmern ihrer Tage wühlen und graben und versuchen, aus den Müllbergen des Unwiederbringlichen, ihres überwältigenden Verlustes die Erinnerung an das Alltägliche zu bergen – ein Spielzeug, ein Buch, ein Gewand, sogar ein Foto. Don Ángel Cruz als Mann mit den Bettelschalen war das kindliche, sagenhafte Bild, das ich brauchte, eine Gestalt, die auf unheimliche Weise an den surrealen Saucepan Man aus einigen von Vina Apsaras Lieblingsbüchern erinnerte, der Faraway-Tree-Serie von Enid Blyton, die sie überallhin begleitete. Ich hüllte mich in meine Unsichtbarkeit und begann zu schießen.
Ich weiß nicht, wie lange das alles dauerte. Der hüpfende Tisch, die kollabierende Hazienda, die Achterbahnstraßen, die keuchenden, umhergeschleuderten Menschen im Tequila-Strom, die Hysterie, das tödliche Gelächter der Obdachlosen, der Heruntergekommenen, der Arbeitslosen, der Verwaisten, der Toten … Wenn man mich bäte, den Zeitraum zu schätzen, ich könnte es nicht. Zwanzig Sekunden? Eine halbe Stunde? Fragt mich was anderes. Die Tarnkappe sowie mein zweiter Trick, sämtliche Sinne auszuschalten und meine gesamte Wahrnehmungsfähigkeit durch meine mechanischen Augen zu lenken – derartige Dinge haben, wie man so sagt, eine Kehrseite. Wenn ich vor der Ungeheuerlichkeit des Aktuellen stehe, wenn dieses gigantische Monster in meine Linse brüllt, verliere ich die Kontrolle über andere Dinge. Wie viel Uhr ist es? Wo ist Vina? Wer ist tot? Wer ist am Leben? Öffnet sich da ein Abgrund unter meinen Kampfstiefeln? Was hast du gesagt? Da drüben versucht ein Ärzteteam eine Sterbende zu erreichen? Was redest du da? Warum bist du mir im Weg, was, zum Teufel, bildest du dir ein, mich rumzustoßen? Kannst du nicht sehen, dass ich arbeite?
Wer lebte noch? Wer war tot? Wo war Vina? Wo war Vina? Wo war Vina?
Ich kam wieder zu mir. Insekten stachen mich in den Hals. Der Tequila-Sturzbach versiegte, der kostbare Strom versickerte in der zerrissenen Erde. Die Stadt sah aus wie eine Ansichtskarte, die von einem zornigen Kind zerrissen und von der Mutter gewissenhaft wieder zusammengeklebt wurde. Sie hatte ein Fluidum der Zerbrochenheit angenommen, sich zu der großen Familie der Zer- und Gebrochenen gesellt: zerbrochene Teller, zerbrochene Puppen, gebrochenes Englisch, gebrochene Versprechungen, gebrochene Herzen. Durch den Staub kam Vina Apsara auf mich zugetaumelt. »Rai, Gott sei Dank!« Trotz ihres Herumtändelns mit buddhistischen Weisen (Rinpoche Hollywood und der Ginsberg Lama), Krishna-bewussten Zymbalisten und tantrischen Gurus (diesen Kundalini-Vorzeigern), TM-Rishis und Meistern dieser oder jener verrückten Weisheit, Zen und der Kunst des Dealens, des Taos des promiskuitiven Sex, Eigenliebe und Erleuchtung, trotz all ihrer spirituellen Marotten fiel es mir in meiner eigenen Gottlosigkeit immer wieder schwer zu glauben, dass sie wahrhaftig an einen existierenden Gott glaubte. Aber genau das tat sie offenbar; in dieser Hinsicht lag ich vermutlich ebenfalls falsch; und überhaupt, welches andere Wort gibt es denn? Wenn man Dankbarkeit für das blinde Glück des Lebens empfindet, wenn niemand da ist, dem man danken kann, aber irgendjemandem danken muss, was sagt man da? Gott, sagte Vina. Für mich klang das Wort wie eine Möglichkeit, ein Gefühl loszuwerden: ein Ort, an den man etwas tut, das man sonst nirgendwohin tun kann.
Vom Himmel herab kam ein größeres Insekt zu uns herunter und attackierte uns mit dem starken Fallstrom seiner lärmenden Flügel. Der Hubschrauber hatte gerade noch so rechtzeitig abgehoben, dass er nicht beschädigt wurde. Jetzt brachte ihn der Pilot fast ganz bis auf den Boden, hielt ihn in der Schwebe und winkte uns. »Nichts wie raus hier!«, rief Vina mir zu. Ich schüttelte den Kopf. »Geh du nur«, rief ich zurück. Arbeit geht vor Spiel. Ich musste meine Fotos auf den Weg bringen. »Bis später«, rief ich.
»Was?«
»Später!«
»Was?«
Eigentlich war vorgesehen, dass uns der Hubschrauber für ein erholsames Wochenende zu einer entlegenen Villa an der Pazifikküste bringen sollte, der Villa Huracán, Miteigentum des Präsidenten der Colchis-Schallplattengesellschaft und nördlich von Puerto Vallarta in privilegierter Abgeschiedenheit wie ein Zauberreich zwischen dem Dschungel und dem Meer gelegen. Jetzt wusste niemand, ob die Villa noch stand. Die Welt hatte sich verändert. Dennoch klammerte sich Vina Apsara wie die Stadtbewohner an ihre gerahmten Fotos, wie Don Ángel an seine Kasserollen, an die Idee der Kontinuität, des vorbestimmten Zeitablaufs. Sie hielt sich eisern ans Programm. Doch bis meine gekidnappten Fotos an die Nachrichtenschreibtische der Weltpresse gelangten, um ausgelöst zu werden, konnte es für mich kein tropisches Shangri-La geben.
»Ich haue dann ab«, rief sie mir laut zu. »Ich kann nicht mitkommen.«
»Was?«
»Geh!«
»Scheiß auf dich!«
»Was?«
Dann saß sie im Hubschrauber, der emporstieg, und ich war nicht mit ihr gegangen und sollte sie auch nie wieder sehen, keiner von uns sah sie je wieder, und die letzten Worte, die sie zu mir herunterschrie, brechen mir jedes Mal, wenn ich daran denke, das Herz, und ich denke ein paar hundertmal am Tag daran, Tag für Tag, und dann sind da noch die endlosen schlaflosen Nächte.
»Goodbye, Hope.«
Den Arbeitsnamen ›Rai‹ legte ich mir zu, als ich bei der berühmten Agentur Nebuchadnezzar angenommen wurde. Pseudonyme, Künstlernamen, Arbeitsnamen: Für Schriftsteller, für Schauspieler, für Spione sind das nützliche Masken, durch welche die eigene, die wahre Identität verborgen oder verändert wird. Doch als ich mich Rai zu nennen begann, Fürst, hatte ich das Gefühl, eine Tarnung abzulegen, weil ich der Welt mein kostbarstes Geheimnis kundtat, und zwar, dass dies seit meiner Kindheit Vinas ganz persönlicher Kosename für mich gewesen war, das Kennzeichen einer Jugendliebe. »Weil du dich wie ein kleiner Rajah verhältst«, erklärte sie mir liebevoll, als ich erst neun war und noch Zahnspangen trug. »Deswegen sind es nur deine engsten Freunde, die wissen können, dass du eigentlich nur ein unwichtiger Lümmel bist.«
Das war Rai: ein Fürstenknabe. Aber die Kindheit endet, und im Erwachsenenleben war es dann Ormus Cama, der Vinas Märchenprinz wurde, nicht ich. Immerhin, der Kosename blieb mir erhalten. Und Ormus war so freundlich, ihn ebenfalls zu benutzen, oder sagen wir, er übernahm ihn von Vina wie eine Infektion, oder sagen wir, er konnte sich nicht vorstellen, dass ich zu seinem Rivalen, zu einer Gefahr für ihn werden könnte, deswegen konnte er mich als Freund betrachten … Aber lassen wir das jetzt. Rai. Das bedeutete auch Begierde: die persönliche Neigung eines Menschen, die Richtung, die einzuschlagen er sich entschied; und Wille, die Charakterstärke eines Menschen. All das gefiel mir. Es gefiel mir, dass es sich um einen Namen handelte, mit dem leicht zu reisen war, jedermann konnte ihn aussprechen, er klang in jeder Sprache gut. Und wenn ich in dieser mächtigen Demokratie der falschen Aussprache, den Vereinigten Staaten, gelegentlich zu »Hey, Ray« wurde, hatte ich keine Lust, mich zu streiten, sondern pickte mir einfach die Rosinen unter den Aufträgen heraus und verließ die Stadt. In einem anderen Teil der Welt war Rai Musik. In der Heimat dieser Musik jedoch haben religiöse Fanatiker in letzter Zeit begonnen, die Musiker zu töten. Sie sehen in der Musik eine Beleidigung Gottes, der uns Stimmen gab, aber nicht wünscht, dass wir singen, der uns den freien Willen gab, rai, dem es aber lieber ist, wenn wir unfrei sind.
Wie dem auch sei, jetzt sagen es alle: Rai. Nur dieser eine Name, es ist ganz leicht, es ist ein Stil. Die meisten Menschen kennen meinen richtigen Namen nicht einmal. Umeed Merchant, hatte ich das schon erwähnt? Umeed Merchant, aufgewachsen in einem anderen Universum, in einer anderen Dimension der Zeit, in einem Bungalow an der Cuffe Parade in Bombay, der vor langer Zeit schon abgebrannt ist. Der Name ›Merchant‹ bedeutet, wie ich vielleicht erklären sollte, ›Kaufmann‹. In Bombay tragen die Familien oft Namen, die vom Beruf irgendeines verstorbenen Vorfahren abgeleitet wurden. Ingenieure, Bauunternehmer, Ärzte. Und vergessen wir nicht die Readymoneys, die Cashondeliveris, die Fishwalas. Ein Mistry ist ein Maurer, ein Wadia ist ein Schiffsbauer, ein Vakil ist ein Anwalt und ein Bankier ist ein Shroff. Und der langen Liebschaft der durstigen Stadt mit Mineralwasserdrinks entsprangen nicht nur die Batliwalas, sondern auch die Sodawaterbatliwalas, und nicht nur die Sodawaterbatliwalas, sondern auch die Sodawaterbatliopenerwalas.
Ungelogen!
»Goodbye, Hope«, rief Vina, dann zog der Hubschrauber in einer steilen Kurve nach oben und verschwand.
Umeed, verstehen Sie? Substantiv, weiblich. Und heißt hope, Hoffnung.
Warum interessieren wir uns für Sänger? Worin liegt die Macht der Lieder? Vielleicht in der höchst erstaunlichen Tatsache, dass es auf dieser Welt überhaupt Gesang gibt. Die Note, die Tonleiter, der Akkord; Melodien, Harmonien, Arrangements; Symphonien, Ragas, Chinesische Opern, Jazz, der Blues: dass derartige Dinge existieren, dass wir die magischen Intervalle und Distanzen entdeckt haben, die das kümmerliche Bündel Noten ergeben, alles innerhalb einer menschlichen Handspanne, aus der heraus wir uns Kathedralen der Klänge erbauen, ist genauso ein Geheimnis der Alchimie wie Mathematik oder Wein oder Liebe. Vielleicht haben die Vögel es uns gelehrt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir ganz einfach Kreaturen auf der Suche nach Trost. Denn davon bekommen wir nicht sehr viel. Unser Leben ist nicht das, was wir verdienen, es ist, einigen wir uns darauf, auf vielerlei schmerzliche Art mangelhaft. Der Gesang verwandelt es in etwas anderes. Der Gesang zeigt uns eine Welt, die unseres Sehnens würdig ist, zeigt uns unser eigenes Ich, wie es sein könnte, wenn wir dieser Welt würdig wären.
Fünf Mysterien bergen den Schlüssel zum Unsichtbaren: der Liebesakt, die Geburt eines Kindes, die Betrachtung großer Kunstwerke, die Gegenwart des Todes oder Unglücks und zu hören, wie sich die menschliche Stimme im Gesang erhebt. Das sind die Ereignisse, bei denen die Riegel des Universums aufbrechen und uns einen kurzen Blick auf das Verborgene schenken; auf einen Zipfel des Unnennbaren. In solchen Stunden kommt Glanz auf uns herab: der dunkle Glanz der Erdbeben, das glitschige Wunder des neuen Lebens, der strahlende Klang von Vinas Gesang.
Vina, zu der sogar völlig Fremde kamen, um ihrem Stern zu folgen, weil sie sich von ihrer Stimme Erlösung erhofften, von ihren großen, feuchten Augen, von ihrer Berührung. Wie kommt es, dass eine so explosive, ja sogar amoralische Frau von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung als Symbol, als Ideal betrachtet wurde? Denn sie war keineswegs ein Engel, glauben Sie mir, aber versuchen Sie das mal Don Ángel zu sagen. Vielleicht war es ja gut, dass sie nicht als Christin geboren war, sonst hätten die noch versucht, sie zur Heiligen erklären zu lassen. Unsere Liebe Frau von den Stadien, unsere Arena-Madonna, die den Massen wie Alexander der Große, als er seine Soldaten für den Krieg begeistern wollte, ihre Narben zeigte; unsere gipserne Nichtjungfrau, die blutige Tränen aus ihren Augen und heiße Musik aus ihrer Kehle rinnen lässt. Wenn wir uns von der Religion lösen, unserem uralten Opiat, gibt es unweigerlich Entzugserscheinungen, wird diese Apsara-Version zahlreiche Nebenwirkungen haben. Die Gewohnheit des Anbetens ist niemals leicht zu brechen. In den Museen sind die Räume mit Heiligenbildern voll gestopft. Es war uns schon immer lieber, wenn unsere Heiligen gemartert dargestellt wurden, mit Pfeilen gespickt, kopfüber gekreuzigt, wir brauchen sie gegeißelt und nackt, wir wollen sehen, wie ihre Schönheit langsam zerbricht, wollen ihre narzisstische Qual betrachten. Nicht trotz ihrer Fehler, sondern wegen ihrer Fehler verehren wir sie, bewundern wir ihre Schwächen, ihre Petitessen, ihre schlechten Ehen, ihren Drogenmissbrauch, ihre Gehässigkeit. Wenn wir uns in Vinas Spiegel betrachtet und ihr vergeben haben, haben wir auch uns selbst vergeben. Sie hat uns durch ihre Sünden erlöst.
Mir ging es nicht anders. Ich habe sie immer gebraucht, um alles geradezubiegen: einen verhauenen Job, einen Zacken aus meiner Krone, eine davongelaufene Frau, die es geschafft hatte, mir mit ihren grausamen Worten unter die Haut zu dringen. Aber erst gegen das Ende ihres Lebens fand ich den Mut, sie um ihre Liebe zu bitten, um sie zu werben, und einen himmlischen Augenblick lang glaubte ich tatsächlich, sie Ormus’ Fängen entreißen zu können. Dann starb sie und ließ mich mit einem Schmerz zurück, den nur sie mit ihrer magischen Berührung hätte lindern können. Aber sie war nicht mehr da, um mir die Stirn zu küssen und mir zu sagen, ist schon okay, Rai, du kleiner Lümmel, es geht vorbei, ich streiche meinen Hexenbalsam auf diese schlimmen, bösen Stiche, komm her zu Mama, und du wirst sehen, alles wird gut.
Dies ist es, was ich jetzt empfinde, wenn ich an Don Ángel Cruz denke, wie er in seiner zerbrechlichen Brennerei weinend vor ihr kniete: Neid. Und Eifersucht. Ich wünschte, ich hätte das getan, hätte mein Herz geöffnet und um sie gebettelt, bevor es zu spät war, und auch Ich wünschte, ich hätte dich nicht berührt, du wimmernder, bankrotter Kapitalistenwurm mit deiner Piepsstimme.
Wir alle wandten uns an sie, um Frieden zu finden, dabei hatte sie selbst keinen Frieden. Also habe ich mich entschlossen, hier in aller Öffentlichkeit aufzuschreiben, was ich ihr nicht mehr vertraulich ins Ohr flüstern kann: das heißt alles. Ich habe mich entschlossen, unsere Geschichte zu erzählen, ihre und meine und Ormus Camas, alles, bis ins letzte Detail; dann kann sie vielleicht hier, auf dieser Seite, in dieser Unterwelt der Tinte und der Lügen, eine Art Frieden finden, die Ruhe, die ihr das Leben versagt hat. Und nun stehe ich am Tor des Infernos der Sprache, vor mir einen bellenden Hund, einen wartenden Fährmann und unter der Zunge eine Münze für die Überfahrt.
»Ich war kein schlechter Mensch«, wimmerte Don Ángel Cruz. Okay, jetzt werde ich auch mal wimmern. Hör zu, Vina: Ich bin auch kein schlechter Mensch. Obwohl ich, wie ich offen gestehe, ein Verräter an der Liebe war und als einziges Kind bisher noch kein Kind gezeugt habe, aber im Namen der Kunst die Bilder der Geschlagenen und der Toten gestohlen, getändelt und die Achseln gezuckt (um die Engel von meinen Schultern zu vertreiben, die über mich wachten) und noch weit schlimmere Dinge getan habe; dennoch sehe ich mich als Mann unter Männern, als einen Mann, wie Männer sind, nicht besser und nicht schlechter. Obwohl ich dazu verurteilt bin, von Insekten gestochen zu werden, habe ich nicht das verruchte Leben eines Bösewichts geführt. Verlass dich drauf: wirklich nicht.
Kennen Sie den vierten Gesang der Georgica des Barden von Mantua, P. Vergillus Maro? Ormus Camas Vater, der gestrenge Sir Darius Xerxes Cama, Klassizist und Honigfreund, kannte seinen Vergil, und durch ihn lernte auch ich etwas davon kennen. Sir Darius war natürlich ein Bewunderer des Aristaeus; Aristaeus, der erste Bienenzüchter der Weltliteratur, dessen unwillkommene Avancen die Dryade Eurydike dazu brachten, auf eine Schlange zu treten, woraufhin die Waldnymphe den Tod erlitt und die Berge weinten. Vergils Version der Orpheus-Geschichte ist außergewöhnlich: Er berichtet sie in sechsundsiebzig flammenden Zeilen, schreibt mit überwältigender Kraft, und dann lässt er Aristaeus in beiläufigen dreißig weiteren Zeilen sein rituelles Sühneopfer bringen, und damit hat sich’s, Ende des Gesangs, kein Grund, noch länger über diese törichten, todgeweihten Liebenden zu trauern. Der eigentliche Held des Gesangs ist der Bienenzüchter, der ›arkadische Meister‹, Bewirker eines Wunders, weit größer als die Kunst des unglücklichen thrakischen Sängers, die nicht einmal seine Geliebte von den Toten zu erwecken vermochte. Das ist es, was Aristaeus vermochte: Er konnte aus dem faulenden Kadaver einer Kuh spontan neue Bienen entstehen lassen. Er war »die himmlische Gabe des Honigs aus der Luft«.
Nun gut. Don Ángel konnte aus blauen Agaven Tequila machen. Und ich, Umeed Merchant, Fotograf, konnte spontan neue Bedeutungen aus den verwesenden Kadavern dessen schaffen, was sich tatsächlich abspielte. Ich besitze die teuflische Gabe, in gleichgültigen Augen Reaktionen auszulösen, Gefühle, vielleicht sogar Verständnis, indem ich die schweigenden Gesichter der Realität vor ihnen ausbreite. Auch ich bin korrumpiert, kein Mensch weiß besser als ich, wie unwiderruflich. Auch gibt es keine Opfer, die ich bringen, oder Götter, die ich versöhnlich stimmen könnte. Und dennoch bedeuten meine Namen ›Hoffnung‹ und ›Wille‹, und das zählt doch auch etwas, nicht wahr? Stimmt’s, Vina?
Aber sicher, Baby. Sicher, Rai, mein Liebling. Es zählt.
Musik, Liebe, Tod. Irgendwie ein Dreieck; vielleicht sogar ein ewiges. Doch Aristaeus, der den Tod brachte, brachte auch Leben, ein bisschen wie der Gott Shiva damals, zu Hause. Nicht nur Tänzer, sondern sowohl Schöpfer als auch Zerstörer. Nicht nur von Bienen gestochen, sondern auch Schöpfer des Stiches der Bienen. So also Musik, Liebe und Leben-Tod: diese drei. Wie wir es früher ebenfalls waren. Ormus, Vina und ich. Wir ersparten einander nichts. Daher wird auch in dieser Geschichte nichts ausgelassen werden. Vina, ich muss dich verraten, damit ich dich endlich loslassen kann.
Lasst uns beginnen.
Melodien und Stille
Ormus Cama wurde in den frühen Stunden des 27. Mai 1937 in Bombay, Indien, geboren und begann nur wenige Minuten nach seiner Geburt mit beiden Händen seltsame, sehr schnelle Fingerbewegungen zu machen, die jeder Gitarrist als Akkordfolgen identifiziert hätte. Da nun aber zu jenen, die zu der von Gurrlauten begleiteten Bewunderung des Neugeborenen in der Privatklinik der Sisters of Maria Gratiaplena in der Altamount Road oder auch später in der Familienwohnung in Apollo Bunder geladen waren, kein Gitarrenspieler gehörte, wäre das Wunder möglicherweise niemals bemerkt worden, hätte es nicht eine einzelne Rolle 18-mm-Film gegeben, die am 17. Juni mit einer Paillard Bolex aufgenommen wurde, Eigentum meines Vaters, Mr. V. V. Merchant, eines begeisterten Schmalfilmamateurs. Der ›Vivvy-Film‹, als der er später bekannt wurde, überlebte glücklicherweise in akzeptablem Zustand, bis die neuen Computertechnologien es viele Jahre später ermöglichten, in digital vergrößerten Nahaufnahmen die Patschhändchen von Baby Ormus zu bewundern, wie sie in der leeren Luft Gitarre spielten und tonlos eine komplizierte Reihe von Monster-Riffs und Dizzy Licks mit einem Tempo und einem Gefühl hinlegten, auf welche die größten Routiniers des Instruments stolz gewesen wären.
Damals, am Anfang, war die Musik jedoch das Letzte, an das man dachte. Lady Spenta Cama, Ormus’ Mutter, hatte in der fünfunddreißigsten Schwangerschaftswoche erfahren müssen, dass das Kind, das sie trug, im Mutterleib gestorben war. Zu diesem späten Zeitpunkt hatte sie keine andere Wahl, als die ganze Qual der Wehen durchzustehen, und als sie den tot geborenen Körper von Ormus’ älterem Bruder Gayo sah, seinen nichtidentischen, zweieiigen Zwillingsbruder, war sie so niedergeschlagen, dass sie fest daran glaubte, die unveränderte Bewegung in ihrem Leib sei ihr eigener Tod, der zur Welt gebracht werden wolle, damit sie sofort mit ihrem leblosen Kind wieder vereint werden konnte.
Bis zu diesem unglückseligen Moment war sie ein sanftmütiger Mensch gewesen, astigmatisch und endomorph, der zu einer gewissen kuhähnlichen Rotation des Unterkiefers neigte, die Sir Darius Xerxes Cama, ihr redegewandter, jähzorniger, launenhafter Ehemann, hoch gewachsen, ektomorph und unter dem roten Fez mit der Goldquaste überdimensional schnauzbärtig und mit stechenden Augen ausgestattet, häufig durchaus absichtlich für Dummheit hielt. Es war nicht Dummheit. Es war die Flügelschwere einer Seele, die ganz mit der geistigen Ebene beschäftigt ist, oder, genauer, einer Seele, die in ihrer alltäglichen Routine eine Möglichkeit fand, mit dem Göttlichen zu kommunizieren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!