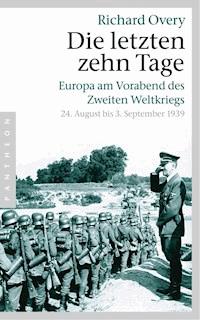17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Nichts hat die Zerstörungskraft des Zweiten Weltkriegs so sehr ins kollektive Gedächtnis eingebrannt wie Der Bombenkrieg: Mit nie da gewesener Gewalt vernichtete er Dutzende Städte in ganz Europa, 600000 Menschen starben, Millionen verloren alles; die Ruinen von Coventry oder Dresden wurden zu Symbolen einer technischen, menschengemachten Apokalypse. In der ersten umfassenden Darstellung erzählt Richard Overy die Geschichte dieses Krieges. Er schildert die Anfänge der neuen Strategie des «Moral Bombing», ihre Entwicklung wie schließlich ihr Scheitern, und er deckt zahlreiche Mythen und Irrtümer auf, die bis heute kursieren. Erstmals entsteht ein internationales Gesamtbild, von der Offensive gegen das Ruhrgebiet bis zu den «Baedeker-Angriffen», die unschätzbares historisches Erbe auslöschten, von den deutschen Bomben auf Stalingrad bis zu wenig bekannten Schauplätzen wie Rom oder Bulgarien. Overy zeigt, warum der Luftkrieg trotz Ineffektivität und mörderischer Kosten ausgeweitet wurde, welche Rolle Hermann Göring oder General Harris dabei spielten. Aber auch die kulturellen und menschlichen Verheerungen treten vor Augen, die Not und Hoffnung in den Luftschutzkellern wie bei den Piloten. Richard Overy zeichnet ein monumentales Panorama Europas in dunkler Zeit – das Standardwerk über den Bombenkrieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1489
Ähnliche
Richard Overy
Der Bombenkrieg
Europa 1939 bis 1945
Aus dem Englischen von Hainer Kober
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Nichts hat die Zerstörungskraft des Zweiten Weltkriegs so sehr ins kollektive Gedächtnis eingebrannt wie der Bombenkrieg: Mit nie da gewesener Gewalt vernichtete er Dutzende Städte in ganz Europa, 600000 Menschen starben, Millionen verloren alles; die Ruinen von Coventry oder Dresden wurden zu Symbolen einer technischen, menschengemachten Apokalypse.
Über Richard Overy
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Zwischen 1939 und 1945 wurden Hunderte europäische Städte, Ortschaften und Dörfer zum Ziel von Luftangriffen. Nach seriösen Schätzungen belief sich die Zahl der Bombenopfer in der Zivilbevölkerung auf unfassbare sechshunderttausend Tote und weit mehr als eine Million Schwerverletzte, die in manchen Fällen ein Leben lang unter den körperlichen und geistigen Folgen der Bombardements zu leiden hatten. Große Teile Europas lagen zeitweilig so vollständig in Trümmern, dass sie den traurigen Resten des einst glorreichen Römischen Reiches glichen. Jedem, der unmittelbar nach Kriegsende durch die verwüsteten Städte streifte, stellte sich zunächst die offensichtliche Frage, wie so etwas überhaupt geschehen konnte, und gleich darauf, wie sich Europa jemals davon erholen sollte.
Das sind nicht die Fragen, die man sich gewöhnlich in Hinblick auf den Bombenkrieg stellt. Dass Bombardements ein wesentlicher Teil jedes künftigen Krieges sein würden, war für viele Europäer Ende der dreißiger Jahre eine Selbstverständlichkeit; damals war es nahezu unvorstellbar, dass irgendein Staat freiwillig auf das scheinbar naturgegebene Werkzeug des totalen Krieges verzichten würde. Zwar prägt die Technik das Wesen aller Kriege, auf den Zweiten Weltkrieg traf dies jedoch in besonderem Maße zu. Nachdem die Bomberwaffe einmal losgelassen war, ließ sich ihr Potenzial nicht mehr vorhersagen. 1945 zeugten die stummen Ruinen Europas von der unbarmherzigen Gewalt der Bombardements und der Unvermeidlichkeit ihrer Eskalation. Umso bemerkenswerter ist es, dass die europäischen Städte während des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit zu boomenden Konsumzentren avancierten. Flaniert man heute auf den Pracht- und Geschäftsstraßen der Städte Deutschlands, Italiens und Großbritanniens, so lässt sich kaum vorstellen, dass sie nur siebzig Jahre zuvor mehr oder minder hilflos massiven Luftangriffen ausgesetzt waren. In Europa bewies nur noch das Schicksal, das 1999 der Stadt Belgrad von den Luftstreitkräften der NATO beschert wurde, dass der Luftkrieg eine zentrale Strategie der westlichen Welt geblieben ist.
Die meisten historischen Darstellungen der Bomberoffensiven in Europa kreisen um zwei Fragen: Welche strategischen Folgen hatten die Bombardements? Und: Waren sie moralisch vertretbar? Der Verknüpfung beider Fragen in jüngeren Abhandlungen zum Thema liegt oftmals die Annahme zugrunde, dass das, was strategisch ungerechtfertigt ist, auch ethisch zweifelhaft sein muss – und umgekehrt. An dieser Art der teils erhellenden, teils überhitzten Beweisführung überrascht, dass sie sich im Allgemeinen auf eine schmale empirische Basis stützt, die meist aus den offiziellen Darstellungen und Nachkriegsbewertungen des Bombenkriegs übernommen wird, und dass sie sich beinahe ausschließlich auf die Bombardierungen Deutschlands und Englands konzentriert. Es gibt einige ausgezeichnete neuere Studien zum Bombenkrieg, die über die Standardversion hinausgehen (obwohl sie sich nach wie vor auf die alliierten Bombardierungen Deutschlands beschränken), in den meisten allgemeinen Darstellungen jedoch wimmelt es von hartnäckigen Mythen und Fehldeutungen, während sich die Versuche, das Problem der Legalität oder Moralität zu lösen, immer weiter von der historischen Realität entfernen.
Die vorliegende Untersuchung ist der erste Versuch einer vollständigen Darstellung des Bombenkriegs in Europa – ein Projekt, das trotz siebzig Jahren eingehender Forschung seit Kriegsende ausstand. Drei Aspekte unterscheiden dieses Buch von den herkömmlichen Geschichten des Bombenkriegs.
Erstens nimmt es ganz Europa in den Blick. Zwischen 1939 und 1945 wurden beinahe alle europäischen Staaten bombardiert, entweder vorsätzlich oder zufällig (neutrale eingeschlossen). Das weiträumige Gefechtsfeld wurde durch die deutsche Neuordnung Europas geprägt, die fast ganz Kontinentaleuropa zum unfreiwilligen Kriegsgebiet machte. Die Bombardierungen Frankreichs und Italiens (die in beiden Ländern zu Opferzahlen führten, die mit denen des «Blitz» in England vergleichbar sind) kommen in den bisherigen Darstellungen des Krieges kaum vor, wenn auch eine neuere, ausgezeichnete Untersuchung von Claudia Baldoli und Andrew Knapp sie in angemessener Weise behandelt. Die Bombardierungen Skandinaviens, Belgiens, der Niederlande, Rumäniens und Bulgariens durch die Alliierten sowie die deutschen Luftangriffe gegen sowjetische Städte werden meist ebenso wenig berücksichtigt. Um all diese Teilaspekte des Bombenkriegs wird es im Folgenden gehen.
Zweitens wurde der Bombenkrieg allzu oft beschrieben, als ließe er sich auf irgendeine Weise von den übrigen Vorgängen des Krieges lösen. Der Bombenkrieg war, wie zu zeigen sein wird, stets nur Teil eines umfassenderen strategischen Ganzen – noch dazu ein Teil, der viel kleiner war, als die Luftwaffenführungen es wahrhaben wollten. Wenn man sich zur Bombardierung entschloss, geschah es oft eher gewohnheitsmäßig. Meist war diese Option den politischen und militärischen Prioritäten der Kriegführenden nachgeordnet und wurde vom Konkurrenzdenken der Teilstreitkräfte beeinflusst, was die ehrgeizigen Bestrebungen der Flieger einschränkte. Was immer über die Luftmacht im Zweiten Weltkrieg behauptet wird, muss deshalb entsprechend zurechtgerückt werden. Bombenangriffe waren in Europa zu keinem Zeitpunkt eine kriegsentscheidende Strategie – was den beiden anderen Teilstreitkräften, dem Heer und der Marine, sehr wohl bewusst war.
Drittens beschäftigen sich die meisten Darstellungen des Bombenkriegs entweder nur mit den Männern, die für die Luftangriffe verantwortlich waren, oder ausschließlich mit den Bevölkerungen, die die Bombardements erlitten. Zwar werden zwischen beiden Erzählungen bisweilen Verbindungen hergestellt, die Geschichte der Einsätze blendet jedoch oft die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Folgen der Angriffe für die Menschen aus: eine Geschichte der Schlachten statt einer Geschichte kriegführender Gesellschaften. Die folgende Darstellung betrachtet die Bombardements aus beiden Blickwinkeln – und fragt sowohl danach, was mit den Bomberoffensiven erreicht werden sollte, als auch, welche Auswirkungen sie tatsächlich auf die bombardierten Bevölkerungen hatten. In dieser Doppelperspektive lässt sich das Problem der Effizienz und der ethischen Zwiespältigkeit ganz neu angehen.
Es besteht kein Zweifel, dass dies ein ehrgeiziges Unternehmen ist, hinsichtlich des geographischen Umfangs wie auch der erzählerischen Breite. Nicht alles kann in gebotener Ausführlichkeit behandelt werden. So befasst sich dieses Buch etwa nicht mit Nachkriegserinnerungen an den Bombenkrieg, da es hierzu mittlerweile einen wachsenden Bestand an originären und konzeptionell ausgereiften Arbeiten gibt. Auch der Wiederaufbau Europas im ersten Jahrzehnt nach Kriegsende wird nur kurz angerissen. Er ist ebenfalls Gegenstand einer vielfältigen und lebhaften Forschung, die sich an Fragestellungen der Stadtgeographie, des Wiederaufbaus und der Stadtplanung orientiert. Die vorliegende Darstellung beschränkt sich auf die Geschichte des Luftkriegs, der zwischen 1939 und 1945 in Europa geführt wurde. Es geht darum, Aspekte zu untersuchen, zu denen es nur wenig oder gar keine Literatur gibt, oder aber die Ergebnisse etablierter Forschungsfelder Revue passieren zu lassen, um herauszufinden, ob die archivierten Belege sie tatsächlich stützen.
Ich hatte das Glück, zwei neue Quellen aus Archiven der ehemaligen Sowjetunion auswerten zu können. Diese umfassen Dokumente der deutschen Luftwaffe zum «Blitz», also den deutschen Bombenangriffen auf britische Städte 1940/41, über den auf deutscher Seite bemerkenswert wenig geschrieben worden ist. Zudem gibt es dort umfangreiches Material zur Organisation der sowjetischen Luftverteidigung sowie die ersten Statistiken über sowjetische Opfer und materielle Verluste durch deutsche Luftangriffe. Diese Unterlagen befinden sich im staatlichen russischen Militärarchiv (RGWA) in Moskau und im Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation (ZAMO) in Podolsk. Ich bin Dr. Matthias Uhl vom Deutschen Historischen Institut in Moskau sehr dankbar dafür, dass er mir Zugang zu diesen Quellen verschafft hat; mit ihrer Hilfe konnte ich zwei wichtige und dennoch bislang vernachlässigte Aspekte des Bombenkriegs rekonstruieren. Ferner habe ich im Imperial War Museum in Duxford eine große Sammlung italienischer Originalakten des Ministero dell’Aeronautica entdeckt, die sowohl über den italienischen Luftschutz als auch über die italienischen Bombardierungen Maltas – jener Insel, die in den Jahren 1941/42 der meistbombardierte Ort Europas war – Auskunft geben können. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Stephen Watson dafür bedanken, dass er mir diese Dokumente frei zugänglich gemacht hat.
Meine Absicht war es zudem, die gängigen, insbesondere britischen und amerikanischen Darstellungen des Bombenkriegs durch eine erneute Sichtung der in beiden Ländern befindlichen Archivalien zu überprüfen. Lange Zeit hat die offizielle Geschichtsschreibung die Art und Weise, wie der Bombenkrieg erzählt wurde, geprägt. Obwohl etwa das von Charles Webster und Noble Frankland 1961 veröffentlichte Werk zweifellos zu den besten offiziellen britischen Darstellungen des Krieges zählt (General Harris tat es später als «Schüleraufsatz» ab), geben die vier Bände lediglich die Sicht der offiziellen Akten des Nationalarchivs wieder und konzentrieren sich auf die Bombardierung Deutschlands, statt ganz Europa einzubeziehen. Die siebenbändige offizielle Geschichte von Wesley Craven und James Cate hält sich eng an die Operationsgeschichte der United States Army Air Forces, wobei der Bombenkrieg nur einen Teilaspekt darstellt. In den fünfziger Jahren verfasst, deckt sich die Quellenbasis ebenfalls mit den offiziellen Akten, die jetzt in den National Archives II in College Park (Maryland) und bei der Air Force Historical Research Agency in Maxwell (Alabama) liegen.
Die Geschichte des Bombenkriegs und seiner Politik ist jedoch erst dann wirklich zu verstehen, wenn man auch die privaten Papiere der beteiligten Personen heranzieht und sich mit den offiziellen Akten aus Bereichen beschäftigt, die mit den Bombardierungen in keinem direkten Zusammenhang stehen oder zunächst unter Verschluss gehalten wurden, weil sie zu unbequemen Fragen geführt hätten. Über die umfangreichen Vorbereitungen des Einsatzes von Giftgas und biologischen Kampfstoffen beispielsweise ließ sich in den fünfziger Jahren nicht so einfach sprechen (und im Fall vieler Akten wurde über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestfrist hinaus jede Einsichtnahme verweigert); Gleiches gilt für die Aktivitäten der Nachrichtendienste, deren Geheimnisse in den vergangenen dreißig Jahren erst allmählich gelüftet werden konnten.
Über die Erfahrungen der Menschen, die unter den Bombardements litten, erfährt man in offiziellen Geschichtsdarstellungen nur wenig. Lediglich in Großbritannien erfasste die «Civil Series» der offiziellen Geschichte auch Zivilschutz, Kriegsproduktion und Sozialpolitik. Sie ist noch immer eine nützliche Quelle, wurde jedoch in vielen Fällen durch genauere und kritischere historische Arbeiten überholt. Die Akten des Zentralarchivs habe ich durch weniger bekannte lokale Aufzeichnungen ergänzt. Besonders hilfreich waren die Luftschutzakten, die im History Centre der Stadt Hull aufbewahrt werden und die Geschichte einer Stadt erzählen, die vom Sommer 1940 bis zum März 1945, als der letzte deutsche Luftangriff auf Großbritannien registriert wurde, Bombenangriffen ausgesetzt war. Aufschlussreich waren auch die Aufzeichnungen zu den Bombardierungen im Nordosten Englands, die im Discovery Museum in Newcastle upon Tyne lagern. Entsprechende «Official Histories» gibt es in anderen europäischen Ländern nicht (obwohl die Beiträge über die Heimatfront, die vom halboffiziellen Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg und Potsdam verfasst wurden, denselben Zweck sehr gut erfüllen), doch es gibt in jedem Land eine Fülle von lokalen Studien über einzelne Städte. Es handelt sich dabei um Quellen von unschätzbarem Wert über örtliche Verhältnisse, Reaktionen der Bevölkerung, die Leistungen des zivilen Bevölkerungsschutzes und über die Opfer; ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, die Geschichten der bombardierten Städte in Frankreich, Italien, den Niederlanden und Deutschland zu rekonstruieren. Ergänzt wurden diese Studien durch Material aus staatlichen Archiven in Berlin, Freiburg, Rom, Paris und auf Malta (wo es ein brauchbares Luftschutzarchiv gibt, das nur wenige Kilometer von den schönen Stränden der Insel entfernt liegt).
Abschließend ein Wort zu den verwendeten Statistiken. Viele Statistiken aus der Kriegszeit sind bekanntlich aus dem ein oder anderen Grund unzulänglich, nicht zuletzt hinsichtlich der Opferzahlen. Ich stütze mich bei der Angabe von Zahlen der Toten und Verwundeten auf die in Archiven auffindbaren Unterlagen, allerdings unter dem üblichen Vorbehalt, was deren Verlässlichkeit und Vollständigkeit betrifft. Daneben habe ich versucht, so gewissenhaft wie nur möglich angemessene Fehlermargen zu berücksichtigen. Dennoch weist das statistische Bild, das sich im Folgenden ergibt, erhebliche Unterschiede zu vielen herkömmlichen Angaben auf, insbesondere im Fall Deutschlands und der Sowjetunion. Oft hielten die Zahlen der Bombenopfer der Revision nicht stand. Dabei war es keineswegs meine Absicht anzuzweifeln, dass Hunderttausende Europäer von Bomben getötet oder schwer verletzt wurden. Das Bemühen um historisch plausible statistische Zahlen verleiht der Tötung von Zivilisten aus der Luft weder mehr noch weniger Legitimität; es steht lediglich im Dienst einer verlässlicheren Wiedergabe der Ereignisse.
In einem Buch dieses Umfangs ist es schwer, der menschlichen Dimension auf Seiten der Bombardierenden wie der Bombardierten die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die sie verdient. Dennoch geht es um ein sehr menschliches Geschehen, das in der umfassenderen Gewaltgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts wurzelt. Immer wieder wird es im Folgenden um Personen gehen, deren Erfahrungen beispielhaft für etwas stehen sollen, was Tausende andere Menschen berührte; ob es nun die Fliegersoldaten waren, die unter gewaltigem körperlichen und seelischen Stress gegen den Feind und die Elemente kämpften, oder die Ortschaften, die tief unter ihnen zu Opfern einer Technologie wurden, die niemals so akkurat wirkte, dass sich die Vernichtung von Menschenleben und städtischen Räumen hätte eingrenzen lassen. Es gehört zu den furchtbaren Paradoxien des totalen Krieges, dass er die Bomberbesatzungen nicht weniger als die Bombardierten traumatisieren konnte. Im heutigen Rückblick auf den Bombenkrieg, aus einer Distanz von siebzig Jahren, wird dieses Paradox die entwickelte Welt hoffentlich in der Entschlossenheit stärken, ihn nie zu wiederholen.
Prolog: Die Bombardierung Bulgariens
Die moderne Fliegerbombe mit ihrer charakteristischen länglichen Form, stabilisierenden Heckflossen und dem in die Spitze eingebauten Zünder ist eine bulgarische Erfindung. Im Balkankrieg von 1912, in dem Bulgarien, Griechenland, Serbien und Montenegro (der Balkanbund) gegen die Türkei kämpften, modifizierte und vergrößerte der Heereshauptmann Simeon Petrow eine Anzahl von Granaten dahin gehend, dass man sie von Bord eines Flugzeugs aus einsetzen konnte. Am 16. Oktober 1912 wurden sie aus einem Albatros-F-2-Doppeldecker, der von einem gewissen Radul Milkow geflogen wurde, auf einen türkischen Bahnhof abgeworfen. Anschließend ergänzte Petrow die Konstruktion um das Heck zur Stabilisierung sowie einen Aufschlagzünder und schuf damit die Sechs-Kilogramm-Bombe, die bis 1918 das bulgarische Standardmodell blieb. Später wurden die Pläne der sogenannten «Tschataldscha-Bombe» an Deutschland weitergegeben, Bulgariens Verbündeten im Ersten Weltkrieg. Der Bauplan der Bombe wurde in der Frühzeit der Luftwaffe mehr oder weniger unverändert in allen Ländern als Standardmuster übernommen.
Während des Zweiten Weltkriegs suchte Petrows Erfindung ihr Ursprungsland heim. Am 14. November 1943 griff ein amerikanischer Verband von einundneunzig B-25-Mitchell-Bombern und neunundvierzig P-38-Lightning-Begleitjägern die Rangierbahnhöfe der bulgarischen Hauptstadt Sofia an. Die Bomben wurden weiträumig abgeworfen, unter anderem über drei Dörfern. Der Angriff zerstörte einen Teil der Gleisanlagen, den Flugplatz Vrajedna und weitere 187 Gebäude, rund 150 Menschen kamen ums Leben. Zehn Tage später verlief ein zweiter Angriff von B-24-Liberator-Bombern weniger erfolgreich. Über Südbulgarien herrschte schlechtes Wetter, und so kamen nur siebzehn Maschinen dort an, wo man Sofia vermutete. Sie luden ihre Bomben durch dichte Wolken ab und trafen weitere sieben Dörfer rund um die Hauptstadt.[1] Die Angriffe versetzten die Stadt in Panik. Da keine wirksamen Luftverteidigungs- oder Zivilschutzmaßnahmen getroffen worden waren, flohen Tausende ins Umland. Obwohl die Königlich Bulgarische Luftwaffe von ihrem deutschen Verbündeten mit sechzehn Messerschmitt-Jagdflugzeugen vom Typ Me-109G ausgerüstet worden war, vermochte sie wenig gegen die Luftangriffe auszurichten, die zwar nicht gänzlich unerwartet kamen, aber doch überraschten.[2]
Der Luftangriff im November 1943 war nicht der erste auf ein bulgarisches Ziel, jedoch der bis dahin schwerste und wirkungsvollste. Angegriffen wurde Bulgarien nur deshalb, weil seine Regierung im März 1941 nach langem Zögern beschlossen hatte, sich Deutschland anzuschließen, indem sie den Dreimächtepakt unterschrieb, der im September zuvor von den Achsenmächten Deutschland, Italien und Japan geschlossen worden war.[3] Als im Frühjahr 1941 deutsche Streitkräfte in Bulgarien stationiert wurden, um von dort Griechenland und Jugoslawien anzugreifen, entsandte die britische Luftwaffe (Royal Air Force, RAF) sechs Wellington-Bomber, um Sofias Schienenverbindungen zu zerstören und so die Konzentration deutscher Truppen zu behindern. Am 13. April gelang bei einem britischen Nachtangriff ein Glückstreffer auf einen Munitionszug, der zu erheblichen Bränden und großräumigen Zerstörungen führte.
Zu weiteren kleineren Bombenangriffen, für die die bulgarische Regierung die sowjetische Luftwaffe verantwortlich machte, kam es am 23. Juli und 11. August 1941. Obwohl sich Bulgarien am 22. Juni 1941 nicht aktiv am Einmarsch der Achsenmächte in die Sowjetunion beteiligte, versorgte es Deutschland doch mit Nachschubgütern und gestattete deutschen Schiffen, die Haupthäfen Warna und Burgas zu nutzen. Am 13. September 1942 flogen die Sowjets einen weiteren Angriff auf Burgas, wo deutsche Schiffe mit Bohrausrüstung an Bord auf das Zeichen zur Überquerung des Schwarzen Meeres warteten, um nach der gelungenen Eroberung der kaukasischen Ölfelder den deutschen Ingenieuren sofort das nötige Gerät zur Wiederaufnahme der Ölförderung zu liefern. Die Sowjetunion befand sich mit Bulgarien nicht im Krieg und leugnete die Angriffe von 1941 und 1942, die ziemlich sicher auf ihr Konto gingen, aber die Bombenschäden waren ohnehin so geringfügig, dass die bulgarische Regierung nicht auf Wiedergutmachung bestand.[4]
Diese wenigen Nadelstiche in den Jahren 1941 und 1942 genügten, um in Bulgarien Besorgnis zu wecken. Man fragte sich, was kommen mochte, wenn sich die Alliierten jemals entschließen sollten, bulgarische Städte massiv zu bombardieren. Die Situation des Landes im Zweiten Weltkrieg war zwiespältig. Nach den empfindlichen territorialen und finanziellen Verlusten, die Bulgarien in der Friedensregelung von 1919 als Strafe hatte hinnehmen müssen, weil es sich im Ersten Weltkrieg mit Deutschland und Österreich-Ungarn verbündet hatte, lehnte König Boris III. eine aktive Beteiligung seines Landes am Krieg ab. Nur sehr widerstrebend und unter deutschem Druck erwirkte der Premierminister Bogdan Filow die Kriegserklärung gegen Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Wohl wissend um Bulgariens Verwundbarkeit, wollten Regierung und König Kriegshandlungen gegen die Westmächte vermeiden, und so hatten sie sich auch geweigert, der Sowjetunion den Krieg zu erklären. Bulgariens kleine Streitmacht unternahm nichts gegen die Alliierten; stattdessen wurde sie von den Deutschen als Besatzungstruppe in Mazedonien und Thrakien eingesetzt, Gebieten, die die Deutschen 1941 nach dem Sieg über Jugoslawien und Griechenland den Bulgaren überlassen hatten.
1943 war der Regierung und dem bulgarischen Volk klar, dass sie abermals der falschen Seite zugearbeitet hatten. Ein Großteil der Bevölkerung war antideutsch eingestellt, einige Teile sogar prosowjetisch. 1942 hatte sich eine linksgerichtete Vaterländische Front formiert, die forderte, den Krieg zu beenden und sich von Deutschland zu lösen. Kommunistische Partisanen verlangten eine engere Bindung an die Sowjetunion. Im Mai 1943 und dann noch einmal im Oktober veranlasste Filow die Kontaktaufnahme mit den Westalliierten, um Verständigungsmöglichkeiten zu sondieren. Man teilte ihm mit, dass nur eine bedingungslose Kapitulation und der Abzug aus den besetzten Gebieten akzeptiert würden.[5]
Erst vor diesem Hintergrund lässt sich die Entscheidung der Alliierten verstehen, eine Reihe von schweren Luftangriffen gegen bulgarische Städte zu fliegen. Als die alliierte Führung erkannte, dass Bulgarien, hin- und hergerissen zwischen seinem deutschen Verbündeten und der Furcht vor einem sowjetischen Sieg, zunehmend in eine Krise geriet, meinte man in den Bombenangriffen ein geeignetes politisches Mittel gefunden zu haben, um Bulgarien möglichst rasch zum Kriegsaustritt zu bewegen. Diese Strategie kennzeichnete die Haltung des britischen Premiers Winston Churchill zum Luftkrieg – er hatte sie zuvor schon im Kampf gegen Deutschland und Italien in die Tat umgesetzt. Kein Zufall also, dass es Churchill war, der am 19. Oktober 1943 in einer Lagebesprechung mit den britischen Stabschefs kundtat, seiner Ansicht nach seien die Bulgaren «ein sündiges Volk, dem eine strenge Lektion erteilt werden sollte». Ihr Fehler sei es gewesen, sich abermals auf die Seite der Deutschen zu schlagen, trotz seiner, Churchills, Bemühungen, sie zur Vernunft zu bringen. Die Bombardements seien dazu bestimmt, die Bulgaren ihrer deutschen Schutzmacht abspenstig zu machen.
Die «strenge Lektion» sollte ein schwerer Bombenangriff auf Sofia sein. Churchill rechtfertigte die Operation politisch: «Die Erfahrung zeigt», teilte er den Stabschefs mit, «dass die Bombardierung eines Landes, in dem es widerstreitende Gruppierungen gibt, nicht zu deren Einigung führt, sondern den Zorn der Antikriegspartei noch verstärkt.»[6] Einige Anwesende, unter ihnen Luftmarschall Sir Charles Portal, der Stabschef der Luftwaffe, und der Stabschef des Heeres General Alan Brooke, waren nicht ganz so tatendurstig. Sie bestanden darauf, dass mit den Bomben Flugblätter abgeworfen werden sollten, die erläuterten, dass die Alliierten von Bulgarien den Abzug seiner Besatzungstruppen und die Kapitulation verlangten. (Schließlich wurde ein Flugblatt abgeworfen, dessen seltsame Überschrift lautete: «Es geht nicht um alliierten Terror, sondern um bulgarischen Irrsinn.»[7])
Die Idee einer «strengen Lektion» machte rasch die Runde. Zwar schätzten die amerikanischen Stabschefs die militärische Bedeutung Sofias als so gering ein, dass aus ihrer Sicht ein Angriff kaum gerechtfertigt war, sie waren jedoch von der Möglichkeit eines «großen psychologischen Effekts beeindruckt».[8] Sowohl der britische als auch der amerikanische Botschafter in Ankara drängten auf einen Angriff, um den türkisch-deutschen Güterverkehr auf Schienen zu unterbrechen.[9] Am 24. Oktober beauftragten die britisch-amerikanischen Vereinigten Stabschefs den US-General Dwight D. Eisenhower, Oberbefehlshaber im Mittelmeerraum, Bulgarien eine Lektion zu erteilen, sobald es operativ möglich war.[10] Die türkische Regierung erklärte sich einverstanden, vermutlich hoffte sie, trotz ihrer Neutralität bei einer eventuellen Nachkriegsregelung von Bulgariens Niederlage profitieren zu können. Auch auf Stalins Plazet legte Churchill wert, weil Bulgarien eindeutig in der sowjetischen Interessenssphäre lag. Der britische Außenminister Anthony Eden, der sich zu Verhandlungen in Moskau aufhielt, konnte am 29. Oktober Stalins Kommentar übermitteln, Sofia solle ganz gewiss bombardiert werden, die Stadt sei nicht mehr als «eine deutsche Provinz».[11]
Die bulgarische Regierung rechnete schon seit einiger Zeit mit Bombenangriffen. Während das Regime versuchte, mit den innenpolitischen Auseinandersetzungen, der sowjetischen Präsenz im Osten und der alliierten Forderung einer bedingungslosen Kapitulation zurechtzukommen, war es gleichzeitig bestrebt, die Deutschen zu besänftigen, falls sie sich entschließen sollten, Bulgarien zu besetzen. Im Laufe des Jahres 1943 wurde die Deportation der Juden aus den besetzten Gebieten Thrakiens abgeschlossen. Trotz der Feindseligkeit des Königs konnten die deutschen Behörden in Sofia die bulgarische Regierung veranlassen, auch in Bulgarien gebürtige Juden zu deportieren. Man kam überein, dass sie zunächst in zwanzig kleine Ortschaften im Umland Sofias gebracht werden sollten. Im Mai 1943 wurden etwa sechzehntausend Juden aus der Hauptstadt verschleppt und auf acht Provinzen verteilt. Die Regierung Filow verband die Judenpolitik mit dem Bombenkrieg. Als der Schweizer Botschafter Filow bat, die Deportation thrakischer Juden nach Auschwitz aus humanitären Gründen zu beenden, erwiderte Filow, es sei wohl kaum angebracht, von Humanität zu reden, solange sich die Alliierten anschickten, Europas Städte mit Bomben aus der Luft dem Erdboden gleichzumachen. Im Februar 1943 schlug er ein Angebot der Engländer aus, 4500 jüdische Kinder von Bulgarien nach Palästina zu bringen, und fürchtete, Sofia würde zur Vergeltung bombardiert werden.[12] Nachdem die Juden aus Sofia in die Provinzen deportiert worden waren, kam in Bulgarien erneut die Angst auf, die Alliierten würden, nun von der Sorge befreit, dabei auch Juden zu töten, vor Bombenangriffen nicht länger zurückschrecken. Am Ende entgingen die bulgarischen Juden nicht nur der Deportation nach Auschwitz, sondern auch den Bombardements, die große Teile von Sofias jüdischem Viertel in Schutt und Asche legten.
Obwohl es viele Bulgaren glaubten, war es nicht die jüdische Frage, die die Alliierten im November 1943 zu ihren Bombenangriffen veranlasste. Die ersten Angriffe schienen das Vorspiel zu einem gewaltigen Strafgericht aus der Luft zu sein, und vorübergehend brach Panik unter den Bewohnern der Hauptstadt aus. Allerdings folgten auf die beiden Angriffe im November in den Monaten danach lediglich zwei planlose Einsätze. Insgesamt wurden in Sofia etwa 209 Bewohner getötet und 247 Gebäude beschädigt. Die «strenge Lektion» war den Alliierten nicht streng genug, denn sie bewog Bulgarien nicht dazu, eine politische Lösung zu suchen. Den militärischen Erfolg der Angriffe, durch mangelnde Treffsicherheit und trübes Balkanwetter beeinträchtigt, konnte man bestenfalls als begrenzt bezeichnen. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1943 schrieb Churchill an Eden, es seien «schwerstmögliche Luftangriffe» auf Sofia geplant, in der Hoffnung, sie würden ergiebigere «politische Reaktionen» hervorrufen.[13]
Am 4. Januar 1944 startete ein Großverband von 108 B-17-Flying-Fortress-Bombern in Richtung Sofia, aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse wurde der Angriff jedoch abgebrochen, nachdem einige Bomben auf eine Brücke abgeworfen worden waren. Am 10. Januar 1944 wurde schließlich der erste schwere Angriff von 141 amerikanischen B-17 geflogen, die in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar von vierundvierzig englischen Wellington-Bombern unterstützt wurden. Dieser Angriff hatte verheerende Folgen für die bulgarische Hauptstadt: Es gab 750 Tote und 710 Schwerverletzte, dazu kam es weitflächig zu Schäden an Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden. Wegen eines Stromausfalls blieben die Luftschutzsirenen stumm. Dieses Mal geriet die Bevölkerung vollends in Panik, es kam zu einer Massenflucht. Bis zum 16. Januar hatten dreihunderttausend Menschen die Hauptstadt verlassen. Die Regierung gab ihren Sitz auf und zog in nahegelegene Ortschaften. Die Versorgungsbetriebe der Hauptstadt brauchten mehr als zwei Wochen, um ihre Arbeit wiederaufzunehmen, während viele Bewohner aus Angst vor erneuten Fliegerangriffen nicht mehr in die Stadt zurückkehrten. Am 23. Januar telegraphierte der deutsche Botschafter nach Berlin, die Bombardierung habe die «psychologisch-politische Lage» vollkommen verändert, sie habe die Unfähigkeit der Behörden offenbart und die Gefahr eines bulgarischen Seitenwechsels vergrößert.[14] Die Regierung in Bulgarien ordnete an, im Falle künftiger Stromausfälle bei Fliegeralarm die Kirchenglocken zu läuten.
Der große Angriff am 10. Januar zahlte sich politisch aus. Während Filow erfolglos versuchte, den zu Besuch weilenden deutschen General Walter Warlimont, den Stellvertretenden Chef des Wehrmachtsführungsstabs im Oberkommando der Wehrmacht (OKW), zu einem Vergeltungsangriff auf das neutrale Istanbul zu überreden – dessen Folgen durchaus noch katastrophaler für Bulgarien hätten ausfallen können –, waren die meisten bulgarischen Politiker zu der Einsicht gelangt, dass sie die Verbindung mit den Deutschen so rasch wie möglich beenden und ein Abkommen mit den Alliierten schließen mussten.[15] Der Bischof von Sofia nahm die Beerdigung der Bombenopfer zum Anlass, der Regierung vorzuwerfen, dass sie Bulgarien an Deutschland binde, statt die Menschen vor dem Krieg zu bewahren. Noch im gleichen Monat bat man die Sowjetunion, sich bei den Westalliierten für eine Beendigung der Fliegerangriffe einzusetzen, Moskau jedoch erhöhte nur seinen Druck auf Bulgarien, die Unterstützung der Achse aufzugeben.[16]
Im Februar stellte man über einen bulgarischen Mittelsmann in Istanbul erste Kontakte zu den Alliierten her, um festzustellen, unter welchen Bedingungen man sich auf einen Waffenstillstand würde einigen können. Obwohl die Hoffnung auf Verhandlungen auf Seiten der Alliierten der Hauptgrund für den Beginn der Bombardierung war, fiel die erste Reaktion nicht unbedingt positiv aus. Roosevelt schlug Churchill in einem Schreiben vom 9. Februar vor, die Fliegerangriffe auszusetzen, falls sich die Bulgaren gesprächsbereit zeigten – eine Haltung, die von den Diplomaten des britischen Nahost-Hauptquartiers in Kairo geteilt wurde.[17] «Warum?», kritzelte Churchill an den Rand des Briefs.[18] In seiner Antwort vom 12. Februar schrieb er Roosevelt, dass die Bombardierung seiner Meinung nach «genau die von uns erhoffte Wirkung» hervorgerufen habe und die Bombenangriffe fortgesetzt werden müssten, bis die Bulgaren sich zu offiziellen Verhandlungen bereit erklärten: «Wenn die Arznei gewirkt hat, sollen sie noch mehr davon haben.»[19] Umgehend kabelte Roosevelt sein volles Einverständnis zurück: «Lasst sie weiterwirken.»[20]
Einige Hinweise, die aus Bulgarien eintrafen, schienen Churchills Ansicht zu bestätigen. Die Nachrichtendienste berichteten von der raschen Ausweitung sowohl der kommunistischen Partisanenbewegung als auch der Vaterländischen Front. Über einen britischen Verbindungsoffizier, der in Bulgarien stationiert war, nahmen die Partisanen mit den Alliierten Verbindung auf und ermutigten sie, die Fliegerangriffe fortzusetzen, um den Zusammenbruch des deutschlandfreundlichen Regimes zu erzwingen und dem Widerstand weitere Unterstützung zu verschaffen. Sie verlangten allerdings auch, dass die Arbeiterviertel verschont blieben. Im März wurden die Partisanen schließlich von den Kommunisten in die Nationalrevolutionäre Befreiungsarmee eingegliedert.[21] Aufgrund dieser Hinweise machten sich die Westalliierten – mit Stalins verdeckter Billigung (die Sowjetunion wollte nicht, dass die Bulgaren von ihrer Unterstützung des Bombardements erfuhren) – Edens Auffassung zu eigen, dass man den bulgarischen Städten nur «die Hölle heißmachen» müsse, um binnen kurzem einen Staatsstreich zu provozieren oder die Regierung an den Verhandlungstisch zu bomben.[22] Sir Charles Portal berichtete Churchill am 10. März von seinem Befehl, sobald wie möglich schwere Bombenangriffe gegen Sofia und andere bulgarische Großstädte zu fliegen.[23]
Am 16. und dann am 29./30. März führten die Alliierten die schwersten Bombardements auf Sofia durch, dazu unterstützende Angriffe auf Burgas, Warna und das im Binnenland gelegene Plowdiw. Der Schienenverkehr und der türkische Überseehandel mit Deutschland sollten damit zum Erliegen gebracht werden. Die Angriffe konzentrierten sich vor allem auf das Regierungs- und Verwaltungszentrum Sofias, wobei auch viertausend Brandbomben zum Einsatz kamen, mit denen man das erreichen wollte, was in Deutschland so gut gelungen war. Beim Angriff vom 16. März brannte der Königspalast nieder; das schwere Bombardement vom 29./30. März durch 367 B-17- und B-24-Bomber, dieses Mal unter Einsatz von dreißigtausend Brandbomben, löste einen großflächigen Feuersturm aus, der den Sitz des Heiligen Synods der orthodoxen Kirche Bulgariens, das Nationaltheater, mehrere Ministerien und weitere 3575 Gebäude zerstörte, aber «nur» 139 der in der Stadt verbliebenen Einwohner tötete.[24] Der letzte Großangriff vom 17. April, an dem 350 amerikanische Bomber beteiligt waren, zerstörte weitere 750 Gebäude und richtete große Schäden am Rangierbahnhof an.
1944 starben in Sofia 1165 Menschen unter den Bomben – eine Zahl, die ohne die freiwillige Evakuierung der Stadt wohl erheblich größer ausgefallen wäre. Der Einsatz der Brandbomben beschleunigte den Zerfall des bulgarischen Regimes und verstärkte die Unterstützung der Sowjetunion, deren Armeen schon in Schussweite standen. Doch erst am 20. Juni 1944, etliche Monate nach den Bombenangriffen, nahm die neue Regierung unter Iwan Bagrjanow formelle Verhandlungen auf, um aus dem Krieg auszuscheiden. Man hatte immer noch die Hoffnung, die territoriale Beute behalten und eine alliierte Besetzung des Landes verhindern zu können.[25] Inzwischen hatten die Alliierten allerdings jedes Interesse verloren, Bulgarien weiter zu bombardieren, da die Bomber ihre Aufmerksamkeit bereits auf die in Marschrichtung der näher rückenden Roten Armee liegenden Städte Budapest und Bukarest richteten.[26]
Im Sommer 1944 hatten die Alliierten ganz andere Sorgen, und es schien klar, dass die bulgarische Politik durch die Bombardierungen hinreichend destabilisiert und eine Fortführung der Angriffe überflüssig war. Trotzdem fiel das abschließende Urteil über die Wirkung der Fliegerangriffe zwiespältig aus. Im Juli kamen die Stabschefs der USA in einer Bewertung des Balkan-Bombardements zu dem Schluss, dass der erwünschte psychologische Effekt weitgehend eingetreten sei; trotzdem vermerkte der Bericht, der Feind habe in einer erfolgreichen Propagandakampagne die hohen Verluste in der Zivilbevölkerung angeprangert und dadurch dem Ansehen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens beim bulgarischen Volk erheblichen Schaden zugefügt. Die Stabschefs ordneten an, künftige Angriffe in der Region auf «Ziele von eindeutig militärischer Bedeutung» zu beschränken und zivile Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die britischen Stabschefs wiesen die amerikanischen Ansichten zurück und behaupteten wider besseres Wissen, es seien nur militärische Ziele angegriffen worden, auch wenn es dabei zu Schäden an Wohngebäuden gekommen sei und es zivile Opfer gegeben habe. Ihr Bericht endete mit der Forderung, die alliierten Bomber müssten immer in der Lage sein, auf diese Weise vorzugehen, ihre Operationen dürften «nicht durch unangebrachte Rücksichtnahme auf das mögliche Ausmaß an zufälligen Opfern beeinträchtigt werden».[27] Diese Auffassung entsprach all dem, was die RAF seit 1941, seit dem Übergang zur vorsätzlichen Bombardierung deutscher Zivilisten, vertreten und praktiziert hatte.
Für den Historiker ist die Bewertung komplizierter. Beinahe sicher lässt sich sagen, dass die Bombardements jeden prodeutschen Konsens in der Bevölkerung beseitigten und sowohl die gemäßigte linke Mitte der Vaterländischen Front als auch die radikale Partisanenbewegung stärkten. Zu einem vollständigen Regierungswechsel führte das jedoch erst am 9. September 1944, als die Sowjets die Vaterländische Front eine Regierung bilden ließen, die von der bulgarischen Kommunistischen Partei beherrscht wurde – im Übrigen ein politisches Ergebnis, das weder Churchill noch Eden mit der Bombardierung bezweckt hatten.[28] Außerdem spielten für Bulgarien auch andere Faktoren eine wichtige Rolle: die durch die Niederlage und Kapitulation der Italiener im September 1943 ausgelöste Krise; der deutsche Rückzug in der Sowjetunion; die Furcht vor einer möglichen alliierten Balkaninvasion oder einer türkischen Intervention.[29] Während Churchill Bombenangriffe für ein einfaches Instrument hielt, um eine politische Krise herbeizuführen, und von Oktober 1943 bis März 1944 darauf beharrte, dass man Bulgarien damit zum Kriegsaustritt zwingen könne, hielten die amerikanischen Militärführer die Bombardierung Italiens und Deutschlands nach wie vor für wichtiger und den Nutzen eines Vorgehens gegen Bulgarien für nicht gesichert. Ihrer Ansicht nach sollten Fliegerangriffe einer anderen Strategie folgen: Man wollte die militärische Schlagkraft Deutschlands schwächen, indem man den Nachschub an entscheidendem Kriegsmaterial unterband und die deutschen Truppen von der unmittelbar bevorstehenden Landung in der Normandie ablenkte. Die Bombardierungen hatten aber auch für die Amerikaner ihren Preis. Man ging von 175 amerikanischen Gefallenen auf bulgarischem Staatsgebiet aus, obwohl nur 84 Leichen gefunden werden konnten.[30]
Die Bombardierung Bulgariens wies im Kleinen beinahe alle Probleme auf, die für die umfangreicheren Bomberoffensiven des Zweiten Weltkriegs charakteristisch waren. Sie kann als ein klassisches Beispiel für «strategisches Bombardieren» gelten. Der Begriff lässt sich nur ungenau definieren. Geprägt wurde er im Ersten Weltkrieg, als alliierte Offiziere versuchten, die Langstreckeneinsätze zu beschreiben, die gegen weit entfernte Ziele hinter den feindlichen Linien geflogen wurden. Diese Operationen wurden unabhängig vom Landkrieg durchgeführt, auch wenn sie den Feind schwächen und zum Erfolg der Kämpfe auf dem Boden beitragen sollten. Der Ausdruck «strategisch» wurde von den britischen und amerikanischen Fliegern benutzt, um den Abnutzungsangriff auf die feindliche Heimatfront und Volkswirtschaft von dem direkten Angriff auf die feindlichen Streitkräfte zu unterscheiden.
Außerdem sollte der Begriff unabhängige Bomberoperationen von direkten Unterstützungsangriffen für Heer und Marine abheben. In Deutschland und Frankreich stand in der Zwischenkriegszeit «strategischer» Luftkrieg für den Bombereinsatz gegen militärische und volkswirtschaftliche Ziele, die, mehrere hundert Kilometer von der Hauptkampflinie entfernt, der unmittelbaren Unterstützung des feindlichen Landkriegs dienten. Deutsche und französische Militärführer hielten Bombenangriffe gegen weit entfernte Ziele ohne direkten Zusammenhang mit den Erdkämpfen für eine Ressourcenverschwendung. Die deutschen Bombardierungen von Warschau, Belgrad, Rotterdam und zahlreichen sowjetischen Städten entsprechen dieser engeren Definition des strategischen Bombardements. Im Laufe des Zweiten Weltkriegs verlor die Unterscheidung zwischen dem begrenzteren Konzept des strategischen Luftkriegs und den unabhängigen Fernbomberangriffen zunehmend an Trennschärfe; Operationen gegen weit entfernte militärische, wirtschaftliche oder unspezifisch städtische Ziele wurden von Bombern durchgeführt, die man wahlweise auch zur direkten Unterstützung der kämpfenden Truppe einsetzte. So bombardierten die Maschinen der amerikanischen Luftwaffe (United States Army Air Forces, USAAF) im Februar 1944 das italienische Kloster Monte Cassino, um die deutsche Front zu durchbrechen, sie flogen aber auch Angriffe gegen Rom, Florenz und Städte in Norditalien, um eine politische Krise auszulösen, das Wirtschaftspotenzial der Achsenmächte zu schwächen und die militärischen Nachschublinien zu sprengen. Die deutsche Bombardierung britischer Ziele im Sommer und Herbst 1940 sollte die Invasion Englands im September vorbereiten und war damit strategisch in der engeren – deutschen – Bedeutung des Begriffs. Mit dem «Blitz» – so die englische Bezeichnung für die deutschen Bombenangriffe auf englische Städte von September 1940 bis Juni 1941 in Anlehnung an den Ausdruck «Blitzkrieg» – nahm der Luftkrieg jedoch eher den Charakter einer strategischen Offensive im eigentlichen Sinn an: Er hatte die Aufgabe, die britische Kriegswilligkeit und Kriegsfähigkeit zu treffen – und das ohne die Unterstützung deutscher Erdkampftruppen. Der Bevölkerung in Italien oder England oder anderswo konnte es allerdings völlig gleich sein, ob sie strategisch bombardiert wurde oder nicht, die verheerende Wirkung auf dem Erdboden blieb die gleiche: eine große Zahl an Toten und Schwerverwundeten, großflächige Zerstörung der Stadtlandschaft, Ausfall lebenswichtiger Versorgungsbetriebe und willkürliche Vernichtung von Kulturschätzen.
Im vorliegenden Buch wird keine trennscharfe Linie zwischen verschiedenen Formen des strategischen Luftkriegs gezogen, das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Bombenkrieg oder den Operationen, die als unabhängig von den Kampfhandlungen zu Land oder zu Wasser anzusehen sind. Solche Operationen unterschieden sich von den taktischen Angriffen der Bomber oder Jagdbomber auf bewegliche Gefechtsfeldziele, örtliche Truppenkonzentrationen, Nachschublinien, Treibstoffdepots, Ersatzteillager oder die Handelsschifffahrt – all das ging streng genommen auf das Konto der unmittelbaren Kampfunterstützung. Dank dieser Definition ist es möglich, unter «strategisch» auch solche Operationen einzuordnen, die zwar dazu bestimmt waren, den Vormarsch des Heeres zu beschleunigen, jedoch losgelöst und häufig in beträchtlicher Entfernung vom eigentlichen Gefechtsfeld stattfanden – so wie in Italien, in der Sowjetunion oder beim Luftangriff auf Malta. Den Kern jeder Geschichte des Bombenkriegs bilden dagegen die großen, unabhängigen Bombereinsätze, deren Ziel es war, der Heimatfront des Feindes schwere Schäden zuzufügen und einen politischen Zusammenbruch herbeizuführen. Allen strategischen Großeinsätzen – Deutschland gegen Großbritannien 1940 bis 1941, Großbritannien und die Vereinigten Staaten gegen Deutschland und das von Deutschland besetzte Europa 1940 bis 1945, Großbritannien und die Vereinigten Staaten gegen Italien 1942 bis 1945 – lag die implizite Vorstellung zugrunde, dass die Bombenangriffe allein die Kriegsanstrengungen des Feindes zunichtemachen, die Bevölkerung demoralisieren und Politiker vielleicht sogar zur Kapitulation veranlassen könnten, ohne dass gefährliche, groß angelegte und möglicherweise verlustreiche amphibische Operationen durchgeführt werden mussten. Diese Erwartungen sind für die Geschichte des Bombenkriegs ein wesentliches Element.
Die politischen Zwänge lassen sich anhand des kurzen Luftangriffs auf Bulgarien gut verdeutlichen. Die heute sogenannte «politische Dividende» ist eine Dimension des Bombenkriegs, die in Analysen oft hinter die rein militärische Bewertung, also die Frage, inwieweit die Bombardierungen die Einsatzmöglichkeiten und die Kriegswirtschaft des Feindes beeinträchtigten, zurückgestellt wird. Es lassen sich aber zwischen 1939 und 1945 viele Beispiele für Bombereinsätze und -operationen finden, die nicht nur aus militärischen Erwägungen durchgeführt wurden, sondern auch ein oder mehrere politische Ziele erreichen sollten. Die frühen Bombenangriffe der Royal Air Force in den Jahren 1940 und 1941 hatten, ungeachtet ihrer militärischen Unwirksamkeit, unter anderem die Aufgabe, den Krieg in die deutsche Bevölkerung zurückzutragen und eine soziale und politische Krise an der Heimatfront auszulösen. Zudem sollten sie die besetzten Staaten Europas beeindrucken und ihnen zeigen, dass Großbritannien entschlossen war, den Krieg fortzusetzen. Der Öffentlichkeit in Amerika wollte man vor Augen führen, dass der demokratische Widerstand noch lebendig und ungebrochen war. Die RAF sah ihre Chance gekommen, die Unabhängigkeit der Luftwaffe von Heer und Marine zu beweisen und eine eigene strategische Nische zu besetzen. Für die britische Öffentlichkeit stellten die Luftangriffe während des schwierigen Jahres nach der Niederlage im Frankreichfeldzug eines der wenigen sichtbaren Mittel dar, mit denen man dem Feind zusetzen konnte. «Unsere wunderbare RAF hat dem Ruhrgebiet ein schreckliches Bombardement verabreicht», schrieb eine Hausfrau aus Mittelengland in ihr Tagebuch. «Aber man denkt auch an die Elternhäuser dieser Männer und daran, was es für ihre Familien bedeutet!»[31]
Das politische Element der Bombardierungen verdankte sich zum Teil der unmittelbaren Beteiligung von Politikern an den Entscheidungen über den Luftkrieg. Bulgarien zu bombardieren war Churchills Idee. Er vertrat, wie bereits erwähnt, entschieden die Auffassung, dass Luftangriffe eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit boten, den Gegner zu einem Seitenwechsel zu zwingen. Im Dezember 1943, als die Befehlshaber an der Mittelmeerfront den Einsatz wegen schlechten Wetters hinausschoben, kritzelte ein gereizter Churchill unter das Telegramm: «Tut mir leid, dass das Wetter so ungünstig ist. Das politische Moment könnte sich verflüchtigen.» Drei Monate später, als die bulgarische Regierung erste Fühler ausstreckte, schrieb Churchill: «Bombardiert sie jetzt mit aller Kraft», wobei er «jetzt» dreimal unterstrich.[32] Der Einsatz auf dem Balkan zeigte auch, wie beiläufig Politiker Operationen beschließen konnten, deren Folgen für sie angesichts ihrer begrenzten Strategie- und Taktikkenntnisse kaum absehbar waren. Der Versuchung, Luftangriffe anzuordnen, wenn keine anderen gewaltsamen Druckmittel zur Verfügung standen, war schwer zu widerstehen. Sie hatten den Vorzug, flexibel, weniger kostspielig als andere militärische Optionen und für die Öffentlichkeit sehr gut wahrnehmbar zu sein – ganz ähnlich wie der Einsatz des Kanonenboots in der Diplomatie des 19. Jahrhunderts. Die politische Mitbestimmung über Bombereinsätze war während des Krieges an der Tagesordnung und gipfelte schließlich in der Entscheidung, im August 1945 die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen. Dieser beinahe letzte Akt des Bombenkriegs hat eine bis zum heutigen Tag anhaltende Debatte über die Balance zwischen politischen und militärischen Erwägungen ausgelöst, diskutieren ließe sich diese Frage aber genauso gut innerhalb anderer Zusammenhänge der Kriegszeit. Als man die Auswirkungen der Bombenangriffe auf Bulgarien und andere Balkanstaaten bewertete, stieß man auf einen einzigartigen gemeinsamen Vorzug: «Sie führen den betroffenen Völkern vor Augen, dass der Krieg von den Vereinten Nationen zu ihnen zurückgetragen wird.»[33] In diesem Sinne ist die Instrumentalisierung der Luftmacht als strategisches Ziel, in jüngerer Zeit unmissverständlich als Strategie von «Shock and Awe» (Schock und Ehrfurcht) bezeichnet, erstmals in den neunziger Jahren an der United States National Defense University formuliert und 2003 eindrucksvoll in Bagdad und anderen irakischen Städten zur Geltung gebracht worden. Ein solcher Einsatz der Luftmacht folgt dem während des Zweiten Weltkriegs entwickelten Muster der «politischen» Bombardierung.
Bombardements waren natürlich weit mehr als nur ein bequem handhabbares politisches Instrument. Im Folgenden werden daher auch die Organisation, die Truppen und die Technologie, die Bomberoperationen möglich machten, beschrieben. Strategisches Bombardieren musste ganz anders organisiert werden als die Kampfhandlungen des Heeres oder der Marine und war aufgrund der technischen Gegebenheiten der Zeit mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet. Die Luftwaffenbefehlshaber wollten liefern, was die Politiker wünschten, versuchten genau aus diesem Grund aber immer, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Alle großen Luftstreitkräfte durchliefen im Krieg eine lange Lehrzeit, stets auf der Suche nach Mitteln und Wegen, um eine ganze Reihe von Problemen und Grenzen zu überwinden. Die Angriffe galten in der Regel weit entfernten Städten oder Industrieeinrichtungen, was in den meisten Fällen lange und gefährliche Flüge erforderte, die sich angesichts von unbeständigem Wetter, der feindlichen Flugabwehr und der unzureichenden Technik für Navigation und Bombenzielwurf schwierig gestalteten. Feste Standorte mussten nahegelegen vorhanden sein, damit die Bombardements erfolgen konnten. Die Verlustrate der Besatzungen war hoch, wenn auch nicht außergewöhnlich, vergleicht man sie mit denen anderer Fronttruppen.
Das besondere Unterscheidungsmerkmal der Bombereinsätze war die Fähigkeit der Flugzeuge, in den feindlichen Luftraum einzudringen, um von dort je nach Auftrag der Wirtschaft, den militärischen Einrichtungen oder der Bevölkerung des Feindes Schaden zuzufügen. Keine andere Teilstreitkraft konnte ihre Zerstörungsmacht über solche Distanz entfalten, und so wurde der Bomber automatisch zur wichtigsten Waffe jener Form des Krieges, die man damals als «totalen Krieg» bezeichnete. Dass der moderne, industrialisierte Krieg zwischen ganzen Gesellschaften auszutragen sei, wobei jede für sich die Energie und die Willenskraft der ganzen Bevölkerung für den Kampf, die Bewaffnung und die Versorgung der Massenheere mobilisieren müsse, war die feste Überzeugung der Generation, die nach dem Ersten Weltkrieg aufwuchs. Während in den Luftwaffen grundsätzlich Einigkeit darüber herrschte, dass die Bombardierung der feindlichen Bevölkerung zur Verbreitung von Angst und Schrecken mit den tradierten Dienstvorschriften unvereinbar war, ließen sich die Bombardierung und Tötung von Rüstungsarbeitern, die Zerstörung von Hafenanlagen oder sogar das Niederbrennen der Ernte relativ leicht als legitime Ziele des totalen Krieges auffassen.
Vor Beginn des Zweiten Weltkriegs mussten die Luftwaffen, die sich mit den Einzelheiten eines Krieges gegen die feindliche Heimatfront beschäftigten, eine Reihe von strategisch sinnvollen Zielen bestimmen. Dazu gehörten militärische Einrichtungen, Schwerindustrie, Energieversorgung, Waffenproduktion sowie Verkehrs- und Fernmeldeverbindungen. Die deutschen Einsätze gegen Großbritannien beruhten auf einem genauen Ortsverzeichnis mit industriellen und militärischen Zielen, das vor 1939 mit Hilfe von Fotoaufklärung und Industriespionage zusammengestellt worden war.[34] Im Sommer 1941 hatte die amerikanische Luftwaffe einen Plan zur Bombardierung Deutschlands mit sechs Schlüsselzielkomplexen und insgesamt 154 industriellen Einzelzielen erarbeitet, deren Zerstörung zum Zusammenbruch der deutschen Kriegswirtschaft und der zu ihrer Unterstützung tätigen Dienstleistungseinrichtungen führen sollte.[35] Luftwaffenbefehlshabern widerstrebte es, Operationen zu befürworten, die keine eindeutig militärischen oder wirtschaftlichen Absichten erkennen ließen, ganz gleich, wie weit der totale Krieg auch ausgreifen oder wie stark der politische Druck sein mochte. Selbst im Fall Bulgariens milderte man Churchills knappe politische Anweisung ab, als man sie der militärischen Führung übermittelte, um eine fadenscheinige militärische Rechtfertigung zu geben: «Sofia ist das Verwaltungszentrum einer kriegführenden Regierung, ein wichtiges Eisenbahnzentrum, eine Stadt mit Kasernen, Arsenalen und Rangierbahnhöfen.»[36] Das Widerstreben der Luftwaffenbefehlshaber, die Bombardierung umgehend mit der von Churchill geforderten Konsequenz durchzuführen, ließ erkennen, dass der Angriff ihrer Meinung nach ohne großen praktischen Nutzen war, während beispielsweise Luftangriffe gegen rumänische Ölreserven oder die Wiener Flugzeugindustrie erhebliche Wirkung hätten erzielen können.
Der kurze Feldzug gegen Bulgarien offenbarte die Spannung zwischen den überhöhten Erwartungen, die Politiker und Öffentlichkeit hinsichtlich der politischen und psychologischen Ergebnisse der Luftangriffe hegten, und ihren nachweisbaren Erfolgen in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Diese Unklarheit bestimmte viele allgemeinere Auseinandersetzungen, die während des Krieges von Politikern, Fliegern und höchsten Militärs über die Frage geführt wurden, was die Bombardierung leisten konnte und was nicht. Jene Auseinandersetzungen erklären auch ein charakteristisches Merkmal aller Bombereinsätze: das stetig zunehmende Maß unterschiedsloser Zerstörung. Unter den vielen Fragen, die die militärische Durchführung der Einsätze aufwirft, ist die nach der Eskalation und ihren Konsequenzen sicherlich am wichtigsten. Sie hat erhebliche Bedeutung für die Praxis der Luftangriffe in den Kriegen des 21. Jahrhunderts.
Für die Gesellschaften, die während des Krieges die Bombardements erlitten, gab es nur eine Realität von Belang: «Der Bomber kommt immer durch.» Diese berühmte Bemerkung des britischen Stellvertretenden Premierministers Stanley Baldwin am Vorabend seiner Abreise nach Genf zu den Abrüstungsgesprächen im November 1932 – der Mann auf der Straße müsse wissen, dass es keine Macht auf Erden gebe, die ihn vor Bombenangriffen schützen könne – wurde gewöhnlich als Übertreibung mit der Absicht gewertet, die Delegierten in Genf so zu erschrecken, dass sie für die Ächtung von Bombenflugzeugen stimmten. Doch obwohl es sich während des Krieges als möglich erwies, Flugzeuge mittels Radar aufzuspüren, sie bei Tag und zunehmend auch bei Nacht abzufangen und dem angreifenden Verband hohe Verluste zuzufügen, hatte Baldwin, auf den Zweiten Weltkrieg bezogen, recht. Die meisten Bomber erreichten das erweiterte Zielgebiet, warfen ihre Bomben mit begrenzter Genauigkeit ab und verwandelten in gewisser Weise die Zivilbevölkerung in eine richtige Kampffront.
Dass es so kommen würde, hatte man in den dreißiger Jahren in den großen Staaten der ganzen Welt erwartet. Man hatte eine fatalistische Einstellung zum Bombenkrieg und ging davon aus, dass er künftige Konflikte bestimmen werde. Im Juli 1934 schrieb der britische Luftfahrtminister Lord Londonderry an Baldwin: «Zu glauben, man könne irgendeinen Krieg ohne größere Gefahr für die Zivilbevölkerung führen, ist absoluter Wahnsinn.»[37] Aufgewachsen mit einer Flut von schaurigen Romanen und Filmen und in den dreißiger Jahren regelmäßig Übungen, Unterweisungen und Propaganda zum Luftschutz ausgesetzt, rechnete die Zivilbevölkerung selbstverständlich damit, zum Ziel von Luftangriffen zu werden. Zudem meinte sie sogar, es gebe ein gewisses Maß an demokratischer Legitimation für den Bombeneinsatz, wenn alle modernen Massengesellschaften für den Bombenkrieg mobilisiert werden müssten. 1940, während der schlimmsten Phase des «Blitz», schrieb die britische Pazifistin Vera Brittain, es habe sich im Ersten Weltkrieg eine «Mauer aus unvorstellbaren Erfahrungen» zwischen den Soldaten der Westfront und den Zivilisten zu Hause in Großbritannien aufgebaut. Im gegenwärtigen Konflikt, so fuhr sie fort, «sind Leiden und Bangen auch in England selbst allgegenwärtig […]. Es gibt keine emotionale Barriere mehr zwischen Männern und Frauen, Eltern und Kindern, Alten und Jungen, da alle Altersgruppen und beide Geschlechter an der Schlacht teilnehmen».[38]
Die Vorstellung von einer Zivilgesellschaft, in erster Linie einer städtischen Gesellschaft, als neuer Kriegsfront war in Wirklichkeit ein neues, ja einzigartiges Phänomen der Moderne. Sie verlieh dem strategischen Bombenkrieg eine zweite politische Dimension, weil es nun galt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die politische Loyalität angesichts extremer militärischer Gewalt gegen die Heimatfront aufrechtzuerhalten. Eine positive «Moral» zu bewahren wurde zu einem zentralen Anliegen jener Staaten, die Luftangriffen ausgesetzt waren. Herrschende und Beherrschte waren gleichermaßen der Ansicht, dass sich Bombenangriffe in besonderer Weise auf die Kriegswilligkeit und die psychische Verfassung der Bevölkerung auswirkten, entsprechend wurde dieser Aspekt in den Berichten der Inlandsnachrichtendienste über die öffentliche Stimmung in Großbritannien, Deutschland, Italien und Japan regelmäßig hervorgehoben. Jene Staaten, die für die Bombardements verantwortlich waren, versuchten, möglichst genau abzuschätzen, wie sich ihre Angriffe auf die psychische Verfassung der betroffenen Bevölkerung auswirkten, aber meist waren die Ergebnisse widersprüchlich oder verwirrend. Es steht außer Zweifel, dass die Erfahrung der Bombardements für viele Menschen äußerst demoralisierend war, obwohl das Erleben auch jähe Momente der Erheiterung oder tiefe Apathie hervorrufen konnte. Die Schwierigkeit jedoch, eindeutige Kausalverbindungen zwischen der Bombardierung und den Reaktionen der Betroffenen herzustellen, rührte einfach daher, dass die Reaktionen ebenso vielfältig, unregelmäßig und unvorhersehbar ausfielen wie überhaupt das Verhalten der Gesellschaft, in der sie zu beobachten waren.
Eine der entscheidenden Fragen lautet, warum die bombardierten Gesellschaften nicht augenblicklich unter der Wirkung der Angriffe zusammengebrochen sind, wie es vor 1939 allgemein erwartet wurde. Dabei darf man es sich nicht zu leicht machen. Die Bombardierung bedeutete eine enorme Belastung für die lokalen Gemeinwesen, und es kam in einigen Fällen zu langsamen oder temporären Zusammenbrüchen, aber es war stets ein langer Weg von einer lokalen sozialen Krise bis zum vollständigen Erliegen der Kriegsanstrengungen. Die Erklärung, warum die «Moral» in Großbritannien oder Deutschland keinen Zusammenbruch im Sinne eines politischen Aufstands erlebte, hängt an komplizierten Fragen des sozialen Zusammenhalts, wobei regionale Unterschiede, die Intensität der Bombenerfahrung, die Natur des jeweiligen Staates und der lokalen Verwaltung, die besonderen Strukturen der örtlichen Gesellschaft und die kulturelle Wirkung der Propaganda eine Rolle spielen. Jede Darstellung des Bombenkriegs muss sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte ebenso einbeziehen wie die herkömmliche militärische Realität: den Blick von oben mit dem Blick von unten verbinden. Dieser doppelte Ansatz wurde in den bisherigen Darstellungen des Bombenkriegs nur selten gewählt, aber er ist der einzig sichere Weg, um zu beurteilen, wie sich die Bombardements tatsächlich auf die Zielbevölkerung auswirkten, und um treffende Vermutungen über ihre Wirksamkeit in künftigen Kriegen anstellen zu können.
Die Geschichte der «zivilen Front» im Luftkrieg ist die Geschichte einer Zerstörung von außerordentlichen Ausmaßen: geschätzte sechshunderttausend Tote, ebenso viele Schwerversehrte, Millionen Leichtverwundete; Millionen Ausgebombte; fünfzig bis sechzig Prozent der deutschen Stadtflächen ausradiert; zahllose Kulturdenkmäler und Kunstwerke unwiderruflich verloren. Nur wenn man diese Schäden und Verluste in Rechnung stellt, lässt sich der Bombenkrieg wirklich verstehen. Diejenigen, die zu Tode kamen, waren keine Unbeteiligten, die zufällig getroffen worden waren, sondern Opfer einer Technik, die generell unfähig war, Unterschiede zu machen und kleine, individuelle Ziele zu treffen – einer Technik, von der alle Seiten wussten, dass sie beim damaligen Stand der Wissenschaft dazu nicht in der Lage war. Das wirft eine Reihe von Fragen auf: Warum nahmen die beteiligten Staaten nie Abstand von Einsätzen, die so vielen Zivilisten das Leben kosteten? Und warum entschlossen sich am Ende ausgerechnet Großbritannien und die Vereinigten Staaten – liberale Demokratien, die während des Krieges selbstgerecht moralische Überlegenheit für sich reklamierten und vor 1939 alle Bombardements verurteilt hatten –, strategische Bombereinsätze durchzuführen, die in Europa und Asien rund eine Million Menschenleben forderten? Siebzig Jahre später scheinen diese Fragen naheliegend, aber sie lassen sich nur dann richtig beantworten, wenn wir die Bedingungen verstehen, unter denen die moralischen Imperative des Krieges damals wahrgenommen wurden. Der Angriff auf Zivilisten lässt darauf schließen, dass neue Normen der Kriegführung weitgehend akzeptiert wurden, sogar von den Opfern der Bombenangriffe; was 1939 noch rechtlich oder moralisch inakzeptabel erschien, wurde rasch im Rahmen der relativen Ethik von Überleben oder Niederlage revidiert.[39]
Es ist leicht, Verluste zu beklagen und die Strategie, die sie hervorgerufen hat, als unmoralisch oder illegitim zu verurteilen – dieses Vorgehen zeichnet zahlreiche jüngere Darstellungen des Bombenkriegs aus. Unsere heutigen ethischen Bedenken bringen uns jedoch keinen Schritt voran, wenn wir begreifen wollen, wie all diese Dinge möglich waren und wie es kam, dass sie sogar begrüßt wurden; warum sich so wenige Stimmen erhoben, um gegen die Vorstellung zu protestieren, die Heimatfront sei ein legitimes Ziel für Bombenangriffe.[40] Damals war die ethische Auffassung des Bombenkriegs keineswegs klar, sondern häufig widersprüchlich. Auffällig ist beispielsweise, dass unter denen, die bombardiert wurden, selten ein konkreter und dauerhafter Hass auf den Feind vorherrschte; verbreitet war eher das Gefühl, «der Krieg» selbst, vor allem «der moderne Krieg», sei schuld, als führe er eine Art Eigenleben, unabhängig von den Bomberflotten, die das Unheil anrichteten. Zum Teil empfand man die Bombardements auch als erforderlich, um die Welt von den Kräften zu reinigen, die die Barbarei entfesselt hatten – in dieser Sicht waren sie ebenso Segen wie Fluch. Ein junger deutscher Soldat, der Anfang 1945 in Italien gefangen genommen worden war, erklärte während seines Verhörs: «Auf lange Sicht könnten eure Bombardements Deutschland guttun. Sie haben dem Land einen Vorgeschmack gegeben, mag er auch noch so bitter sein, wie der Krieg wirklich ist.»[41]
Die moralische Reaktion auf das Bombardieren und Bombardiertwerden ist historisch komplex und manchmal überraschend. Was vor dem Krieg und heute schwarz-weiß erscheint, wies währenddessen viele Grauschattierungen auf. Dennoch sind die Zahl der Toten und Verwundeten sowie das Ausmaß der Zerstörungen schockierend, genauso wie andere Formen der Massentötung von Zivilisten im Zweiten Weltkrieg. Die Bombardierung und ihre Folgen hätten die Öffentlichkeit in den dreißiger Jahren nicht weniger empört, als sie heute von Historikern und Völkerrechtlern angeprangert werden.[42] Die Klärung der Frage, wie es möglich war, dieses Maß der Vernichtung in der kurzen Spanne des totalen Krieges zwischen 1940 und 1945 zu legitimieren, bildet das vierte und vielleicht wichtigste Element des vorliegenden Buchs, neben dem politischen Kontext, der prägend war für die Entwicklung des Luftkriegs, den militärischen Operationen, die seinen Charakter und seinen Umfang bestimmten, und den sozialen und kulturellen Reaktionen, die die Grenzen dessen festlegten, was mit einem Bombardement tatsächlich zu erreichen war.
1. Bombenangriffe vor 1940: Fiktion und Wirklichkeit
1938 untersuchte der amerikanische Architekturtheoretiker Lewis Mumford, bekannt für ungeschminkte Beschreibungen der modernen Metropole, in seinem Buch «The Culture of Cities» den Aufstieg und Fall der «Megalopolis», wie er sie nannte. Er beschrieb die Megalopolis als eine «Eiterbeule aus vulgärer Anmaßung und Kraftmeierei», eine Riesenstadt, in der die Zivilisation im Laufe der Jahre brüchiger und unsicherer werde, bis zu dem Tag, an dem Luftschutzsirenen heulen: «Schrecken, die schlimmer und demoralisierender sind als alles, was unsere Vorfahren in den urzeitlichen Dschungeln oder Höhlen erlebten, suchen das moderne städtische Dasein heim. Keuchend, würgend, hustend, kriechend, hassend stirbt der Bewohner der Megalopolis, die Katastrophe vorausahnend, tausend Tode.» Ein menschliches, zivilisiertes Leben sei im Bombenkrieg nicht mehr möglich. Am Ende der Zerstörung warte die Stadt der Toten, «Nekropolis», «ein Grab für die Sterbenden […], für Fleisch verwandelt in Asche».[1]
Mumford war einer von Hunderten europäischer und amerikanischer Schriftsteller, die phantasievoll beschworen, wie ein Bombenkrieg aussehen könnte, lange bevor er möglich oder real wurde. Der berühmteste unter ihnen war der Romancier H. G. Wells, dessen bereits 1908 veröffentlichter Roman «Der Luftkrieg» das Vorbild für alle nachfolgende Erzähl- und Sachliteratur lieferte, die sich mit den zu erwartenden Auswirkungen eines Bombenkriegs beschäftigte. Der Roman erzählt von einer Flotte todbringender deutscher Luftschiffe, die binnen Stunden New York zerstört, «ein einziger Hochofen voll roter Flammen, aus dem kein Entrinnen war». Der weltweite Krieg, der sich daraufhin entwickelt, verschlingt die Zivilisation, deren irregeleiteter Glaube an Sicherheit und Fortschritt rascher ausgelöscht wird als jede frühere Ordnung: «Und diesmal war es kein langsamer Verfall, der über die europäisierte Welt kam; jene anderen Zivilisationen verrotteten und zerbröckelten; die europäische Zivilisation flog sozusagen in die Luft.»[2] In seinem Buch beschäftigte sich Wells mit einem Thema, das er in den Jahren bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs immer wieder zur Sprache brachte: die Anwendung der modernen Wissenschaft auf den Krieg, die ungeahnte Gefahren heraufbeschwört. Die Zerstörung New Yorks sei, so heißt es im Roman, «das logische Ergebnis» dieser unglücklichen Verbindung. In einer weniger bekannten Fortsetzung, «The World Set Free» von 1913, nahm Wells das Atomzeitalter vorweg: Die zweihundert größten Städte der Erde werden im «unaufhaltsamen, blutroten Feuersturm der Atombombe» zerstört.[3] Wie Mumford begriff auch Wells das städtische Leben einerseits als charakteristisches Merkmal der Moderne («Riesenstädte, die sich ins Ungeheuerliche dehnten»), andererseits als extrem anfällig für die Vernichtung durch ebenjene Wissenschaft, die es hervorgebracht hatte.[4]
Weder die Zerstörung der modernen Großstadt noch das Ende der Zivilisation brachte der Krieg, der im August 1914 ausbrach, mit sich. Trotzdem blieben beide Befürchtungen die beherrschenden Motive in den dreißig Jahren, die Wells’ frühe Vorhersagen von der Realität der Massenbombardements nach 1940 trennten. Im Ersten Weltkrieg steckten die Flugzeuge technisch noch in ihren Kinderschuhen. Der Krieg erlebte zwar die Anfänge der später sogenannten «strategischen Bombardierung», aber das Ausmaß der Angriffe war minimal und die unmittelbare Wirkung auf die betroffenen kriegführenden Staaten unerheblich. Wie in Wells’ Roman wurden die ersten großen Luftangriffe von lenkbaren Luftschiffen aus durchgeführt. Die deutsche Marine genehmigte Fernangriffe mit Zeppelinen gegen britische Hafenstädte und schließlich auch gegen Ziele in London. Der erste von zweiundfünfzig Angriffen erfolgte in der Nacht zum 21. Januar 1915. Während des Krieges warfen die Luftschiffe eine Bombenlast von insgesamt 162 Tonnen ab – überwiegend auf gut Glück – und töteten 557 Menschen.[5] Mit Flugzeugangriffen auf Ziele weit hinter der Front begann man am 22. September 1914, als eine Handvoll Maschinen der Marine (Royal Naval Air Service) auf Befehl des damaligen Marineministers Winston Churchill Zeppelinhangars in Köln und Düsseldorf angriffen. Am 23. November folgte ein Bombardement Friedrichshafens, wo die Zeppeline gebaut wurden. Mit einem Vergeltungsschlag am 24. Dezember bombardierten die ersten deutschen Flugzeuge Großbritannien.
Während der nächsten zwei Jahre kam es zu kleineren Luftangriffen deutscher, französischer und britischer Fliegertruppen, die kaum Schaden anrichteten, bis die deutschen Luftstreitkräfte Ende 1916 ein «England-Geschwader» bildeten, das, von Hauptmann Ernst Brandenburg befehligt, eine Reihe von Tag- und Nachteinsätzen gegen britische Häfen flog, darunter achtzehn Angriffe auf London. Der erste, am 25. Mai 1917, galt Folkestone, der letzte, in der Nacht zum 20. Mai 1918, London. Der gemischte Verband aus mehrmotorigen Gotha-IV- und R-Gigant-Bombern warf bei 52 Angriffen 110 Tonnen Bombenlast ab, tötete 836 und verwundete 1982 Menschen. Ursprünglich hatte man das Ziel verfolgt, «die Moral des britischen Volks» so gründlich zu brechen, dass die britische Regierung einen Rückzug aus dem Konflikt in Erwägung ziehen könnte. Die Wirkung der Bombardements konnte dieser höchst spekulativen Strategie jedoch nicht im Entferntesten zum Erfolg verhelfen. Kleine deutsche Luftangriffe wurden auch gegen französische Industrieziele in Paris geflogen, man tötete 267 Bewohner der Stadt, erreichte militärisch aber wenig. Nach steigenden Verlusten verlief die Offensive im Frühjahr 1918 im Sand.[6] Ihr Hauptergebnis bestand darin, dass die Briten sich zur Vergeltung rüsteten.
Ein britisches Plakat aus dem Jahr 1915, das es ermöglichen sollte, zwischen britischen und deutschen Luftfahrzeugen zu unterscheiden.
Die deutschen Bombenangriffe, so sporadisch und begrenzt sie waren, erwiesen sich als Geburtshelfer nicht nur einer organisierten Luftverteidigung, sondern auch eines Vorgehens, das man die erste strategische Luftoffensive nennen könnte. Flugabwehrgeschütze waren erstmalig im Frühjahr 1915 in Südostengland in Feuerstellung gebracht worden. Die Flugabwehrstellungen wurden formal als «Air Defence of Great Britain» zusammengefasst. Herzstück des Systems war die Luftverteidigungszone London, die im Juli 1917 unter Generalmajor Edward Ashmore eingerichtet wurde. Im Sommer 1918 besaß die Luftverteidigung 250 Flugabwehrgeschütze (basierend auf der Rohrartillerie, die an der Westfront entwickelt worden war), 323 Scheinwerfer, acht Jägerstaffeln für den Tag- und Nachteinsatz und eine Personalstärke von siebzehntausend Mann. Zur Beobachtung und Meldung anfliegender Flugzeuge wurden vor schutzbedürftigen Räumen in etwa achtzig Kilometern Entfernung Flugmelderketten von Soldaten und Polizisten aufgestellt.[7] In bedrohten Städten wurde 1917 ein primitives Luftschutzsystem aufgebaut – behelfsmäßige Luftschutzräume, Luftschutzwarte und Polizisten mit Trillerpfeifen, die vor Angriffen warnen sollten. Das System kam in den letzten beiden Kriegsjahren nur selten zum Einsatz, nach den Angriffen im Mai 1918 dann gar nicht mehr. Dennoch lieferte es eine Vorlage, auf die man in den dreißiger Jahren zurückgriff, als Lehren aus dem Ersten Weltkrieg für die Planung britischer Luftschutzvorkehrungen gezogen werden sollten.
Die Luftangriffe führten in den betroffenen Städten kurzzeitig zu Panik; im Ostküstenhafen Hull, ein leichtes Bombenziel für die Zeppeline, wich ein Teil der Einwohner in das Umland aus, was sich im nächsten Krieg wiederholen sollte. In London suchten schätzungsweise hundert- bis dreihunderttausend Menschen Schutz in den U-Bahn-Tunneln.[8] Die Luftangriffe wurden weithin als heimtückische, feige Überfälle auf Unschuldige verurteilt. Am Ende kosteten die Zeppelin- und Bomberangriffe 1239 Menschen das Leben, darunter 366 Frauen und 252 Kinder. Die Bombardements empfand man, so schrieb etwa die Tageszeitung «The Times», als «einen Rückfall in die Barbarei», eine Formulierung, die nach Bombenangriffen in den nächsten fünfundzwanzig Jahren regelmäßig wiederkehren sollte.[9] Der Ruf nach Vergeltung wurde landesweit laut, wobei ganz ähnliche moralische Rechtfertigungen bemüht wurden wie später während des «Blitz». Tatsächlich kam es zu einigen wohlüberlegten Vergeltungsangriffen. Die britische Regierung indessen verlangte nach einer systematischeren Reaktion. 1916 wurde ein Luftfahrtausschuss ins Leben gerufen, man plante, eine gesonderte, unabhängige Luftwaffe zu schaffen und sie – mit Billigung der Regierung – für eine Fernbomberoffensive gegen militärische und wirtschaftliche Ziele in Deutschland einzusetzen, soweit es die begrenzte Reichweite der vorhandenen Flugzeuge zuließ.