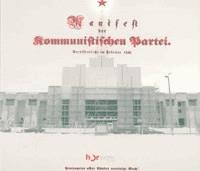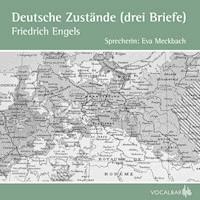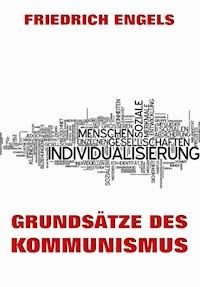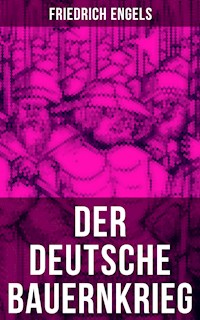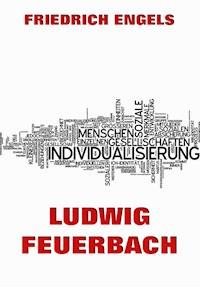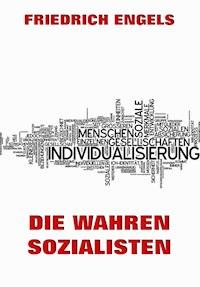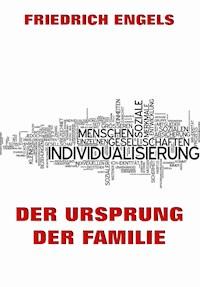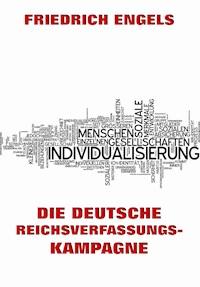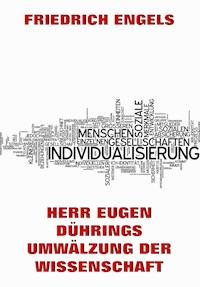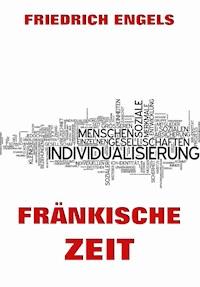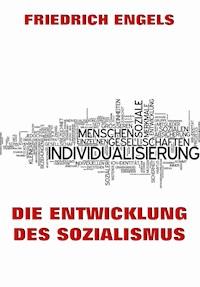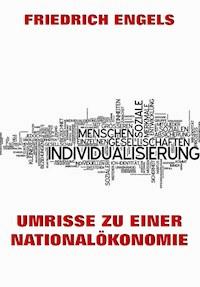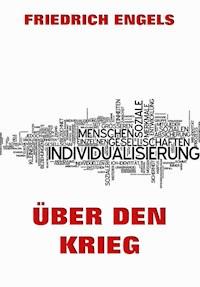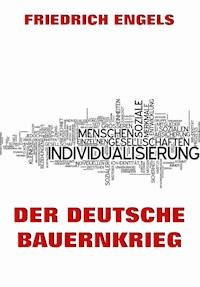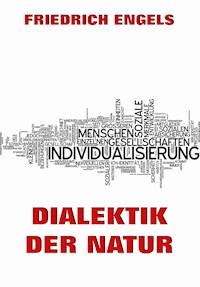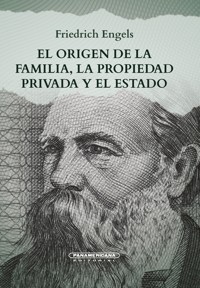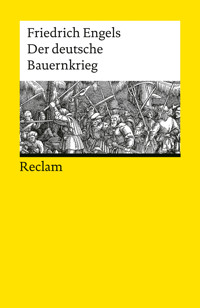
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Nach der Niederlage der Revolution von 1848 erinnert Friedrich Engels an die Bauernkriege der Reformationszeit, den »Angelpunkt der deutschen Geschichte«. Keine nüchterne historische Darstellung hatte er dabei im Sinn, sondern eine ermutigende Streitschrift für Zeitgenossen: »Auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition.« Seine glänzend geschriebene Darstellung der Aufstände verbindet sozialgeschichtliche Analysen mit einer packenden Erzählung: Ein literarisches Meisterwerk ist neu zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Engels Friedrich
Der deutsche Bauernkrieg
Reclam
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962209
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Coverabbildung: Ein Haufen kämpfender Bauern, Faksimile aus dem Holzschnitt von Hans Lützelburger (1495–1526) nach Hans Holbein d. J. – © Quagga Media / Alamy Stock Photo.
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962209-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014333-9
www.reclam.de
Inhalt
Der deutsche Bauernkrieg.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Anhang
Zu dieser Ausgabe
Die Zwölf Artikel (in der Memminger Fassung)
Anmerkungen
Eine deutsche Revolution
Schlachten
Kampfschrift und Geschichtswerk
Quellen- und Methodenfragen
Erzählen
Luther und Müntzer
Leitbegriffe
Revolution und Religion
Nachleben
Literaturhinweise
[7]Neue Rheinische ZeitungPolitisch-ökonomische Revue.H. 5/6. Mai–Oktober 1850
Der deutsche Bauernkrieg.
Auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition. Es gab eine Zeit, wo Deutschland Charaktere hervorbrachte, die sich den besten Leuten der Revolutionen anderer Länder an die Seite stellen können, wo das deutsche Volk eine Ausdauer und Energie entwickelte, die bei einer zentralisierteren Nation die großartigsten Resultate erzeugt hätte, wo deutsche Bauern und Plebejer1 mit Ideen und Plänen schwanger gingen, vor denen ihre Nachkommen oft genug zurückschaudern.
Es ist an der Zeit, gegenüber der momentanen Erschlaffung, die sich nach zwei Jahren des Kampfes2 fast überall zeigt, die ungefügen, aber kräftigen und zähen Gestalten des großen Bauernkriegs dem deutschen Volke wieder vorzuführen. Drei Jahrhunderte sind seitdem verflossen, und manches hat sich geändert; und doch steht der Bauernkrieg unsern heutigen Kämpfen so überaus fern nicht, und die zu bekämpfenden Gegner sind großenteils noch dieselben. Die Klassen und Klassenfraktionen, die 1848 und 49 überall verraten haben, werden wir schon 1525, wenn auch auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe, als Verräter vorfinden. Und wenn der robuste Vandalismus des Bauernkriegs in der Bewegung der letzten Jahre nur stellenweise, im Odenwald, im Schwarzwald, in Schlesien zu seinem Rechte kam, so ist das jedenfalls kein Vorzug der modernen Insurrektion3.
[8]I.
Gehen wir zunächst zurück auf die Verhältnisse Deutschlands zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts.
Die deutsche Industrie1 hatte im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert einen bedeutenden Aufschwung genommen. An die Stelle der feudalen2 ländlichen Lokalindustrie war der zünftige Gewerbebetrieb der Städte getreten, der für weitere Kreise und selbst für entlegnere Märkte produzierte. Die Weberei von groben Wollentüchern und Leinwand war ein stehender, weitverbreiteter Industriezweig geworden, und selbst feinere Wollen- und Leinengewebe sowie Seidenstoffe wurden schon in Augsburg verfertigt. Neben der Weberei hatte sich besonders jene an die Kunst anstreifende Industrie gehoben, die in dem geistlichen und weltlichen Luxus des späteren Mittelalters ihre Nahrung fand: Die der Gold- und Silberarbeiter, der Bildhauer und Bildschnitzer, Kupferstecher und Holzschneider, Medaillierer, Drechsler etc. etc. Eine Reihe von mehr oder minder bedeutenden Erfindungen, deren historische Glanzpunkte die des Schießpulvers und der Buchdruckerei3 bildeten, hatte zur Hebung der Gewerbe wesentlich beigetragen. Der Handel ging mit der Industrie gleichen Schritt. Die Hanse hatte durch ihr hundertjähriges Seemonopol die Erhebung von ganz Norddeutschland aus der mittelaltrigen Barbarei sichergestellt; und wenn sie auch schon seit Ende des fünfzehnten Jahrhunderts der Konkurrenz der Engländer und Holländer rasch zu erliegen anfing, so ging doch trotz Vasco da Gamas Entdeckungen4 der große Handelsweg von Indien nach dem Norden immer noch durch Deutschland, so war Augsburg noch immer der [9]große Stapelplatz für italienische Seidenzeuge, indische Gewürze und alle Produkte der Levante5. Die oberdeutschen Städte, namentlich Augsburg und Nürnberg, waren die Zentren eines für jene Zeit ansehnlichen Reichtums und Luxus. Die Gewinnung der Rohprodukte hatte sich ebenfalls bedeutend gehoben. Die deutschen Bergleute waren im fünfzehnten Jahrhundert die geschicktesten der Welt, und auch den Ackerbau hatte das Aufblühen der Städte aus der ersten mittelalterlichen Rohheit herausgerissen. Nicht nur waren ausgedehnte Strecken urbar gemacht worden, man baute auch Farbekräuter und andere eingeführte Pflanzen an, deren sorgfältigere Kultur auf den Ackerbau im Allgemeinen günstig einwirkte.
Der Aufschwung der nationalen Produktion Deutschlands hatte indes noch immer nicht Schritt gehalten mit dem Aufschwung andrer Länder. Der Ackerbau stand weit hinter dem englischen und niederländischen, die Industrie hinter der italienischen, flämischen und englischen zurück, und im Seehandel fingen die Engländer und besonders die Holländer schon an, die Deutschen aus dem Felde zu schlagen. Die Bevölkerung war immer noch sehr dünn gesät. Die Zivilisation in Deutschland existierte nur sporadisch, um einzelne Zentren der Industrie und des Handels gruppiert; die Interessen dieser einzelnen Zentren selbst gingen weit auseinander, hatten kaum hie und da einen Berührungspunkt. Der Süden hatte ganz andre Handelsverbindungen und Absatzmärkte als der Norden; der Osten und der Westen standen fast außer allem Verkehr. Keine einzige Stadt kam in den Fall, der industrielle und kommerzielle Schwerpunkt des ganzen Landes zu werden, wie London dies z. B. für England schon war. Der ganze innere Verkehr [10]beschränkte sich fast ausschließlich auf die Küsten- und Flussschifffahrt und auf die paar großen Handelsstraßen, von Augsburg und Nürnberg über Köln nach den Niederlanden und über Erfurt nach dem Norden. Weiter ab von den Flüssen und Handelsstraßen lag eine Anzahl kleinerer Städte, die, vom großen Verkehr ausgeschlossen, ungestört in den Lebensbedingungen des späteren Mittelalters fortvegetierten, wenig auswärtige Waren brauchten, wenig Ausfuhrprodukte lieferten. Von der Landbevölkerung kam nur der Adel in Berührung mit ausgedehnteren Kreisen und neuen Bedürfnissen; die Masse der Bauern kam nie über die nächsten Lokalbeziehungen und den damit verbundnen lokalen Horizont hinaus.
Während in England und Frankreich das Emporkommen des Handels und der Industrie die Verkettung der Interessen über das ganze Land und damit die politische Zentralisation zur Folge hatte, brachte Deutschland es nur zur Gruppierung der Interessen nach Provinzen, um bloß lokale Zentren, und damit zur politischen Zersplitterung; einer Zersplitterung, die bald darauf durch den Ausschluss Deutschlands vom Welthandel sich erst recht festsetzte. In demselben Maß, wie das reinfeudale Reich zerfiel, löste sich der Reichsverband überhaupt auf, verwandelten sich die großen Reichslehenträger in beinahe unabhängige Fürsten6, schlossen einerseits die Reichsstädte, andrerseits die Reichsritter Bündnisse, bald gegeneinander, bald gegen die Fürsten oder den Kaiser. Die Reichsgewalt, selbst an ihrer Stellung irre geworden, schwankte unsicher zwischen den verschiednen Elementen, die das Reich ausmachten, und verlor dabei immer mehr an Autorität; ihr Versuch, in der Art Ludwigs XI. zu zentralisieren7, kam trotz aller Intrigen [11]und Gewalttätigkeiten nicht über die Zusammenhaltung der österreichischen Erblande hinaus. Wer in dieser Verwirrung, in diesen zahllosen sich durchkreuzenden Konflikten schließlich gewann und gewinnen musste, waren die Vertreter der Zentralisation innerhalb der Zersplitterung, der lokalen und provinziellen Zentralisation, die Fürsten, neben denen der Kaiser selbst immer mehr ein Fürst wie die andern wurde.
Unter diesen Verhältnissen hatte sich die Stellung der aus dem Mittelalter überlieferten Klassen wesentlich verändert, und neue Klassen hatten sich neben den alten gebildet.8
Aus dem hohen Adel waren die Fürsten hervorgegangen. Sie waren schon fast ganz unabhängig vom Kaiser und im Besitz der meisten Hoheitsrechte. Sie machten Krieg und Frieden auf eigne Faust, hielten stehende Heere, riefen Landtage9 zusammen und schrieben Steuern aus. Einen großen Teil des niederen Adels und der Städte hatten sie bereits in ihre Botmäßigkeit10 gebracht; sie wandten fortwährend jedes Mittel an, um die noch übrigen reichsunmittelbaren Städte und Baronien ihrem Gebiet einzuverleiben. Diesen gegenüber zentralisierten sie, wie sie gegenüber der Reichsgewalt dezentralisierend auftraten. Nach innen war ihre Regierung schon sehr willkürlich. Sie riefen die Stände11 meist nur zusammen, wenn sie sich nicht anders helfen konnten. Sie schrieben Steuern aus und nahmen Geld auf, wenn es ihnen gutdünkte; das Steuerbewilligungsrecht der Stände wurde selten anerkannt und kam noch seltner zur Ausübung. Und selbst dann hatte der Fürst gewöhnlich die Majorität durch die beiden steuerfreien und am Genuss der Steuern teilnehmenden Stände, die [12]Ritterschaft und die Prälaten12. Das Geldbedürfnis der Fürsten wuchs mit dem Luxus und der Ausdehnung des Hofhaltes, mit den stehenden Heeren, mit den wachsenden Kosten der Regierung. Die Steuern wurden immer drückender. Die Städte waren meist dagegen geschützt durch ihre Privilegien; die ganze Wucht der Steuerlast fiel auf die Bauern, sowohl auf die Domanialbauern13 der Fürsten selbst wie auch auf die Leibeignen und Hörigen der lehnspflichtigen Ritter14. Wo die direkte Besteurung nicht ausreichte, trat die indirekte ein; die raffiniertesten Manöver der Finanzkunst wurden angewandt, um den löchrigen Fiskus zu füllen. Wenn alles nicht half, wenn nichts mehr zu versetzen war und keine freie Reichsstadt15 mehr Kredit geben wollte, so schritt man zu Münzoperationen der schmutzigsten Art, schlug schlechtes Geld, machte hohe oder niedrige Zwangskurse, je nachdem es dem Fiskus konvenierte16. Der Handel mit städtischen und sonstigen Privilegien, die man nachher gewaltsam wieder zurücknahm, um sie abermals für teures Geld zu verkaufen, die Ausbeutung jedes Oppositionsversuchs zu Brandschatzungen17 und Plünderungen aller Art etc. etc. waren ebenfalls einträgliche und alltägliche Geldquellen für die Fürsten jener Zeit. Auch die Justiz war ein stehender und nicht unbedeutender Handelsartikel für die Fürsten. Kurz, die damaligen Untertanen, die außerdem noch der Privathabgier der fürstlichen Vögte und Amtleute zu genügen hatten, bekamen alle Segnungen des väterlichen Regierungssystems im vollsten Maße zu kosten.
Aus der feudalen Hierarchie des Mittelalters war der mittlere Adel fast ganz verschwunden; er hatte sich entweder zur Unabhängigkeit kleiner Fürsten [13]emporgeschwungen oder war in die Reihen des niedern Adels herabgesunken. Der niedere Adel, die Ritterschaft, ging ihrem Verfall rasch entgegen. Ein großer Teil war schon gänzlich verarmt und lebte bloß von Fürstendienst in militärischen oder bürgerlichen Ämtern; ein andrer stand in der Lehenspflicht und Botmäßigkeit der Fürsten; der kleinere war reichsunmittelbar. Die Entwicklung des Kriegswesens, die steigende Bedeutung der Infanterie, die Ausbildung der Feuerwaffe beseitigte die Wichtigkeit ihrer militärischen Leistungen als schwere Kavallerie und vernichtete zugleich die Uneinnehmbarkeit ihrer Burgen. Gerade wie die Nürnberger Handwerker wurden die Ritter durch den Fortschritt der Industrie überflüssig gemacht. Das Geldbedürfnis der Ritterschaft trug zu ihrem Ruin bedeutend bei. Der Luxus auf den Schlössern, der Wetteifer in der Pracht bei den Turnieren und Festen, der Preis der Waffen und Pferde stieg mit den Fortschritten der Zivilisation, während die Einkommensquellen der Ritter und Barone wenig oder gar nicht zunahmen. Fehden mit obligater Plünderung und Brandschatzung, Wegelagern und ähnliche noble Beschäftigungen wurden mit der Zeit zu gefährlich. Die Abgaben und Leistungen der herrschaftlichen Untertanen brachten kaum mehr ein als früher. Um ihre zunehmenden Bedürfnisse zu decken, mussten die gnädigen Herrn zu denselben Mitteln ihre Zuflucht nehmen wie die Fürsten. Die Bauernschinderei durch den Adel wurde mit jedem Jahr weiter ausgebildet. Die Leibeigenen wurden bis auf den letzten Blutstropfen ausgesogen, die Hörigen mit neuen Abgaben und Leistungen unter allerlei Vorwänden und Namen belegt. Die Frohnden, Zinsen, Gülten, Laudemien, Sterbfallabgaben, Schutzgelder18 u. s. w. wurden allen alten [14]Verträgen zum Trotz willkürlich erhöht. Die Justiz wurde verweigert oder verschachert, und wo der Ritter dem Geld des Bauern sonst nicht beikommen konnte, warf er ihn ohne weiteres in den Turm19 und zwang ihn, sich loszukaufen.
Mit den übrigen Ständen20 lebte der niedere Adel ebenfalls auf keinem freundschaftlichen Fuß. Der lehnspflichtige Adel suchte sich reichsunmittelbar21 zu machen, der reichsunmittelbare seine Unabhängigkeit zu wahren; daher fortwährende Streitigkeiten mit den Fürsten. Der Geistlichkeit, die dem Ritter in ihrer damaligen aufgeblähten Gestalt als ein rein überflüssiger Stand erschien, beneidete er ihre großen Güter, ihre durch das Zölibat und die Kirchenverfassung zusammengehaltenen Reichtümer. Mit den Städten lag er sich fortwährend in den Haaren; er war ihnen verschuldet, er nährte sich von der Plünderung ihres Gebiets, von der Beraubung ihrer Kaufleute, vom Lösegeld der ihnen in den Fehden abgenommenen Gefangenen. Und der Kampf der Ritterschaft gegen alle diese Stände wurde umso heftiger, je mehr die Geldfrage auch bei ihr eine Lebensfrage wurde.
Die Geistlichkeit, die Repräsentantin der Ideologie des mittelaltrigen Feudalismus, fühlte den Einfluss des geschichtlichen Umschwungs nicht minder. Durch die Buchdruckerei und die Bedürfnisse des ausgedehnteren Handels war ihr das Monopol nicht nur des Lesens und Schreibens, sondern der höheren Bildung genommen. Die Teilung der Arbeit trat auch auf intellektuellem Gebiet ein. Der neu aufkommende Stand der Juristen verdrängte sie aus einer Reihe der einflussreichsten Ämter. Auch sie fing an, zum großen Teil überflüssig zu werden und erkannte dies selbst an durch ihre stets wachsende Faulheit und Unwissenheit. [15]Aber je überflüssiger sie wurde, desto zahlreicher wurde sie – dank ihren enormen Reichtümern, die sie durch Anwendung aller möglichen Mittel noch fortwährend vermehrte.
In der Geistlichkeit gab es zwei durchaus verschiedne Klassen. Die geistliche Feudalhierarchie bildete die aristokratische Klasse: die Bischöfe und Erzbischöfe, die Äbte, Prioren und sonstigen Prälaten.22 Diese hohen Würdenträger der Kirche waren entweder selbst Reichsfürsten oder sie beherrschten als Feudalherren unter der Oberhoheit andrer Fürsten große Strecken Landes mit zahlreichen Leibeignen und Hörigen. Sie exploitierten23 ihre Untergebnen nicht nur ebenso rücksichtslos wie der Adel und die Fürsten, sie gingen noch viel schamloser zu Werke. Neben der brutalen Gewalt wurden alle Schikanen der Religion, neben den Schrecken der Folter alle Schrecken des Bannfluchs und der verweigerten Absolution24, alle Intrigen des Beichtstuhls in Bewegung gesetzt, um den Untertanen den letzten Pfennig zu entreißen oder das Erbteil der Kirche zu mehren. Urkundenfälschung war bei diesen würdigen Männern ein gewöhnliches und beliebtes Mittel der Prellerei. Aber obgleich sie außer den gewöhnlichen Feudalleistungen und Zinsen noch den Zehnten25 bezogen, reichten alle diese Einkünfte noch nicht aus. Die Fabrikation wundertätiger Heiligenbilder und Reliquien, die Organisation seligmachender Betstationen, der Ablassschacher wurde zu Hilfe genommen, um dem Volk vermehrte Abgaben zu entreißen, und lange Zeit mit bestem Erfolg.
Diese Prälaten und ihre zahllose, mit der Ausbreitung der politischen und religiösen Hetzereien stets verstärkte Gendarmerie26 von Mönchen waren es, auf die der [16]Pfaffenhass nicht nur des Volks, sondern auch des Adels sich konzentrierte. Soweit sie souverän, standen sie den Fürsten im Weg. Das flotte Wohlleben der beleibten Bischöfe und Äbte und ihrer Mönchsarmee erregte den Neid des Adels und empörte das Volk, das die Kosten davon tragen musste, umso mehr, je schreiender es ihre Predigten ins Gesicht schlug.
Die plebejische Fraktion der Geistlichkeit bestand aus den Predigern auf dem Lande und in den Städten. Sie standen außerhalb der feudalen Hierarchie der Kirche und hatten keinen Anteil an ihren Reichtümern. Ihre Arbeit war weniger kontrolliert und, so wichtig sie der Kirche war, im Augenblick weit weniger unentbehrlich als die Polizeidienste der einkasernierten Mönche. Sie wurden daher weit schlechter bezahlt, und ihre Pfründen27 waren meist sehr knapp. Bürgerlichen oder plebejischen Ursprungs, standen sie so der Lebenslage der Masse nahe genug, um trotz ihres Pfaffentums bürgerliche und plebejische Sympathien zu bewahren. Die Beteiligung an den Bewegungen der Zeit, bei den Mönchen nur Ausnahme, war bei ihnen Regel. Sie lieferten die Theoretiker und Ideologen der Bewegung, und viele von ihnen, Repräsentanten der Plebejer und Bauern, starben dafür auf dem Schafott. Der Volkshass gegen die Pfaffen wendet sich auch nur in einzelnen Fällen gegen sie.
Wie über den Fürsten und dem Adel der Kaiser, so stand über den hohen und niedrigen Pfaffen der Papst. Wie dem Kaiser der »gemeine Pfennig«, die Reichssteuern bezahlt wurden, so dem Papst die allgemeinen Kirchensteuern, aus denen er den Luxus am römischen Hof bestritt. In keinem Lande wurden diese Kirchensteuern – dank der Macht und [17]Zahl der Pfaffen – mit größerer Gewissenhaftigkeit und Strenge eingetrieben als in Deutschland. So besonders die Annaten28 bei Erledigung der Bistümer. Mit den steigenden Bedürfnissen wurden dann neue Mittel zur Beischaffung des Geldes erfunden: Handel mit Reliquien, Ablass- und Jubelgelder29 u. s. w. Große Summen wanderten so jährlich aus Deutschland nach Rom, und der hierdurch vermehrte Druck steigerte nicht nur den Pfaffenhass, er erregte auch das Nationalgefühl, besonders des Adels, des damals nationalsten Standes.
Aus den ursprünglichen Pfahlbürgern30 der mittelalterlichen Städte hatten sich mit dem Aufblühen des Handels und der Gewerbe drei scharf gesonderte Fraktionen entwickelt.
An der Spitze der städtischen Gesellschaft standen die patrizischenGeschlechter, die sogenannte »Ehrbarkeit«. Sie waren die reichsten Familien. Sie allein saßen im Rat und in allen städtischen Ämtern. Sie verwalteten daher nicht bloß die Einkünfte der Stadt, sie verzehrten sie auch. Stark durch ihren Reichtum, durch ihre althergebrachte, von Kaiser und Reich anerkannte aristokratische Stellung, exploitierten sie sowohl die Stadtgemeinde wie die der Stadt untertänigen Bauern auf jede Weise. Sie trieben Wucher in Korn und Geld, oktroyierten sich31 Monopole aller Art, entzogen der Gemeinde nacheinander alle Anrechte auf Mitbenutzung der städtischen Wälder und Wiesen und benutzten diese direkt zu ihrem eignen Privatvorteil, legten willkürlich Weg-, Brücken- und Torzölle und andre Lasten auf und trieben Handel mit Zunftprivilegien, Meisterschafts- und Bürgerrechten und mit der Justiz. Mit den Bauern des Weichbilds32 gingen sie nicht schonender um als der Adel [18]oder die Pfaffen; im Gegenteil, die städtischen Vögte und Amtleute auf den Dörfern, lauter Patrizier, brachten zu der aristokratischen Härte und Habgier noch eine gewisse bürokratische Genauigkeit in der Eintreibung mit. Die so zusammengebrachten städtischen Einkünfte wurden mit der höchsten Willkür verwaltet; die Verrechnung in den städtischen Büchern, eine reine Förmlichkeit, war möglichst nachlässig und verworren; Unterschleife und Kassendefekte waren an der Tagesordnung. Wie leicht es damals einer von allen Seiten mit Privilegien umgebenen, wenig zahlreichen und durch Verwandtschaft und Interesse eng zusammengehaltenen Kaste war, sich aus den städtischen Einkünften enorm zu bereichern, begreift man, wenn man an die zahlreichen Unterschleife und Tripotagen33 denkt, die das Jahr 1848 in so vielen städtischen Verwaltungen an den Tag gebracht hat.
Die Patrizier hatten Sorge getragen, die Rechte der Stadtgemeinde besonders in Finanzsachen überall obsolet werden zu lassen. Erst später, als die Prellereien dieser Herren zu arg wurden, setzten sich die Gemeinden wieder in Bewegung, um wenigstens die Kontrolle über die städtische Verwaltung an sich zu bringen. Sie erlangten in den meisten Städten ihre Rechte wirklich wieder. Aber bei den ewigen Streitigkeiten der Zünfte unter sich, bei der Zähigkeit der Patrizier und dem Schutz, den sie beim Reich und den Regierungen der ihnen verbündeten Städte fanden, stellten die patrizischen Ratsherren sehr bald ihre alte Alleinherrschaft faktisch wieder her, sei es durch List, sei es durch Gewalt. Im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts befand sich die Gemeinde in allen Städten wieder in der Opposition.
[19]Die städtische Opposition gegen das Patriziat teilte sich in zwei Fraktionen, die im Bauernkrieg sehr bestimmt hervortreten.
Die bürgerliche Opposition, die Vorgängerin unsrer heutigen Liberalen, umfasste die reicheren und mittleren Bürger sowie einen nach den Lokalumständen größeren oder geringeren Teil der Kleinbürger. Ihre Forderungen hielten sich rein auf verfassungsmäßigem Boden. Sie verlangten die Kontrolle über die städtische Verwaltung und einen Anteil an der gesetzgebenden Gewalt, sei es durch die Gemeindeversammlung selbst oder durch eine Gemeindevertretung (großer Rat, Gemeindeausschuss); ferner Beschränkung des patrizischen Nepotismus und der Oligarchie34 einiger wenigen Familien, die selbst innerhalb des Patriziats immer offener hervortrat. Höchstens verlangten sie außerdem noch die Besetzung einiger Ratsstellen durch Bürger aus ihrer eignen Mitte. Diese Partei35, der sich hier und da die malkontente36 und heruntergekommene Fraktion des Patriziats anschloss, hatte in allen ordentlichen Gemeindeversammlungen und auf den Zünften die große Majorität. Die Anhänger des Rats und die radikalere Opposition zusammen waren unter den wirklichen Bürgern bei weitem die Minderzahl.
Wir werden sehn, wie während der Bewegung des sechzehnten Jahrhunderts diese »gemäßigte«, »gesetzliche«, »wohlhabende« und »intelligente« Opposition genau dieselbe Rolle spielt, und genau mit demselben Erfolg, wie ihre Erbin, die konstitutionelle Partei37, in der Bewegung von 1848 und 1849.
Im Übrigen eiferte die bürgerliche Opposition noch sehr ernstlich wider die Pfaffen, deren faules Wohlleben und [20]lockere Sitten ihr großes Ärgernis gaben. Sie verlangte Maßregeln gegen den skandalösen Lebenswandel dieser würdigen Männer. Sie forderte, dass die eigne Gerichtsbarkeit und die Steuerfreiheit der Pfaffen abgeschafft und die Zahl der Mönche überhaupt beschränkt werde.
Die plebejische Opposition bestand aus den heruntergekommenen Bürgern und der Masse der städtischen Bewohner, die vom Bürgerrecht ausgeschlossen war: den Handwerksgesellen, den Taglöhnern und den zahlreichen Anfängen38 des Lumpenproletariats39, die sich selbst auf den untergeordneten Stufen der städtischen Entwicklung vorfinden. Das Lumpenproletariat ist überhaupt eine Erscheinung, die mehr oder weniger ausgebildet in fast allen bisherigen Gesellschaftsphasen vorkommt. Die Menge von Leuten ohne bestimmten Erwerbszweig oder festen Wohnsitz wurde gerade damals sehr vermehrt durch das Zerfallen des Feudalismus in einer Gesellschaft, in der noch jeder Erwerbszweig, jede Lebenssphäre hinter einer Unzahl von Privilegien verschanzt war. In allen entwickelten Ländern war die Zahl der Vagabunden nie so groß gewesen wie in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Ein Teil dieser Landstreicher trat in Kriegszeiten in die Armeen, ein anderer bettelte sich durchs Land, der dritte suchte in den Städten durch Taglöhnerarbeit und was sonst gerade nicht zünftig40 war, seine notdürftige Existenz. Alle drei spielen eine Rolle im Bauernkrieg: der erste in den Fürstenarmeen, denen die Bauern erlagen, der zweite in den Bauernverschwörungen und Bauernhaufen, wo ihr demoralisierender Einfluss jeden Augenblick hervortritt, der dritte in den Kämpfen der städtischen Parteien. Es ist übrigens nicht zu vergessen, dass ein großer Teil dieser Klasse, [21]namentlich der in den Städten lebende, damals noch einen bedeutenden Kern gesunder Bauernnatur besaß und noch lange nicht die Käuflichkeit und Verkommenheit des heutigen, zivilisierten Lumpenproletariats entwickelt hatte.
Man sieht, die plebejische Opposition der damaligen Städte bestand aus sehr gemischten Elementen. Sie vereinigte die verkommenen Bestandteile der alten, feudalen und zünftigen Gesellschaft mit dem noch unentwickelten, kaum emportauchenden proletarischen Element der aufkeimenden, modernen bürgerlichen Gesellschaft. Verarmte Zunftbürger41, die noch durch das Privilegium mit der bestehenden bürgerlichen Ordnung zusammenhingen, auf der einen Seite; verstoßene Bauern und abgedankte Dienstleute, die noch nicht zu Proletariern werden konnten, auf der andern. Zwischen beiden die Gesellen, momentan außerhalb der offiziellen Gesellschaft stehend und sich in ihrer Lebenslage dem Proletariat so sehr nähernd, wie dies bei der damaligen Industrie und unter dem Zunftprivilegium42 möglich; aber zu gleicher Zeit, fast lauter zukünftige, bürgerliche Meister, kraft eben dieses Zunftprivilegiums. Die Parteistellung dieses Gemisches von Elementen war daher notwendig höchst unsicher und je nach der Lokalität verschieden. Vor dem Bauernkriege tritt die plebejische Opposition in den politischen Kämpfen nicht als Partei, sie tritt nur als turbulenter, plünderungssüchtiger, mit einigen Fässern Wein an- und abkäuflicher Schwanz der bürgerlichen Opposition auf. Erst die Aufstände der Bauern machen sie zur Partei, und auch da ist sie fast überall in ihren Forderungen und ihrem Auftreten abhängig von den Bauern – ein merkwürdiger Beweis, wie sehr damals die Stadt noch abhängig vom Lande war. Soweit sie [22]selbstständig auftritt, verlangt sie die Herstellung der städtischen Gewerbsmonopole43 auf dem Lande, will sie die städtischen Einkünfte nicht durch Abschaffung der Feudallasten im Weichbild geschmälert wissen, u.s.w; kurz, so weit ist sie reaktionär, ordnet sie sich ihren eignen kleinbürgerlichen Elementen unter und liefert damit ein charakteristisches Vorspiel zu der Tragikomödie, die die moderne Kleinbürgerschaft seit drei Jahren44 unter der Firma der Demokratie aufführt.