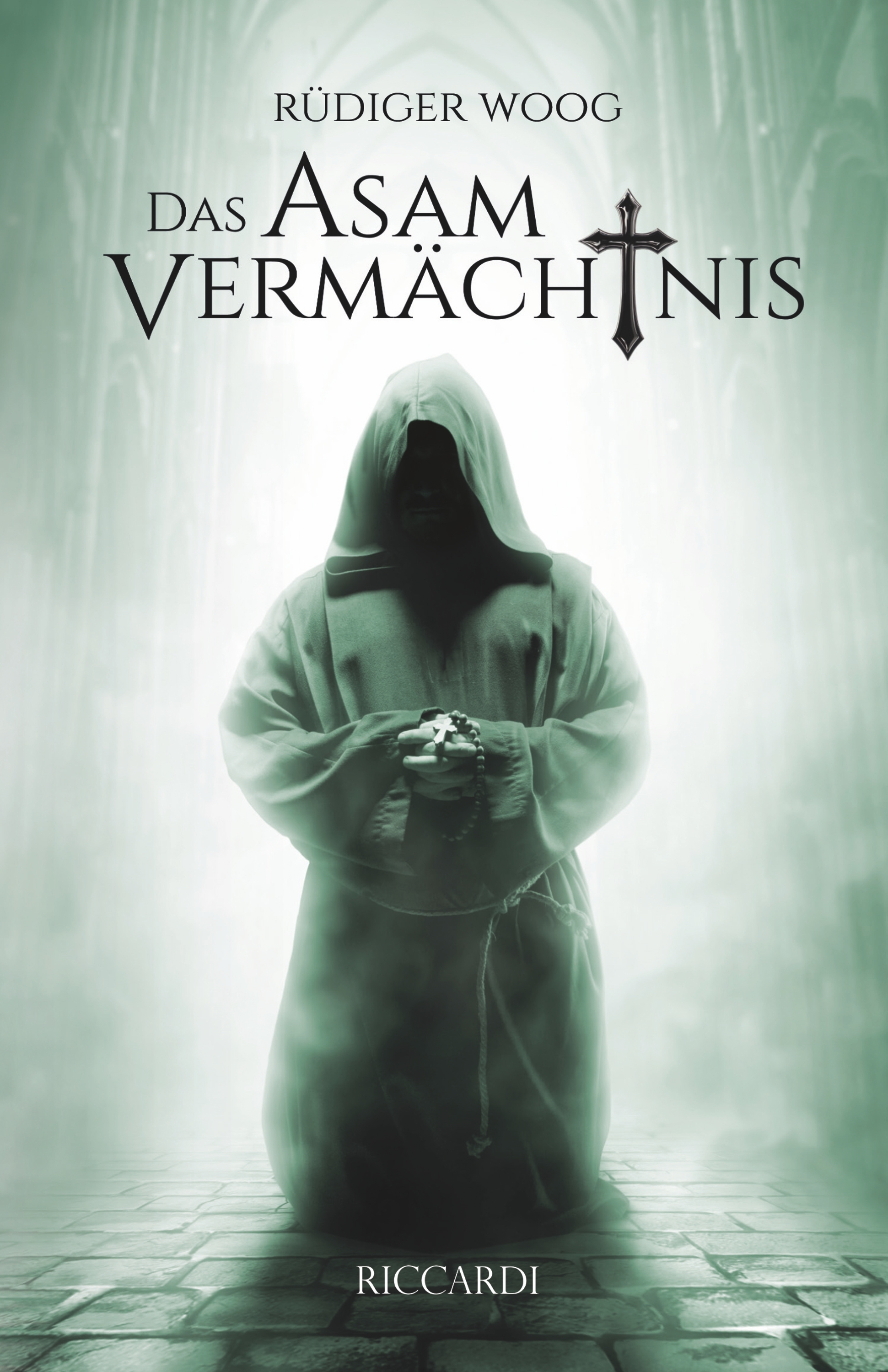Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Spielberg Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2008
Der Regensburger Hauptkommissar Leo Dietz wird in seine Heimatstadt, das niederbayerische Kelheim, gerufen, um in einem äußerst mysteriösen Mordfall zu ermitteln: Denn der täglich von Hunderten von Touristen aufgesuchte Tatort und die bewusste Zurschaustellung der Leiche lassen nicht den Anschein erwecken, als hätte sich der Mörder viel Mühe gegeben, seine Tat zu vertuschen. Er wollte, dass man sie findet – und zwar genau so, wie er alles inszeniert hat. Noch ahnt Dietz nicht, dass auch er nur eine von vielen Figuren ist, die der 'Einschläfer' in seinem perfiden Spiel auftreten lässt. Aber welche Rolle spielt die traurig schöne Anna, die ihrer toten Schwester auf geradezu gespenstische Weise gleicht? Welche Sprache sprechen die Toten und was ist ihre Botschaft?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
1. Kapitel
Es war die erste Fahrt am Morgen, aber eine der letzten dieser Saison. Obwohl der Oktober sich ungewöhnlich warm und sonnig verabschiedete, sollte der Betrieb noch vor Allerheiligen eingestellt werden. Dann kam die ganze Flotte der Kelheimer Donau- und Altmühltalpersonenschifffahrt wie jedes Jahr in die Werft nach Saal, wo die acht prächtigen Schiffe überholt und eingewintert werden sollten.
Die Ludwig der Kelheimer lag ruhig und irgendwie vertrauenserweckend an der Anlegestelle in Kelheim. Nur beim Ablegen vibrierte die Reling, an der sich eine Gruppe Mountainbiker anlehnte, etwas unangenehm, da die Motoren auf volle Kraft liefen, denn das Schiff musste sich auf seiner Fahrt zum Kloster Weltenburg gegen die Strömung behaupten. Dann aber ging das Motorengeräusch in ein angenehmes, beruhigendes Brummen über und der größere Teil der Passagiere nahm auf den Sitzbänken an und unter Deck Platz, um sich ein Weißbier oder einen Milchkaffee servieren zu lassen. Ein eingespieltes Tonband begleitete mit leiser, dezenter Orchestermusik das kaum merkliche, aber stete Auf und Ab des Bugs, der sich gegen die für die meisten Touristen unerwartet hoch schlagenden Wellen behauptete. Die deutsche Synchronstimme eines bekannten Hollywoodschauspielers erzählte in sonorem Bariton von der Entstehung des Donaudurchbruchs, der überregionalen Bedeutung des Juramarmors, den man in den umliegenden Steinbrüchen abbaue, und von archäologischen Funden, die schon eine erste Besiedelung der Jurakämme zwischen Altmühl und Donau in der Risseiszeit belegen.
Als die Ludwig der Kelheimer das so genannte Klösterl passierte, eine Einsiedlerklause aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die um eine an der Uferböschung liegende Grotte herumgebaut war, und die Tonbandstimme von einer Steinformation, die man Napoleons Koffer nannte, Flusspiraten, und altbayerischem Aberglauben berichtete, waren einige Mountainbiker schon beim zweiten Radler und ein paar Rentnerinnen einer rheinländischen Reisegruppe beim zweiten Stück Donauwelle. Schließlich näherte sich die Fahrt ihrem Höhepunkt: Auf beiden Uferseiten ragten immer steilere Felswände empor und der von Strudeln und Stromschnellen bewegte Fluss, der hier bis zu zwanzig Meter tief war, zappelte durch den Canyon, wie ein Fisch, der den steinernen Klauen der Felsgiganten zu entrinnen sucht. Und als die rheinländischen Seniorinnen anfingen, sich ernsthafte Sorgen um die entgegenkommenden Kajakfahrer zu machen, ragte schon hinter den grünen Spitzen und gelbroten Kronen des Mischwalds, der sich wie ein bunter Pelz um die hohen Felsen schmiegte, die Kuppel des weltberühmten Benediktinerklosters Weltenburg hervor.
Die meisten Passagiere standen auf und begaben sich zum Ausstieg, um einen möglichst guten Platz in der Klosterschänke zu ergattern. Die Kirche, deren Innenarchitektur von den genialen Brüdern und Barockmeistern Asam geschaffen wurde, und die nebst ihrer Geschichte, die bis auf die früheste Christianisierung Europas zurückgeht, eines der grandiosesten Bauwerke Bayerns ist, konnte man ja nach der Schweinshax’n und einem süffigen Dunkelbier besichtigen.
Alle Aufmerksamkeit war also auf das südliche Ufer gerichtet, wo das Schiff in wenigen Augenblicken anlegen würde, als einem Mountainbiker, der schon in der ersten Reihe stand, auffiel, dass er sein Kopftuch – ein Multifunktionstuch aus atmungsaktivem Material von Nike, das man als Halstuch, Mundschutz oder Kopfbedeckung benutzen konnte – auf Deck vergessen hatte. Er bahnte sich mit einem lauten, die rheinischen Kaffeedamen schockierenden Zefix einen Weg zurück zur Treppe, die nach draußen an Deck führte. Natürlich lag sein Tuch auf dem hintersten Tisch achtern und er musste über das ganze Deck laufen. Mit einem erneuten Zefix sprintete er hin. Aber als er vor dem Tisch stand, vergaß er sein Tuch.
Am nördlichen Ufer erhob sich ein mächtiger Felsen, die so genannte lange Wand. Im Sommer waren hier oft Seilschaften oder Freeclimber zugange. Doch heute kletterte trotz des wunderbaren Wetters scheinbar niemand. Etwas Anderes hatte die Aufmerksamkeit des Mountainbikers auf sich gezogen: Ein bis zwei Meter über der Wasseroberfläche waren Eisenringe in den Fels getrieben, an denen wohl früher Boote festgebunden wurden. Etwas darüber stand eine Heiligenstatue, vermutlich der heilige Nepomuk. Die Figur hielt den Oberkörper zum Wasser hinunter geneigt; ein Arm war wie segnend erhoben; und an eben der Stelle, auf die Nepomuk seinen Blick gerichtet zu haben schien, trieb etwas im Wasser und schlug immer wieder ans Ufer. Es war ein blauer Beutel oder Sack, der mit einem roten Bergsteigerseil an einem der Eisenringe festgebunden war, damit er nicht davontrieb oder ganz unterging.
Sein dritter Fluch blieb dem Sportler nur als ein Zef… im Hals stecken. Er ließ sich auf die Sitzbank fallen und führte beide Hände zum Mund. Unendliche Sekunden später sollte er um Hilfe schreiend zu seinen Radlergefährten und den Kaffeedamen rennen.
Aus dem blauen Sack hing eine Hand heraus, die so von den Wellen bewegt wurde, als winke sie, graziös, wie die Hand einer Königin, zu ihm herüber.
Leo Dietz saß in seinem Büro und versuchte, Hans, seinem besten Freund, einen Korb zu geben. Seit Brigitte Leo verlassen hatte und zu ihrem Werbe-Yuppie am Domplatz gezogen war, was nun schon bald ein halbes Jahr zurücklag, glaubten scheinbar alle um ihn herum, dass sie ihn ständig mitziehen und bei Laune halten müssten.
In demselben Gebäude am Haidplatz, in dem Hans seine Zahnarztpraxis hatte, war eine Pizzeria mit gotischem Gewölbe, einem hervorragenden Büfett und den hübschesten Bedienungen in ganz Regensburg. Dorthin wollte Hans ihn – zum dritten Mal in dieser Woche – einladen, aber Dietz hatte heute einfach keine Lust. Er war in einen regelrechten Freizeitstress geraten: mit den Kollegen jeden Mittwochabend Hallenfußball spielen, mit Hans samstags, oder wenn es ging freitags, zum Klettern und anschließend in die Sauna, sonntags bei den Eltern in Ihrlerstein essen und, und und.
Eigentlich war er gar nicht so am Boden zerstört, wie er wohl allseits den Anschein erweckte. Irgendetwas in ihm war sogar ein wenig erleichtert darüber, dass sich ihre Beziehung, die immerhin fast bis auf den Tag genau fünf Jahre gedauert hatte, aufgelöst hatte. Ja, aufgelöst war das richtige Wort: Mit der Zeit hatten sie noch weniger als nur nebeneinander her gelebt, sie waren sich regelrecht aus dem Weg gegangen; obwohl oder vielleicht gerade weil nie etwas vorgefallen war.
Gleichgültigkeit hatte sich breitgemacht und alle Gemeinsamkeiten, die sie miteinander verbunden hatten, überwuchert und nach und nach erdrückt.
Als Leo das letzte Mal mit Brigitte geschlafen hatte, kam es ihm schon wie ein kalter, emotionsloser Abschied vor. Sie liebten sich mechanisch und Brigittes vorgespielte Lust empfand er mehr als würdelos. Vielleicht, dachte er, als er mit dem blauen Alessi-Bilderrahmen, der ohne Brigittes Foto auf seinem Schreibtisch stand, spielte, waren wir nur zusammen, weil wir nach außen hin das perfekte Paar abgaben. Und vielleicht kann oder will deswegen auch niemand verstehen, dass es aus ist.
Dietz zog eine Schublade an der Unterseite des Schreibtischs auf, nahm seine Dienstwaffe heraus, legte den Bilderrahmen hinein und schloss die Schublade mit mechanischer Gewohnheit ab. Dann zog er seine Öljacke an – deren Geruch Brigitte immer gestört hatte und die er nun wie zum Trotz fast jeden Tag trug – und steckte die Pistole samt Halfter in die Brustinnentasche. Er fuhr sich mit beiden Händen durch die strubbeligen Haare mit der silbernen Strähne am Stirnansatz, von der jeder glaubte, dass sie gefärbt wäre, gab jedoch schnell den Kampf auf und entschied sich lieber dafür, die grüne Fischer-Wollmütze aufzusetzen.
Er war schon im Gang und wollte gerade die Glastür zum Treppenhaus aufstoßen, als er hörte, wie jemand rief
»Ist Hauptkommissar Dietz noch im Haus? Die Kollegen in Kelheim sind schon ziemlich angefressen und wollen wissen, wie lange sie den Tatort noch absperren müssen. Die Schifffahrtsgesellschaft steht Kopf, weil sie den Verkehr lahmgelegt haben, und am Ufer stehen an die hundert Schaulustige.«
Dietz verdrehte die Augen. Doch anstatt noch einmal umzukehren, rief er nur ans andere Ende des Gangs
»Bin schon weg. Rufen Sie bitte noch einmal an und sagen Sie, in zwanzig Minuten bin ich da.«
Er wusste, dass das sehr knapp veranschlagt war und sprang, jeweils drei Stufen nehmend, die Treppe hinunter, wobei er mit der einen Hand die Jacke nach seinem Handy abtastete und mit der anderen den Defender-Schlüssel aus der Hosentasche fischte.
Tatsächlich kam er nach fünfundzwanzig Minuten in Weltenburg an, wo die vielen Reisebusse und Touristen ihm erst Platz machten, als er das Blaulicht aufs Dach stellte und zweimal die Sirene gellen ließ. Am Kiesstrand vor dem Tor zum Klosterbiergarten warteten ein Polizist und ein Mann mit einem grauen Rauschebart vor einem langen, motorisierten Fischerboot auf ihn, das ihn auf die andere Seite zum Tatort bringen sollte. Der Bärtige schien der Besitzer des Bootes zu sein. Am anderen Ufer schaukelte zwar ein Polizeiboot im Wasser, aber Dietz wusste, dass der Strand hier so flach in den Fluss lief, dass es nicht genug Tiefgang gehabt hätte; und bis zum Anlegesteg der großen Schiffe hätte er noch ein gutes Stück zu Fuß zurücklegen müssen.
Drüben angekommen, taumelte Dietz beim Aussteigen und wäre beinahe ins Wasser gefallen, was ein Obacht des Bärtigen und vielsagendes Grinsen seitens der Beamten hervorrief.
»Hauptkommissar Dietz, Grüß Gott.«, stellte er sich vor.
»…’ß Gott.«, erwiderten die drei Polizisten, von denen aber keiner seinen Namen nannte.
Nur ein Mann, der mit seiner runden Brille, dem getrimmten Dreitagebart und den kurz geschorenen Haaren, auf denen eine winzige, rote Strickmütze saß, wie Eric Clapton aussah, zog sich einen Gummihandschuh ab, reichte Dietz die Hand und stellte sich als Doktor Haas, Pathologe vom Kelheimer Krankenhaus, vor.
»Wer hat in den Tatort eingegriffen?«, fragte Dietz und wies auf den verschlossenen Aluminiumsarg und den daneben liegenden, sorgsam zusammengefalteten blauen Sack.
»Eingegriffen! Was wollen S’ denn?«, sagte der Polizist aus dem Boot, »Dass die tot ist, hat der Doktor schon lang festgestellt und Spuren gibt’s im Wasser eh keine.«
Dietz versuchte, den Ärger, der in ihm aufstieg, so gut wie möglich zu verstecken und sagte ruhig, aber bestimmt
»Welche Spuren hier abgenommen werden und wann die Leiche vom Tatort gebracht wird, bestimme ich, werter Herr Kollege!«
»Hören Sie, das war doch …« Dietz unterbrach ihn unwirsch
»Und wo ist das Bergsteigerseil, von dem Sie den Kollegen am Telefon erzählt haben?«
Der Beamte, der noch vor zwei Minuten so höhnisch gegrinst hatte, schien einige Zentimeter zu schrumpfen, und das Grinsen wich einer tiefen Röte, die von chronisch überhöhtem Blutdruck zeugte. Er murmelte irgendetwas kleinlaut vor sich hin und ging zum Polizeiboot. Er beugte sich über die Reling und zog einen durchsichtigen Plastikbeutel mit dem feinsäuberlich zusammengelegten und verknoteten Seil heraus. Dietz verdrehte die Augen und sah hilfesuchend zu Doktor Haas hinüber, der mit den Schultern zuckte und dabei auf seine Uhr zeigte, als wolle er sagen, dass auch er zu spät gekommen war, um die übereifrigen Polizisten davon abzuhalten, alle Spuren zu verwischen.
»Können Sie noch etwas damit anfangen, Doktor Haas?«, fragte Dietz.
»Ich versuch’s mal.«, sagte der Pathologe, zog seinen zweiten Handschuh wieder an, nahm dem Polizisten den Plastikbeutel aus der Hand und hob den nassen, blauen Sack auf, der in keinen der Plastikbeutel passte.
»Allerdings ist die Kelheimer Pathologie nicht die CSI New York.«, grinste er. »Erwarten Sie keine Offenbarungen von mir.«
Dietz nickte.
»Identität?«, fragte er dann, wobei er den genervten Unterton in seiner Stimme nicht mehr unterdrücken konnte.
»Der Kollege kennt sie.«, sagte der Polizist, dessen Kopf immer noch kurz davor war, zu platzen.
»Das ist die Stadler Michaela. Ihr Vater ist ein guter Freund von mir. Die Familie wohnt in Staubing, das ist gleich hier, bei Weltenburg.«
»Ich kenne Staubing. Meine Eltern sind aus Ihrlerstein. Aufmachen bitte.«
Der Polizist, der sich vorher noch selbst zum Wortführer gemacht hatte, tat so, als müsse er irgendwelche Formalitäten erledigen und fummelte mit dem Rücken zum Kommissar an einem Klemmbrett herum, an das ein voll beschriebenes Blatt geheftet war. Die anderen zwei öffneten den Alusarg.
Der Pathologe nahm seine Brille ab und hauchte hinein. Dann trat er mit dem Kommissar an den Sarg.
»Stadler …?«, fragte Dietz einen der Beamten.
»Michaela.«, kam die Antwort.
Dietz beugte sich über die Tote und hatte sofort den Eindruck, dass irgendetwas an der Leiche anders war als bei allen anderen Toten, die er bei seiner Arbeit schon zu Gesicht bekommen hatte. Was es genau war, konnte er nicht sagen. Womöglich hing es auch mit der beinahe wie gewollt aussehenden Spurenvernichtung der Kollegen zusammen, dachte er sich.
Michaela Stadler muss eine sehr hübsche Frau gewesen sein. Da sie wohl noch nicht allzu lange im Wasser gehangen hatte, konnte man das noch sehr deutlich sehen. Ihre langen, vermutlich welligen, schwarzen Haare klebten ihr in dicken, nassen Strähnen um den schlanken Hals, der wahrscheinlich vor Tagen oder nur Stunden noch einen sportlichen, braunen Teint gehabt hatte. Unter der eng anliegenden Kletterkleidung und dem durchnässten Vliespullover zeichnete sich eine athletische Figur ab. Sie mochte kaum mehr als fünfundzwanzig Jahre alt gewesen sein und hatte etwas von jenem bayerischen und zugleich mediterranen Typ, der Dietz eigentlich recht gut gefiel. Er zog, obwohl er nicht die Absicht hatte, etwas zu berühren, aus seiner Öljacke ein Paar Gummihandschuhe, das noch im Beutel verschweißt war, und streifte sie über seine Hände. Als jedoch der linke Handschuh unter dem Handgelenk aufplatzte, setzten die Polizisten wieder ihre höhnischen Mienen auf.
»War sie schon tot, Doktor Haas, als sie ins Wasser getaucht wurde?«
»Vermutlich ja. Sehen Sie sich ihren Hals an.«
Dietz berührte die Leiche nun doch. Er strich ihr, behutsam, als wolle er ein schlafendes Kind nicht wecken, das dicke, nasse Haar vom Hals und entdeckte zwei tiefe, inzwischen violette Strangulierungsstreifen.
»Scheinbar ist sie ihm fast entkommen.«, sagte der Pathologe. »Denn wie es aussieht, hat er zweimal ansetzen müssen. Ich nehme an, er hat das Bergsteigerseil benutzt, oder zumindest ein Stück davon, mit dem er sie erst heruntergelassen und dann verschnürt hat.«
»Er?«, hakte Dietz nach.
»Auch das ist anzunehmen.«, erwiderte Haas.
»Ich habe er gesagt, weil es meiner Ansicht nach sehr viel Kraft bedarf, die Leiche ausgerechnet an dieser Stelle aufzubauen, wenn ich das so sagen darf. Sehen Sie sich nur einmal die Wand und den Uferbereich an.«
Dietz kannte den Felsen, er hatte ihn sogar schon selbst ein- oder zweimal bestiegen. Und er musste dem Pathologen Recht geben. Um den Sack mit der Toten flussseits anzubinden, hätte der Täter ein Boot gebraucht. Dann hätte er sich auf dem in den Stromschnellen schaukelnden Boot aufstellen müssen und mit der Toten auf den Armen, ohne sich festzuhalten, eineinhalb oder zwei Meter die glatte Felswand emporklimmen müssen – und er hätte dabei riskiert, seine Last an die Donau zu verlieren. Er musste also von oben gekommen sein und sein Opfer am Seil hinuntergelassen haben.
Dietz war mit dem Alpenverein schon mehrfach Hochalpintouren gegangen und wusste, dass eine Frau sehr wohl einen anderen Bergsteiger mehrere Seillängen ablassen kann. Aber erstens wollte er sich nicht aufspielen und zweitens hatte auch er irgendeine Art Intuition, die ihn spüren ließ, dass das Täterprofil mehr auf einen Mann passte.
»Gut. Danke.«, sagte er zu den Polizisten. Sie können den Tatort abbauen. Doktor Haas …«
Er zog die Handschuhe aus und reichte dem Pathologen die Hand.
»Ich werde sobald wie möglich mit der Autopsie beginnen – ich gehe davon aus, dass Sie eine anordnen.«, sagte er mit einem viel sagenden Lächeln. »Der Bericht wird in zwei, drei Tagen fertig sein.«
Dann schüttelte er sich und sagte
»Ich brauche jetzt etwas Warmes.«, und führte dabei seine Hand mit zusammengepresstem Daumen und Zeigefinger zum Mund, als hätte er eine Tasse, vielleicht auch einen Flachmann, in der Hand.
Noch einmal wandte Dietz sich an die Polizisten
»Haben Sie schon ein Fahrzeug gefunden?«
Wieder Blicke, die zu sagen schienen Was will der Spinner denn noch alles?
»Sie wird mit ihrer Kletterausrüstung wohl kaum den Bus genommen haben oder mit dem Fahrrad gefahren sein. Also würde ich an Ihrer Stelle mal da oben nachsehen.«
Dietz wies mit dem Plastikbeutel für die Gummihandschuhe auf den Waldhang oberhalb des Felsens. »Dort oben gibt es doch Parkmöglichkeiten. Rufen Sie mich am Handy an. Hier ist die Nummer. Noch Fragen?«
Natürlich hätte er sich das sparen können.
»Servus.«, sagte er und ging zu dem bärtigen Fährmann, der in seinem Boot saß und mit der Zunge das Papier für seine selbstgedrehte Zigarette befeuchtete.
Als der Defender über die geschotterte Einfahrt an der mächtigen Linde, unter der eine aus einem halben Baumstamm gefertigte Sitzbank stand, vorbei auf das zweistöckige, mit blätterlosem Wein umrankte Bauernhaus zurollte, dachte Leo Dietz, wie ironisch das Leben manchmal sein kann. Als er noch in Ihrlerstein wohnte, war er oft an diesem Hof vorbeigefahren und hatte sich gefragt, wem er wohl gehörte. Jetzt, da er den dunkel lasierten Balkon sah, bildete er sich sogar ein, einmal im Vorbeifahren dort oben eine hübsche, junge, dunkelhaarige Frau stehen gesehen zu haben.
Es war ein stattlicher Hopfenbauernhof und vor der Gerätehalle, an die der Turm mit der Darre anschloss, standen das neueste Kombimodell von Audi, ein BMW-Cabrio und eine größere Enduro. Dietz stellte den Motor ab und ging auf das Haus zu; doch kurz vor dem Stufenpodest drehte er noch einmal um und ging zu den Fahrzeugen hinüber. Der Audi stand da wie frisch ausgeliefert – auf Hochglanz poliert und an der Bereifung konnte man noch die roten und grünen Markierungslinien sehen. Das Cabrio dagegen hatte einige unübersehbare Schrammen und Beulen. Auf dem Beifahrersitz stand ein Karton, der bis zum Rand mit CDs gefüllt war und auf dem Rücksitz lag ein Gitarrenkoffer. Die Enduro war die gleiche Yamaha, die Dietz früher selbst einmal gefahren hatte, und er war sich sicher, dass sie genauso aufgemotzt war wie sein altes Motorrad und alle anderen Geländemaschinen weit und breit. Er musste schmunzeln, als er daran dachte, wie er mit seinen Freunden in der Garage seines Vaters seinen Bock, wie sie ihre Motorräder nannten, frisierte und in der Schule beinahe sitzen geblieben wäre, weil sie jede freie Minute damit verbrachten, in einem stillgelegten Steinbruch Gelände zu fahren. Einmal hatte er sich sogar bei einem verunglückten Sprung von einem Sandhügel das Wadenbein gebrochen.
»Die ist nicht zu verkaufen.«, hörte er eine Stimme hinter sich und drehte sich um.
Vom Haus her kamen ein großer, blonder Mann mit einem rotweißen Lederkombi und eine Frau herüber, die der Toten aus dem Donaudurchbruch wie aus dem Gesicht geschnitten war. Sie trug eine enge Jeans und einen ebenfalls eng anliegenden, bunten Rollkragenpullover. Aus ihrem langen, lockigen Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, fielen Strähnen herab, die sie beim Näherkommen hinter die Bügel ihrer schmalen, schwarzen Brille steckte.
»Nein.«, gab Dietz zurück. »Ich möchte sie nicht kaufen. Ich hatte aber mal die gleiche.«
»Wie können wir Ihnen dann helfen – suchen Sie vielleicht ein Fremdenzimmer? Wir haben leider keine.«, sagte die junge Frau und schielte auf das Regensburger Kennzeichen.
»Nein … danke. Das auch nicht. Mein Name ist Leo Dietz. Kriminalpolizei Regensburg.«
Der große Mann im Lederkombi baute sich vor Dietz auf.
»Hören Sie, die Maschine ist sauber; alles ist zugelassen und vom TÜV abgenommen. Was soll ich denn schon wieder gemacht haben? Suchen S’ wieder einen von uns kriminellen Motorradfahrern?«
Dietz machte eine beschwichtigende Handbewegung.
»Es geht um …«
»Ist was mit Michaela?«, fragte plötzlich jemand ganz dicht neben Dietz, der zusammenzuckte und einem etwa sechzig Jahre alten Mann mit grauem Schurrbart und Filzhut direkt in die blauen Augen sah.
»Könnten wir vielleicht ins Haus gehen?«, fragte Dietz.
Der Mann nickte und stapfte mit seinen klobigen Sicherheitsstiefeln voraus. Die junge Frau wartete schweigend auf Dietz – er sah ihr an, dass ihr plötzlich kalt wurde – und führte ihn ins Haus, während der Motorradfahrer noch schnell seinen Helm an den Lenker der Yamaha hängte und hinterher kam.
Dietz betrat die große, mit Solnhofer Platten ausgelegte Diele, die geradewegs zu einer schweren Eichentreppe führte. Zu beiden Seiten der Diele befanden sich je zwei verschlossene Türen. Der große Kronleuchter warf ein warmes Licht auf eine mit Bauernmalerei verzierte Kommode, über der ein breiter, silberner Spiegel hing. Die Wände waren mit allerlei größeren und kleineren Landschaftsansichten und Fotografien behängt; links neben dem Raum, in den Stadler vorausgegangen war, zierte ein mächtiger Kranz aus Hopfendolden die Wand.
Stadler saß auf einer Eckbank am Kopfende eines ovalen Buchentisches und stellte, mit einem Blick zu seiner Tochter, die zwei Töpfe vom Herd schob und das Gas abdrehte, das unbenutzte Geschirr an den Tischrand. Dietz blieb so lange stehen, bis auch der junge Mann Platz genommen hatte, und zog dann, da niemand etwas sagte, einen Stuhl vom Tisch und setzte sich.
Für ihn waren solche Momente das Schlimmste, was sein Beruf ihm abverlangte. Er sah in bleiche Gesichter, die ihn anflehten, nicht das auszusprechen, weswegen er gekommen war. Und jedes Mal, wenn er den letzten Hoffnungsfunken zertreten musste und sich die Furcht, die aus den Blicken der Menschen sprach, in nacktes Entsetzen verwandelte, fühlte er sich schuldig, wie ein Operateur, dem ein Patient unter dem Skalpell gestorben war.
»Ist sie …«, brach die junge Frau das lange, schwere Schweigen, das den Raum erfüllte und die Decke und die Wände immer enger zusammenzog.
»Ja.« Dietz nickte.
»Wir haben Ihre Tochter«, er sprach in Richtung Stadlers, der seinen Filzhut abgenommen hatte und den Kopf mit dem schütteren Haar in seine langen, sehnigen Hände gestützt hatte, als ob er ganz behutsam ein filigranes Vogelnest hielte, das er nicht zerbrechen wollte,
»beim Kloster gefunden. Es tut mir sehr Leid.
Und, Herr Stadler«, fuhr er fort, obwohl er jetzt zu der jungen Frau hinüber sah, die zweifellos Michaela Stadlers Schwester war,
»Sie … Es war kein Unfall.«
Stadler hob langsam den Kopf und sah an Dietz vorbei zur Tür hinaus.
»Michaela ist offensichtlich das Opfer eines Verbrechens.«
»Wie … meinen … Sie das? Opfer eines Verbrechens?«, fragte der Motorradfahrer schwer atmend und zog gleich darauf ein Asthma-Spray aus seiner Brusttasche und setzte es an den Mund.
»Ich muss Ihnen leider sagen, dass jemand Ihre … Schwester … ermordet hat.«, antwortete Dietz, und merkte sofort an seinem Blick, dass er nicht ihr Bruder war.
»Sie sind der …?«
Er erhielt keine Antwort mehr. Der junge Mann war aus dem Zimmer gestürmt.
»Daniel ist – war – Michaelas Verlobter.«, antwortete die Frau an seiner Statt.
»Entschuldigen Sie bitte, Herr … Dietz. Wir haben uns alle nicht vorgestellt. Ich bin Anna Stadler, Michaelas Schwester. Und das«, sie drehte ihren Kopf halb zur Tür, »ist Daniel Schneider. Sie wollten nächstes Jahr im Sommer heiraten.«
Dietz nahm drei Visitenkarten aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. Dann fasste er noch einmal in seine Öljacke, holte einen Kugelschreiber heraus und notierte etwas auf eine der Karten.
»Das ist die Nummer von Doktor Jahn. Sie ist meine Kollegin, und falls Sie psychologischen Beistand brauchen, kann sie Ihnen sicher helfen.«
Der Vater reagierte nicht. Aber Anna Stadler nahm die Karte mit zitternden Fingern an sich und starrte sie lange an, als könnte sie den Zahlen und Buchstaben entnehmen und verstehen, was mit ihrer Schwester geschehen war.
»Ich kenne Frau Doktor Jahn. Sie war schon einmal bei uns in der Schule und hat … ein … Seminar durchgeführt. – Ich bin Lehrerin am Kelheimer Gymnasium.«, fügte sie erklärend hinzu.
Schließlich fragte sie, ohne den Kopf zu heben
»Müssen wir sie identifizieren?«
»Nein, heute nicht. Aber morgen oder übermorgen müsste es ein Familienmitglied tun.«
»Wo ist sie jetzt?«
»Im Kelheimer Krankenhaus, in der … wir … müssen eine Autopsie durchführen.«
Beide nickten wortlos, Stadler hielt den Kopf in den Händen, aber Dietz konnte sehen, wie seine Knöchel weiß wurden und ihm Tränen über die Handgelenke liefen.
Dietz stand auf und ging zur Tür.
»Rufen Sie mich oder meine Kollegin an, wenn irgendetwas ist – auch wenn es mitten in der Nacht sein sollte.«, sagte er leise, obwohl er wusste, dass niemand anrufen würde. So war es immer.
»Es tut mir wirklich Leid. Gute Nacht.«
Als er zu seinem Defender ging, sah er, dass die Enduro weg war.
Gerade, als er den Motor starten wollte, kam Anna Stadler aus dem Haus gelaufen. Er stieg noch einmal aus und wartete.
»Ich werde morgen meine Schwester identifizieren, wenn das möglich ist.«
Ihre Stimme war zittrig, aber gefasst.
»Ich weiß nur nicht, was ich da tun muss.«
Der Kommissar sah sie lange an.
»Wenn Sie möchten, begleite ich Sie.«, sagte Dietz. »Geht morgen Vormittag für Sie in Ordnung?«
Anna zuckte mit den Schultern.
»Gut, dann werde ich Sie gegen zehn abholen, wenn Ihnen das recht ist.«
»Danke. Sie sind sehr nett.«
Er hatte keine Lust mehr, bis nach Regensburg zu fahren. Morgen war Sonntag und er konnte bei seinen Eltern in Ihrlerstein bleiben. Auf dem Rückweg nach Kelheim sah er immer wieder von weitem die beleuchtete Befreiungshalle durch die Bäume blitzen. Und als er unten in der Stadt war, entschloss er sich, obwohl er schon seit Mittag nichts mehr gegessen hatte und ziemlich hungrig war, kurzerhand, hinaufzufahren.
Es war mittlerweile schon nach neun und der erhabene Klenzebau seit Stunden von den Touristen verwaist. Dietz ließ den Defender mitten auf der Zufahrtsstraße stehen und setzte sich auf die ausladenden Stufen des klassizistischen Tempels, den König Ludwig I. dem Volk aus Dank für die Kämpfe gegen Napoleon erbaut hatte, und der wie eine Krone auf dem sagenumwobenen Michelsberg saß. Früher sollte hier eine bedeutende Keltenstadt gestanden haben, und noch heute zog es Möchtegern-Druiden, Anthroposophen und andere Esoteriker hier herauf, um allerhand Schwingungen und magische Kräfte zu verspüren.
Unter ihm lag die schwarze Donau, um die herum die Lichter von Kelheim funkelten. Ganz im Osten leuchtete der Hafen und gab, jetzt in der Dunkelheit, der Stadt den Anschein, als läge sie irgendwo am Meer.
Dietz stellte seinen Kragen hoch und lehnte müde die Schulter gegen die gemauerte Einfassung der riesigen Treppe. Irgendwo da unten sitzt vielleicht dieses Schwein, dachte er, schaut sich ’Wetten, dass?’ im Fernsehen an und trinkt gemütlich sein Bier. Irgendwo da unten, irgendwo…
Als Leo von Regentropfen, die immer stärker wurden und in immer kürzeren Abständen auf sein Gesicht niederprasselten, aufwachte, war es Viertel vor zwölf. Er hinkte zum Auto, da seine ganze linke Körperhälfte eingeschlafen und jetzt taub war, fuhr wieder die Serpentinen in die Stadt hinunter und nahm die Straße nach Ihrlerstein.