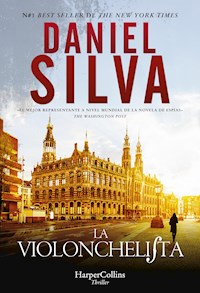8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gabriel Allon
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Volk verehrt sie. Doch ihr Exmann und seine Mutter, die Königin von England, verachten sie. Als eine Bombe sie in den Tod reißt, setzt die britische Regierung alles daran, den Täter zu finden. Dafür benötigen sie die Hilfe eines Mannes: Gabriel Allon, legendärer Agent des israelischen Geheimdienstes. Zusammen mit dem ehemamligen SAS-Offizier Christopher Keller macht er sich daran, die blutige Fährte des verantwortlichen Topterroristen zu verfolgen. Eine Fährte, die Gabriel an den dunkelsten Ort seiner Vergangenheit führt …
"Daniel Silvas "Der englische Spion" ist so gut wie erwartet - wenn nicht besser!" The Huffington Post
"Ein absoluter Blockbuster. Die Welt braucht mehr Männer wie Allon. Und mehr Autoren wie Silva." Bookreporter.com
"Fesselnd und sehr genau, mit viel Detailtreue geschildert, legt man diesen Thriller nur schwer aus der Hand." familien-welt.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Ähnliche
Daniel Silva
Der englische Spion
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Wulf Bergner
HarperCollins®
HarperCollins® Büchererscheinen in der HarperCollins Germany GmbH,Valentinskamp 24, 20354 HamburgGeschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2016 by HarperCollinsin der HarperCollins Germany GmbH
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The English Spy Copyright © 2015 by Daniel Silva erschienen bei: Harper, New York An Imprint of HarperCollins Publishers, L.L.C
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, KölnUmschlaggestaltung: büropecher, KölnRedaktion: Thorben ButtkeTitelabbildung: albertobrian, IakovKalinin/Thinkstock
ISBN eBook 978-3-959-67604-5
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Für Betsy und Andy Lack
und wie immer für meine Frau Jamie
und meine Kinder Lily und Nicholas.
Genug der Tränen; ich will auf Rache sinnen.
Maria Stuart
TEIL EINS
TOD EINER PRINZESSIN
1
GUSTAVIA, SAINT-BARTHÉLEMY
Nichts von alledem wäre passiert, hätte Spider Barnes sich nicht zwei Abende vor dem Auslaufen der Aurora im Eddy’s betrunken. Spider galt als der beste Schiffskoch der gesamten Karibik, cholerisch, aber unersetzlich, ein verrücktes Genie in weißer Jacke und Schürze. Spider, müssen Sie wissen, hatte eine klassische Ausbildung. Spider hatte einige Zeit in Paris gearbeitet. Spider war in London gewesen. Spider hatte New York, San Francisco und einen unglücklichen Zwischenstopp in Miami absolviert, bevor er endgültig aus dem Restaurantgeschäft ausgestiegen war, um die Freiheit der Meere zu genießen. Jetzt arbeitete er auf den großen Charterjachten, wie sie Filmstars, Rapper, Moguln und Angeber charterten, wenn sie imponieren wollten. Und wenn Spider nicht an seinem Herd stand, war er unweigerlich auf einem der besseren Barhocker an Land anzutreffen. Das Eddy’s gehörte zu seinen Top Five im Karibischen Meer, vielleicht zu seinen Top Five weltweit. Er begann den Abend um sieben Uhr mit ein paar Bieren, zog sich um neun Uhr in dem schattigen Garten einen Joint rein und starrte um zehn Uhr grübelnd in sein erstes Glas Vanille-Rum. Mit der Welt schien alles in Ordnung zu sein. Spider war angetrunken und im Paradies.
Dann entdeckte er jedoch Veronica, und der Abend nahm eine gefährliche Wendung. Sie war neu auf der Insel, eine junge Frau, die sich hierher verirrt hatte, eine Europäerin ungewisser Herkunft, die in der Kneipe nebenan Tagesausflüglern Drinks servierte. Aber sie war hübsch – hübsch wie ein Blumenbouquet, bemerkte Spider seinem unbekannten Saufkumpan gegenüber –, und er verlor sein Herz in nur zehn Sekunden an sie. Er hielt um ihre Hand an, was seine bevorzugte Anmache war, und als sie ihn abwies, schlug er ihr stattdessen vor, mit ihm ins Bett zu gehen. Irgendwie hatte er damit Erfolg, und die beiden wurden gesehen, als sie gegen Mitternacht in einen tropischen Wolkenbruch hinaustorkelten. Und dies war das letzte Mal, dass jemand ihn zu sehen bekam: um 0.03 Uhr in einer regnerischen Nacht in Gustavia, nass bis auf die Haut, betrunken und mal wieder verliebt.
Der Skipper der Aurora, einer 47 Meter langen Jacht aus Nassau auf den Bahamas, war ein Mann namens Ogilvy: Reginald Ogilvy, ehemals Royal Navy, ein gütiger Tyrann, auf dessen Nachttisch ein Exemplar des Betriebshandbuchs neben der King-James-Bibel seines Großvaters lag. Er hatte sich nie viel aus Spider Barnes gemacht – aber nie weniger als am folgenden Morgen, als Spider nicht zu der für neun Uhr angesetzten Besprechung von Besatzung und Kabinenpersonal erschien. Dies war keine Routinebesprechung, denn die Aurora wurde auf einen Törn mit einer prominenten Persönlichkeit vorbereitet, deren Identität nur Ogilvy kannte. Er wusste auch, dass zu ihrem Gefolge zwei Leibwächter gehören würden – und dass sie gelinde ausgedrückt anspruchsvoll war, was seine Besorgnis wegen der Abwesenheit seines berühmten Kochs erklärte.
Kapitän Ogilvy informierte den Hafenmeister in Gustavia über die Situation, und der Hafenmeister informierte pflichtgemäß die örtliche Gendarmerie. Zwei Beamte klopften an die Tür von Veronicas Häuschen in den Hügeln, aber auch sie schien spurlos verschwunden zu sein. Als Nächstes suchten sie die Handvoll Orte auf der Insel ab, an denen Betrunkene oder Verzweifelte nach einer Nacht voller Ausschweifungen gewöhnlich strandeten. Ein rotgesichtiger Schwede in Le Select behauptete, Spider an diesem Morgen ein Heineken gezahlt zu haben. Jemand anderer wollte ihn als Strandläufer in Colombier gesehen haben, und es gab einen Bericht – der allerdings nie bestätigt wurde –, in der Wildnis von Toiny habe eine untröstliche Kreatur den Mond angeheult.
Die Gendarmen gingen pflichtbewusst allen Hinweisen nach. Dann suchten sie die Insel von Nord nach Süd, von der Luv- bis zur Leeseite ab, ohne fündig zu werden. Kurz nach Sonnenuntergang trommelte Reginald Ogilvy die Besatzung der Aurora zusammen und teilte ihr mit, Spider Barnes sei verschwunden und müsse schnellstens durch einen geeigneten Mann ersetzt werden. Die Besatzungsmitglieder schwärmten über die Insel aus, suchten in den Hafenrestaurants von Gustavia und fahndeten in den Strandhütten am Grand Cul-de-Sac. Und um neun Uhr abends entdeckten sie an einem ganz unwahrscheinlichen Ort den richtigen Mann.
Er war mitten in der Hurrikansaison auf die Insel gekommen und hatte in Lorient das kleine Holzhaus am Ende der Bucht bezogen. Sein gesamter Besitz bestand aus einem Seesack, einem Stapel Bücher, einem Kurzwellenempfänger und einem klapprigen Motorroller, den er in Gustavia für ein paar Euro und ein Lächeln erstanden hatte. Die Bücher waren dick, gewichtig und gelehrt; das Radio war von einer Qualität, die heutzutage selten geworden war. Saß er spätabends auf seiner baufälligen Veranda und las im Licht einer Petroleumlampe, übertönte Musik das Rascheln der Palmwedel und den Wellenschlag der harmlosen Brandung. Vor allem Jazz und Klassik, manchmal etwas Reggae von Sendern jenseits des Wassers. Immer zur vollen Stunde ließ er sein Buch sinken und hörte aufmerksam die BBC-Nachrichten. Anschließend durchsuchte er die Ätherwellen wieder nach etwas, das ihm gefiel, und bald pulsierten Palmen und Brandung wieder im Rhythmus seiner Musik.
Anfangs war unklar, ob er hier Urlaub machte, auf der Durchreise war, sich versteckt hielt oder die Absicht hatte, auf der Insel sesshaft zu werden. Geld schien keine Rolle zu spielen. Wenn er morgens in die Boulangerie kam, um Brot zu essen und einen Kaffee zu trinken, gab er den Mädchen immer reichlich Trinkgeld. Und wenn er nachmittags in dem kleinen Supermarkt beim Friedhof deutsches Bier und amerikanische Zigaretten kaufte, machte er sich nie die Mühe, das Kleingeld mitzunehmen, das die Registrierkasse automatisch ausspuckte. Sein Französisch war einigermaßen gut, aber er sprach mit einem Akzent, den niemand recht einordnen konnte. Sprach er mit dem Dominikaner, der im JoJo Burger hinter der Theke stand, war sein Spanisch viel besser, aber der Akzent blieb. Die Mädchen in der Boulangerie hielten ihn für einen Australier, aber die Jungs im JoJo Burger tippten auf einen Südafrikaner. Die waren in der gesamten Karibik anzutreffen. Die meisten waren anständige Leute, aber manche von ihnen hatten geschäftliche Interessen, die nichts weniger als illegal waren.
Seine Tage verbrachte er ohne bestimmten Plan, aber doch mit gewisser Regelmäßigkeit. Er frühstückte in der Boulangerie, kaufte am Kiosk in Saint-Jean einen Tag alte englische und amerikanische Zeitungen, joggte ausdauernd am Strand und las unter einem tief ins Gesicht gezogenen Sonnenhut seine dicken Werke über Literatur und Geschichte. Und einmal charterte er ein Angelboot und verbrachte den Nachmittag damit, vor der kleinen Insel Tortu zu schnorcheln. Aber seine Untätigkeit schien nicht freiwillig, sondern erzwungen zu sein. Er wirkte wie ein verwundeter Soldat, der sich danach sehnt, aufs Schlachtfeld zurückzukehren, wie ein im Exil Lebender, der von seiner verlorenen Heimat träumte, wo immer sie liegen mochte.
Wie Jean-Marc Andrée, Zollbeamter am Flughafen, zu berichten wusste, war er aus Guadeloupe kommend mit einem gültigen venezolanischen Pass eingereist, der auf den seltsamen Namen Colin Hernandez ausgestellt war. Offenbar war er das Produkt einer kurzen Ehe zwischen einer anglo-irischen Mutter und einem spanischen Vater. Die Mutter hatte sich als Dichterin geriert; der Vater war in irgendwelche dunklen Geschäfte verwickelt gewesen. Seinen Alten hatte Colin gehasst, aber von seiner Mutter redete er, als sei ihre Heiligsprechung nur noch eine Formsache. Ihr Foto steckte in seiner Geldbörse. Der schwarz gelockte Junge auf ihren Knien sah Colin nicht sehr ähnlich, aber das war dem Lauf der Zeit geschuldet.
In dem Reisepass war sein Alter mit 38 Jahren angegeben, was ungefähr zu stimmen schien, und sein Beruf als „Geschäftsmann“, was so ziemlich alles heißen konnte. Die Mädchen in der Boulangerie vermuteten, er sei ein Schriftsteller auf der Suche nach einer Inspiration. Wie sollte man sonst die Tatsache erklären, dass er fast nie ohne ein Buch anzutreffen war? Aber die Mädchen im Supermarkt stellten die wilde, durch nichts bewiesene Theorie auf, er habe auf Guadeloupe einen Mann ermordet und warte hier auf Saint-Barthélemy den Sturm ab. Der Dominikaner aus dem JoJo Burger, der sich selbst versteckt hielt, fand diese Hypothese lachhaft. Colin Hernandez, behauptete er, sei nur ein weiterer antriebsloser Tagedieb, der von dem Erbe seines Vaters, den er hasste, recht angenehm lebte. Er würde bleiben, bis er sich zu langweilen begann oder seine finanziellen Reserven dahinschmolzen. Dann würde er anderswo hinfliegen, und sie würden zwei, drei Tage später Mühe haben, sich an seinen Namen zu erinnern.
Eines Tages, exakt einen Monat nach seiner Ankunft, kam es zu einer kleinen Veränderung seiner Routine. Nachdem er im JoJo Burger zu Mittag gegessen hatte, ging er in Saint-Jean zum Friseur, und als er den Salon verließ, war seine zottige schwarze Mähne gekürzt, modisch gestylt und frisiert. Als er am Morgen darauf in der Boulangerie erschien, war er frisch rasiert und trug zu seiner Kakihose ein blütenweißes Hemd. Er aß sein gewohntes Frühstück – zwei Scheiben grobes Landbrot mit Butter zu einer großen Schale Milchkaffee – und studierte dabei die Londoner Times vom Vortag. Statt dann wieder nach Hause zu fahren, setzte er sich auf seinen Motorroller und raste nach Gustavia hinein. Und spätestens gegen Mittag wurde endlich klar, wozu der Mann namens Colin Hernandez nach Saint-Barthélemy gekommen war.
Als Erstes sprach er in dem luxuriösen alten Hotel Carl Gustaf vor, dessen Küchenchef nicht mal mit ihm reden wollte, als er hörte, dass er keine Kochlehre gemacht hatte. Die Besitzer des Maya’s wiesen ihn höflich ab, was auch die Inhaber dreier weiterer Restaurants – Wall House, Ocean und La Cantina – taten. Er versuchte es im La Plage, aber das La Plage hatte kein Interesse an ihm. Ebenso erfolglos blieb er im Eden Rock, dem Guanahani, La Crêperie, Le Jardin und Le Grain de Sel, einem einsamen Vorposten über den Salzgärten der Saline. Selbst das La Gloriette, das doch einem politischen Flüchtling gehörte, wollte nichts mit ihm zu schaffen haben.
Ohne sich entmutigen zu lassen, versuchte er sein Glück bei den noch unentdeckten Perlen der Insel: der Snackbar auf dem Flughafen, dem kreolischen Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite und der Pizza-und-Panini-Bude auf dem Parkplatz des Supermarkts L’Oasis. Und dort lächelte ihm das Glück endlich, da er erfuhr, dass der Koch des Le Piment am Vorabend nach einem lange schwelenden Streit wegen langer Arbeitszeiten und schlechter Bezahlung fristlos gekündigt hatte. Nachdem er seine Fähigkeiten in der winzigen Küche des Restaurants demonstriert hatte, war er ab vier Uhr nachmittags auf Probe angestellt. Die erste Schicht absolvierte er gleich an diesem Abend, und die Gäste waren des Lobes voll.
Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis die Nachricht von seinen erstaunlichen Kochkünsten auf der kleinen Insel die Runde machte. Le Piment, das früher nur Einheimische als Stammgäste gehabt hatte, war bald voller neuer Gäste, die alle ein Loblied auf den geheimnisvollen neuen Koch mit dem merkwürdigen anglo-spanischen Namen sangen. Das Carl Gustaf wollte ihn abwerben, aber es blitzte ebenso ab wie das Eden Rock, das Guanahani und das La Plage. Deshalb war Reginald Ogilvy, Kapitän der Aurora, pessimistisch gestimmt, als er am Abend nach Spider Barnes’ Verschwinden im Le Piment aufkreuzte. Weil er nicht reserviert hatte, musste er eine gute halbe Stunde an der Bar warten, bevor er einen Tisch bekam. Er bestellte drei Appetithäppchen und drei Vorspeisen. Nachdem er von allem gekostet hatte, ließ er den Koch bitten, kurz an seinen Tisch zu kommen. Zehn Minuten verstrichen, bevor sein Wunsch in Erfüllung ging.
„Hungrig?“, fragte der Mann namens Colin Hernandez mit einem Blick auf die Teller vor Ogilvy.
„Eigentlich nicht.“
„Wozu sind Sie dann hier?“
„Ich wollte sehen, ob Sie wirklich so gut sind, wie die Leute sagen.“
Als Nächstes streckte Ogilvy ihm die Hand hin und stellte sich mit Dienstgrad, Familienname und dem Namen seiner Jacht vor. Der Mann namens Colin Hernandez zog fragend eine Augenbraue hoch.
„Die Aurora ist Spider Barnes’ Schiff, nicht wahr?“
„Sie kennen Spider?“
„Ich habe mal ein Bier mit ihm getrunken.“
„Da sind Sie nicht der Einzige.“
Ogilvy musterte den vor ihm Stehenden prüfend. Der Mann war kompakt, hart, durchtrainiert. Der scharfe Blick des Engländers erkannte in ihm einen Mann, der auf rauer See zu Hause war. Seine Brauen waren dunkel und dicht; sein kantiges Kinn wirkte energisch. Ein Gesicht, das einiges aushalten konnte, fand Ogilvy.
„Sie sind Venezolaner“, sagte er.
„Sagt wer?“
„Sagen alle, bei denen Sie sich erfolglos als Koch beworben haben.“
Ogilvys Blick wanderte von dem Gesicht zu der auf der Stuhllehne gegenüber ruhenden Hand. Kein Anzeichen für irgendwelche Tätowierungen, was er als positives Signal betrachtete. Für Ogilvy waren moderne großflächige Tattoos eine Form der Selbstverstümmelung.
„Trinken Sie?“, fragte er.
„Nicht wie Spider.“
„Verheiratet?“
„Nur einmal.“
„Kinder?“
„Himmel, nein.“
„Laster?“
„Coltrane und Monk.“
„Schon mal jemanden umgebracht?“
„Nicht dass ich wüsste.“
Das sagte er mit einem Lächeln, und Reginald Ogilvy lächelte seinerseits.
„Ich frage mich, ob ich Sie von alledem weglocken könnte“, sagte er mit einer Handbewegung, die das bescheidene Lokal unter freiem Himmel umfasste. „Ich bin bereit, Ihnen ein großzügiges Salär zu zahlen. Und wenn wir nicht auf See sind, haben Sie reichlich freie Zeit, um zu tun, was immer Sie tun, wenn Sie nicht kochen.“
„Wie großzügig?“
„Zweitausend pro Woche.“
„Wie viel hat Spider verdient?“
„Drei“, antwortete Ogilvy nach kurzem Zögern. „Aber Spider war schon in der zweiten Saison bei mir.“
„Jetzt ist er weg, nicht wahr?“
Ogilvy dachte angelegentlich nach. „Also gut, drei“, sagte er dann. „Aber Sie müssten sofort anfangen.“
„Wann laufen Sie aus?“
„Morgen früh.“
„Dann“, sagte der Mann namens Colin Hernandez, „werden Sie mir vier zahlen müssen.“
Reginald Ogilvy, Kapitän der Aurora, betrachtete die vor ihm stehenden Teller, bevor er sich erhob. „Acht Uhr“, sagte er. „Seien Sie rechtzeitig da.“
François Soubies, der quecksilbrige, in Marseille geborene Inhaber des Le Piment, nahm die Kündigung nicht gelassen hin. Er reagierte mit einer Flut von Flüchen und Verwünschungen im maschinengewehrartigen Patois des Südens. Er drohte sogar mit Vergeltung. Und dann passierte es, dass eine ziemlich gute Flasche Bordeaux an einer Wand der winzigen Küche in tausend Scherben zerschellte. Später leugnete François, sie seinem hinausgehenden Koch nachgeworfen zu haben. Aber die Serviererin Isabelle, eine Augenzeugin des Vorfalls, widersprach seiner Version der Ereignisse. François, schwor sie, habe mit der Flasche direkt auf den Kopf von Monsieur Hernandez gezielt. Und dieser sei dem Wurfgeschoss mit einer so blitzschnellen Kopfbewegung ausgewichen, dass das Auge ihr kaum habe folgen können. Anschließend habe er François mit einem langen kalten Blick gemustert, als denke er darüber nach, wie er ihm am besten das Genick brechen könne. Dann habe er gelassen seine fleckenlos weiße Schürze abgelegt und sei mit seinem Motorroller davongefahren.
Den Rest dieser Nacht verbrachte er im Licht seiner Petroleumlampe lesend auf der Veranda des Holzhauses. Und zu jeder vollen Stunde ließ er sein Buch sinken und hörte die BBC-Nachrichten, während die Palmwedel in der Nachtbrise raschelten und harmlose Brandungswellen sich am Strand brachen und wieder abliefen. Am Morgen duschte er nach einem erfrischenden Bad im Meer, zog sich an und packte seine Habseligkeiten in den Seesack: seine Kleidung, seine Bücher, sein Radio. Außerdem packte er zwei Dinge ein, die auf Île de la Tortue für ihn zurückgelassen worden waren: eine 9-mm-Pistole der russischen Marke Stetschkin mit aufgeschraubtem Schalldämpfer und ein dreißig mal fünfzig mal zehn Zentimeter großes rechteckiges Paket. Dieses Paket wog genau fünfzehn Pfund. Er steckte es in die Mitte des Seesacks, damit er ausbalanciert blieb, wenn er getragen wurde.
Um halb acht Uhr verließ er die Bucht von Lorient zum letzten Mal und fuhr, den Seesack auf den Knien liegend, nach Gustavia hinein. Die Aurora lag in der Morgensonne glänzend am Ende des Hafens. Er ging um zehn vor acht an Bord und bekam von seinem Sous-Chef, einer mageren jungen Engländerin mit dem ungewöhnlichen Namen Amelia List, seine Kajüte gezeigt. Dort verstaute er seine Habseligkeiten – auch die Stetschkin-Pistole und das fünfzehn Pfund schwere Paket – in dem Wandschrank und zog die gestreifte Hose und die weiße Kochjacke an, die auf seiner Koje für ihn bereitlagen. Als er die Kabine wieder verließ, wartete draußen Amelia auf ihn. Sie begleitete ihn in die Kombüse und führte ihn durch die Vorratskammer, den Kühlraum und den klimatisierten Lagerraum für Wein. Dort im kühlen Halbdunkel des Weinkellers dachte der Mann namens Colin Hernandez erstmals lüstern an die junge Engländerin in der leicht gestärkten weißen Uniform. Er tat jedoch nichts, um diesen Gedanken zu verdrängen. Er hatte so viele Monate enthaltsam gelebt, dass er sich kaum erinnern konnte, wie es war, das glänzende Haar einer Frau zu streicheln oder eine dargebotene Brust zu umfassen.
Wenige Minuten vor zehn Uhr kam eine Durchsage aus den Bordlautsprechern, die Besatzung solle auf dem Achterdeck antreten. Der Mann namens Colin Hernandez folgte Amelia List nach draußen und stand neben ihr, als zwei schwarze Range Rover am Heck der Aurora hielten. Aus dem ersten stiegen zwei kichernde junge Frauen, die beide einen Sonnenbrand hatten, und ein blasser, schwammiger Mann Anfang vierzig, der die Riemen eines rosa Beach Bags in einer Hand und den Hals einer offenen Champagnerflasche in der anderen hielt. Aus dem zweiten Rover sprangen zwei sichtbar durchtrainierte Männer, denen wenig später eine Frau folgte, die an lebensbedrohlicher Melancholie zu leiden schien. Sie trug ein pfirsichfarbenes Kleid, das sie halb nackt wirken ließ, einen breitkrempigen Hut, der ihre schmalen Schultern beschattete, und eine riesige dunkle Sonnenbrille, die große Teile ihres Porzellangesichts verdeckte. Trotzdem war sie unverkennbar. Ihr Profil verriet sie – das Profil, das Modefotografen und die Paparazzi, die sie auf Schritt und Tritt verfolgten, so bewunderten. Aber an diesem Morgen waren keine Paparazzi anwesend. Sie hatte es ausnahmsweise geschafft, ihnen zu entwischen.
Sie kam an Bord der Aurora, als steige sie über ein offenes Grab hinweg, und schritt an der angetretenen Besatzung vorbei, ohne sie eines Wortes oder Blickes zu würdigen. Dabei kam sie dem Mann namens Colin Hernandez so nahe, dass er den Drang unterdrücken musste, sie zu berühren, um sich davon zu überzeugen, dass sie kein Hologramm war, sondern wirklich existierte. Fünf Minuten später legte die Aurora ab, und mittags war die verzauberte Insel Saint-Barthélemy nur mehr ein braun-grüner Klumpen am Horizont. Topless in einem Liegestuhl auf dem Vordeck ausgestreckt, mit einem Drink in der Hand, ihre makellose Haut in der Sonne bräunend, lag die berühmteste Frau der Welt. Und ein Deck unter ihr war der Mann, der sie ermorden würde, damit beschäftigt, Kanapees mit Thunfischsalat, Essiggurken und Ananas zuzubereiten.
2
VOR DEN INSELN UNTER DEM WINDE
Jeder kannte die Story. Und selbst diejenigen, die sich angeblich nicht für sie interessierten oder sich verächtlich über die Verehrung äußerten, die ihr weltweit entgegengebracht wurde, kannten alle schäbigen Einzelheiten. Sie war das schüchterne schöne Mädchen aus einer mittelständischen Familie in Kent, das es geschafft hatte, in Cambridge studieren zu dürfen, und er war der blendend aussehende, etwas ältere zukünftige englische König. Die beiden waren sich auf dem Campus bei einer Diskussionsveranstaltung über den Klimawandel begegnet, und der Thronfolger – so wollte es die Legende – hatte sich augenblicklich in sie verliebt. Ihre dann folgende längere Beziehung verlief still und diskret. Das Mädchen wurde von den Leuten des Kronprinzen unter die Lupe genommen, der zukünftige König von ihrer Familie. Schließlich brachte eines der übleren Boulevardblätter ein Foto, auf dem die beiden Hand in Hand das alljährliche Sommerfest des Herzogs von Rutland auf Schloss Belvoir verließen. Der Buckingham-Palast bestätigte in einer dürren Pressemitteilung das Offenkundige: Der Thronfolger und das Bürgermädchen ohne blaues Blut in den Adern waren ein Paar. Und einen Monat später, als die Boulevardpresse sich mit Gerüchten und Spekulationen überschlug, gab der Palast bekannt, der zukünftige König und das Mädchen aus dem Mittelstand würden heiraten.
Die Trauung fand in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale an einem Junimorgen statt, an dem in ganz Südengland schauriges Regenwetter herrschte. Als die Ehe dann später scheiterte, schrieben einige englische Journalisten, sie habe von Anfang an unter einem schlechten Stern gestanden. Nach Temperament und Herkunft war das Mädchen ganz ungeeignet für ein Leben im königlichen Goldfischglas, und der Kronprinz war aus genau denselben Gründen ungeeignet für die Ehe. Er hatte zahlreiche Affären – mehr, als man zählen konnte –, und seine junge Gattin rächte sich dadurch, dass sie mit einem ihrer Leibwächter ins Bett ging. Als der Thronfolger von dieser Affäre erfuhr, sorgte er dafür, dass ihr Liebhaber auf einen einsamen Außenposten in Schottland versetzt wurde. Die verzweifelte junge Frau unternahm einen Selbstmordversuch mit Schlaftabletten und wurde mit Blaulicht in die Notaufnahme des St.-Annes-Krankenhauses eingeliefert. In einer Pressemitteilung gab der Buckingham-Palast bekannt, sie habe nach einem grippalen Infekt an Flüssigkeitsmangel gelitten. Als Journalisten nachfragten, warum ihr Gatte sie nicht im Krankenhaus besucht habe, murmelte der Palastsprecher etwas von Terminüberschneidungen. Somit warf die Pressemitteilung mehr Fragen auf, als sie beantwortete.
Bei ihrer Entlassung konnten die Beobachter der Royals sehen, dass mit der schönen Frau des zukünftigen Königs keineswegs alles in Ordnung war. Trotzdem erfüllte sie ihre ehelichen Pflichten, indem sie ihm zwei Kinder schenkte, einen Sohn und eine Tochter, die beide nach schwierigen Schwangerschaften vorzeitig geboren wurden. Zum Dank dafür kehrte der Kronprinz zu einer früheren Geliebten zurück, der er früher einmal die Ehe versprochen hatte, und die Prinzessin revanchierte sich dafür, indem sie zu einer Weltberühmtheit aufstieg und damit sogar die Königin, ihre heiligengleich verehrte Schwiegermutter, in den Schatten stellte. Obwohl Rudel von Reportern und Fotografen jedes Wort und jede Bewegung aufzeichneten, während sie im Dienst humanitärer und ökologischer Projekte die ganze Welt bereiste, schien niemand zu merken, wie oft sie am Rand eines Nervenzusammenbruchs stand. Schließlich erschien mit ihrem Einverständnis und unauffälliger Mithilfe ein Enthüllungsbuch, das alles preisgab: die unzähligen Affären ihres Gatten, ihre anfallartigen Depressionen, die Selbstmordversuche, ihre Essstörungen als Folge des ständigen Drucks der Medien und der Öffentlichkeit. Der wütende Thronfolger versorgte ausgewählte Journalisten mit Informationen über das oft erratische Benehmen seiner Gattin. Dann folgte der entscheidende Schlag: die Veröffentlichung der Aufzeichnung eines leidenschaftlichen Telefongesprächs der Prinzessin mit ihrem gegenwärtigen Liebhaber. Nun hatte die Königin genug. Weil sie die Monarchie in Gefahr sah, forderte sie das Paar auf, sich schnellstens scheiden zu lassen. Vier Wochen später waren die beiden geschieden. Der Buckingham-Palast sprach ohne die geringste Ironie von einer Scheidung „in freundschaftlichem Einvernehmen“.
Die Prinzessin durfte ihre Wohnung im Kensington-Palast behalten, war aber nun keine Königliche Hoheit mehr. Die Königin bot ihr einen zweitrangigen Titel an, den sie jedoch ablehnte, weil sie lieber wieder ihren Mädchennamen tragen wollte. Sie verzichtete sogar auf ihre Personenschützer von Scotland Yards Abteilung SO14, in denen sie mehr Spione als Leibwächter sah. Der Palast beobachtete weiter unauffällig ihre Reisen und die Leute, mit denen sie sich umgab; das tat auch der britische Geheimdienst, der sie allerdings als zwar lästig, aber für die Monarchie nicht wirklich gefährlich einstufte.
In der Öffentlichkeit war die Prinzessin das schöne Gesicht globaler Mildtätigkeit. Hinter geschlossenen Türen trank sie jedoch zu viel und umgab sich mit einem Gefolge, das ein Vertrauter der Königin als „Europack“ bezeichnete. Auf dieser Kreuzfahrt war ihr Gefolge allerdings kleiner als gewöhnlich. Die beiden jungen Frauen mit dem Sonnenbrand waren Freundinnen aus ihrer Kindheit; der Mann, der mit der offenen Champagnerflasche an Bord der Aurora kam, war Simon Hastings-Clarke, der grotesk reiche Viscount, der ihr den Lebensstil ermöglichte, an den sie sich gewöhnt hatte. Es war Hastings-Clarke, in dessen Privatjets sie durch die Welt flog, und Hastings-Clarke, der ihre Leibwächter bezahlte. Die beiden Männer, die sie in die Karibik begleiteten, waren Angestellte eines privaten Sicherheitsdiensts in London. Vor dem Auslaufen aus Gustavia hatten sie die Aurora und ihre Besatzung flüchtig inspiziert. Dem Mann namens Colin Hernandez hatten sie nur eine einzige Frage gestellt: „Was gibt’s zum Lunch?“
Auf Wunsch der ehemaligen Prinzessin gab es ein leichtes Büfett, für das sich jedoch weder sie noch ihre Begleiter sonderlich zu interessieren schienen. An diesem Nachmittag tranken sie alle viel und sonnten sich auf dem Vordeck, bis ein Regenschauer sie lachend in ihre Kabinen flüchten ließ. Dort blieben sie bis neun Uhr abends, um sich dann wie für eine Gartenparty in Somerset gekleidet und zurechtgemacht auf dem Achterdeck einzufinden. Nach Cocktails und Kanapees wurde im großen Salon das Dinner serviert: Salat mit Trüffelvinaigrette, danach Hummer-Risotto und Lammkarree mit Artischocken, geriebener Zitronenschale, Zucchini und Nelkenpfeffer. Die ehemalige Prinzessin und ihre Begleiter fanden das Dinner köstlich und verlangten, den Küchenchef zu sehen. Als er endlich kam, feierten sie ihn mit kindisch wirkendem Applaus.
„Und womit verwöhnen Sie uns morgen?“, fragte die ehemalige Prinzessin.
„Das ist eine Überraschung“, antwortete er mit seinem seltsamen Akzent.
„Oh, gut“, sagte sie und bedachte ihn mit dem Lächeln, das er von unzähligen Magazintiteln kannte. „Ich liebe Überraschungen!“
Die Aurora kam mit einer nur achtköpfigen Besatzung aus, daher mussten der Koch und seine Assistentin sich um das Porzellan, die Gläser, das Silber, die Töpfe und Pfannen und die Küchengeräte kümmern. Als die ehemalige Prinzessin und ihre Begleiter längst zu Bett gegangen waren, standen sie noch nebeneinander an dem langen Spülbecken. Ihre Hände berührten sich gelegentlich in dem warmen Wasser, und Amelias knochige Hüfte drückte an seinen Oberschenkel. Und als sie sich einmal an ihm vorbeizwängte, um an den Wäscheschrank zu gelangen, zogen ihre aufgerichteten Brustspitzen zwei Linien über seinen Rücken und schickten einen Stromstoß in seinen Schritt. Sie zogen sich allein in ihre Kabinen zurück, aber wenige Minuten später wurde leise an seine Tür geklopft. Sie nahm ihn, ohne den geringsten Laut von sich zu geben. Er kam sich vor, als liebe er eine Stumme.
„Vielleicht war das ein Fehler“, flüsterte sie ihm danach ins Ohr.
„Wie kommst du darauf?“
„Weil wir noch lange zusammenarbeiten werden.“
„Nicht so lange.“
„Du willst nicht bleiben?“
„Kommt darauf an.“
„Worauf?“
Er sagte nichts mehr. Sie legte den Kopf auf seine Brust und schloss die Augen.
„Du kannst nicht bleiben“, sagte er.
„Ich weiß“, antwortete sie schläfrig. „Nur für ein paar Minuten.“
Während Amelia List mit dem Kopf auf seiner Brust schlief und die Aurora sich kaum merklich unter ihm hob und senkte, lag er noch lange unbeweglich wach und ging in Gedanken seinen Plan für die bevorstehenden Ereignisse durch. Um drei Uhr stand er schließlich auf, ohne Amelia zu wecken, und trat nackt an den Wandschrank. Er zog sich lautlos an: schwarze Hose, schwarzer Wollpullover und dunkle Gore-Tex-Jacke. Dann packte er das Paket aus, das dreißig mal fünfzig mal zehn Zentimeter große Paket, das genau fünfzehn Pfund wog, schaltete die Stromversorgung ein und aktivierte den Zeitzünder. Als er das Paket in den Schrank zurücklegte und nach der Stetschkin-Pistole griff, hörte er, wie Amelia sich hinter ihm bewegte. Er drehte sich langsam um und starrte sie im Halbdunkel an.
„Was war das?“, fragte sie.
„Schlaf weiter.“
„Ich habe ein rotes Licht gesehen.“
„Das war mein Radio.“
„Wieso hörst du um drei Uhr morgens Radio?“
Bevor er antworten konnte, wurde die Nachttischlampe angeknipst. Amelias Blick streifte seine dunkle Kleidung, bevor sie erschrocken die Pistole mit Schalldämpfer in seiner Hand anstarrte. Als sie schreien wollte, war er bereits heran und bedeckte ihren Mund mit einer Hand, sodass sie keinen Ton herausbrachte. Während sie darum kämpfte, sich aus seinem Griff zu befreien, flüsterte er ihr beruhigende Worte ins Ohr. „Keine Angst, Liebling“, sagte er leise. „Es tut fast nicht weh.“
Ihre Augen weiteten sich erschrocken. Dann drehte er ihren Kopf mit einem scharfen Ruck nach links, sodass ihre Halswirbelsäule brach, und hielt sie sanft in den Armen, als sie starb.
Reginald Ogilvy übernahm üblicherweise nicht die unbeliebte Mittelwache, aber die Sorge um das Wohl seiner berühmten Passagierin hatte ihn an diesem frühen Morgen auf die Brücke der Aurora getrieben. Er saß mit einem Becher Kaffee in der Hand am Computer und sah sich die Wettervorhersage für den kommenden Tag an, als der Mann namens Colin Hernandez ganz in Schwarz den Niedergang heraufkam. Der Kapitän hob den Kopf und fragte scharf: „Was machen Sie hier?“ Aber die einzige Antwort waren zwei Schüsse aus der schallgedämpften Stetschkin, die sein Uniformjackett und das Herz darunter zerfetzten.
Der Kaffeebecher zerschellte am Boden; Ogilvy, der bereits tot war, sackte daneben zusammen. Der Killer trat ruhig an das automatische Navigationssystem, nahm eine kleine Kursänderung vor und stieg wieder den Niedergang hinunter. Das Bootsdeck war verlassen, weil sonst niemand Dienst hatte. Er ließ eines der Zodiac-Schlauchboote zu Wasser, stieg die Strickleiter hinunter und legte von der Jacht ab.
Unter einem Nachthimmel mit leuchtend weißen Sternen dümpelte das Schlauchboot in der leichten Dünung, während er beobachtete, wie die Aurora nach Osten ablief, wo die Schifffahrtsrouten im Atlantik vorbeiführten: steuerlos, als Geisterschiff. Er sah aufs Leuchtzifferblatt seiner Armbanduhr. Als der Stoppuhrzeiger auf null stand, sah er wieder auf. Fünfzehn weitere Sekunden vergingen, in denen er Zeit hatte, über die unwahrscheinliche Möglichkeit nachzudenken, die Bombe könnte defekt sein. Endlich sah er einen Lichtblitz an der Kimm – das grelle Weiß einer Sprengstoffdetonation, dann das Orangerot weiterer Explosionen und des anschließenden Brandes.
Übers Wasser kam ein Grollen wie von fernem Donner. Danach war nur noch der Wellenschlag an der Außenhaut des Schlauchboots zu hören. Er drückte den Anlassknopf des großen Außenborders und beobachtete, wie die Aurora zu sinken begann. Dann ging er mit dem Zodiac auf Westkurs und gab Gas.
3
KARIBIK – LONDON
Der erste Hinweis auf mögliche Probleme war die Meldung von Pegasus Global Charters in Nassau, eine Routineabfrage bei einem ihrer Schiffe, der 47 Meter langen Luxusjacht Aurora, sei unbeantwortet geblieben. Die Einsatzzentrale der Reederei alarmierte sofort alle Frachter, Kreuzfahrtschiffe und Jachten im Seegebiet vor den Inseln unter dem Winde und erhielt binnen Minuten die Nachricht, der Rudergänger eines unter liberianischer Flagge fahrenden Öltankers habe im betreffenden Seegebiet morgens um 3.45 Uhr einen ungewöhnlichen Lichtblitz beobachtet. Wenig später entdeckte die Besatzung eines Containerschiffs eines der Schlauchboote der Aurora, das etwa hundert Seemeilen südsüdöstlich von Gustavia unbemannt im Meer trieb. Fast zur gleichen Zeit stieß eine Segeljacht wenige Meilen weiter westlich auf Schwimmwesten und anderes Treibgut.
Das Pegasus-Management, das nun das Schlimmste fürchtete, rief die Britische Hochkommission in Kingston an und teilte dem Honorarkonsul mit, die Aurora werde vermisst und sei vermutlich gesunken. Anschließend übermittelte die Reederei eine Passagierliste mit dem Mädchennamen der ehemaligen Prinzessin. „Sagen Sie mir, dass sie’s nicht ist“, verlangte der Honorarkonsul ungläubig, aber die Reederei bestätigte, die Passagierin sei tatsächlich die Exgattin des zukünftigen Königs. Der Honorarkonsul rief sofort seine Vorgesetzten im Außenministerium an, die den Vorfall für so schwerwiegend hielten, dass sie Premierminister Jonathan Lancaster wecken ließen, womit die Krise ernstlich begann.
Der Premierminister benachrichtigte den Kronprinzen um halb zwei Uhr morgens, wartete aber bis neun Uhr, bevor er das britische Volk und die Welt informierte. Mit grimmiger Miene vor der schwarzen Tür des Hauses Downing Street Nr. 10 stehend, rekapitulierte er die bis dahin bekannten Tatsachen. Die Exgattin des Thronfolgers war mit Simon Hastings-Clarke und zwei Jugendfreundinnen in die Karibik geflogen. Auf der Ferieninsel Saint-Barthélemy waren sie zu einer einwöchigen Kreuzfahrt an Bord der Luxusjacht Aurora gegangen. Nun war der Funkkontakt zu der Jacht abgerissen; andere Schiffe hatten Treibgut gefunden, das von ihr zu stammen schien. „Wir hoffen und beten, dass die Prinzessin lebend aufgefunden wird“, sagte der Premierminister ernst, „aber wir müssen aufs Schlimmste gefasst sein.“
Am ersten Tag der Suche wurden weder Tote noch Überlebende gefunden. Auch am zweiten und dritten Tag nicht. Nach einem Gespräch mit der Königin gab Premierminister Lancaster bekannt, seine Regierung gehe davon aus, dass die geliebte Prinzessin tot sei. In der Karibik konzentrierten die Suchmannschaften sich jetzt darauf, Wrackteile statt Leichen zu finden. Durch einen glücklichen Zufall dauerte die Suche nicht lange. Nur achtundvierzig Stunden später entdeckte ein Tauchroboter der französischen Marine die Aurora in sechshundert Meter Wassertiefe. Ein Fachmann, der die Videoaufnahmen ausgewertet hatte, stellte fest, die Jacht sei eindeutig als Folge einer Explosion an Bord gesunken. „Die Frage ist nur“, sagte er, „ob das ein Unfall oder Absicht war.“
Eine Mehrheit der Bevölkerung – das zeigten verlässliche Umfragen – weigerte sich zu glauben, die Prinzessin sei wirklich tot. Ihre Hoffnung beruhte auf der Tatsache, dass nur eines der beiden Zodiacs der Aurora gefunden worden war. Bestimmt trieb es noch auf hoher See oder war auf einer unbewohnten Insel gestrandet. Eine übel beleumundete Webseite berichtete, sie sei auf Montserrat gesehen worden. Eine andere behauptete, sie lebe zurückgezogen in Dorset am Meer. Wilde Verschwörungstheorien besagten, ihre Ermordung sei vom Kronrat der Königin beschlossen und vom britischen Geheimdienst MI6 ausgeführt worden. Dessen Chef Graham Seymour stand zunehmend unter Druck, diese Behauptungen öffentlich zurückzuweisen, was er jedoch hartnäckig verweigerte. „Das sind keine Behauptungen“, erklärte er dem Außenminister bei einem Krisengespräch in der weitläufigen Zentrale seines Diensts direkt an der Themse. „Das sind Märchen, die sich Verrückte ausdenken, und ich werde sie keines Kommentares würdigen.“
Für sich selbst war Seymour jedoch schon zu dem Schluss gelangt, die Explosion an Bord der Aurora sei kein Unfall gewesen. Dieser Ansicht war auch der Direktor des sehr fähigen französischen Auslandsnachrichtendiensts DGSE. Die Auswertung der Videoaufnahmen durch die Franzosen hatte ergeben, dass die Aurora durch einen unter Deck gezündeten Sprengsatz versenkt worden war. Aber wer hatte ihn an Bord geschmuggelt? Und wer hatte den Zeitzünder eingestellt? Die DGSE verdächtigte vor allem den Mann, der am Abend vor dem Auslaufen als Ersatz für den verschwundenen Koch der Aurora angeheuert hatte. Die Franzosen übermittelten dem MI6 ein unscharfes Video von seiner Ankunft auf dem Flughafen St. Barth und ein paar körnige Aufnahmen privater Überwachungskameras. Alle zeigten einen auffällig kamerascheuen Mann. „Ich finde, er sieht nicht wie ein Kerl aus, der mit dem Schiff untergehen würde“, erklärte Seymour seinen engsten Mitarbeitern. „Er ist irgendwo dort draußen. Stellt also fest, wer er wirklich ist und wo er sich verkrochen
hat – im Idealfall natürlich vor den Franzosen.“
Der Unbekannte glich einem Flüstern in einer halbdunklen Kapelle, einem losen Faden am Saum eines abgelegten Kleidungsstücks. Sie ließen die Fotos durch die Computer laufen. Und als die Computer kein Ergebnis ausspuckten, fahndeten sie auf altmodische Weise nach ihm: zu Fuß und mit Briefumschlägen voller Geld – natürlich mit US-Geld, denn in den Niederungen der Geheimdienstwelt war der Dollar weiter die Universalwährung. Der MI6-Resident in Caracas konnte keine Spur von ihm finden. Auch nicht von einer poetisch veranlagten anglo-irischen Mutter oder einem geschäftstüchtigen spanischen Vater. Die Adresse in seinem Pass gehörte zu einem unbebauten Slumgrundstück in Caracas; seine letzte bekannte Telefonnummer war längst anderweitig vergeben. Ein Informant bei der venezolanischen Geheimpolizei sagte, er habe gerüchteweise von einer Verbindung nach Kuba gehört, aber eine Quelle beim kubanischen Geheimdienst verwies auf die kolumbianischen Kartelle. „Vielleicht früher mal“, sagte ein unbestechlicher Polizeibeamter in Bogotá, „aber die Verbindung zu den Drogenbaronen hat er längst gekappt. Meines Wissens lebt er mit seiner ehemaligen Geliebten Noriegas in Panama. Er hat mehrere Millionen auf einer dortigen Bank und eine Eigentumswohnung an der Playa Farallón.“ Die ehemalige Geliebte wollte ihn nie gekannt haben, und der Leiter der entsprechenden Bankfiliale, der sich mit zehntausend Dollar hatte bestechen lassen, konnte kein verdächtiges Konto finden. Sein Nachbar in Farallón konnte sich kaum an sein Aussehen erinnern, aber an seine Stimme. „Er hatte einen komischen Akzent“, sagte er. „Als käme er aus Australien. Oder war’s Südafrika?“
Graham Seymour überwachte die Fahndung nach diesem schwer zu fassenden Verdächtigen in seinem behaglichen Büro, dem luxuriösesten Dienstzimmer der Geheimdienstwelt, mit einem englischen Garten als Atrium, einem riesigen Mahagonischreibtisch, den alle seine Vorgänger benutzt hatten, den wandhohen Fenstern mit Blick auf die Themse und der wuchtigen Standuhr, deren Werk kein Geringerer als Sir Mansfield Smith-Cumming, der erste „C“ des britischen Geheimdiensts, konstruiert hatte. Die Pracht seiner Umgebung machte Seymour ruhelos. In früheren Jahren war er ein guter Mann im Außendienst gewesen – nicht beim MI6, sondern bei dem weniger glamourösen Inlandsgeheimdienst MI5 – und hatte sich dort bewährt, bevor er den kurzen Weg vom Thames House nach Vauxhall Cross gegangen war. Beim MI6 gab es Leute, die weiter Ressentiments gegen einen Außenstehenden hegten, aber die meisten betrachteten Seymours Wechsel als eine Art Heimkehr. Sein Vater war ein legendärer MI6-Offizier gewesen, der die Nazis in die Irre geführt und später im Nahen Osten vieles bewegt hatte. Und nun saß sein Sohn auf dem Höhepunkt seiner Karriere hinter dem Schreibtisch, vor dem Seymour der Ältere mit der Mütze in der Hand gestanden hatte.
Mit Macht geht jedoch oft ein Gefühl der Hilflosigkeit einher, und Seymour, der strategisch denkende Edelspion, fiel ihr bald zum Opfer. Als die Fahndung ergebnislos weiterlief und Downing Street und Buckingham-Palast immer mehr Druck ausübten, wurde er zusehends reizbar. Ein Foto der Zielperson lag auf seinem Schreibtisch neben dem viktorianischen Tintenfass und dem Parker-Füller, mit dem er Anmerkungen auf den Rand von Schriftstücken kritzelte. Etwas an diesem Gesicht kam ihm bekannt vor. Seymour vermutete, irgendwo – auf einem anderen Schlachtfeld, in einem anderen Land – hätten ihre Wege sich schon einmal gekreuzt. Dass die Datenbanken seines Diensts diese Möglichkeit ausschlossen, spielte keine Rolle. Seymour traute dem eigenen Gedächtnis mehr als dem irgendeines staatlichen Computers.
Und während seine Agenten falsche Fährten verfolgten und trockene Brunnen aushoben, betrieb Seymour die eigene Fahndung in seinem goldenen Käfig auf dem Dach des Dienstgebäudes im Vauxhall Cross. Als Erstes durchsuchte er sein erstaunliches Gedächtnis, und als es ihn im Stich ließ, forderte er einen Stapel seiner alten MI5-Unterlagen an, die er ebenfalls durcharbeitete. Aber auch darin wurde er nicht fündig. Am Morgen des zehnten Tages schnurrte dann das Telefon auf seinem Schreibtisch unaufgeregt. Der unverwechselbare Klingelton sagte ihm, wer der Anrufer war: Uzi Navot, der Direktor des viel gepriesenen israelischen Auslandsgeheimdiensts. Seymour zögerte, dann hob er vorsichtig den Hörer ans Ohr. Wie immer vergeudete der israelische Geheimdienstchef keine Zeit mit Höflichkeitsfloskeln.
„Ich glaube, wir haben den Mann gefunden, nach dem Sie fahnden.“
„Wer ist er?“
„Ein alter Freund.“
„Von uns oder von Ihnen?“
„Von Ihnen“, antwortete der Israeli. „Wir haben keine Freunde.“
„Können Sie mir seinen Namen sagen?“
„Nicht am Telefon.“
„Wie bald können Sie in London sein?“
Aber Navot hatte bereits aufgelegt.
4
VAUXHALL CROSS, LONDON
Uzi Navot traf an diesem Abend kurz vor 23 Uhr in Vauxhall Cross ein und wurde sofort mit dem Expressaufzug ins Büro des Direktors hinaufbefördert. Er trug einen grauen Anzug, der an seinen breiten Schultern spannte, ein aufgeknöpftes weißes Oberhemd, das seinen säulenförmigen Hals sehen ließ, und eine randlose Brille, die Druckspuren auf dem Sattel seiner Boxernase zurückließ. Auf den ersten Blick hielten nur wenige Navot für einen Israeli oder auch nur für einen Juden, was ihm im Lauf seiner Karriere schon oft genützt hatte. Begonnen hatte er sie als Katsa, wie sein Dienst verdeckt arbeitende Geheimagenten bezeichnete. Navot, der mehrere Sprachen beherrschte und mit einem Stapel gefälschter Pässe ausgestattet war, hatte Terrororganisationen unterwandert und ein weltweites Netzwerk aus Spionen und Informanten aufgebaut. In London war er als Clyde Bridges, europäischer Marketingdirektor einer obskuren Softwarefirma, aufgetreten. In einer Zeit, in der es Seymours Aufgabe gewesen wäre, solche Aktivitäten zu verhindern, hatte er in Großbritannien mehrere erfolgreiche Geheimdienstunternehmen durchgeführt. Trotzdem verübelte Seymour ihm das nicht, denn wechselnde Allianzen waren in der Branche üblich: heute Gegner, morgen Verbündeter.
Navot, der das SIS-Gebäude von häufigen Besuchen kannte, äußerte sich nicht neiderfüllt zu Seymours großartiger Bürosuite. Er ließ sich auch auf keinen Schwatz über Themen von beruflichem Interesse ein, der den meisten Besprechungen unter Geheimdienstchefs vorausging. Seymour wusste recht gut, was hinter der Wortkargheit des Israelis steckte. Navots erste Amtszeit als Direktor näherte sich dem Ende, und sein Ministerpräsident hatte ihn aufgefordert, seinen Sessel für einen anderen zu räumen: einen legendären Agenten, mit dem Seymour schon unzählige Male zusammengearbeitet hatte. Gerüchteweise hieß es, dem Legendären sei es gelungen, Navot zu weiterer Mitarbeit zu bewegen. Seinen Vorgänger im Haus zu behalten war unorthodox, aber der Legendäre hielt wenig von Orthodoxie. Sein Wagemut war seine größte Stärke – und manchmal sein Verderben, fand Seymour.
Navots rechte Pranke umklammerte einen Aktenkoffer aus Edelstahl mit Zahlenschlössern. Jetzt klappte er ihn auf und nahm einen dünnen Aktenordner heraus, den er auf den Mahagonischreibtisch legte. Der Ordner enthielt ein einziges eng beschriebenes Blatt Papier; die Israelis waren stolz auf die lakonische Kürze ihrer Geheimdienstberichte. Seymour las die Betreffzeile. Dann betrachtete er das Foto, das neben seinem Tintenfass lag, und murmelte einen Fluch. Navot, der vor dem Schreibtisch saß, gestattete sich ein flüchtiges Lächeln. Es kam nicht oft vor, dass man dem MI6-Generaldirektor etwas erzählen konnte, das er nicht schon wusste.
„Aus welcher Quelle stammen diese Informationen?“, fragte Seymour.
„Vielleicht von einem Iraner“, antwortete Navot vage.
„Haben wir normalerweise Zugang zu seinem Produkt?“
„Nein“, sagte Navot. „Er gehört uns allein.“
Der MI6, die CIA und der israelische Geheimdienst arbeiteten seit über einem Jahrzehnt eng zusammen, um den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Die drei Dienste waren gemeinsam gegen die nukleare Beschaffungspolitik der Iraner vorgegangen und hatten sich Unmengen technischer Daten und weiterer Informationen geteilt. Nach allgemeiner Überzeugung hatten die Israelis die besten Quellen in Teheran, die sie jedoch zur Verärgerung der Briten und Amerikaner eifersüchtig abschirmten. Wegen der Wortwahl des Berichts vermutete Seymour, Navots Agent gehöre dem iranischen Geheimdienst VEVAK an. VEVAK-Mitarbeiter zu führen war berüchtigt schwierig. Manchmal trafen die Informationen zu, die sie für westliche Währungen verkauften. Und manchmal dienten sie der Taqiyya, dem altpersischen Brauch, eine Absicht zu demonstrieren, während man eine ganz andere verfolgte.
„Glauben Sie ihm?“, fragte Seymour.
„Sonst wäre ich nicht hier.“ Navot machte eine Pause, dann fügte er hinzu: „Und irgendetwas sagt mir, dass auch Sie ihm glauben.“
Als Seymour sich nicht dazu äußerte, zog Navot ein weiteres Schriftstück aus seinem Aktenkoffer und legte es neben das erste. „Die Kopie eines Berichts, den wir MI6 vor drei Jahren übermittelt haben“, erläuterte er. „Wir wussten schon damals von seiner Verbindung zu den Iranern. Und dass er mit der Hisbollah, al-Qaida und allen zusammenarbeitet, die Verwendung für ihn haben.“ Navot fügte hinzu: „In Bezug auf die Leute, mit denen er umgeht, ist unser Freund nicht besonders wählerisch.“
„Das war vor meiner Zeit“, stellte Seymour fest.
„Aber jetzt ist er Ihr Problem.“ Navot tippte auf einen der letzten Absätze. „Wie Sie sehen, haben wir damals vorgeschlagen, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Das wollten wir sogar freiwillig übernehmen. Und wie, denken Sie, hat Ihr Vorgänger auf unser Angebot reagiert?“
„Er hat es offenbar abgelehnt.“
„Er war ungeheuer voreingenommen. Er hat uns nachdrücklich davor gewarnt, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Er hat befürchtet, dadurch würden wir eine Büchse der Pandora öffnen.“ Navot schüttelte langsam den Kopf. „Und nun sitzen wir hier.“
In dem großen Raum herrschte Stille. Das einzige Geräusch war das Ticken von Cs alter Standuhr. Zuletzt fragte Navot ruhig: „Wo waren Sie an diesem Tag, Graham?“
„An welchem Tag?“
„Am fünfzehnten August neunzehnhundertachtundneunzig.“
„Dem Tag des Bombenanschlags?“
Der Israeli nickte.
„Sie wissen verdammt gut, wo ich war“, sagte Seymour. „Ich war beim MI5.“
„Sie waren Chef der Terrorismusbekämpfung.“
„Ja.“
„Was bedeutet, dass Sie dafür zuständig waren.“
Seymour äußerte sich nicht dazu.
„Was ist damals passiert, Graham? Wieso ist er nicht gefasst worden?“
„Fehler wurden gemacht. Schlimme Fehler. Schlimm genug, um Karrieren zu ruinieren, selbst heute noch.“ Seymour schob die Blätter zusammen und gab sie Navot zurück. „Hat die iranische Quelle Ihnen gesagt, warum er’s getan hat?“
„Vielleicht hat er den alten Kampf wieder aufgenommen. Oder er hat im Auftrag anderer gehandelt. So oder so müssen wir uns um ihn kümmern, besser früher als später.“
Seymour gab keine Antwort.
„Unser Angebot steht nach wie vor, Graham.“
„Welches Angebot?“
„Wir erledigen ihn“, antwortete Navot. „Und dann vergraben wir ihn so tief, dass keines der alten Probleme jemals wieder an die Oberfläche kommt.“
Seymour verfiel in nachdenkliches Schweigen. „Es gibt nur einen, dem ich einen Job dieser Art anvertrauen wollen würde“, sagte er zuletzt.
„Das könnte schwierig werden.“
„Wegen der Schwangerschaft?“
Navot nickte.
„Wann soll das Kind kommen?“
„Das ist geheim, fürchte ich.“
Seymour rang sich ein Lächeln ab. „Glauben Sie, dass er sich dazu überreden ließe, den Auftrag zu übernehmen?“
„Alles ist möglich“, sagte Navot ausweichend. „Soll ich ihn in Ihrem Auftrag ansprechen?“
„Nein“, antwortete Seymour. „Das tue ich selbst.“
„Allerdings gibt’s noch ein Problem“, fügte Navot hinzu.
„Nur eines?“
„Über diesen Teil der Welt weiß er nicht viel.“
„Ich kenne jemanden, der sein Führer sein könnte.“
„Er arbeitet nicht mit Unbekannten zusammen.“
„Tatsächlich kennen die beiden sich sehr gut.“
„Ist er beim MI6?“
„Nein“, antwortete Seymour. „Noch nicht.“
5
FLUGHAFEN FIUMICINO, ROM
„Wieso, glaubst du, hat mein Flug Verspätung?“, fragte Chiara.
„Vielleicht liegt’s an einem technischen Problem“, antwortete Gabriel.
„Vielleicht“, wiederholte sie, aber das klang wenig überzeugt.
Sie saßen in einer stillen Ecke der Lounge für die Passagiere der Ersten Klasse. Die sehen auf allen Flughäfen der Welt gleich aus, dachte Gabriel. Ungelesene Zeitungen, halb leere Fläschchen mit zweifelhaftem Pinot grigio, CNN International ohne Ton auf Großbildschirmen. Gabriel hatte geschätzt ein Fünftel seiner Karriere an solchen Orten verbracht. Im Gegensatz zu seiner Frau konnte er außergewöhnlich gut warten.
„Geh und frage das hübsche Mädchen an der Information, warum mein Flug verspätet ist“, verlangte sie.
„Ich habe keine Lust, mit dem hübschen Mädchen an der Information zu reden.“
„Warum nicht?“
„Weil sie nichts weiß und mir einfach etwas erzählen wird, das ich vermutlich hören will.“
„Wieso musst du immer so fatalistisch sein?“
„Das bewahrt mich vor späteren Enttäuschungen.“ Chiara lächelte und schloss müde die Augen. Gabriel sah auf den Großbildschirm. Ein britischer Fernsehreporter mit Helm und schusssicherer Weste berichtete über den neuesten Luftangriff im Gazastreifen. Gabriel fragte sich, wieso CNN eine so große Vorliebe für britische Reporter entwickelt hatte.
Vermutlich lag das an ihrem Akzent. Reportagen mit englischem Akzent klangen immer glaubwürdiger, selbst wenn kein Wort davon wahr war.
„Was sagt er?“, fragte Chiara.
„Willst du’s wirklich wissen?“
„Dann vergeht die Zeit schneller.“
Gabriel kniff die Augen zusammen, um den in kleiner Schrift mitlaufenden Text lesen zu können. „Er sagt, dass ein israelischer Kampfhubschrauber eine Schule angegriffen hat, in der mehrere Hundert Palästinenser Zuflucht gesucht hatten. Er sagt, dass es mindestens fünfzehn Tote und mehrere Dutzend Schwerverletzte gegeben hat.“
„Wie viele davon waren Frauen und Kinder?“
„Anscheinend alle.“
„War die Schule das eigentliche Ziel des Luftangriffs?“
Gabriel schrieb eine SMS auf seinem BlackBerry und schickte sie verschlüsselt in die Zentrale des israelischen Geheimdiensts am King Saul Boulevard in Tel Aviv. Er hatte einen langen, absichtlich irreführenden Namen, der nichts mit seinen wahren Aufgaben zu tun hatte. Für seine Mitarbeiter war er immer nur „der Dienst“.
„Das eigentliche Ziel“, sagte er und sah auf sein Black Berry, „war das Haus gegenüber.“
„Wer wohnt dort?“
„Muhammad Sarkis.“
„Der Muhammad Sarkis?“
Gabriel nickte.
„Lebt Muhammad noch?“
„Leider nicht.“
„Was war mit der Schule?“
„Die ist nicht getroffen worden. Die einzigen Opfer waren Sarkis und Mitglieder seiner Familie.“
„Vielleicht sollte jemand dem Reporter die Wahrheit mitteilen.“
„Was würde das nützen?“
„Wieder fatalistisch“, sagte Chiara.
„Keine Enttäuschungen.“
„Bitte stelle fest, weshalb mein Flug Verspätung hat.“
Gabriel schrieb eine weitere SMS auf seinem BlackBerry. Die Antwort war fast augenblicklich da.
„Eine Rakete der Hamas ist in der Nähe des Flughafens Ben Gurion eingeschlagen.“
„Wie nahe?“
„Gefährlich nahe.“
„Glaubst du, dass das hübsche Mädchen an der Information weiß, dass mein Zielort unter Raketenbeschuss liegt?“
Gabriel gab keine Antwort.
„Weißt du bestimmt, dass du dir das antun willst?“, fragte Chiara.
„Was antun?“
„Soll ich’s wirklich laut sagen?“
„Fragst du, ob ich in solchen Zeiten noch immer Direktor werden will?“
Sie nickte.
„In solchen Zeiten“, sagte er und beobachtete weiter die Rauchwolken und Detonationen auf dem Großbildschirm, „wünsche ich mir, ich könnte im Gazastreifen Seite an Seite mit unseren Jungs kämpfen.“
„Ich dachte, du hättest die Armee gehasst.“
„Das habe ich.“
Chiara wandte sich ihm zu, öffnete ihre grün-golden gefleckten karamellbraunen Augen. Die Jahre hatten ihrer Schönheit nichts anhaben können. Wäre sie nicht hochschwanger gewesen und hätte keinen Ehering am Finger getragen, hätte sie das junge Mädchen sein können, das er vor vielen Jahren im alten Ghetto von Venedig kennengelernt hatte.
„Passend, nicht wahr?“
„Was denn?“
„Dass Gabriel Allons Kinder in Kriegszeiten zur Welt kommen werden.“
„Mit etwas Glück ist dieser Krieg vorbei, bevor sie geboren werden.“
„Da bin ich mir nicht so sicher.“ Chiara sah wieder zur Anzeigetafel hinüber. Hinter dem El-Al-Flug 386 nach Tel Aviv stand weiter VERSPÄTET. „Wenn die Maschine nicht bald startet, werden sie hier in Italien geboren.“
„Kommt nicht infrage.“
„Was wäre daran so schlimm?“
„Wir hatten einen Plan. Und an den halten wir uns.“
„Wenn ich mich recht erinnere“, wandte sie ein, „war geplant, dass wir gemeinsam nach Israel zurückkehren.“
„Richtig“, bestätigte Gabriel. „Aber die Ereignisse wollten es anders.“
„Das tun sie meistens.“
Erst vor drei Tagen hatten Gabriel und Chiara in einer gewöhnlichen Pfarrkirche am Comer See eines der berühmtesten gestohlenen Kunstwerke der Welt aufgespürt: Caravaggios Christi Geburt mit den Heiligen Laurentius und Franziskus. Das stark beschädigte Gemälde befand sich jetzt im Vatikan, um restauriert zu werden, und Gabriel – ein Mann mit einer einzigartigen Kombination von Talenten – wollte die ersten Arbeitsgänge selbst übernehmen. Er war Restaurator, Meisterspion und Auftragsmörder, eine lebende Legende, die einige der erfolgreichsten Unternehmen in der Geschichte des israelischen Geheimdiensts geleitet hatte. Bald würde er wieder Vater und ungefähr gleichzeitig Direktor des Diensts werden. Über Direktoren werden keine Storys geschrieben, überlegte er sich. Storys werden über die Männer geschrieben, die von Direktoren ins Feld geschickt werden, um deren schmutzige Arbeit zu tun.
„Ich weiß wirklich nicht, warum du wegen dieses Gemäldes so stur bist“, sagte Chiara.
„Ich hab’s gefunden, ich will’s restaurieren.“
„Wir haben es gemeinsam gefunden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du unmöglich fertig werden kannst, bevor die Kinder geboren werden.“
„Ich muss nicht unbedingt damit fertig werden. Ich will eigentlich nur …“
„Du willst deine Spur darauf zurücklassen?“
Gabriel nickte langsam. „Vielleicht ist die Geburt Christi das letzte Gemälde, das ich restaurieren kann. Außerdem bin ich’s ihm schuldig.“
„Wem?“
Er gab keine Antwort; er las wieder den in kleiner Schrift mitlaufenden Text.
„Wovon redet er jetzt?“, fragte Chiara.
„Von der Prinzessin.“
„Was ist mit ihr?“
„Die Explosion, nach der die Jacht gesunken ist, scheint ein Unfall gewesen zu sein.“
„Glaubst du das?“
„Nein.“
„Warum behaupten sie dann so was?“
„Um Zeit und Spielraum zu gewinnen, vermute ich.“
„Wofür?“
„Für die Fahndung nach dem Täter.“
Chiara schloss die Augen und lehnte den Kopf an seine Schulter. Ihr kastanienbraunes Haar mit rötlichen Glanzlichtern duftete zart nach Vanille. Gabriel küsste es leicht und atmete seinen Duft ein. Plötzlich wollte er sie nicht mehr allein fliegen lassen.
„Was steht auf der Anzeigetafel neben meinem Flug?“, fragte sie.
„Verspätet.“
„Kannst du nicht etwas tun, um die Sache zu beschleunigen?“
„Du überschätzt meinen Einfluss.“
„Falsche Bescheidenheit steht dir nicht, Darling.“ Gabriel schrieb eine weitere SMS und schickte sie zum King Saul Boulevard. Wenig später vibrierte sein BlackBerry, als die Antwort eintraf.
„Nun?“, fragte Chiara.
„Sieh auf die Anzeigetafel.“
Chiara öffnete die Augen. Hinter dem El-Al-Flug 386 nach Tel Aviv stand weiter VERSPÄTET. Dreißig Sekunden später wechselte die Anzeige auf BOARDING.
„Zu schade, dass du den Krieg nicht ebenso leicht stoppen kannst“, sagte Chiara.
„Das kann nur die Hamas.“
Sie sammelte ihr Kabinengepäck und einen Stapel Hochglanzmagazine ein und stand schwerfällig auf. „Sei ein guter Junge“, sagte sie. „Und denk an die vier goldenen Worte, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet.“
„Such dir einen anderen.“
Chiara lächelte. Dann küsste sie Gabriel überraschend dringlich.
„Komm heim, Gabriel.“
„Bald.“
„Nein“, sagte sie. „Komm jetzt mit.“
„Beeil dich, Chiara. Sonst verpasst du deinen Flug.“
Sie küsste ihn ein letztes Mal. Dann wandte sie sich ohne ein weiteres Wort ab und ging an Bord der Maschine.
Gabriel wartete, bis Chiaras Flugzeug sicher gestartet war, bevor er das Terminal verließ und zu dem chaotischen Flughafenparkhaus weiterging. Seine anonyme deutsche Limousine stand am Ende des dritten Parkdecks – für den Fall, dass er eilig wegfahren musste, rückwärts eingeparkt. Wie immer suchte er den Unterboden nach einer versteckten Haftladung ab, bevor er sich ans Steuer setzte und den Motor anließ. Das Radio plärrte einen italienischen Popsong, einen der seichten Schlager, die Chiara immer vor sich hin trällerte, wenn sie glaubte, niemand höre sie singen. Gabriel stellte einen Nachrichtensender ein, der aber lauter Meldungen aus dem Krieg brachte, sodass er das Radio ausschaltete. Der Krieg hatte Zeit bis später, fand er. In den kommenden Wochen würde er sich nur dem Caravaggio widmen.
Er überquerte den Tiber auf dem Ponte Cavour und fuhr weiter zur Via Gregoriana. Die alte sichere Wohnung des Diensts lag am anderen Ende der Straße unweit der Spanischen Treppe. Er quetschte sein Auto in eine Parklücke entlang des Kantsteins und nahm die 9-mm-Beretta aus dem Ablagefach mit, als er ausstieg. Die kühle Nachtluft roch nach Kochdüften und schwach nach feuchtem Laub – der Geruch von Rom im Herbst. Irgendwie musste Gabriel dabei immer an Tod denken.
Er ging am Eingang seines Gebäudes vorbei, unter der Markise des Hotels Hassler Villa Medici hindurch und bis zur Kirche Santa Trinità dei Monti. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass er nicht beschattet wurde, kehrte er dort um und ging zu seinem Apartmentgebäude zurück. Im Eingangsbereich brannte eine einzige schwache Energiesparlampe; er durchquerte ihren Lichtkreis und stieg die halbdunkle Treppe hinauf. Auf dem dritten Treppenabsatz machte er ruckartig halt: Seine Wohnungstür war nur angelehnt, und drinnen wurden Schubladen aufgezogen und geschlossen. Gabriel zog ruhig die Beretta, die hinten in seinem Hosenbund steckte, und stieß mit dem Lauf langsam die Tür ganz auf. Anfangs war kein Eindringling zu sehen. Dann ging die Tür noch etwas weiter auf, und er erkannte Graham Seymour, der mit einer Flasche Gavi in einer Hand und einem Korkenzieher in der anderen an der Arbeitsfläche in der Küche stand. Gabriel steckte die Pistole weg und trat ein. Dabei dachte er wieder an die vier goldenen Worte.
Such dir einen anderen …
6
VIA GREGORIANA, ROM
„Vielleicht übernehmen Sie das lieber, Gabriel, bevor es einen Verletzten gibt.“
Seymour überließ ihm Flasche und Korkenzieher und blieb an die Arbeitsplatte gelehnt stehen. Zu einer grauen Flanellhose trug er ein Sakko mit Fischgrätenmuster und ein hellblaues Oberhemd mit Umschlagmanschetten. Die Abwesenheit von Assistenten oder Personenschützern legte den Schluss nahe, er sei unter falschem Namen nach Rom gereist. Das war ein schlechtes Zeichen. Heimlich reiste der MI6-Generaldirektor nur, wenn er ein ernstes Problem hatte.
„Wie sind Sie hier reingekommen?“, fragte Gabriel.
Seymour angelte einen Schlüssel aus der Hosentasche. Er baumelte an einem der schlichten schwarzen Anhänger, die die Hausverwaltung des Diensts, die sichere Wohnungen kaufte und betreute, so liebte.
„Woher haben Sie den?“
„Den hat Uzi mir gestern in London gegeben.“
„Und den Code für die Alarmanlage? Den haben Sie vermutlich auch.“
Seymour sagte die achtstellige Zahl auf.
„Das ist ein Verstoß gegen unsere Geheimhaltungsvorschriften.“
„Es hat mildernde Umstände gegeben. Außerdem“, fügte Seymour hinzu, „gehöre ich nach unseren vielen gemeinsamen Unternehmungen praktisch zur Familie.“
„Selbst Familienmitglieder klopfen an, bevor sie ein Zimmer betreten.“
„Das sagen ausgerechnet Sie!“
Gabriel zog den Korken aus der Flasche, schenkte zwei Gläser voll und gab eines davon Seymour. Der Engländer hob seines kaum merklich und sagte: „Auf die Vaterschaft.“
„Es bringt Unglück, auf Kinder zu trinken, die noch nicht geboren sind, Graham.“
„Worauf sollen wir sonst trinken?“
Als Gabriel nichts vorschlug, ging Seymour ins Wohnzimmer hinüber. Ein großes Fenster gab den Blick auf den Kirchturm und das obere Ende der Spanischen Treppe frei. Er blieb einen Augenblick dort stehen und sah über die Dächer hinaus, als bewundere er die sanften Hügel seines Landsitzes von der Terrasse des Herrenhauses aus. Mit schiefergrauen Locken und energischem Kinn war Graham Seymour der Prototyp des britischen Spitzenbeamten: ein Mann, der durch Herkunft, Erziehung und Bildung für Führungspositionen bestimmt war. Er sah gut aus, aber nicht allzu gut; er war groß, aber nicht übertrieben groß. Bei anderen, vor allem bei Amerikanern, rief er Minderwertigkeitskomplexe hervor.
„Wissen Sie“, sagte er jetzt, „Sie sollten sich in Rom wirklich was anderes suchen. Alle Welt kennt diese sichere Wohnung, die folglich keine mehr ist.“
„Mir gefällt die Aussicht.“
„Ich verstehe nicht, weshalb.“
Seymour starrte wieder über die dunklen Dächer hinaus. Gabriel spürte, dass ihn etwas bedrückte. Irgendwann würde er damit herausrücken. Das tat er immer.
„Wie ich höre, ist Ihre Frau heute abgeflogen“, sagte er zuletzt.
„Welche weiteren vertraulichen Informationen haben Sie vom Direktor meines Diensts bekommen?“
„Er hat irgendwas von einem Gemälde gesagt.“
„Das ist nicht irgendein Gemälde, Graham. Es ist der …“
„Caravaggio“, ergänzte Seymour rasch. Dann fügte er lächelnd hinzu: „Sie verstehen sich darauf, Dinge zu finden, nicht wahr?“
„Soll das ein Kompliment sein?“
„Ich denke schon.“
Seymour trank einen Schluck Wein. Gabriel erkundigte sich, was Uzi Navot nach London geführt habe.
„Er hatte Informationen, die er mir zeigen wollte. Ich muss sagen“, fügte Seymour hinzu, „dass er für einen Mann in seiner Lage recht gut gelaunt war.“
„Welche Lage meinen Sie?“
„Die gesamte Branche weiß, dass Uzi auf dem Weg hinaus ist“, antwortete Seymour. „Und er hinterlässt ein schreckliches Chaos. Der gesamte Nahe Osten steht in Flammen, und alles wird noch weit schlimmer werden, bevor es vielleicht besser werden kann.“
„Uzi hat dieses Chaos nicht verursacht.“
„Nein“, stimmte Seymour zu, „das waren die Amerikaner. Der Präsident und seine Berater haben sich zu rasch von den starken Männern Arabiens losgesagt. Jetzt steht der Präsident vor einer aus den Fugen geratenen Welt und hat keine Ahnung, was er dagegen tun soll.“
„Und was würden Sie dem Präsidenten raten, Graham?“
„Ich würde ihm empfehlen, wieder starke Männer aufzubauen. Das hat einmal funktioniert, also kann es noch mal funktionieren.“
„Und auch der König mit seinem Heer rettete Humpty Dumpty nicht mehr.“
„Was wollen Sie damit sagen?“
„Die alte Ordnung liegt in Trümmern und lässt sich nicht wieder aufrichten. Außerdem“, fügte Gabriel hinzu, „hat sie uns Bin Laden und die Dschihadisten beschert.“
„Und wenn die Dschihadisten versuchen, den jüdischen Staat aus dem Haus des Islams zu vertreiben?“
„Das tun sie bereits, Graham. Und falls Sie’s noch nicht gemerkt haben sollten: Auch das Vereinigte Königreich ist ihr Feind. Ob’s uns gefällt oder nicht, wir müssen gemeinsame Sache machen.“
Gabriels BlackBerry vibrierte. Er sah auf das Display und runzelte die Stirn.
„Was gibt’s?“, fragte Seymour.
„Einen weiteren Waffenstillstand.“
„Wie lange wird der wohl halten?“
„Bis er der Hamas lästig wird, nehme ich an.“ Gabriel legte sein Smartphone auf den Couchtisch und musterte Seymour neugierig. „Sie wollten mir gerade erzählen, was Sie in meiner Wohnung machen.“
„Ich habe ein Problem.“
„Wie heißt er?“
„Quinn“, antwortete Seymour. „Eamon Quinn.“
Gabriel überlegte, aber er konnte sich an keinen Mann dieses Namens erinnern. „Ire?“, fragte er.
Seymour nickte.
„IRA?“
„Von der schlimmsten Sorte.“
„Wo ist also das Problem?“
„Ich habe vor langer Zeit einen Fehler gemacht, durch den Leute gestorben sind.“
„Und Quinn war dafür verantwortlich?“
„Quinn hat die Lunte angezündet, aber letztlich war ich der Verantwortliche. Das ist das Wundervolle an unserer Branche. Unsere Fehler holen uns immer ein, und alle Schulden werden irgendwann fällig.“ Seymour hob sein Glas. „Können wir darauf trinken?“
7
VIA GREGORIANA, ROM
Der Himmel war schon den ganzen Nachmittag wolkenverhangen und düster gewesen. Jetzt, kurz vor halb elf, verwandelte ein Wolkenbruch die Via Gregoriana für kurze Zeit in einen venezianischen Kanal. Graham Seymour, der am Fenster stand und beobachtete, wie dicke Regentropfen auf die Terrasse klatschten, war in Gedanken bei dem hoffnungsvollen Sommer des Jahres 1998. Die Sowjetunion existierte nur mehr als Erinnerung. In Europa und den USA herrschte Hochkonjunktur. Die Dschihadisten der al-Qaida waren Themen für Weißbücher und tödlich langweilige Seminare über zukünftige Gefahren. „Damals haben wir uns eingeredet, wir seien am Ende der Geschichte angelangt“, sagte er eben. „Im Unterhaus gab es Abgeordnete, die tatsächlich Security Service und MI6 abschaffen und uns alle auf dem Scheiterhaufen verbrennen wollten.“ Er sah sich über eine Schulter nach Gabriel um. „Das waren Tage voller Wein und Rosen. Und eine Zeit der Illusionen.“
„Nicht für mich, Graham. Ich war damals nicht mehr in der Branche.“
![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)


![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)
![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)