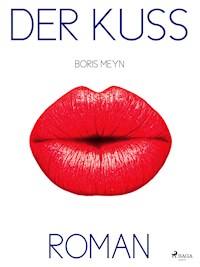4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Sonntag, Herbst und Jensen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Ein starkes Ermittlerteam auf Mörderjagd vor den Toren Hamburgs Frühling im Lauenburgischen – der Raps steht in voller Blüte, und im See des noblen Hockeyclubs schwimmt eine Leiche. Kurz darauf wird auf einem Hochsitz ein Toter gefunden. Die ermittelnden Kommissare brauchen einige Zeit, bis sie erkennen, dass diese scheinbar unverbundenen Fälle zurückführen in die Zeit der deutschen Teilung: Was damals an der Grenze geschah, zeitigt blutige Folgen bis in die Gegenwart …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Ähnliche
Boris Meyn
Der falsche Tod
Ein Fall für Sonntag, Herbst und Jensen
Gewidmet allen (alten) Hockeyspielern, egal, ob in einem Verein zu Hause oder in einem Club
Herbst
Er hatte die Geschwindigkeit der Kugel unterschätzt, aber sein Körper schien sich trotz vieler Jahre Abstinenz zu erinnern, was in einer solchen Situation zu tun war. In allerletzter Sekunde schaffte er es, die richtige Position einzunehmen. ‹Nicht ausweichen›, schien eine innere Stimme zu rufen. Der Rest war ins Erinnerungsvermögen eingebrannt. Ein Bewegungsablauf, dem er sich nicht widersetzen konnte: Füße zusammen, Waffe senkrecht. Leicht nach vorne gebeugt, erwartete er den Aufprall. Für einen kurzen Augenblick setzte sich die Vibration des Holzstocks in seinen Handgelenken fort, dann ruhte die weiße Plastikkugel direkt vor seinem Schläger auf dem Kunstrasen. Es ging also noch. Einen Schritt zurück, den Ball kurz vorgelegt – es war gar nicht so schwierig. Die rechte Hand rutschte mühsam durch das Frottee, mit dem der Griff umwickelt war. Auch die Motorik des Ausholens und Schlagens schien die Jahre unbeschadet überstanden zu haben. Nur das Längenverhältnis zwischen Stock und Körper stimmte nicht mehr, wahrscheinlich lag es an der gebückten Haltung, die man eben mit Mitte vierzig nicht mehr so schnell einnehmen konnte. Das Holz setzte jedenfalls vor der Kugel auf, gab der Masse des Spielers nach und brach mit einem kurzen, splitternden Geräusch auf halber Länge. Verblüfft betrachtete Gero Herbst das kurze Holzstück in seiner Hand, von dem Reste des blauen Griffbandes herabhingen.
«Ich hab mich schon gefragt, wie lange das antiquierte Stück das wohl mitmacht.» Sein Gegenüber kam lachend auf ihn zu. «Die Langkeule war wohl ein Erbstück von deinem Großvater, oder warum guckst du so bekümmert?»
«Eigentlich schade.» Gero sammelte die Reste seines Schlägers zusammen. «Der hat mir früher immer gute Dienste erwiesen.»
Nein, wegschmeißen würde er ihn nicht. Immerhin hatte er mit ihm damals das entscheidende Tor zur Norddeutschen Meisterschaft gegen Braunschweig geschossen. Gero hatte die Bilder noch genau vor Augen. Strafecke zwei Minuten vor Abpfiff wegen Sperrens im Kreis. Es war keine Frage, wer die Ecke ausführte. Niels’ Herausgabe war präzise wie immer. Er sah den Ball noch heute in kurzen Sprüngen über das Gras auf sich zu hoppeln. Stoppen, vorlegen, peilen, eine kurze Drehung, und die Keule peitschte den Ball am Kopf des Keepers vorbei genau unter die Latte. Maßarbeit. Aber das war etwa dreißig Jahre her: Jugend-A anno 1977.Ein wenig Glück war natürlich auch mit im Spiel gewesen. Heute war so etwas nicht mehr erlaubt, wie man ihm erklärt hatte. Strafecken durften aus Sicherheitsgründen nur noch kniehoch geschossen werden. Auch sonst hatte sich eine Menge verändert. Selbst die Abseitsregel hatte man aufgehoben, was aber den älteren Spielern – und dazu zählte sich Gero ohne Frage – entgegenkam. «Ich bin wohl den harten Untergrund nicht so gewohnt.» Als er mit Hockey aufgehört hatte, waren die ersten Kunstrasenplätze gerade im Bau gewesen. Bis dahin wurde ausschließlich auf Naturrasen gespielt.
«So kannst du es natürlich auch sehen, aber Material und Technik haben sich in den letzten zwanzig Jahren schon ein wenig verändert. Mit so einer Krücke kannst du da nichts mehr ausrichten.»
Ein weiterer Mitspieler gesellte sich zu ihnen: «Mit so was spielt doch keiner mehr. Hier!», er drückte ihm seinen Schläger in die Hand. «Versuch es mal damit. Du wirst sehen – ein ganz anderes Gefühl.»
Gero nahm den Schläger entgegen und betrachtete den grünen Schriftzug. Malik J-Turn stand in großen Lettern auf dem Schaft. Die Firma war ihm nicht ganz unbekannt, und was J-Turn bedeutete, lag bei der Form eines Hockeyschlägers ja förmlich auf der Hand. «Ziemlich hart», meinte er nach einigen Probeschlägen und reichte den Schläger zurück.
«Daran gewöhnt man sich.» Der Mitspieler schüttelte den Kopf und deutete auf den Schläger. «Kannst du für heute behalten. Ich habe noch einen Ersatzschläger mit. Neuerdings gibt’s die Dinger auch aus Kunststoff. Die sind dann richtig hart.»
Nach und nach waren immer mehr Spieler zu ihnen gestoßen, und inzwischen bildete man schon eine Gruppe, die sich in zwei Mannschaften aufteilen ließ. Jeder beäugte natürlich den Neuen, der heute zum ersten Mal am Training teilnahm und von dem man sich erhoffte, dass er die Mannschaft in Zukunft auch bei Punktspielen tatkräftig unterstützen würde. Die meisten stellten sich mit einem knappen Handschlag vor, andere nickten nur und nannten ihren Namen.
«Horst– Moin.»
«Rüdiger.»
«Ich bin Pete; Tach auch.»
«Jürgen. Tach!»
Die Hälfte der Anwesenden war wohl noch ein paar Jahre älter als Gero, irgendwo um die fünfzig, einige mochten sogar schon auf die sechzig zusteuern.
«Na, da hat Jo ja gleich einen neuen Kunden», meinte Pete und blickte auf die Überreste von Geros Schläger. «Karatschi King Super, oder?»
«Mit blauem Frottee getunt», feixte Rüdiger.
«Bei Jo im Laden», Pete deutete auf einen gedrungenen Kerl, der etwas abseits stand, «bekommst du als Mannschaftsmitglied ordentlich Prozente auf alles, was dein Hockeyherz begehrt.» Er musterte Gero kurz. «Trikot und eine neue Waffe sollten vorerst reichen. Aber pass auf! Jo schwatzt einem auch gerne etwas auf, neuerdings sogar ganze Golfausrüstungen.»
Den Ball, der Pete in sanftem Bogen entgegenflog, wehrte er geschickt mit dem Schläger ab. «In Ordnung!», rief er in die Runde und zeigte auf den Platz. «Wollen wir dann? Hell gegen Dunkel!» Pete deutete auf die Trikotfarbe und zählte kurz durch. «Und du…?»
«Gero.»
«Gero. In Ordnung. Wie wir alle heißen, wirst du mit der Zeit schon noch mitbekommen. Welche Position spielst du am liebsten?»
«Schiedsrichter.» Einige lachten kurz auf. «Nein. Früher linker Verteidiger.»
«Gut», meinte Pete und machte sich auf in Richtung Mittellinie. «Dann gehst du am besten mit Alfons nach hinten.» Nach ein paar Metern wandte sich Pete nochmals an Gero. «Ach ja, hat man dir sicher schon gesagt: Torschuss im Training natürlich nur flach. Wir spielen ja ohne Torwart.» Ein kurzes Gemurmel setzte ein, dann verteilten sich alle auf dem Platz.
Hauptkommissar Gero Herbst tat sich schwer damit, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu konzentrieren. Hockey hatte ihm schon immer Spaß gemacht. Er grübelte kurz darüber nach, wie er die letzten zwanzig Jahre ohne diesen Sport ausgehalten hatte, kam aber zu keiner plausiblen Erklärung. Dann versuchte er, die Spitz- und Kosenamen seiner Mitspieler den Namen aus dem vereinseigenen Mitgliederverzeichnis zuzuordnen. Das Sekretariat hatte ihm mit dem Aufnahmeantrag zugleich eine Mannschaftsliste der Leeren Krüge, wie sich die Altherrenmannschaft des Krugstädter Tennis-, Hockey- und Golf-Clubs nannte, ausgehändigt, was die Sache natürlich vereinfachte. Die Zuordnung bereitete Gero kaum Schwierigkeiten, wenn der Spitzname sich direkt vom Vor- oder Nachnamen ableiten ließ, zumal es im vorliegenden Fall keine Namensvettern gab. Das war auch in dieser Generation durchaus nicht die Regel, wenn die Modenamen dort auch eher apostolischer Natur waren – Gero erinnerte sich zumindest an zwei Markus und zwei Michaels in seiner Klasse–, was gegenüber den sechs Kevins und drei Mandys in der Klasse seines Sohnes noch vertretbar gewesen war. Aber auch Max hatte eigentlich Finn heißen sollen, und erst als Miriam und Leif ihrem nur wenige Wochen älteren Sohn diesen Namen gegeben hatten, hatten Lena und er einen Rückzieher gemacht. Bis heute war es ihnen immer noch ein Rätsel, wer eigentlich vor zwölf Jahren den Finn-Boom ausgelöst hatte. Wahrscheinlich waren Lena und er damals einfach zu selten ins Kino gegangen.
Bei Pete konnte es sich eigentlich nur um Peter Heumann handeln, Besitzer eines gleichnamigen Autohauses, wie Gero aus einer ganzseitigen Anzeige im Club-Magazin geschlossen hatte, und Jo war mit Sicherheit Joachim Kugler, der ein Sportgeschäft in Ahrensburg betrieb, das ebenfalls eine Werbeanzeige im Magazin geschaltet hatte, jedoch nur einspaltig. Bei Alfons, der neben ihm spielte, musste es sich um Professor Dr.Alfons Blanck, einen bundesweit anerkannten Augenarzt, handeln. Eine Anzeige in der Club-Zeitung hatte er natürlich nicht nötig – aber Lena hatte den Namen richtig einzuordnen gewusst. Traditionell waren überdurchschnittlich viele Ärzte und Akademiker unter Hockeyspielern zu finden. In der Altherrenmannschaft gab es außer Blanck noch drei weitere: Dr.Horst Seipel, Gynäkologe, und Dr.Rüdiger Henne, Zahnarzt, beide in Krugstadt niedergelassen, wie Gero über das Branchenverzeichnis herausgefunden hatte, sowie Dr.Jürgen Gödeke– Beruf bislang unbekannt, aber zumindest promoviert. Ritze war womöglich Erich von Ritzek, ein renommierter Prominenten-Anwalt und zudem Erster Vorsitzender des Krugstädter THGC. Schwieriger war die Zuordnung der sportspezifischen Kosenamen Stecher, Keule und Latte …
Auftritt und Verhalten auf dem Platz ließen jedenfalls keine Rückschlüsse auf Herkunft, gesellschaftliche Stellung und Beruf zu. Auch der Umgangston konnte hier durchaus von der verbalen Zurückhaltung und Diskretion, die bei einigen Berufen unumgänglich war, abweichen. Gerade die Akademiker, die im Alltag eine strenge Etikette wahren mussten, ließen beim Sport und vor allem während der dritten Halbzeit gerne so richtig die Sau raus. Auch Ärzte machten von dieser Form der Kompensation ausgiebig Gebrauch.
Ein Arzt war auch der Grund für Geros Anwesenheit beim Krugstädter THGC. Genau genommen ein toter Arzt. Nach einem rauschenden Fest hier im Clubhaus hatte man Dr.Edgar Möller in den frühen Morgenstunden kopfunter im clubeigenen Badesee treibend gefunden. Ein tragischer Unfall, wie man anfänglich vermutet hatte, schließlich wurden bei der Obduktion über zweieinhalb Promille Alkoholgehalt im Blut festgestellt. Aber Lena, die Möller selbst unter dem Messer gehabt hatte, hatte in der Kopfwunde, von der man anfänglich angenommen hatte, der Tote hätte sie sich beim Sturz zugezogen, einen Splitter gefunden. Die Verletzung war keinesfalls tödlich. Zwar hatte der Schädel eine ziemliche Kerbe, der Mann war aber zweifelsfrei ertrunken, deswegen hatte man dem Splitter zuerst keine besondere Bedeutung geschenkt. Nach dem Laborbericht vom LKA in Kiel sah das jedoch anders aus. Der rote Splitter stammte von der Kunststoffummantelung eines Hockeyschlägers– Marke Malik, wie die genauen Recherchen ergeben hatten. Die moderne Kriminaltechnik war schon erstaunlich.
Die nachträglichen Befragungen hatten nichts gebracht. Niemand hatte konkrete Angaben darüber machen können, ob sich Möller die Verletzung eventuell beim Spiel zuvor zugezogen haben könnte. Auch die Gastmannschaft aus Berlin, zu der der Tote gehörte, hatte nichts Auffälliges bemerkt, weder am Tag noch am Abend. An der Party, die sich bis in den Morgen hingezogen hatte, hatten etwa 60Gäste teilgenommen, gut ein Drittel davon Frauen. Eine genaue Anwesenheitsliste wurde immer noch zusammengestellt. Die Frage, die es zu klären galt, war, ob Möller freiwillig ein nächtliches Bad im Teich genommen oder ihm zuvor jemand mit einem Hockeyschläger auf den Schädel geschlagen und ihn gestoßen hatte. Für Ersteres sprach der Umstand, dass Möller nur mit einer Sporthose bekleidet gefunden wurde, dagegen sprach die Wassertemperatur, die mit knapp 15Grad im April nicht gerade einladend wirkte. Allerdings gab es auch ausgesprochene Kaltschwimmer. Da Möller Arzt war, konnte man voraussetzen, dass er sich der Gefahr bewusst war, in angetrunkenem Zustand nachts baden zu gehen. Bis auf die Wunde am Hinterkopf wies sein Körper keine größeren Blessuren auf, wenn man von einigen blauen Flecken und älteren Prellungen an den unteren Extremitäten und an den Fingern absah, denn das war bei Hockeyspielern nichts Außergewöhnliches.
Eigentlich war es verrückt, was er hier unternahm. Es war die Suche nach einem winzigen Anhaltspunkt, der einen möglichen Verdacht bestätigte. Die offizielle Todesursache Ertrinken rechtfertigte kaum den Sachverhalt einer verdeckten Ermittlung, und anders war sein momentaner Auftrag nicht zu bezeichnen. Zu Zeiten kollektiver Speicheltests und DNA-Analysen war das Ganze so oder so absurd. Eigentlich hätte man sofort sämtliche Hockeyschläger aller Anwesenden beschlagnahmen und eine Laboranalyse durchführen lassen müssen, aber da kein Anfangsverdacht vorgelegen hatte, war das natürlich unterblieben. Und als der Laborbericht fertig gewesen war, hatte die Berliner Mannschaft längst die Heimreise angetreten. Falls also wirklich ein Schläger als echte Waffe missbraucht worden war, hatte der Täter genug Zeit gehabt, das Stück für immer verschwinden zu lassen.
Einzig der Umstand, dass der Lebensgefährte von Dr.Möller dem entfernten Bekanntenkreis von Ines Wissmann zuzurechnen war, hatte dazu geführt, dass Gero nun in seiner Freizeit Überstunden ohne Ausgleich ansammeln durfte. Dr.Ines Wissmann war leitende Staatsanwältin am Amtsgericht Lübeck, und nachdem sie durch eine voreilige Bemerkung von Gero zum Thema Hockey mitbekommen hatte, dass ihr Lieblingskommissar zu Jugendzeiten ebenfalls den Schläger geschwungen hatte, war klar gewesen, wer sich im Verein umsehen sollte. Um die Sache unauffällig und glaubhaft zu untermauern, hatte Kollege Leif seinen Schwiegervater gebeten, als Bürge für das Aufnahmeritual des Vereins herzuhalten. Dieser trieb zwar aktiv längst keinen Sport mehr, aber Freiherr Ernst von Gossewitz war seit mehr als zwanzig Jahren Ehrenmitglied des Krugstädter THGC und hatte wie immer sofort zugestimmt, wenn Leif ihn um etwas bat. Wenn Gero ehrlich war, dann hatte auch er, nachdem ihm Lena von dem ominösen Splitter erzählt hatte, sofort die Möglichkeit eines Gewaltverbrechens in Erwägung gezogen. Anderenfalls hätte er sich auch strikt geweigert, hier den Under-Cover-Agenten zu mimen. Gero konnte nur hoffen, dass ihn niemand aus dem Verein von früher her kannte oder sogar wusste, dass er Kriminalbeamter war. So lange war er noch nicht weg aus Hamburg, und spätestens seit der Angelegenheit in Bad Dürsum war sein Name der Öffentlichkeit nicht ganz unbekannt. Aber Krugstadt lag nicht im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizeistelle Ratzeburg, der er seit nunmehr fünf Jahren vorstand, und die Statistik der Gewaltverbrechen im Lauenburgischen erlaubte es durchaus, dass Hauptkommissar Gero Herbst sich einen dienstlichen Muskelkater zuzog.
So abwegig war der Verdacht eines Gewaltverbrechens nicht. Der Lebensgefährte von Möller, ein Kunstmaler namens Malte Herzog, hatte ausgesagt, sie hätten vor der Reise gehörig Streit gehabt, weil Möller bei dem Spiel jemanden «von früher» wieder sehen wollte. Nun, die Mechanismen der Eifersucht unterschieden nicht zwischen den Geschlechtern. Herzog hatte sicherheitshalber gleich ein bombensicheres Alibi für die Tatzeit mitgeliefert. Wonach Gero also Ausschau zu halten hatte, war bestenfalls ein schwuler Hockeyspieler mit rotem Malik-Schläger. Zumindest von Letzterem hatte er heute Abend schon drei Stück ausgemacht.
Sonntag
Conni folgte dem schmalen Weg am Ufer des Sees und setzte sich auf eine der Bänke, die zwischen den großen Weiden zum Verweilen einluden. Sie war eine gute Stunde zu früh. Genüsslich steckte sie sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. Die Fahrzeit war überraschend kurz gewesen. Gott sei Dank war sie über Land gefahren, denn auf der A24 staute es sich bereits ab fünf Uhr, wie sie wusste, und zwischen den Kleinlastern und tiefer gelegten Rennsportwagen aus Ludwigslust und Parchim, meist voll besetzt mit Handwerkern auf dem Weg nach Hamburg, kam sie sich mit dem kleinen Corsa doch etwas hilflos vor. Annähernd jedes Nummernschild in Richtung Hamburg begann mit LWL oder PCH. Um diese Uhrzeit entvölkerten sich ganze Landstriche, wie man aufgrund dieser Autokennzeichen annehmen musste.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte auch Conni sich noch über den Irrsinn aufgeregt, Arbeitsplätze mit mehr als 100Kilometer Entfernung anzusteuern, zumal mit dem Auto. Nun war sie selbst zu einer Pendlerin geworden. Für die Altstadt von Schwerin war der kleine Flitzer genau das Richtige gewesen, nie hatte sie Schwierigkeiten gehabt, einen Parkplatz zu finden. Jetzt aber würde sie jeden Tag zweimal 50Kilometer fahren müssen. Nun, wenigstens heute hatte sie Glück gehabt. Wäre ja auch noch schöner gewesen, sich gleich am ersten Tag zu verspäten. Aber es war doch an der Zeit, auf ein etwas komfortableres Gefährt umzusteigen, auch weil der Corsa nicht mehr der Jüngste war und langsam von der braunen Pest aufgefressen wurde.
Ein neuer Wagen war immer noch billiger als eine Zweitwohnung vor Ort, denn ihre bisherige Wohnung wollte Conni nicht aufgeben. Zumindest so lange nicht, bis klar war, wie lange sie hier im Lauenburgischen bleiben würde. Die Wohnung war geräumig und im Verhältnis zu den momentanen Mietpreisen fast geschenkt. Auch der Umstand, dass die Wohnung sie ständig an Norbert erinnerte, war zu verschmerzen. Norbert, der Arsch! Nach drei Jahren zurück zu Frauchen. Sie konnte es immer noch nicht fassen. Was hatte seine Eva denn anzubieten, außer den Kindern? Natürlich, sie hatte die Kinder. Dabei hatte sie sich selbst schon fast dazu durchgerungen… Gott sei Dank war es nicht so weit gekommen. Conni versuchte vergeblich, den Kloß im Hals herunterzuschlucken. Verdammt, warum regte sie sich eigentlich immer noch dermaßen darüber auf! Das Thema Norbert war doch nun wirklich abgehakt. Ihr Blick schweifte über den See.
Natürlich wäre ihr eine anonyme Großstadt lieber gewesen. Hätte sie die Stelle in Hamburg bekommen, wäre der Umzug klar gewesen. Aber jetzt? So etwas wie eine Heimat brauchte sie doch. Die Absage aus Hamburg war kurz und schmerzlos gewesen, und sie hatte sich sofort damit abgefunden. Wenn das Ganze nicht auf dem verkürzten Dienstweg abgelaufen wäre, hätte sie bestimmt ein Foto beilegen können, und dann hätte sie jede Wette angenommen, dass die Sache augenblicklich unter Dach und Fach gewesen wäre. Mit ihren Körpermaßen, den blonden Haaren und einem Kampfgewicht von 70Kilo bei einer Größe von ein Meter achtzig war sie zumindest kein Weggucker. Bei der Polizei entsprach man als Frau in der Regel einem anderen Typus. Aber eine Einstellung aufgrund ihrer körperlichen Vorzüge? Das hatte sie einmal hinter sich – einmal und nicht wieder. Es war noch zu Beginn ihrer Polizeilaufbahn gewesen. Den Kollegen waren fast die Augen aus dem Kopf gefallen und es war eine Frage der Zeit gewesen, wie lange die kollegiale Distanz aufrechterhalten werden konnte. Der Vorfall war Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Ein blaues Auge und mehrere Stunden Unterleibsschmerzen hatten den entsprechenden Kollegen einigermaßen ernüchtert.
Die Wälder am gegenüberliegenden Ufer kündigten mit ihrem zarten Grün bereits den Frühsommer an, und auch die morgendlichen Temperaturen waren schon milder. Hin und wieder zogen noch Nebelschwaden über das Land, aber spätestens mit der Rapsblüte begann für Conni die sommerliche Jahreszeit. Weit vor ihrem kalendarischen Anfang. Sommer war für sie gleichzusetzen mit leuchtenden Farben. Und dieses Jahr hatte Conni bereits die ersten blühenden Rapsfelder ausgemacht.
Ihr Blick folgte einem Ruderer, der auf dem spiegelglatten See einsam seine Bahn zog. So beschaulich hatte sie sich den Ratzeburger See nicht vorgestellt. Anders als in ihrer Heimatstadt wirkte das Wasser hier nicht als städtische Kulisse, sondern war der natürliche Landschaftsraum, in den die Stadt wie eine Insel eingebettet lag. Ähnlich wie in Schwerin gab es natürlich auch hier einen Blickfang. Anstelle eines Schlosses erhob sich ein mittelalterlicher Dom als grün behelmte Trutzburg am nördlichen Ufer über der Stadt. Der Rest war kleinstädtisches Idyll mit einer einigermaßen intakten Infrastruktur. Selbst der Umstand, dass der Verkehr mitten durch die Altstadt geleitet wurde – eine Umgehung war wegen der Insellage von Ratzeburg kaum zu bewerkstelligen–, führte hier aufgrund mangelnder Verkehrsdichte anscheinend nicht zu einem Verkehrskollaps.
In weiser Voraussicht hatte sich Conni rechtzeitig über Stadt und Region informiert und alle möglichen im Internet verfügbaren Informationen über Geschichte, Kultur, den Ferienort und den Wirtschaftsstandort ausgedruckt. Neben den touristischen Attraktionen, die hauptsächlich im Zusammenhang mit Wassersport standen – schließlich war die ganze Region von Wasserflächen, Seen und Kanälen durchzogen–, bildete der mittelalterliche Dom Heinrichs des Löwen das Highlight schlechthin. Connis geschichtliche Kenntnisse waren, vor allem, was das Mittelalter betraf, sehr begrenzt. Für den schulischen Unterricht war nur von Interesse gewesen, was irgendwie mit Klassenkampf und Sozialismus zu tun hatte. In erster Linie natürlich der Aufbau des neuen, demokratischen Deutschland, die vereinten Sowjetrepubliken sowie ein bisschen Bürgerkrieg in Angola. Selbstredend das Manifest der Kommunistischen Partei von 1848, Arbeiterbewegung und Russische Revolution. Sämtliche Daten zu Marx und Engels sowie die Hauptaspekte des «Kapitals» konnte Conni noch heute auswendig aufsagen, allerdings interessierte sich niemand mehr dafür. Kurzum, Geschichte hatte für sie erst mit dem 19.Jahrhundert begonnen, und die regionale Bedeutung Ottos von Sachsen, der Slawenaufstände, einer Schlacht auf der Schmilauer Heide sowie die Herrschaft der Askanier waren für sie schwer nachzuvollziehen. Jedenfalls war der Dom so richtig alt, das stand mal fest.
Als Conni das erste Mal einen Blick auf den Stadtplan von Ratzeburg geworfen hatte, hatte sie allerdings ein Schmunzeln nicht unterdrücken können. Auch jetzt ging es ihr nicht anders, als sie Lage und Standort verglich. Selbst wenn Ratzeburg tatsächlich über zehntausend Einwohner haben sollte, war das Ganze doch recht übersichtlich angelegt. Die Altstadt von Ratzeburg durchquerte man zu Fuß in jeder Richtung in weniger als zehn Minuten. Ringsum war nur Wasser, das von den zwei als Damm angelegten Zufahrtswegen in den nördlich angrenzenden Ratzeburger See und den kleinen Domsee sowie die südlich gelegenen Küchenseen geteilt wurde. Eine für Bankräuber nicht gerade günstige Situation, was die Fluchtwege betraf, wie Conni fand. Im Stillen vermutete sie, dass die städtische Sparkasse bestimmt bislang unbehelligt geblieben war.
Ganz allgemein war die Kriminalitätsrate im Lauenburgischen sehr moderat. Die internen Statistiken der Polizei, die sie sich in den letzten Wochen zu Gemüte geführt hatte, stellten einen entspannten Berufsalltag in Aussicht. Es waren überwiegend Einbruchdiebstähle, mit denen sich die Kripo Ratzeburg beschäftigen musste. Hinzu kamen einige Fälle von Wilderei sowie Drogenhandel, der jedoch vorwiegend auf eine Großdiskothek im Westen der Region zwischen Hamburg und Lübeck beschränkt blieb und keinesfalls großstädtische Dimensionen besaß. Des Weiteren kam pro Woche etwa ein Dutzend Abziehdelikte unter Jugendlichen zur Anzeige. Auch das war kein beunruhigender Wert, wie Conni fand, ohne diese verbal entkräftete Version einer Straftat bagatellisieren zu wollen. Aber aus Schwerin war sie einfach anderes gewohnt. Die Abteilung Jugendkriminalität bestand dort aus sechs Kollegen und acht Streetworkern, die sich über Arbeitsmangel wirklich nicht beklagen konnten.
Eine regionale Spezialität, die sich gleichermaßen auf Mecklenburg-Vorpommern wie Schleswig-Holstein verteilte, waren Delikte im Zusammenhang mit randständigen Bevölkerungsgruppen. Das Pendant zu den Türken und Kurden in den Großstädten wie Hamburg oder Berlin war in den ärmeren Provinzen jenseits des städtischen Speckgürtels die große Anzahl der dort lebenden Russlanddeutschen. Conni hatte sich mit dieser Bezeichnung nie anfreunden können, aber ihr fiel auch kein besserer Ausdruck für die fast ausschließlich Deutsch sprechenden Russen ein, deren Vorfahren vor zig Jahrzehnten nach Nordrussland ausgewandert waren und die nach Zusammenbruch der Sowjetunion in ihre vermeintliche Heimat zurückkehrten. Ein Land, das sie nur von Erzählungen her kannten. Genau wie zu Beginn der organisierten Kriminalität unter Gastarbeitern aus Südeuropa stand die Staatsgewalt der kriminellen Energie einzelner Mitglieder aus dieser Bevölkerungsgruppe noch ohnmächtig gegenüber. Vor allem, weil nur jeder zehnte Fall überhaupt zur Anzeige kam, da man solche Dinge traditionell unter sich regelte, wie Conni aus Schwerin bestens wusste.
Demgegenüber gab es im Lauenburgischen nur eine Hand voll wirklich schwerer Kapitaldelikte. Im letzten Halbjahr hatte es hier zwei Verbrechen mit Todesfolge gegeben, die binnen kürzester Zeit aufgeklärt werden konnten. In einem Fall hatten sich zwei stark alkoholisierte Männer aus der untersten sozialen Schicht, beide ohne Arbeit und Unterkunft, im Streit um ein Winterlager in einem leer stehenden Ferienhaus gegenseitig Schnapsflaschen auf den Schädel geschlagen, was einer der beiden nicht überlebt hatte; im anderen Fall hatte ein geistig verwirrter Mann seine weit über siebzigjährige Nachbarin vergewaltigt und dabei erdrosselt. Conni grübelte kurz darüber nach, wie verwirrt man sein musste, um eine fast achtzigjährige Frau zu vergewaltigen, und schüttelte verständnislos den Kopf.
Nach Osten und Westen dehnte sich die Stadt zu beiden Seiten des Wassers mit Vorstädten aus. Conni schaute entlang des Inseldamms in Richtung St.Georgsberg. Ein Kormoran, der in elegantem Tiefflug dicht über der Wasseroberfläche Ausschau nach Beute hielt, nahm von seinem ursprünglichen Vorhaben Abstand, sich auf dem breit ausladenden Steg neben Conni niederzulassen, als ein Ruderer sein Sportgerät kopfüber zum Wasser balancierte. Conni waren die schlanken Boote vorhin schon auf dem Parkplatz aufgefallen, wo sie zu engen Päckchen verschnürt auf langen Trailern lagerten. Jetzt nahm sie das große Gebäude hinter dem Schotterplatz näher in Augenschein und stellte fest, dass sie genau neben der Ratzeburger Ruderakademie saß. Auch darüber hatte sie natürlich gelesen, es war die bundesweite Kaderschmiede des Deutschen Rudersports. Interessiert beobachtete sie, wie der Mann auf dem Steg sein Boot ins Wasser hob. Mit Wassersport hatte Conni bislang nichts am Hut gehabt, aber die breiten Schultern und der athletische Oberkörper des Mannes sagten ihr schon zu. Es sah spielerisch aus, wie er auf seinem Boot Position einnahm. Conni war sich sicher, dass man mehrere Wochen Übung benötigte, um dabei nicht die Balance zu verlieren, so filigran und kippelig wirkte das Boot. Vielleicht sollte sie die Sportart wechseln? Joggen und Mountainbike fahren konnte man sicher auch hier, und eine anständige Mucki-Bude fand sich inzwischen in jeder Kleinstadt, aber ob sie weiterhin die Zeit haben würde, in Schwerin viermal die Woche zum Karate-Training zu gehen, war fraglich. Ihr Trainer würde sie schlichtweg in Stücke reißen, wenn sie nicht mehr regelmäßig erscheinen würde, schließlich hielt er viel auf sie. Und ihre bisherige Leistungsbilanz gab ihm Recht: Es gab nur wenige Frauen, die sich mit dem dritten Dan schmücken durften.
Die Wasserlinie, die der Ruderer hinter sich ließ, wirkte wie mit dem Lineal gezogen. Conni suchte ihre Jacke nach der Zigarettenschachtel ab und fingerte eine Marlboro heraus. Sie würde es einfach ausprobieren.
«Rauchen ist total ungesund.» Der Steppke mit dem bunten Schulranzen auf den Schultern grinste sie frech an. Sein Blick beinhaltete eine Mischung aus Vorwurf und Verständnislosigkeit. Er mochte so um die zehn sein, schätzte Conni. Ein Alter, in dem man in der Regel noch nicht einstiegsgefährdet war.
«Recht hast du.» Conni nickte und winkte ihn zu sich heran. «Du hast doch bestimmt etwas zu schreiben in deiner Schultasche, oder?» Sie überlegte, warum der Junge eine Wildfremde einfach so ansprach. Einerseits hatten Kinder heutzutage kaum mehr Berührungsängste gegenüber Erwachsenen – als Conni in diesem Alter gewesen war, hätte es sich kein Kind herausgenommen, einen Erwachsenen zu bevormunden–, andererseits waren viele von ihnen bereits mit Schicksalsschlägen konfrontiert worden, und Krebs, egal, ob im familiären Umfeld oder Bekanntenkreis, begründete man Kindern gegenüber gerne mit Zigarettenkonsum.
Umständlich nahm der Junge seinen völlig überfüllten Ranzen ab und suchte Block und Federtasche. «Da.»
Conni trat ihre Zigarette aus, stützte die Ellenbogen auf die Knie und lächelte den Jungen an. «Nein, schreib du es dir einfach auf.»
«Was?»
«Was du gesagt hast: Rauchen ist total ungesund.»
Der Junge blickte sie ungläubig an. «Vom Rauchen stirbt man.»
«Meinetwegen kannst du auch das aufschreiben. Und den Zettel steckst du in dein Sparschwein oder gibst ihn deinen Eltern oder versteckst ihn irgendwo. Und in zwei, drei Jahren liest du dir das nochmal durch.»
«Und was soll das bringen?»
«Vielleicht denkst du dann anders darüber. Kann doch sein, oder?»
Der Junge nickte und schrieb den Satz zu Connis Erstaunen tatsächlich auf.
«Woher weißt du eigentlich, dass man vom Rauchen stirbt?», hakte Conni nach.
«Sagt meine Mutter.» Der Junge verstaute den Schreibblock und schulterte die Schultasche. «Mein Opa ist daran gestorben, und der hat total viel geraucht. Und der Vater von einem Klassenkameraden ist auch wegen den vielen Zigaretten gestorben», fügte er hinzu.
«Hm.» Conni nickte verständnisvoll. «Das ist traurig.» Die Frage nach dem Alter des Großvaters konnte sie sich gerade noch verkneifen. «Dann rauchen deine Eltern wohl bestimmt nicht?»
Der Junge schüttelte den Kopf. «Nee, die haben beide aufgehört. Gerade rechtzeitig. Sonst wären sie vielleicht auch tot.»
«Da hast du ja dann richtig Glück gehabt», entgegnete Conni und versuchte, den Hauch von Ironie in ihrer Stimme herunterzuschlucken. Sie hatte einfach keine Übung im Umgang mit Zehnjährigen. «Weißt du, mein Vater hat auch sehr viel geraucht. Bestimmt drei Schachteln am Tag.»
«Und der ist nicht gestorben?», fragte der Junge ungläubig.
«Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Als ich zwanzig war, ist er einfach verschwunden.»
«Wie? Einfach so weg?»
Conni nickte. «Ja, einfach weg. Mir nichts, dir nichts verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, wo er ist und ob er überhaupt noch lebt.»
«Das ist auch traurig.» Der Junge überlegte einen Augenblick. «Aber jetzt bist du ja selbst erwachsen», meinte er schließlich, «da brauchst du ja keinen Vater mehr. Ich muss jetzt los in die Schule.»
Conni winkte ihm zu, als er sich nach einigen Metern nochmal umdrehte. Als er außer Sichtweite war, steckte sie sich eine neue Zigarette an. ‹Rauchen kann tödlich sein›, las sie auf der Schachtel, während sie einen tiefen Lungenzug nahm. Wenn nur die Angst vor dem Dickwerden nicht wäre. Sie schüttelte den Kopf. Ihre Freundin Ingrid war nach einem Jahr Abstinenz aus dem Leim gegangen wie ein Hefeklops. Und das ohne den Griff zur Schokolade, zumindest nach ihrer eigenen Auskunft. Aber eigentlich war es Zeit für einen Neuanfang. Conni blickte auf den langen Glutkegel. So richtig schmecken wollten die Dinger vormittags so oder so nicht. Zumindest für einen kleinen – sie trat die Zigarette energisch mit dem Schuh aus und warf die halb volle Schachtel neben sich in den Papierkorb. Wenn sie auch nur ein Kilo zunahm, schwor sie sich, würde sie sofort wieder anfangen.
Sie schlug den Stadtplan auf. Ihre zukünftige Arbeitsstätte hatte sie bereits lokalisiert, sie musste vorhin daran vorbeigefahren sein. Dann blickte sie auf die Uhr. Es war noch Zeit für einen kleinen Spaziergang rund um die Dominsel. Vielleicht konnte sie sogar einen Blick in den Dom werfen. Wer weiß, wann sie wieder Gelegenheit dazu hatte.
Conni war etwas enttäuscht, dass die Polizeidienststelle nicht in einem der alten Gemäuer, sondern in einem zweckdienlichen Neubau untergebracht war. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen musste sie schmunzeln. Wie bei modernen Polizeiwachen üblich, war ein Zutritt zum Gebäude erst nach Anmeldung über eine Gegensprechanlage bei gleichzeitiger Gesichtskontrolle und mit elektrischem Türöffner möglich. Gut, das Gebäude beherbergte neben der Kripo eben auch eine gewöhnliche Polizeiwache, aber war so eine Sicherheitsschleuse hier in der Provinz nötig?
«Sonntag», murmelte sie in die Gegensprechanlage, und um den gewohnten Kalauer über den Wochentag im Keim zu ersticken, fügte sie im gleichen Atemzug hinzu: «Oberkommissarin Cornelia Sonntag, aus Schwerin. Melde mich zum Dienst!» Durch die getönte Scheibe konnte sie schwach erkennen, wie der wachhabende Beamte aufstand und sich dabei den Hosenbund zurechtrückte.
«Mit einem Dienstausweis oder Ähnlichem kann ich noch nicht dienen. Dies ist mein erster Arbeitstag hier», erklärte sie, nachdem man sie eingelassen hatte. «Ich dachte, ich wäre angemeldet, Kollege?»
«Sind Sie auch, sind Sie auch.» Der Beamte stemmte die Hände in die Hüften und kniff die Lippen zusammen. «Sie kommen nur ungefähr eine Viertelstunde zu spät.»
«Wie bitte?» Conni blickte entgeistert auf ihre Uhr.
«Ja, Sie wollen doch zur Kripo. Eigentlich erster Stock.» Der junge Beamte zeigte auf den Fahrstuhl. «Aber die sind gerade alle ausgeflogen. Sie glauben gar nicht, was hier los ist. Man hat am Kanal einen Toten gefunden. Vermutlich ein Jäger, der auf seinem Hochsitz erschossen wurde. Wenn Sie erst mal einen Kaffee wollen?»
Conni schüttelte den Kopf. «Eine Zigarette wäre mir lieber.»
Jensen
Leif schob das Handy in die Halterung am Armaturenbrett, wendete den Wagen und gab Vollgas in Richtung St.Jürgen. Meine Güte, was für ein Tag. Da nahm man sich frei, um einige Erledigungen machen zu können, und dann so etwas. Das durfte ja wohl nicht angehen.
Dabei hätte ihn schon das morgendliche Telefonat mit Miriam, bei dem es mal wieder nur um die Kinder ging, stutzig machen müssen. Tage wie diese begannen immer mit einer kleinen Katastrophe. Wer hatte ihr nur gesteckt, dass er sich zwei freie Tage und ein Wochenende ohne Bereitschaft gegönnt hatte. Von wegen Fortbildungsveranstaltung für Apotheker. Seit sie wieder angefangen hatte zu arbeiten, gab es für sie an den Wochenenden nur noch Fortbildungsseminare. Warum konnte sie nicht zugeben, dass sie einfach nur mal ihren Spaß haben wollte, wie es ihrem Naturell entsprach. Er machte ihr gegenüber doch auch keinen Hehl aus seinen Freizeitbeschäftigungen. Eigentlich hatte er zum Golfen fahren wollen. Aber wenn Miriam ihm jetzt die Zwillinge aufs Auge drückte, konnte er das vergessen. Die beiden waren ja nicht mal mehr mit einer großen Portion Eis ruhig zu stellen. Mit ihren acht Jahren wussten Annika und Sophie ganz genau, aus welchem Stall sie kamen. Unter einer Tour in einen Freizeitpark lief da nichts mehr. Aber das hatte sich jetzt wahrscheinlich eh alles erledigt. Sollte Miriam doch sehen, wem sie die Kinder unterschob.
Und dann der völlig überflüssige Streit mit den Leuten von «gratis-com» über deren Garantiebestimmungen. Es war doch immer wieder dasselbe – und er fiel immer wieder darauf herein. Wenn es um Service und Kulanz ging, waren die Billig-Ketten inzwischen genauso zweifelhaft wie die Internet-Versender. Dabei handelte es sich lediglich um das Netzteil von seinem neuen Power-Book. Fast 4000Euro hatte er in dem Laden gelassen, und dann stellte man sich wegen so eines Pfennigartikels derart an. Aber das war eben typisch. Wenn alles bezahlt war, war man kein potenzieller Kunde mehr, denn in der Regel kaufte man ja nicht jedes Jahr einen neuen Laptop. Diese hochnäsige studentische Hilfskraft hatte einfach seine Angaben angezweifelt. Das Gerät zeige aber erhebliche Gebrauchsspuren, hatte er bemerkt und gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass hier wohl kein Garantiefall vorliege. Gebrauchsspuren, tatsächlich? Das Gerät war ja nun auch ein Vierteljahr in Betrieb, und Leif gehörte nun mal nicht zu der Spezies, die ihren Computer in einem Alukoffer spazieren führte. Aber das war schließlich kein Grund dafür, dass die vordere Hälfte des Netzteilsteckers nicht wieder aus dem Power-Book herauswollte. Der Mann hinter dem Tresen sah das anscheinend anders. Ob er den Computer auf den Boden geschmissen hätte, wollte er wissen. Der Typ war einfach nur unverschämt gewesen. Ein Leihgerät? Fehlanzeige. Wenn die Leute bei «gratis-com» tatsächlich glaubten, er ließe sich derartig abspeisen, dann hatte man sich aber getäuscht. Ein vollkommen unnötiger Streit, der die Firma aber mit Sicherheit einen ihrer bislang treuesten Kunden kosten würde, so viel stand schon mal fest. Kein Wunder, dass ein Laden nach dem anderen Insolvenz beantragte.
Als wenn das noch nicht gereicht hätte, widmete Leif sich wieder dem leidigen Thema Sendersuche und Programmierung, während er die Posselstraße hinunterdonnerte. Mit einer kurzen Lenkbewegung wich er einem ausparkenden Kleinlaster aus, der die Geschwindigkeit des herannahenden Porsche wohl unterschätzt hatte. Kein Wunder, die Tachonadel bewegte sich bereits im dreistelligen Bereich. Leif befand sich irgendwo in der dritten Menü-Ebene, und jedes Mal, wenn er den Befehl Speichern aufrufen wollte, egal, ob er am Rädchen drehte oder darauf drückte, war der Sender wieder futsch. Wer sollte denn da bitte schön durchsteigen? Und das alles nur, weil die Jungs in der Werkstatt zu blöde gewesen waren, das Radio vor dem Abklemmen der Batterie zu überbrücken. Musste man bei einer kleinen Inspektion, die ihn zudem wieder mal ein halbes Monatsgehalt kosten würde, wirklich die Batterie abklemmen? Jedenfalls war der Senderspeicher nun auf allen Plätzen mit der kleinsten Frequenz belegt. Und die hatte City-Radio, der Sender mit der grooßen Viieeelfalt, wie ihm ein stampfender Jingle nun schon zum dritten Mal mitteilte. Nein, er wollte nicht schon wieder Barry Manilow, Abba oder die neueste gecoverte Version von It’s raining man hören. Kein City-Radio mit den Gute-Laune-Texten der Nachrichtensprecher, deren derbe Zoten längst auf Bildzeitungsniveau abgerutscht waren und deren Grammatik längst ohne Genitiv und Personalpronomen auskam.
Die Ampel am Berliner Platz zeigte ein deutliches Rot, was Leif ignorierte. Ohne den hupenden Querverkehr zu beachten, bog er mit quietschenden Reifen auf den St.-Jürgen-Ring und wenig später auf die Ratzeburger Allee ein. Er war so oder so schon spät dran. Zu allem Überfluss sollte er jetzt auch noch den Taxifahrer spielen und Geros Neuzugang in Ratzeburg einsammeln. War Frau Oberkommissarin nicht selbst in der Lage, Auto zu fahren, oder wie sollte er das verstehen? Wahrscheinlich würden sie als Letzte am Tatort eintreffen. Aus den Lautsprechern ertönte das tägliche Sunrise von Nora Jones. Die Frau machte doch wirklich erstklassige Songs, warum um alles in der Welt spielte man auf sämtlichen Sendern immer nur das eine Lied von ihr? Entnervt schaltete Leif ab.
«Sie hatten das Taxi bestellt?» Leif revidierte schlagartig sein Vorurteil über die neue Kommissarin der Kripo Ratzeburg. Geros Neue sah unverschämt gut aus. Nicht einmal eine Handtasche, für gewöhnlich unverzichtbares Accessoire auch bei der Kripo, hatte sie bei sich. «Leif Jensen– Mordkommission Lübeck. Steigen Sie ein.»
«Angenehm. Cornelia Sonntag. Nett, dass Sie mich mitnehmen.»
«Wir duzen uns hier.»
«Dann Conni.» Sie schlug die Wagentür zu und fingerte umständlich den Anschnallgurt hinter dem Sitz hervor.
Als Leif den Wagen aus der Seestraße steuerte, fiel sein Blick auf die Tankuhr, deren Zeiger gähnende Leere andeutete. Wenn das nur gut ging. Zeit zum Tanken hatten sie nun wirklich nicht mehr. «Dein erster Arbeitstag heute?»
Sie nickte.
«Hattest du dir sicher anders vorgestellt.»
«Ist das dein Dienstwagen?», fragte sie, ohne auf seine Frage einzugehen. «Ich dachte, so etwas fahren nur die Kollegen an der Autobahn.»
«Nein, das ist mein Privater. Ich habe heute eigentlich frei, und als das Handy klingelte…» Seine Worte gingen im Brüllen des Boxermotors unter.
«Wenn du nur halb so schnell fahren würdest», rief sie nach der ersten Kurve, «imponiert mir das genauso! Mein Wagen hat nur 60PS!»
«Entschuldigung!» Leif drosselte das Tempo. «Ich fahre meistens alleine, da fällt mir das gar nicht auf.»
«Wo fahren wir genau hin?» Conni zog eine Landkarte aus der Beifahrertür und schlug sie auf.
Leif lächelte ihr charmant zu. «Zum Kanal. Ungefähr auf Höhe der Autobahn.»
«In der Dienststelle sagte man etwas von einem Hochsitz.»
«Männliche Person auf einem Hochsitz. Höchstwahrscheinlich erschossen. Mehr weiß ich auch noch nicht.» Leif drosselte das Tempo auf Schrittgeschwindigkeit und bog in eine alte Dorfstraße mit Kopfsteinpflaster ein.
«Ein Jäger?»
Er schob die Unterlippe vor und zuckte mit den Schultern. «Ich kann nur hoffen, dass das nicht im Zusammenhang mit der Hochsitzmafia steht», spekulierte er, und seine Stimme zitterte, weil der Wagen auf dem holperigen Untergrund stark vibrierte. «Seit einem Jahr», fuhr er fort, als sie wieder gewöhnlichen Asphalt erreicht hatten, «verschwinden hier in der Gegend Jagdstände. Meist über Nacht. Sie werden nicht einfach angesägt oder so, sondern vollständig abgebaut – im wahrsten Sinne des Wortes sind sie wie vom Erdboden verschluckt.»
«Ja, ich habe davon gehört. Es gab letztes Jahr eine interne Anfrage nach ähnlichen Vorkommnissen in anderen Bundesländern.»
«Stimmt. Aber die Abteilung, die mit dem Fall betraut ist, hat keine positive Resonanz erhalten. Man vermutet deshalb eine kleine Gruppe militanter Tierschützer hinter den Vorfällen, die nur lokal agiert. Bislang gibt es aber kaum konkrete Anhaltspunkte. Weder Hinweise noch Bekennerbriefe.»
«Und die Bauern, an deren Feldern die Hochsitze stehen? Ist denen nichts aufgefallen?»
Leif schüttelte den Kopf. «Nicht mal Reifenspuren. Wenn man davon ausgeht, dass man mindestens einen Lastwagen zum Abtransport benötigt… So einen Hochsitz kann man sich ja nicht einfach unter den Arm klemmen. Der wiegt bestimmt ein paar Tonnen und ist ziemlich sperrig. Sägespäne oder Holzreste, die auf eine Demontage vor Ort schließen lassen, hat man bisher jedenfalls nicht gefunden.»
«Sehr mysteriös, das Ganze. Personenschäden hat es in diesem Zusammenhang also noch nicht gegeben?»
«Bisher nicht», seufzte Leif. «Aber warum spekulieren. Wir sind gleich da, und dann wirst du auch alle Kollegen kennen lernen. Unser Trüffelschwein ist mit seiner Truppe jedenfalls schon vor Ort. – Die Spurensicherung», erklärte er auf Connis fragenden Blick hin. «Peter heißt mit Nachnamen Schweim. Da liegt sein Spitzname förmlich auf der Hand. Wo kommst du eigentlich her?»
Natürlich hatte Gero ihm den Personalbogen von Cornelia Sonntag gezeigt und ihn um eine Einschätzung gebeten, von daher wusste er mehr über sie und ihre Qualifikationen, als ihr recht war, aber das musste er ihr ja nicht gleich auf den Bauch binden. Nachdem Margarethe altersbedingt ausgeschieden war, hatte Gero aus ermittlungstechnischen Gründen wieder um eine Kollegin gebeten, möglichst mit russischen Sprachkenntnissen, da man hinsichtlich der EU-Erweiterung in Richtung Osten entsprechend gewappnet sein müsse, wie er fand. Es war schon ein großes Entgegenkommen, dass man Gero ein Mitspracherecht bei der Personalauswahl einräumte. Keine Ahnung, wie er das immer hinbekam. In dieser Kombination hatte Kiel jedenfalls nicht viel anzubieten gehabt. Lediglich eine 35-jährige Oberkommissarin aus Mecklenburg-Vorpommern.
«Ich war vier Jahre bei der Kripo Schwerin», antwortete Conni.
«Also eine Nachbarin. Und warum…»
«Persönliche Gründe», schnitt sie Leif das Wort ab und faltete die Karte zusammen. «Wäre schön, wenn du mir kurz eure Verfahrensweise erläutern könntest, soweit sie vom Standard abweicht, damit ich nachher nicht so blöd herumstehe. Ich kenne ja überhaupt niemanden. Wer leitet die Ermittlungen?»
«Normalerweise Gero, Hauptkommissar Gero Herbst. Da man aber gleich Lübeck verständigt hat, werde ich als Leiter der Mordkommission hinzugezogen. Wir bleiben vor Ort, das heißt, wir richten in der nächstgelegenen Dienststelle, in diesem Fall Ratzeburg, unser Quartier ein, und jeder macht, was er am besten kann. Dortige Anlaufstelle ist Kollege Lüneburg, unser Buchhalter. Jörn Lüneburg ist aufgrund seiner Dienstjahre nicht mehr so gut zu Fuß und übernimmt dementsprechend gerne die Verwaltungsarbeit.»
«Das gibt es nicht. Ein Kollege, der einem die Durchschläge abnimmt? Ich glaube, ich bin im Paradies gelandet…» Conni schüttelte fassungslos den Kopf.
«Ja, da hat Gero richtig Glück gehabt. Jörn Lüneburg obliegt daher die Gesamtkoordination. In Absprache mit Gero und mir, versteht sich. Aber bislang gab es in der Hinsicht noch keine Kompetenzstreitigkeiten. Kollege Lüneburg trägt einfach alles zusammen, was wir sammeln. Er weiß genau, wann ein Fall für die Staatsanwaltschaft dicht ist. Mit der Staatsanwaltschaft ist das so eine Sache. Aber ich will da nicht vorgreifen – am besten, du machst dir selbst dein Bild. So, wir sind da.»
Leif bog in einen Feldweg ein. Links vor ihnen lag ein dunkler Fichtenhain, auf der rechten Seite erstreckten sich hinter gewöhnlichem Knickbewuchs mehrere Felder. Auf dem ersten stand ein großer grüner Trecker, in dessen aufgeklapptem Ackergerät sich die Sonne spiegelte. Ein gestreiftes Sperrband mit der Aufschrift Polizei signalisierte ihnen, dass sie richtig waren. Nach etwa hundert Metern machte der Weg eine kleine Biegung zum Waldrand und endete an einer Lichtung. Der abgestellte Fuhrpark klärte ohne Worte darüber auf, wer alles regelmäßig Polizeifunk abhörte: Technisches Hilfswerk, Freiwillige Feuerwehr, selbst die DLRG war mit zwei Fahrzeugen vertreten.
Ein weiteres Absperrband signalisierte die «Trockenzone», die erst betreten werden durfte, wenn Peter und seine Leute mit der Arbeit fertig waren. Leif griff hinter sich und zog aus einer kleinen Pappschachtel zwei Paar Füßlinge aus Plastik hervor, die sie überstreiften. Der Hochsitz stand etwa dreißig Meter hinter der Lichtung. Gegen die Sonne wirkten die Kollegen der Spurensicherung trotz ihrer weißen Mondanzüge wie Schattenrisse.
«Müssen wir irgendwo eine Nummer ziehen?», fragte Leif einen Kollegen von der Schutzstaffel angesichts der vor dem Absperrband wartenden Menge.
Der Beamte grüßte mit zwei Fingern an der Dienstmütze. «Gott sei Dank ist die Presse noch nicht da.» Er zeigte auf einen Transporter, der unmittelbar hinter der Absperrung stand. «Dascher und Rörupp vernehmen gerade die Jungens, die den Toten entdeckt haben. Kommissar Herbst ist mit Hauptmeister Bude vorne am Hochsitz.»
«Ja, danke. Oberkommissarin Sonntag», stellte Leif seine Begleiterin vor und hob das Absperrband an, damit sie darunter durchschlüpfen konnte. «Eine neue Kollegin. Dann wären wir also komplett. Ist außer uns und der Spurensicherung schon jemand aus Lübeck da?», fragte er und schaute sich suchend um.
«Bislang noch nicht», entgegnete der Beamte. «Aber wenn Sie die Staatsanwaltschaft meinen…» Er deutete zum Feldweg, auf dem ein schwarzer Mercedes langsam auf sie zurollte. «Die scheint gerade im Anmarsch zu sein, wenn ich das recht erkenne.»
Leif drehte sich um und nickte bestätigend. «Van Helsing», murmelte er. «Der hat mir heute gerade noch gefehlt.»
Feldarbeit
«Wenn ich genau darüber nachdenke…» Hauptmeister Jörg Bude schüttelte unentwegt den Kopf und wischte sich mit einem Taschentuch die Mundwinkel ab. «Mir ist immer noch schlecht, Gero. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich bin überhaupt nicht geeignet für diesen Job.»
«Das ist doch Quatsch, Jörg.» Gero hatte sich neben Bude auf den Stapel frisch geschlagener Stämme gesetzt und ihm tröstend die Hand auf die Schulter gelegt. Er hatte es mehr als ein Dutzend Mal erlebt, dass Kollegen nach einem Leichenfund mit den Nerven am Ende waren, und wusste, wie wichtig menschliche Zuneigung in einer solchen Situation war. Vor allem kam es darauf an, keine kollegiale Skepsis an den Tag zu legen. Der eine konnte kein Blut sehen, andere scheuten körperlichen Kontakt oder erbrachen sich bei bestimmten Gerüchen. Das kam nicht nur vor – es war die Regel. Schlimmstenfalls meldete man sich dienstunfähig und begab sich schleunigst in ärztliche Behandlung oder wurde unter psychologische Betreuung gestellt. Nicht nur Polizisten, auch Sanitäter und selbst Ärzte waren davon betroffen. Lena konnte ein Lied davon singen, wie viele Kollegen nach Anwesenheit bei einer Obduktion traumatisiert waren, wobei die Teilnahme an einer Leichenöffnung auch wirklich den Härtefall darstellte. Bei Hauptmeister Jörg Bude lag der Fall etwas komplizierter.
«Mensch, Gero, ich mach das hier jetzt seit mehr als dreißig Jahren. Da sollte man doch meinen…» Bude versuchte, mit tiefen Atemzügen gegen seine Tränen anzukämpfen. «Ich hab’s so satt, ich könnte einfach nur heulen.»
«Komm schon, Jörg! Du weißt genau, dass ich dich jetzt brauche, du bist für mich unverzichtbar.» Gero hatte sich seine Worte wohl überlegt. Obwohl Hauptmeister Bude nicht seinem Stab angehörte, hatte sich nach fünf Jahren gemeinsamer Arbeit ein freundschaftliches Verhältnis zwischen dem Kriminalen und dem Dorfbullen