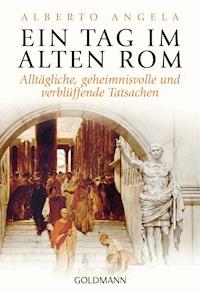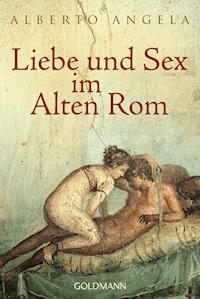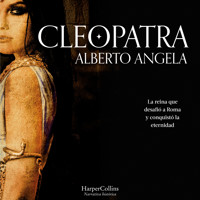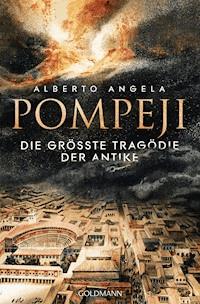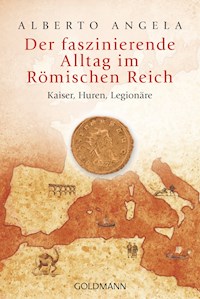
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Eine spannende Reise durch das Römische Reich – hier wird die Antike lebendig.
Wir begeben uns auf einen faszinierenden Streifzug durch die Weiten des Römischen Reiches zur Zeit seiner größten Ausdehnung. Auf der Reise durch dieses antike Weltreich blicken wir auf die farbenprächtigen Schilde der Legionäre in Germanien und bewundern die kunstvollen Körperbemalungen der Barbaren in Schottland. Wir riechen das Parfum feiner Bürgerinnen in Mailand, in unseren Ohren erklingt das Schleifgeräusch der Athener Steinmetze ... ein unscheinbarer Sesterz ist dabei das Bindeglied, das alle diese Orte und Menschen und ihre Schicksale miteinander verbindet. Die kleine Münze geht von Hand zu Hand, und jedes Mal lässt Alberto Angela den Leser wieder eintauchen in eine neue fremde Welt, die unserer Gegenwart oft ähnlicher ist, als man denkt.
Bereits erschienen unter dem Titel »Vom Gladiator zur Hure. Die Reise einer Münze durch das Römische Reich« im Riemann Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 822
Ähnliche
Buch
Alberto Angela lädt uns ein zu einem spannenden Streifzug durch das Römische Reich zur Zeit seiner größten Ausdehnung: Von den unwirtlichen, kalten Grenzposten in Britannien und Germanien bis ins ferne Mesopotamien und nach Nordafrika.
Vom Sklaven bis zu Kaiser Trajan persönlich, vom Bernsteinhändler bis zum Legionär. Ob in London oder Alexandria, in den Tavernen des Imperiums wird Wein aus Gallien und Olivenöl aus Spanien gereicht, und überall trägt man Tuniken aus ägyptischer Baumwolle.
Alle Orte, Menschen und Schicksale sind durch einen unscheinbaren Sesterz verbunden, der von Hand zu Hand wandert und so die gesamte römische Welt durchstreift. Jedes Mal, wenn die kleine Münze ihren Besitzer wechselt, eröffnet sich uns ein neuer, aufregender Blick hinter die Kulissen des mächtigen Imperiums – das uns heute verblüffend modern anmutet.
Das ist Geschichte von ihrer faszinierendsten Seite!
Autor
Alberto Angela wurde 1962 in Paris geboren und studierte in Rom Naturwissenschaften. Als Paläontologe nahm er an zahlreichen Ausgrabungsprojekten in Afrika und Asien teil. Heute ist er in Italien ein populärer Fernsehmoderator für naturwissenschaftliche Sendungen. Außerdem ist er Mitglied des Istituto Italiano di Paleontologia in Rom sowie des Centro Studi e Ricerche Ligabue in Venedig. Gemeinsam mit seinem Vater Piero – einem bekannten Archäologen, Journalisten und Autor – hat er mehrere Bücher veröffentlicht.
Bei Goldmann ist bereits erschienen »Ein Tag im Alten Rom« (2011).
Alberto Angela
Der faszinierende Alltag im Römischen Reich
Kaiser, Huren, Legionäre
Aus dem Italienischen von Elisabeth Liebl
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die deutschsprachige Ausgabe ist zuerst im Riemann Verlag unter dem Titel »Vom Gladiator zur Hure. Die Reise einer Münze durch das Römische Reich« erschienen. Copyright © der Originalausgabe 2010 by lberto Angela Originaltitel: »Impero. Viaggio nell’Impero di Roma seguendo una moneta« Originalverlag: Mondadori Editore, Mailand Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Riemann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, in Anlehnung an die Gestaltung der HC-Ausgabe (www.buero-jorge-schmidt.de) Umschlagabbildungen: © DEA Picture Library/Getty Images (Karte) © Museumslandschaft Hessen Kassel / bpk (Münze) Lektorat: Ingrid Lenz-Aktaş DF · Herstellung: Str. ISBN: 978-3-641-25672-2V002www.goldmann-verlag.de
Für Monica, Riccardo, Edoardo und Alessandro. Denn die schönste Reise führt mich Tag für Tag in eure Augen ...
Einführung
Nehmen Sie doch einmal eine Karte zur Hand, die das Römische Reich zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung zeigt. Sind Sie nicht auch erstaunt, wie unglaublich groß es ist? Es reicht von Schottland bis nach Kuwait, von Portugal bis nach Armenien. Doch wie lebten die Leute damals? Welche Menschen begegneten einem in den Städten? Wie ist es den Römern nur gelungen, ein so gewaltiges Imperium zu schaffen und zahllose Völker und Siedlungen unter einer Herrschaft zu vereinen?
Genau das zu beantworten, ist das Ziel dieses Buches: Es will Sie mitnehmen auf eine lange Reise durch das Römische Reich, um Antworten auf ebendiese Fragen zu finden.
In dieser Hinsicht ist dieses Buch die Fortsetzung von Ein Tag im Alten Rom, in dem ich versucht habe, dem Leser den Alltag in der Hauptstadt des Römischen Reiches nahezubringen. Zu diesem Zweck sind wir dem Stundenzeiger gefolgt – an einem beliebigen Dienstag zur Zeit Kaiser Trajans.
Stellen Sie sich nun vor, wie Sie einen Tag später erwachen. Es ist Mittwoch und der Tag, an dem wir zu einer Reise durch das gesamte Weltreich aufbrechen. Wir werden die Atmosphäre verschiedener Orte atmen – den Duft in den Gassen des ägyptischen Alexandria, das Parfüm der Damen in Mailand. Wir werden die Schläge der Steinmetze in Athen hören, die bunten Schilde der römischen Soldaten blitzen sehen, die durch Germanien marschieren. Und wir werden staunen ob der Tätowierungen auf den Körpern der Barbaren im hohen Norden, in Schottland.
Doch was ist der rote Faden, der die Etappen unserer Reise verbindet? Als ich mir diese Frage stellte, kam mir die Idee mit der Münze. Einem Sesterz, genauer gesagt. Eine Münze wandert von Hand zu Hand und kann uns so – theoretisch wenigstens – im Verlaufe weniger Jahre (in diesem Fall drei) durch das ganze Imperium führen. Und: Unser Sesterz kennt keine Standesunterschiede. Wir werden die Menschen kennenlernen, die ihn entgegennehmen, ihr Gesicht, ihre Gefühle, ihre Welt, ihre Häuser, ihre Lebensart, ihre Eigenarten und Gewohnheiten. So folgen wir einem Legionär, einem Grundbesitzer, einem Sklaven, einem Arzt, der versucht, mit einer schwierigen Operation ein Kind zu retten. Wir werden einem Garum-Händler begegnen, der die von den Römern so heiß geliebte Würzsoße verkauft, einer Prostituierten, einer Sängerin, die bei einem Schiffsunglück im Mittelmeer beinahe ertrinkt, einem Seemann und sogar einem Kaiser sowie vielen, vielen anderen.
Diese Reise hat sich so nie zugetragen, möglich wäre sie allerdings durchaus gewesen. Die Menschen, denen Sie begegnen werden, haben – mit wenigen Ausnahmen – in jener Zeit an jenen Orten gelebt. Sie trugen die Namen, die Sie hier lesen, und sie haben ihr Gewerbe tatsächlich ausgeübt. Diese Geschichte fußt auf langen Jahren der Forschung, in denen ich Inschriften auf Gräbern und Monumenten sowie alte Handschriften entzifferte. Von einigen dieser Menschen kennen wir sogar das Konterfei. Auf dem Umschlag finden Sie einige Porträts, die fast wie Fotos wirken. Sie wurden im ägyptischen Al-Fayyum von Archäologen entdeckt und stammen aus den ersten nachchristlichen Jahrhunderten, ebender Zeit, in der unsere Reise stattfindet. Es handelt sich dabei um Porträts, die in Häusern hingen, bevor man sie auf Mumiensärgen befestigte. Diese Porträts inspirierten mich zu einigen der Charaktere unserer Geschichte.
Wie durch Zauberhand tauchen ihre antiken und doch vertrauten Gesichter in den Straßen einer Stadt auf, in den Winkeln eines Hafens, auf der Brücke eines Schiffs. Wir tauchen ein in ihre Welt und erhalten Einblick in ihre Kultur, in das Alltagsleben ihrer Epoche. Die Sprüche, die wir von ihnen hören, stammen von antiken Autoren: Martial, Juvenal, Ovid ...
Mein Ziel war es, ein möglichst lebensnahes Bild der Zeit, der Menschen und Orte zu zeichnen. Wenn es zum Beispiel in Leptis Magna, einem Ort in Nordafrika, zu Zeiten Trajans noch keine großen Thermen gab (weil sie erst unter Hadrian errichtet wurden), dann werden Sie sie im Stadtbild auch noch nicht sehen, wenn Sie unserem Sesterz auf seinem Weg folgen.
Mag die Handlung des Buches auch fiktiv sein, das Rohmaterial für die Beschreibung von Orten, des Klimas, von Gebäuden und Landschaften, die so dargestellt werden, wie die Römer sie zu ihrer Zeit sahen und erlebten, verdanke ich dem intensiven Studium antiker archäologischer wie schriftlicher Quellen. Für eventuelle Fehler möchte ich mich jetzt schon bei meinen Lesern entschuldigen.
Dieses Buch will seine Leser hineinversetzen in das Alltagsleben jener Zeit. Es will den Geschichts- und Archäologiebegeisterten jene Atmosphäre, jene Details bieten, die in Geschichtsbüchern gewöhnlich fehlen. Es hat den Anspruch, seine Leser den Geruch der Menge spüren zu lassen, den die Fans der Wagenrennen im Circus Maximus verströmten. Und Ihnen das Funkeln des Lichts auf den Sprossen römischer Fenster zu zeigen.
Da wir natürlich nicht alle Ereignisse jener Jahre kennen können (unsere Reise endet 117 n. Chr.), war es in manchen Fällen nötig, gewisse Anpassungen vorzunehmen. Mitunter geschah ein Ereignis nicht exakt zu dem Zeitpunkt, an dem ich es ansiedle. Doch solche Anpassungen gehorchen immer dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit: Besagtes Ereignis hätte auch zu diesem anderen Zeitpunkt stattfinden können.
Für dieses Buch habe ich mich auf die verschiedensten Quellen gestützt: zuallererst natürlich auf die Autoren der Antike. Dann auf die Erkenntnisse von Archäologen, die mir ihre Funde häufig auch in persönlichen Gesprächen erläuterten. Ergänzt wurde dieses Material durch zahlreiche Bücher und Aufsätze von Fachleuten über das Leben in jener Zeit. Da es mir de facto nicht möglich ist, alle Autoren aufzuzählen, möchte ich einen exemplarisch für alle nennen: Professor Lionel Casson, den großen Altphilologen, der die Reisewege der Antike erforschte.
Was also erwartet Sie in diesem Buch? Ein Blick hinter die Kulissen des Römischen Reiches.
Sie werden feststellen, dass die Welt der Römer in gewisser Weise unserer sehr ähnlich war. Rom hat die erste große Globalisierungswelle eingeleitet. Im ganzen Imperium zahlte man mit einer Währung. Es gab nur eine einzige Verkehrssprache (zusammen mit dem Griechischen, das im Orient gesprochen wurde). Fast alle Menschen konnten damals lesen, schreiben und rechnen. Das römische Recht galt im ganzen Imperium. Güter wurden von einem Ende des Reiches ans andere transportiert. Ob man nun in Alexandria, in London oder in Rom in der Taverne saß, man trank überall den gleichen gallischen Wein und verfeinerte das Mittagsmahl mit Olivenöl aus Spanien. Im Laden nebenan konnte man Tuniken kaufen, die aus ägyptischem Flachs genäht waren, den man in Rom zu Stoff gewebt hatte. (Geschieht heute nicht das Gleiche mit unseren T-Shirts?) Unterwegs konnte man sich in der Raststätte versorgen oder in einem Motel übernachten, genau wie heute. Man konnte sogar Fahrzeuge mieten, die in der nächsten Stadt wieder abgegeben wurden.
So erscheint vieles vertraut, wenn man sich auf eine Rundreise durchs Römische Reich begibt.
Sogar die Probleme ähneln den unseren: Die Scheidungsquote stieg, die Geburtenrate hingegen sank. Das Justizsystem brach unter der Last der anstehenden Prozesse zusammen. Es gab Korruptionsskandale und Herren, die sich aus der Staatskasse bedienten, indem sie Rechnungen für Arbeiten stellten, die nie ausgeführt wurden. Wenn eine bestimmte Holzart in Mode kam, führte dies in der Herkunftsregion zu rücksichtslosem Kahlschlag. Und man klagte über das »Zubetonieren« bestimmter Küstenabschnitte durch den Bau riesiger Villen mit ägyptisierendem Dekor. Die damalige Zeit hatte sogar ihren eigenen »Irakkrieg«! Der Einfall Trajans in Mesopotamien wurde sehr kontrovers diskutiert. Mesopotamien war ebenjene Region, in die Bushs »Koalition der Willigen« einmarschierte. Das hatte auch in der Antike militärische und geopolitische Probleme zur Folge, die unseren heutigen nicht unähnlich sind.
Beim Blick auf vergangene Jahrhunderte stellen wir immer wieder erstaunt fest, wie »modern« das Römische Reich mitunter wirkt. Woher das kommt? Nun, es ist nicht nur militärisch überlegen, sondern verfügt auch über herausragende Ingenieure, die Aquädukte, Thermen, Straßen und Städte mit einer perfekten Infrastruktur bauen.
Auch die Einzigartigkeit des alten Rom lässt uns aufhorchen: Tatsächlich hat keine andere Kultur, keine andere Zivilisation je wieder ein derartiges Reich geschaffen. Möglicherweise waren die alten Römer ja einfach ihrer Zeit voraus. Oder wir hinken hinterher ...
Die Reise, die Sie nun gleich antreten werden, spiegelt eine ungewöhnliche Epoche der römischen Geschichte wider. Zum ersten und gleichzeitig letzten Mal sind der Mittelmeerraum und die Länder nördlich der Alpen beziehungsweise Pyrenäen in einem Reich vereint. Dieser Zustand währte die ersten vier nachchristlichen Jahrhunderte: Es gab keine Grenzen, man konnte frei von einem Ende zum anderen reisen (und musste keine Piraten oder Wegelagerer fürchten). Bald darauf schließt sich die Klammer um diese außergewöhnliche Periode und sollte sich nie wieder öffnen.
Eine der Personen unserer Geschichte nämlich hat entscheidenden Einfluss auf ihren Verlauf: Trajan. Aus den Geschichtsbüchern erfährt man wenig über Kaiser Trajan. In Italien nennt niemand seinen Sohn nach ihm, obwohl es nicht wenige Cesares, Augustos, Constantinos und Alessandros gibt, ja sogar sein Nachfolger Hadrian (Adriano) ist als Namenspatron beliebt. Und doch war er es, unter dem das Römische Reich seine maximale Ausdehnung erreichte. Er schenkte ihm einen Wohlstand, einen Reichtum, einen Lebensstandard, der sich nie mehr wiederholen sollte – ein veritables goldenes Zeitalter also. Wenn Sie in einem Geschichtsbuch eine Karte zur maximalen Ausdehnung des Römischen Reiches finden, dann zeigt diese Karte das Reich unter Trajan.
Dieses Buch möchte die Gestalt des optimus princeps,
ROM
Wo alles beginnt
In der Unterwelt Roms
Schnellen Schrittes eilt sie durch das Gedränge in den Gassen aus gestampfter Erde. Um nicht erkannt zu werden, hat sie ihr Gesicht mit einem Schleier verhüllt. Sie ist eine elegante, kultivierte Frau von vornehmem Wesen. Die Nägel ihrer schmalen, langgliedrigen Hände sind gepflegt; es sind Hände, die noch nie arbeiten mussten. Hier in der Subura, dem Wohnviertel Roms, in dem nicht Seide und Marmor, sondern Hunger und Armut vorherrschen, wirkt sie fehl am Platz.
Mit der Geschicklichkeit einer Katze schlüpft sie zwischen den Menschen hindurch, jede Berührung vermeidend, was hier einigermaßen schwierig ist. Zahnlose Metzger kreuzen ihren Weg, mächtige Rinderviertel auf den Schultern. Kleine, dickleibige Matronen, die sich aufgeregt und lautstark unterhalten, geschorene Sklaven, abgezehrte Männer, die recht ungewaschen riechen, Kinder, die kreuz und quer durcheinanderrennen. Unsere Dame muss achtgeben, wohin sie ihren Fuß setzt, denn ein Netz von Abwasser führenden Rinnsalen zieht sich durch die Gassen und bildet allenthalben kleine Pfützen, an denen sich Schwärme von Fliegen gütlich tun. Ohne jeden Erfolg versuchen die Passanten immer wieder, sie mit ihren nackten Füßen zu verscheuchen.
Von rechts schlägt ihr eine schrille Frauenstimme entgegen. Hinter dieser Tür zankt man sich offensichtlich. Doch ihr bleibt keine Zeit, einen verstohlenen Blick zu wagen, denn das Geflatter eines Huhns im Laden auf der anderen Seite erregt nun ihre Aufmerksamkeit. Dort stapeln sich hölzerne Käfige mit zahllosen Hühnern, die den unverkennbaren Stallgeruch verbreiten.
Die Frau eilt weiter, als wolle sie so schnell wie möglich aus dieser Gasse heraus. Sie kommt an einem alten Mann vorbei, der dort hockt. Er hebt den Kopf, nicht weil ihr Umhang sanft sein Knie streift, sondern weil ihn der zarte Duft ihres frischen Parfüms umweht. Vergeblich suchen seine Augen, eines davon vollständig weiß, diese »Fee« auszumachen, die da vorüberschwebt. Sein gesundes Auge erhascht nur einen Blick auf den wallenden Schleier, der schon hinter der nächsten Ecke verschwindet.
Nun ist sie am Ziel. Hier muss es sein: »Nachdem du abgebogen bist, gehst du weiter die abschüssige Straße hinunter. Bevor sie endet, kommst du an einem Haus mit einer Ädikula, einer kleinen Tempelnische in der Wand, vorbei. Gegenüber siehst du eine Pforte, dahinter Stufen, die nach unten führen. Dort wirst du sie finden«, hatte ihre alte Amme zu ihr gesagt.
Die junge Frau zögert. Die Pforte ist sehr niedrig. Die Stufen scheinen im Dunkeln zu verschwinden. Sie sieht sich noch einmal um. Ringsum nur die Mauern von hoch aufragenden, baufälligen Mietskasernen. Die Feuchtigkeit lässt überall den Putz von den schmutzigen Wänden bröckeln, die Fensterläden sind zerbrochen, die Balkone sehen aus, als müssten sie jeden Augenblick in die Tiefe stürzen, überall hängen Stricke herab. »Wie kann man nur so leben?«, fragt sie sich. Und: »Was tue ich hier eigentlich?« Die Antwort liegt gegenüber auf der anderen Straßenseite verborgen, in diesem dunklen Hauseingang. Ihr Blick kreuzt sich mit dem einer alten Frau in zerknitterter Tunika, die sich plötzlich an einem der Fenster zeigt und mütterlich lächelt. Mit einem Kopfnicken bedeutet sie ihr hereinzukommen, ganz so, als wisse sie, was die junge Frau da unten suche, und wolle ihr Mut machen. Wer weiß, wie viele solcher Frauen sie schon hat kommen und gehen sehen.
Die junge Frau holt tief Luft und tritt ein. Ein beißender Geruch schlägt ihr entgegen, so als würde etwas anbrennen, doch sie kann nicht ausmachen, was es ist. Wenn sie überhaupt etwas erkennen kann, dann macht es den Anschein, als hätte sie die Unterwelt betreten. Nun weiß sie mit Gewissheit, den Ort gefunden zu haben, den sie gesucht hat. Ihr Herz schlägt wie wild, in der Stille des Halbdunkels kann sie sein Pochen beinahe hören. Sie tastet sich noch ein paar Schritte vorwärts – da springt ihr das Gesicht einer Frau aus dem Dunkel förmlich entgegen. Erschrocken zuckt die junge Frau zurück.
Vor ihr steht die Zauberin.
Die »Zauberin« und der Fluch
Die dicke, rundliche Gestalt sieht aus wie eine Frau aus dem Volk, ihr ungepflegtes Haar ist von vielen weißen Strähnen durchzogen. Eindrucksvoll sind ihre schwarzen Augen und der durchdringende Blick, vor allem aber der entschiedene und selbstsichere Gesichtsausdruck. »Hast du alles mitgebracht?«, fragt sie. Die Jüngere reicht ihr ein zusammengerolltes Tuch. Sie nimmt es, dann packt sie die Hände der eleganten Besucherin mit festem Griff und zieht sie zu sich heran. »Willst du, dass er stirbt?« Ihre Augen saugen sich an denen der Jüngeren fest, die verängstigt mit dem Kopf nickt.
Die Zauberin ist bereits über alles unterrichtet. Sie soll ein Ritual ausführen, das den Ehemann der jungen Frau, mit dem sie auf Geheiß ihrer Eltern verheiratet wurde, vom Erdboden verschwinden lässt. Der Mann ist gewalttätig und schlägt seine Frau regelmäßig. Doch seit einiger Zeit findet sie Trost in den Armen eines anderen. Die große Liebe eben. Und so sucht sie in der Welt der Magie nach einem Ausweg.
Die Zauberin wickelt aus, was die junge Frau ihr mitgebracht hat: Haare und Nägel ihres Ehemannes. Dann beginnt sie mit den Vorbereitungen für ihr Zauberritual. Zunächst muss sie aus Mehlteig und den »Stücken« des Mannes, den der Fluch treffen soll, eine Puppe formen. Doch zuvor will sie natürlich bezahlt werden. Die junge Frau zieht einen mit Geldstücken gefüllten Lederbeutel hervor und gibt ihn der Zauberin. Diese macht ihn auf und schüttelt ihn, um den Inhalt zu überprüfen. Ein Lächeln zieht über ihr Gesicht, denn im Beutel sind reichlich Geldstücke. Sie wendet sich ab und verbirgt ihn in einer kleinen Wiege, die an Bändern von der Decke hängt. In der Wiege schläft ein kleines Mädchen. Die Zauberin stößt die Wiege sanft an. Sie mag vielleicht fünfunddreißig, vierzig Jahre alt sein, doch ihr verblühter Körper und ihr vernachlässigtes Äußeres lassen sie um einiges älter wirken.
Ihre Behausung ist dunkel und schmutzig, erhellt nur vom Feuer, das im Herd brennt. Über der Feuerstelle hängt ein kleiner Kessel, in dem ein eigenartiges Gebräu schäumt. Dessen beißender Geruch war der jungen Frau beim Eintreten in die Nase gestiegen, ein Zaubertrank möglicherweise, den sie für eine ihrer Kundinnen zubereitet.
Diese caccabus genannte Art von Kessel ist ein typisches Requisit jener Frauen aus dem niederen Volk, die Kräutermedizinen herstellen und notfalls zu Zaubersprüchen und Flüchen greifen, wie auch Vergil berichtet. Wenn Sie so wollen, sind diese Frauen Hexen. Über die Jahrhunderte hin wird der caccabus-Kessel mit dem Bild der Hexe verknüpft bleiben. Tatsächlich wird unsere Zauberin sämtlichen Klischeevorstellungen gerecht, stellt man sich doch unter einer Hexe eine nicht mehr junge Frau vor, die ihre Reize eingebüßt hat (oder, anders gesagt, hässlich ist wie die Nacht). Sie ist arm und schlecht gekleidet, haust in einer ärmlichen Unterkunft (mit Sicherheit nicht in einem vornehmen Haus) und bereitet Gifttränke zu. Hier hat der Hexenglaube seinen Ursprung: bei einem ganz bestimmten Typ Frau aus den untersten Bevölkerungsschichten, der sich zu allen Zeiten und Epochen (nicht nur im römischen Altertum) auf Magie und Hexerei verlegt hat, um sich die Leichtgläubigkeit der einfachen Leute, ihre Schwächen und vor allem ihre Leiden zunutze zu machen.
Die mit Sesterzen, Drachmen, Gulden, Schillingen – oder Euros – gefüllten Beutel, die sie den Leuten über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg abgeluchst haben, sind sicher eine der gemeinsten und am wenigsten geahndeten Formen von Diebstahl. Auch im Rom zu Zeiten Trajans.
Die Puppe ist jetzt fertig. Sie sieht aus wie ein Mann, sogar die Geschlechtsorgane sind angedeutet. In den noch nicht ausgehärteten Teig, aus dem sie den Leib der Puppe geknetet hat, ritzt die Zauberin nun einige Zaubersprüche, die wohl nur sie selbst zu entziffern vermag. Nachdem sie eine Reihe von Ritualen ausgeführt und mit lauter Stimme die Götter der Unterwelt beschworen hat, steckt die Zauberin die Puppe mit dem Kopf nach unten (in symbolhafter Stellung) in ein zylindrisches Gefäß aus Blei. Dieses Gefäß kommt wiederum in zwei größere Gefäße. Zum Abschluss versiegelt die Zauberin ihre schwarzmagische »Matroschka« mit Wachs und ritzt mit einem Messer Verwünschungsformeln und Fluchbilder ein. Nun hebt sie mit schweißnassem Gesicht den Behälter über ihren Kopf und legt dabei die Fingerspitzen aneinander. Sie rezitiert noch einmal magische Formeln und überreicht das Gefäß der jungen Frau. »Geh jetzt«, sagt sie zu ihr, »du weißt, wohin du das bringen musst.« Die Frau nimmt das Gefäß, das die Maße einer großen Konservendose hat, jedoch aufgrund seiner bleiernen Konsistenz sehr viel mehr wiegt. Sie wickelt es in ein Tuch und geht, ohne der Zauberin auch nur noch einen Blick zuzuwerfen.
Das Licht auf der Straße hat sich verändert. Auch wenn in den engen Gassen Roms die Strahlen der Sonne niemals den Boden berühren, weiß die junge Frau doch, dass die Sonne nun auf der anderen Seite der Dächer stehen muss. Wer weiß, wie lange sie bei der Zauberin gewesen ist. Nun muss sie sich sputen.
Die Quelle der Anna Perenna
Tags darauf geht die Frau zusammen mit der alten Amme hinaus vor die Stadt. Ihrem Mann hat sie erzählt, sie wolle eine Verwandte besuchen. Die beiden folgen der Via Flaminia. Unvermittelt erheben sich zu ihrer Rechten Hänge aus gelbem Sedimentgestein, die gänzlich mit Wald bedeckt sind. Den »Hügel« gibt es noch, auf ihm wurde schließlich Parioli gegründet, eines der Stadtviertel Roms. Heute ist dieses Gebiet dicht bebaut, doch ein Stückchen des Waldes hat überlebt und ist noch zu sehen. Unberührt liegt es im Stadtzentrum und bildet eine der vielen grünen Inseln der italienischen Hauptstadt. Die Bäume dort, für die Autofahrer und Fußgänger kaum mehr als einen flüchtigen Blick übrig haben, sind also tatsächlich die direkten Nachfahren jener Bäume, die in römischer Zeit einen heiligen Wald bildeten.
Die beiden Frauen folgen einer gut befestigten Straße, die von der Flaminia abzweigt und in ein Tal dieses »Hügels« führt. Nun sind sie in das Herz des heiligen Hains eingetaucht. Es ist wunderschön hier. Tiefe Stille herrscht, nur durchbrochen vom Gezwitscher der Vögel. Welch ein Unterschied zum lauten Treiben Roms. Zwischen den Bäumen, die die Hänge des kleinen Tals umschließen, öffnen sich Grotten, die den Nymphen geweiht sind. Diese Wälder sind unantastbar: Wehe dem, der wagt, hier eine Blume zu pflücken oder einen Baum zu schlagen. Die Baumreihen dieses Hains gelten den Römern als Tempel. Und selbst in Wäldern, die nicht tabu sind, ist es angebracht, mit Bedacht zu Werke zu gehen, ehe man einen Baum fällt. Denn nach römischem Glauben wohnen beispielsweise unter der Rinde von Eichen Nymphen, die Dryaden, die eng mit dem Leben der Pflanze verquickt sind. Ehe man also einen Baum schlagen kann, muss ein Priester ein Ritual durchführen, damit die Dryaden ihren Wohnsitz verlassen.
In der Mitte des kleinen Tales, dort, wo es sich zu einer ebenen Lichtung öffnet, entspringt eine Quelle, das Zentrum des ganzen Ortes. Um die Quelle wurde ein großer Ziegelbau mit einem Hauptbecken errichtet, das die Wasser der Polla und ihrer Seitenarme aufnimmt und aus dem die Gläubigen das heilige Wasser schöpfen.
Diese Quelle ist heilig, denn sie ist einer Gottheit geweiht, die allerdings einen eigenartigen Namen trägt: Anna Perenna. Bei ihr handelt es sich nicht um eine konkrete Person, wie der Name vielleicht vermuten lässt, sondern sie ist die Göttin, der das Verstreichen und die Erneuerung des Jahres unterstehen. Nicht umsonst lautet ein häufiger Glückwunsch bei den Römern: annare perennereque commode, was so viel bedeutet wie: vom ersten bis zum letzten Tag ein gutes Jahr haben – ein Glückwunsch, der vor allem zum Jahresbeginn ausgesprochen wurde.
Da wir gerade beim Thema sind: Auf welchen Tag fällt eigentlich das römische Neujahr? Auf den ersten Januar in der Kaiserzeit, in republikanischer Zeit auf die – berühmt-berüchtigten – »Iden des März«, also den 15. März. Dann kommen die Menschen zu Tausenden, um hier an der heiligen Quelle der Anna Perenna den Neujahrstag zu feiern. Die Szenen, die sich bei diesen Festivitäten abspielen, müssen den Berichten der Alten zufolge beeindruckend gewesen sein.
Das Neujahrsfest der Römer: ein antikes Woodstock
Stellen Sie sich das einmal bildlich vor: Eine lange Kolonne von Männern und Frauen zieht aus Rom aus und kommt hierher, um zu schmausen, zu singen und sich zu amüsieren. Die gesamte Via Flaminia entlang werden Tische aufgestellt, doch die meisten Leute lassen sich einfach im Gras nieder wie zu einem riesigen Picknick. Man singt und tanzt und spricht kräftig dem Rebensaft zu. Der eine oder andere Trinkspruch dürfte schwer einzulösen gewesen sein: Einen Becher Wein für jedes Jahr, das du noch leben willst! Vieles von diesem Treiben erinnert an unsere heutigen Silvesterpartys, allerdings ging es um einiges feuchtfröhlicher zu: Man könnte das Ganze gut für einen antiken Vorläufer des Oktoberfestes halten.
Tatsächlich ist es aber mehr als das: Ovid zufolge geht es bei diesem Fest sehr ausgelassen zu, und es hat einen eindeutig erotischen Hintergrund. Man zecht und man treibt es miteinander. Ovid erzählt weiter, dass die Frauen mit aufgelöstem Haar Lieder mit unverhohlen sexuellen Anspielungen sangen. Dieses Fest hat Initiationscharakter, und so manches Mädchen verliert hier seine Unschuld. Ein bisschen wie zu Woodstock-Zeiten lassen sich die Pärchen ins Gras sinken oder ziehen sich kurzerhand in aus Ästen, Stöcken und Togen improvisierte Zelte zurück. Tatsächlich sehen einige Gelehrte in jenen Holzfragmenten, die im Hauptbecken der Quellenanlage gefunden wurden, Überbleibsel jener »Notzelte«.
Die Quellenanlage wurde bei den Arbeiten für ein unterirdisches Parkhaus wiederentdeckt. Die Ausgrabungen unter der Leitung von Frau Professor Marina Piranomonte vom Amt für Denkmalpflege der Stadt Rom, der Soprintendenza archeologica di Roma, förderten zahlreiche Objekte zutage, die als Opfergaben ins Wasser geworfen worden waren. Zum Beispiel Eier, die als Fruchtbarkeitssymbole galten, oder auch Pinienzapfen, die ebenfalls Fruchtbarkeitssymbole sind, aber auch für Keuschheit stehen können. Dann aber entdeckten die Archäologen einige Objekte, die ihre besondere Aufmerksamkeit erregten, da sie nicht mit dem Kult der Anna Perenna in Verbindung gebracht werden konnten, sehr wohl aber mit magischen Praktiken und Verwünschungen.
Magische Ritualgegenstände
Bei den erwähnten Grabungen wurden neben einem prächtigen caccabus (einem »Hexenkessel«) mindestens fünfhundert Münzen entdeckt, welche die Römer an heiligen Stätten opferten, wie das ja auch heute noch vielfach geschieht. Und wie die heutige Praxis zeigt, sind es nie große Münzen, die geopfert werden: Die meisten der gefundenen Münzen sind Asse. Ein As entspricht einem Viertelsesterz und besitzt in heutiger Währung einen Wert von circa 50 Cent.
Des Weiteren wurden gut siebzig Lampen ausgegraben, die – und das ist das Merkwürdige – fast alle neu waren. Aus welchem Grund sollte man über viele Epochen hinweg so viele neue Lampen aus Rom hierherschaffen, um sie dann in einen Brunnen zu werfen? Sowohl Ovid wie Apuleius beschreiben in ihren Werken die Rituale antiker Zauberinnen. Da die meisten dieser Rituale nachts stattfanden, waren die Lampen sowohl für die Zauberin wie für ihre Kundschaft ein wichtiges Requisit. Und sie mussten neu sein. Daher ist anzunehmen, dass die gefundenen Lampen nicht im Kult der Anna Perenna Verwendung fanden, sondern zu magischen Ritualen oder Beschwörungen gehörten. Dieser Schluss liegt nahe, da sechs dieser Lampen im Inneren mit Verwünschungsformeln versehen sind.
Die Verwünschungstheorie ist auch insofern interessant, als in dem Becken etwa zwanzig dünne Bleiplättchen, sogenannte Fluchtafeln oder defixiones, gefunden wurden. Da Blei weich und leicht zu bearbeiten ist, anderseits nicht rostet, wurde es anderen Materialien vorgezogen. Man beschafft sich einen kleinen, dünnen Streifen Blei, ritzt Verwünschungen hinein, faltet das Ganze zusammen und versenkt diese Bleilamellen in einem Grab, einem Brunnen, einem Fluss oder einer Quelle (wie jener, die der Anna Perenna geweiht ist). Man glaubt nämlich, dass diese Orte direkt mit dem Fluss der Unterwelt beziehungsweise den Göttern der Unterwelt verbunden sind und diese dann die Verwünschungen, sobald sie ihnen übergeben werden, verwirklichen. Ein ebenso merkwürdiges wie erheiterndes Detail ist, dass neben den characteres, den magischen Formeln und Zeichen, mit denen das Täfelchen sozusagen »scharf« gemacht wurde, auch der Name des Opfers mehrfach wiederholt wird. Manchmal werden auch genaue Angaben zu seiner Person (wohnt da und da, übt diesen Beruf aus) gemacht. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Gottheiten der Unterwelt nicht versehentlich den Falschen erwischen. Fast so, als würde man einen Killer anheuern und ihm ein genaues Profil des Opfers geben.
Doch wer waren eigentlich die Opfer?
In eine der entdeckten defixiones zum Beispiel ist eine menschliche Gestalt eingeritzt und daneben der Name des Mannes, Sura, sowie sein Beruf: Er ist eine Art Schlichter, ein Richter vielleicht. Ihm sollen die Götter der Unterwelt die Augen herausreißen, erst das rechte, dann das linke, denn, so kann man auf dem Täfelchen lesen: Qui natus est da vulva maledicta – »Er ist geboren aus einer verfluchten Scheide«. Ein Hurensohn also.
Römische Voodoo-Puppen
Berühmt wurde die Quelle der Anna Perenna aber durch den Fund von sieben (vollständig erhaltenen) menschlichen Figuren, die ganz offensichtlich zu magischen Riten benutzt wurden. Sie ähneln traditionellen Fluchpuppen oder Voodoo-Puppen.
Genau so ein Fluchritual, bei dem der Fluch auf ein materielles Objekt wie zum Beispiel eine Puppe übertragen wird, hat unsere Zauberin soeben durchgeführt.
Laboranalysen zeigen, dass der Teig, aus dem die Püppchen gefertigt werden, aus Milch und Mehl besteht. Nur eine wurde aus Wachs hergestellt. Man erkennt deutlich Augen und Mund, Brüste oder das männliche Glied, je nach Geschlecht des Opfers. Bei mindestens einer dieser Puppen wurden die Füße absichtlich zerschmettert. Diese fragilen Figuren haben sich nur deshalb erhalten, weil sie sich auf dem Grund des Brunnens sammelten, wo sie langsam in eine Tonschicht einsanken. Sauerstoffmangel sorgte dafür, dass die Bakterien ihr Werk nicht verrichten konnten, was die Puppen vor dem Verfall bewahrte.
Ihre Behältnisse sind durchweg aus Blei. Jede Puppe steckt in genau drei dieser Behälter, die ineinandergesteckt wurden. Auch die Zahl drei hat sicher eine magische Bedeutung.
Als »Rückgrat« dient den Puppen ein Knochen, in den – in mindestens einem Fall – lateinische Buchstaben eingeritzt wurden. Genau das empfahlen die berühmten griechischen Papyri, in denen wir die Zauberrituale der Antike überliefert finden.
Doch die Untersuchung der aufgefundenen Puppen zeigt, dass es auch andere magische Praktiken gab. Eine der Puppen ist beispielsweise über und über mit magischen Formeln bedeckt und hat ein Loch im Kopf. Es ist nicht schwer, sich auszumalen, welche Wirkung auf das Opfer beabsichtigt war. Am ungewöhnlichsten aber wirkt eine Puppe, um deren Körper sich eine Schlange windet, die der Puppe ins Gesicht beißt. Als würde das nicht genügen, ist auch noch ein hauchdünnes Metallplättchen um die Figur gewickelt. Ein weiteres trägt Zauberformeln und ist mit zwei Nägeln befestigt, am Nabel und an den Füßen. Auch dies hat möglicherweise symbolische Bedeutung.
Vermutlich haben sich viele Römer derartiger Praktiken bedient. Das zeigt allein die Tatsache, dass die Bleibehälter für die Fluchpuppen in Serie gefertigt wurden. Wer immer einen Schadenszauber brauchte, kaufte diese Behältnisse und brachte sie zur Zauberin. Es gab einen florierenden Markt für diese Gegenstände, der viel Geld abwarf.
Die in der Quelle der Anna Perenna gefundenen Bleibehälter waren mit Wachs verschlossen. Auf einer dieser Wachsschichten fand sich ein Fingerabdruck quasi als Siegel. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung des Stückes fand man heraus, dass der Fingerabdruck außerordentlich klein war. Er musste von einem sehr jungen Mann oder einer Frau stammen! Aber sagten nicht schon die römischen Autoren, dass Zauberei Frauensache war?
Botschaften an die Götter der Unterwelt
Die junge Frau und ihre alte Amme nähern sich der Quelle. Vorsichtig sehen sie sich um: niemand in Sicht. Eilig packt die Amme den Behälter aus dem Tuch, das ihn verborgen hat. Dann wirft sie ihn in hohem Bogen in die Quelle. Die »Dose« verschwindet im Dunkel, und man hört das dunkle Plopp, mit dem sie ins Wasser fällt. Die beiden Frauen sehen sich lächelnd an.
Die Quelle der Anna Perenna bleibt als Kultstätte noch eine Zeit lang erhalten. Sie schenkt angeblich Fruchtbarkeit und Glück. An diesem Ort wird noch bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. hinein das Neujahrsfest gefeiert. Dann allmählich gerät die eigentliche Bedeutung des Kults in Vergessenheit. Im 4. und 5. Jahrhundert wird er zunehmend vom Aberglauben überwuchert. Das liegt vor allem daran, dass die Quelle verschlossen wurde. (Unter Theodosius I. werden heidnische Kulte verboten, und das Christentum wird Staatsreligion.) Die römische Gesellschaft hat ihr Wertesystem verloren und steht kurz vor dem Zusammenbruch. Nur wenige Jahrzehnte später ist der Kult der Anna Perenna vergessen.
Das bedeutet aber nicht, dass man keine püppchengefüllten Bleibehälter mehr in der Quelle versenkt. Vor allem zu Neujahr wird dies immer noch praktiziert. Wir haben nur einen kleinen Zeitsprung nach vorne gemacht. Denn was unsere Geschichte erzählt, ist mehr als wahrscheinlich.
Die beiden Frauen verlassen die Quelle. Ihre »Mission« ist erfüllt. Auf dem Grund der Hauptquelle liegt zwischen Eiern und Pinienzapfen ein Bleibehälter, der gleichsam einen Antrag auf Tötung darstellt. Der Mann, um den es dabei geht, ist gerade mit seinem Pferd zu seinem Landgut aufgebrochen. Er weiß von nichts.
Für die beiden Frauen aber ist das Ganze nur eine Frage der Zeit – sie wissen, dass der Fluch irgendwann wirkt. Daher wird die junge Frau heute Nacht wieder ihren Liebhaber treffen.
Die Farben der Nacht
In ihren Augen spiegelt sich die Farbe der Nacht. Die Strahlen des Mondes fallen durch das Gitter an ihrem Fenster und malen elegante Arabesken auf den Boden. Schwarze Efeuranken, die sich durchs Haus schlängeln, aufs Bett kriechen, über die Kissen, um ihren nackten Körper einzuhüllen, ihre Brüste, ihr Gesicht zu liebkosen. Licht und Schatten spielen auf ihrer Haut Fangen. Eine Lichtinsel umfängt ihre fleischigen Lippen, auf denen ein zärtliches Lächeln liegt. Ihre Augen leuchten im frischen Grün junger Haselnüsse. Tagsüber ziehen sie die Blicke auf sich, nachts leuchten sie wie zwei Sterne in der Unendlichkeit des Universums. Doch heute verliert sich der Blick der Frau in einer anderen Art Unendlichkeit, dem Meer der Sinne.
Auf ihrer Brust funkelt es wie Diamanten: Ein Schweißtropfen sucht sich seinen Weg durch ihre Brüste und besiegelt eine Nacht voller leidenschaftlicher Seufzer. Als sich ihre Muskeln im Aufschrei der Lust entspannen, verschwindet der funkelnde Tropfen zwischen den Lippen des Mannes.
Eine lange, zärtliche Umarmung, dann erhebt er sich und geht in den kleinen Raum nebenan. Das Mondlicht tanzt auf seinen Muskeln, seinen Schultern, seinem Gesäß und macht jeden Schritt zu einem Lichtspiel. Er tritt auf die Terrasse hinaus und stützt sich mit beiden Händen auf das Holzgeländer. Tief saugt er die Luft in seine Lungen. In dieser heißen Sommernacht scheint es kaum genug Luft zum Atmen zu geben. Wenige Minuten später hört er den leichten Schritt einer Frau in seinem Rücken. Dann spürt er, wie ihr Körper sich gegen den seinen drückt. Zum Glück liegt das Gebäude auf einem der Hügel Roms, dem Quirinal. Dort weht immer eine leichte Brise. Eng umschlungen stehen die beiden da und betrachten sinnend das Spektakel, das sich ihnen bietet: das antike Rom auf dem Gipfel seiner Schönheit und Macht.
In dieser Vollmondnacht scheint die Ewige Stadt keine Grenzen zu kennen. Die Bauten erstrecken sich, so weit das Auge reicht. Dahinter ist nur Dunkelheit. Nur was den Hügel umgibt, ist klar zu erkennen: große insulae, ähnlich den heutigen Mietshäusern, mit ihren weiß gestrichenen Mauern und den roten Ziegeldächern. Man sieht in die Fenster hinein, weil die Läden wegen der Hitze ausgehängt wurden. Balkone mit Tontöpfen, in denen sich Pflänzchen ranken – fast wie heutzutage. Manche sind ganz von Holzgittern umgeben, wie man sie in Indien noch häufig sieht. Es sieht aus, als habe man hölzerne Schränke an die Gebäude gehängt.
Hinter den offenen Fenstern ist es dunkel. Die Menschen schlafen. Nur da und dort erhellt das Licht einer Öllampe das Innere des Hauses. Von den Lichtpunkten der Öllampen und Fackeln übersät, verwandelt die Stadt sich in eine eigene Galaxie, die vor dem Nachthimmel funkelt.
Die Stille wirkt ein wenig überraschend. Tagsüber produziert die Stadt mit mehr als einer Million Einwohnern einen ungeheuren Lärm, doch nicht so in der Nacht. In manchen Gassen herrscht absolute Stille, nur unterbrochen vom Wasserstrahl, der aus der öffentlichen Wasserleitung plätschert; oder von einem Hund, der in der Ferne bellt, einem Lachen, das irgendwo erklingt.
Allerdings wird nachts auch Ware an die Geschäfte geliefert, die Läden, die Thermen. Dann rollen Fuhrwerke durch die Stadt, die Straße hallt wider von den Flüchen der Kutscher, weil man ihnen an der letzten Kreuzung die Vorfahrt genommen hat. Lautes Schimpfen ertönt, weil die Lieferung nun schon wieder zu spät kommt. Doch verglichen mit dem Treiben tagsüber, entfaltet Rom erst in der Nacht seinen wahren Zauber. Jenen Zauber, den es auch heute zeigt, wenn man durch seine nächtlichen Straßen spaziert.
Von dort oben, vom Quirinalshügel (der seinen Namen von einem Tempelchen hat, das der vorrömischen Gottheit Quirin geweiht war), sieht man die dunklen Rücken der anderen sechs Hügel im Mondlicht schimmern. Auch das Kolosseum stemmt seine vertraute Gestalt gen Himmel.
Die beiden Verliebten flüstern sich Zärtlichkeiten ins Ohr, während ihr Blick auf das gigantische Amphitheater fällt, das Stück um Stück von der Morgenröte erhellt wird. Der weiße Marmor, die Fackeln und die Leuchter, die die Arkaden erhellen, ziehen ihre Blicke an wie ein gigantischer Magnet. Doch sie wissen nicht, dass im Schatten des Kolosseums gerade etwas geschaffen wird, was uns auf eine lange Reise in die entlegensten Winkel des Imperiums führen wird, aber auch in seine prunkvollsten. Es nimmt gerade Form an in einem der schrecklichsten Orte Roms. Einem wahren Inferno, das sich hinter dem Kolosseum auftut: der Münzanstalt.
Ein Sesterz wird geboren
Die Hitze ist erdrückend. Kann man schon draußen kaum atmen, so hat man hier drinnen das Gefühl, einen Backofen betreten zu haben. Dafür sorgt schon der flackernde Schein der Fackeln. Sie tauchen den Raum in orangefarbenes Licht. Unser Blick fällt durch ein mit Beschlägen verziertes Portal auf eine lange Wand. Der Putz blättert ab, über die Wand zucken flüchtige Schatten, sie entstehen und vergehen wieder. Manchmal scheinen sie sich zu einem frenetischen Tanz zu vereinen, um dann von Neuem zu verschwinden. Sie sind der helle Widerschein dessen, was dort drinnen geschieht. Was mag das wohl sein?
Wir schieben uns durch das Portal hinein. Laute Hammerschläge hallen in unseren Ohren wider. Mächtige Schläge, die auf Metall niedergehen. Wir wenden uns um und scheinen mitten in Dantes Hölle gelandet zu sein: Schwitzende, halb nackte Männer in kleinen Gruppen heben schwere Hämmer über den Kopf und lassen sie niedersausen. Hier werden die Sesterzen geprägt, die durch das ganze Reich wandern. Und nicht nur sie. Je nach Jahreszeit werden dort auch Denare (Silbermünzen) geschlagen, Aurei (Goldmünzen), aber auch kleinere Münzen aus Bronze (Dupondien) und Kupfer (Asse, Semes).
Augustus hat nämlich ein strenges Währungssystem eingeführt, das als Grundlage des Handels im Römischen Reich dient. Ein Aureus (Gold) ist wert:
25 Denare (Silber)100 Sesterze (Bronze)200 Dupondien (Bronze)400 Asse (Kupfer)800 Semes (Kupfer).Wir nähern uns einer solchen Gruppe von Männern. Es sind die Arbeiter der Münzanstalt. Eines ist auf Anhieb klar: Es handelt sich um Sklaven. Sie gehören zur sogenannten familiamonetalis, der »Münzfamilie«, und stehen ständig unter strenger Auf sicht. Schließlich handelt es sich bei dem Material, das sie hier verarbeiten, um Silber und manchmal auch um Gold. Die Wachen haben also stets ein waches Auge auf sie. Am Ende der Schicht werden alle Arbeiter gründlich durchsucht, um Diebstähle zu verhindern. Sie müssen ihre Sandalen ausziehen, die Haare werden durchkämmt, sogar der Mund wird abgetastet. Der Boden der Münzstätte besteht aus Gitterrosten, damit jedes noch so kleine Stück Edelmetall aufgefangen werden kann.
Heute werden Sesterzen geprägt, und wir dürfen zuschauen. Der erste Schritt ist das Gießen der Bronzebarren.
Gleich neben der Prägehalle stehen die Schmelzöfen, in denen man mittels unvorstellbarer Hitze Kupfer und Zink verflüssigt. Der Schmied packt mit langen Zangen den Schmelztiegel und gießt den Inhalt in eine feuerfeste Tonform. Die flüssige Bronze ist glühend heiß. Aus der Eingussöffnung tritt heißer Rauch. Der Schmied schließt die entzündeten Augen. In diesem Beruf gibt es nur selten Pausen. Sein Gesicht glüht noch röter als seine Haare. Man muss nun abwarten, bis die Flüssigkeit abgekühlt ist. In der Zwischenzeit öffnet ein anderer Sklave die bereits abgekühlten Tonformen und holt die Bronzebarren heraus. Diese werden dann zu dünnen Plättchen gesägt, ähnlich wie man eine Salami schneidet. Aus jedem Plättchen wird ein Sesterz. Natürlich muss man es noch ein wenig abrunden, damit die Form stimmt. (In der Volkssprache nennt man den Sesterz denn auch »Rundling«.)
Nun haben wir die Rohmünze vor uns, ohne Aufschrift und Münzbild. Dann wird der Rohling genau gewogen. Das ist zu jener Zeit wichtig, denn der Wert einer Münze bestimmt sich durch ihr Gewicht und nicht durch die Prägung. (Bei Goldmünzen versteht sich das von selbst, doch Gleiches gilt auch für Silber- oder Bronzemünzen.) Nun wird der Rohling wieder erhitzt und an die Männer mit den Prägestempeln weitergegeben. Diese werden das Bild des amtierenden Kaisers auf die Vorderseite prägen und auf die Rückseite Inschrift, Zahlen und so weiter. (Daher der Ausdruck »Kopf« oder »Zahl«.)
Wir stehen unmittelbar neben den Arbeitern. Sie sind gereizt und erschöpft, denn die Schichten sind unmenschlich. Und wenn sie einen Fehler machen, bekommen sie die Grausamkeit der Wachen zu spüren.
Einer der Sklaven nähert sich und legt die runde, noch blanke Münze auf einen kleinen, runden Amboss. Und zwar genau in die Mitte, wo das reliefartige Prägeeisen mit dem Bild des Kaisers liegt. Mit einem kräftigen Hammerschlag wird der Münze das Bildnis aufgeprägt. Und die Rückseite? Ganz einfach, das funktioniert genauso. Nachdem der erste Sklave die Münze mit der Zange auf den Amboss gelegt hat, bedeckt ein anderer sie mit dem Prägeeisen für die Rückseite. Auf diese fährt nun der mächtige Hammer eines dritten Sklaven hernieder.
Den Bruchteil einer Sekunde lang sehen die drei Männer sich an. Der Sklave mit dem Hammer ist ein riesenhafter Kelte mit roten Haaren. Er lässt den Hammer mit Macht niedersausen. Die beiden anderen schließen die Augen. Vor allem der Syrer verzieht das Gesicht so stark, dass seine Augen kaum noch zu sehen sind. Der Afrikaner fletscht die Zähne. Der Schlag hat eine solche Wucht, dass der Gitterrostboden erzittert. Einen Augenblick lang wenden sich die Blicke aller den dreien zu, selbst der Wächter der Gruppe daneben sieht herüber. Ein Schlag wie dieser ist auch hier keine Alltäglichkeit.
Dem Syrer klingt der metallische Laut noch in den Ohren nach, seine Hände kribbeln. Doch er dankt den Göttern, dass der Riese nicht danebengehauen hat, denn sonst wären seine Hände jetzt zerschmettert. Der Afrikaner sagt kein Wort. Der Kelte mustert zufrieden das Ergebnis. Einen Augenblick lang ist dieser Moment, der sich hier gleichwohl ständig wiederholt, zu etwas ganz Besonderem geworden.
Alle betrachten die frisch geprägte Münze. Der Mann mit dem Prägeeisen nimmt sie mit einer Zange vom Amboss; ein Dicker mit lockigem Bart. Auch er begutachtet sie eingehend. Doch der Schlag war perfekt. Das Gesicht des Kaisers sitzt genau in der Mitte. Die Schrift ist gut lesbar. Einen kleinen Fehler hat die Münze allerdings: An der Seite ist ein feiner Haarriss sichtbar. Dafür kann niemand etwas. Das Prägeeisen ist eben schon »müde«, wie es heißt. Zu viele Sesterzen wurden damit schon geschlagen. Vielleicht ist es auch schon kaputt.
LONDON
Römische Erfindungen
Der Beginn einer langen, langen Reise
Der Soldat stößt einen Pfiff aus, und schon legen sich die schweren weißen Pferde in die Seile. Diese straffen sich und reißen an den Ringen, die an den Flügeln des schweren, hölzernen Tores angebracht sind. Die Türangeln, die sich so lange nicht bewegt haben, ächzen, Staub wirbelt auf, und schließlich setzen sie sich quietschend in Bewegung.
Die Flügel des Tores öffnen sich zentimeterweise, so als würde ein schläfriger Riese die Arme ausbreiten. Die Sonne schickt ihre ersten Strahlen und zeichnet dunkle Schatten auf die moosüberwucherten Mauern des Kastells. Über das Quietschen der Angeln werden kurze Befehle gebellt. Das Lateinische hat einen eindeutig germanischen Akzent, denn die kleine Befestigungsanlage wird von Tungrern gehalten, römischen Auxiliartruppen, die aus den Gebieten nördlich der Ardennen stammen. Ursprünglich waren die Tungrer Gallier, doch mittlerweile sind sie seit mehreren Generationen »romanisiert«.
Noch bevor das Tor ganz geöffnet ist, stürmt eine turma hindurch, eine Schwadron von dreißig Reitern. Es handelt sich um Kurierreiter des römischen Heeres. Ihre Pferde sind an beiden Flanken mit dicken Bündeln bepackt, in denen die frisch geschlagenen Münzen transportiert werden. Die Kuriere bringen das Geld in die entfernten Bezirke im Norden des Reiches: in Kastelle, Provinzhauptstädte, in denen römische Statthalter residieren, in die wirtschaftlichen Dreh- und Angelpunkte des Imperiums, die strategischen Vorposten Roms.
Das ist der normale Ablauf: Sobald neue Münzen geprägt wurden, werden sie im Reichsgebiet verteilt. In diesen Zeiten ohne Fernsehen, Radio oder Telefon sind die Münzen nämlich nicht nur Handels- und Tauschmittel, sondern auch Propagandainstrument und Informationsträger. Im Grunde ist jede Münze ein politisches Statement, ein Manifest, das für ein bestimmtes Programm steht.
Auf der Vorderseite sehen wir das Profil des herrschenden Kaisers: Trajan mit ernster Miene. Sein Haupt – im Profil nach rechts gezeigt, wie das auf diesen Münzen üblich ist – schmückt ein Lorbeerkranz. Die Botschaft ist klar: Der mächtigste Mann im Reich (der Einzige, der sein Amt auf Lebenszeit behält) glaubt an die traditionellen Werte. Er ist Soldat und »Sohn« des Senates. Von Kaiser Nerva zum Nachfolger bestimmt, tritt er für Tradition und Beständigkeit ein.
Die Rückseite der Münze zeigt meist eine Errungenschaft, die dem Herrscher zu verdanken ist: ein Monument, das er für das römische Volk hat bauen lassen, wie den Circus Maximus, den neuen Hafen in Ostia, eine gewaltige Brücke über die Donau, ein Aquädukt für Rom, das Forum im Herzen der Stadt et cetera; oder ein Symbol für eine militärische Eroberung – meist eine Darstellung der Besiegten –, in deren Gefolge neue Länder ins Römische Reich eingegliedert wurden, wie zum Beispiel Dakien, das spätere Rumänien. Manchmal aber finden sich auf der Rückseite einer Münze auch Darstellungen von Gottheiten, die für bestimmte positive Kräfte wie Fülle, Vorsehung, Eintracht et cetera stehen. So soll gezeigt werden, dass diese Gottheiten dem Kaiser wohlgesonnen sind.
Doch ob Sieg, neuer Monumentalbau oder Titel, die Neuigkeit muss allen Untertanen des Reiches bekannt gemacht werden, wie es heute durch die Nachrichten geschieht. Ebendiese Funktion übernehmen im Altertum die Münzen: Über sie kommuniziert der mächtigste Mann im Staat mit seinen Untertanen.
Wie wichtig diese Funktion ist, wird deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, was geschieht, wenn ein neuer Kaiser an die Spitze des Reiches tritt. Innerhalb weniger Stunden läuft eine Serienproduktion von neuen Münzen mit seinem Bild an, die in alle Provinzen des Imperiums gebracht werden. Manchmal wird nur das Konterfei des alten Kaisers verändert, der erst seit wenigen Stunden tot ist: Man feilt etwas am Prägeeisen (eine antike Form der Bildretusche sozusagen). In den meisten Fällen allerdings machen sich eilig die Graveure ans Werk und gestalten einen Prägestempel mit dem Profil des neuen Herrschers, sodass jeder Untertan erfährt, wer nun »offiziell« die Macht ergriffen hat.
Der Einsatz des Bildes für politische Zwecke ist keine Erfindung der Moderne: Schon die alten Römer wussten um die Wirkung von Bildern und machten davon reichlich Gebrauch. Nur wurde eben statt Fernsehen oder Zeitung eingesetzt, was damals an »Medien« zur Verfügung stand: Münzen, Statuen, Inschriften, Reliefs und so weiter.
Zu dem Zeitpunkt jedoch, da wir unsere Reise antreten, liegt die Thronbesteigung Kaiser Trajans schon längere Zeit zurück. Doch ist dies kein Grund, es beim Prägen von Sesterzen an Sorgfalt fehlen zu lassen. Tatsächlich herrscht in der Münzanstalt allgemeine Zufriedenheit. Das kleine Meisterwerk wird hunderttausendfach »geklont«, um sodann im ganzen Imperium in Umlauf gebracht zu werden. Die Münzen, die wir auf ihrer Reise begleiten, sind quasi eine Art »Wurfsendung« von propagandistischem Charakter.
Die anderen Münzen nehmen einen etwas gewöhnlicheren Weg. Sie werden der Staatskasse übergeben, damit sie in Rom ausgegeben werden – auf den Märkten, in den Läden, in den Schänken. Von Rom aus wandern sie in aller Herren Länder – auf Handelswegen und bei Reisen zu Lande und zur See. Ihre Verbreitung besorgt der Geldwechsler, der argentarius, der in der Antike die Funktion unserer Banken einnahm.
Doch nicht alle Münzen nehmen den gleichen Weg. Silbermünzen beispielsweise verbreiten sich viel schneller. Da sie einen hohen Wert haben und andererseits sehr klein sind, befüllt man damit gern die Reisekasse. Ein paar Silbermünzen, und schon hat man ein nettes Sümmchen zusammen, das sich leicht verstauen lässt und wenig wiegt. (Man muss sich das ein wenig so vorstellen wie die Fünfzig- und Hunderteuroscheine heutiger Zeit.)
Goldmünzen hingegen reisen am weitesten, da sie damals so begehrt waren wie heute. So haben Archäologen römische Goldmünzen sogar in Vietnam im Mekongdelta und im Norden von Afghanistan gefunden. Die Römer sind dort niemals hingekommen, ihre Münzen allerdings schon. Sie wurden von örtlichen Händlern verwendet. Mit den Sesterzen hingegen verhält es sich etwas anders. Sie finden vorzugsweise lokale Verbreitung, da ihr Wert geringer ist. Einige allerdings machen trotzdem eine weite Reise, wie wir sehen werden.
Die turma, die Reiterschwadron, ist mittlerweile seit vielen Tagen unterwegs. Sie hat die Alpen überquert, Gallien hinter sich gelassen und auf Schiffen den Ärmelkanal überquert. In Dubris (dem heutigen Dover) sind die Reiter an Land gegangen, um in einem kleinen Kastell im Landesinneren zu übernachten. Hier ist man Besuch in dieser Größenordnung nicht gewöhnt, wie wir aus dem Ächzen der Türangeln des hölzernen Tores schließen dürfen, das offensichtlich nur selten geöffnet werden muss. Auf ihrem Weg hat die turma befehlsgemäß den diensthabenden Kommandanten oder Beamten der Städte und Marktflecken, die sie passierte, eine bestimmte Anzahl Münzen ausgehändigt. Dann ging es weiter.
Nun sind die Männer in ihren roten Mänteln zur letzten Etappe ihrer Reise aufgebrochen. Sie reiten nach Norden, an die Grenze des Reiches, dorthin, wo einmal die Grenzbefestigung liegen wird, die wir heute als »Hadrianswall« bezeichnen. Später wird man die Grenze noch weiter nach Norden verschieben und aus Stein, Holz und Grassoden den »Antoninuswall« errichten. Doch vorher wartet noch eine wichtige Station auf sie: London.
Der Hilfssoldat, der auf dem Wall des kleinen Kastells Wache steht, kneift die Augen zusammen, um dem Reitertrupp so lange wie möglich mit dem Blick folgen zu können. Die Standarte des Trupps flattert wie eine kleine, farbige Wolke über der mit Kies befestigten Straße.
Als sie im Ungewissen verschwindet, richtet der Soldat den Blick zum Himmel und betrachtet besorgt die Wolken. Sie hängen tief, so als wollten sie die Reiter verfolgen. Es sieht nach Regen aus. Er schiebt den Helm in den Nacken und verzieht das Gesicht. Na ja, das Wetter in Britannien bleibt eben immer gleich. Immer regnet es, ob es Sommer ist oder Winter ...
London – eine Erfindung der Römer
Der Reitertrupp ist seit Stunden auf der Landstraße unterwegs, überholt Grüppchen von Fußgängern und Fuhrwerke von Händlern. Je näher die Reiter der Stadt kommen, desto zahlreicher die Menschen, die ihnen begegnen. Dann tauchen die ersten Holzhäuser auf, eigentlich nur Hütten, die sich da und dort an den Straßenrand kauern. Doch die Hütten wachsen schnell zu ganzen Zeilen zusammen, bis sie als geschlossene Reihen rechts und links die Straße säumen. Wenn sie diesem Weg folgen, so glauben sie, müssen sie früher oder später unweigerlich ins Zentrum der Stadt gelangen, aufs Forum. Ein Irrtum: Die Straße endet jäh. Sie stehen vor einem gewaltigen Fluss, der Themse. London liegt am anderen Ufer.
Zu Beginn des 2. nachchristlichen Jahrhunderts bietet die Stadt noch einen ganz anderen Anblick. Sie erinnert eher an eine gemütliche Kleinstadt. Kein Mensch ahnt damals, zu welcher Dimension sie in 2000 Jahren anwachsen wird. Nur eines käme einem Besucher aus der Zukunft bekannt vor: die große Brücke, die sich über die Themse spannt, mit einem Mittelstück, das sich hochziehen lässt. Ein würdiger Vorläufer der London Bridge. Das Erstaunlichste aber ist, dass sie an genau derselben Stelle stand wie ihr heutiges Gegenstück, wie englische Archäologen festgestellt haben. Doch die antike Brücke ist aus Holz, nicht aus Metall. Und unsere dreißig Reiter sprengen gerade im Moment darüber.
Die Hufe der dreißig Pferde lassen die Brücke erzittern und schicken ein lautes Trommelgeräusch über den Fluss. Fischer und Schiffer blicken von ihrer Tätigkeit auf und sehen den wehenden roten Mänteln der Soldaten nach. Doch auch die Reiter sind neugierig, waren sie doch noch nie in dieser Stadt.
Nun haben wir das andere Ufer erreicht, wo sich 2000 Jahre später die City erheben wird, das Londoner Bankenviertel. Von Hochhäusern noch keine Spur. Niedrige Holzbauten ducken sich an den Straßenrand. Wo heute die Wahrzeichen Londons liegen – der Buckingham-Palast, Westminster, Big Ben, ja sogar Downing Street Nr. 10, Sitz des englischen Premierministers –, erstreckte sich damals noch grüne Wiese. Und dasselbe gilt für die großen Touristenziele in der britischen Hauptstadt – Trafalgar Square, Harrods, Piccadilly Circus, die Regent Street.
London oder Londinium, wie es damals heißt, ist nämlich tatsächlich eine römische »Erfindung«. Vor Ankunft der Römer und ihrer Legionen gab es dort nur Feld, Wald und Wiesen. Und den Sandstrand der Themse.
Möglicherweise standen auch schon ein paar Hütten, wie man sie des Öfteren an den Ufern großer Flüsse sieht. Eines aber ist ganz sicher: London wurde von den Römern gegründet. Warum?
Das verstehen wir erst, wenn wir in der Mitte der Brücke stehen. Von hier aus können wir sehen, dass die Themse an dieser Stelle eine Furt bildet und damit den Bau einer Brücke ermöglicht. Andererseits ist sie immer noch so tief, dass Lastschiffe dort anlegen können. Tatsächlich besitzt die Stadt einen langen Landesteg, an dem sich die Schiffe reihen, kleine und große, darunter auch viele Segelschiffe. Dort herrscht rege Geschäftigkeit: Aus einem der Schiffe werden Amphoren mit Wein aus Italien ausgeladen, aus einem anderen gebrannte Keramik aus Gallien, in flammendem Rot mit hübschen Reliefverzierungen. Man benutzt sie vorzugsweise bei Banketten. Unser Blick fällt auf zahllose andere Waren aus aller Herren Länder: Leinenstoffe und Tuniken aus Ägypten, Glaskrüge aus Germanien, Amphoren mit garum, der aus Spanien importierten Würzsoße.
Eigenartigerweise gibt es am Hafen keine Lagerhallen. (Die Archäologen entdeckten im gesamten Hafengebiet nur zwei.) Das bedeutet, dass die Waren dort nicht zwischengelagert, sondern sofort weitertransportiert wurden. Man muss sich den Londoner Landesteg der Antike also eher vorstellen wie einen neuzeitlichen Flughafen, auf dem ebenfalls keine Güter gelagert werden.
Aus diesen Hinweisen dürfen wir mit Recht schließen, dass es sich hier um eine Stadt handelt, die noch im Aufstreben begrif fen ist, aber doch alle Kennzeichen einer römischen, keiner keltischen Siedlung trägt. Und noch ein weiterer Punkt: London ist aus dem Nichts entstanden, und zwar nicht aus militärischen, sondern aus handelstechnischen Gründen. Die Archäologen haben keinerlei Hinweise auf ein Legionärslager gefunden, das etwa Kern der Stadt gewesen wäre, wie dies andernorts häufig der Fall war.
Nein, London verdankt seine Gründung dem Geld, genauer gesagt dem Sesterz. Die Stadt liegt an einem Punkt, an dem es ein Leichtes war, Waren aus dem gesamten Reich anlanden zu lassen, um sie sodann über ein Netz von Straßen in ganz Britannien zu verteilen. Im Austausch liefert Britannien seine Waren ans Reich: Sklaven, Jagdhunde, Mineralien.
Ist es nicht eigenartig, dass London rein aus wirtschaftlichen Motiven heraus gegründet wurde und sein antiker Kern genau dort lag, wo sich heute die City erhebt? Offensichtlich war der Kaufmannsgeist schon in den Anfangstagen der Stadt lebendig.
Die »Fertighäuser« von London
Nun hat unser Reitertrupp die Brücke überquert. Wir begeben uns in die Stadt. Dabei verblüfft uns am meisten, dass London fast ländlich wirkt und seltsam gleichförmige Häuser hat. Alles Holzbauten, höchstens zwei Stockwerke hoch. Die Straßen versinken winters im Schlamm, sommers im Staub. Pferde, Menschen, Fuhrwerke kämpfen sich hindurch – weit entfernt von den Marmor- und Ziegelstädten des Mittelmeerraumes. Gemauerte Häuser sind hierzulande eine Seltenheit.
Der Reitertrupp trabt an einem Haus vorbei, das soeben errichtet wird. Erstaunt sehen die Männer, dass viele der Bauteile schon vorgefertigt sind. Londinium wird nach einem sehr »modernen« System gebaut. Hier besteht jedes Haus aus einem Grundgerüst aus Eichenbalken, die perfekt ineinanderpassen. Und dieses wurde tatsächlich fertig angeliefert, die Arbeiter müssen die Balken nur noch miteinander verbinden.
Das System ist simpel: Kennen Sie noch die Holzleitern von früher? Im Grunde handelt es sich um zwei Holme mit Bohrungen in regelmäßigen Abständen, in die die Sprossen eingesetzt wurden. Die Wände der antiken Londoner Holzbauten waren nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut. Die Arbeiter legen einen Balken auf die Erde, in den in bestimmten Abständen Löcher gebohrt sind. Dann setzen sie die Querstreben ein, die nach oben zu immer dünner werden. Oben wird das Ganze dann mit einem weiteren Balken mit vorgebohrten Löchern abgeschlossen. Und so wirkt jede Wand, als bestünde sie aus Leitern mit eng aneinandergefügten Sprossen, die hochkant im Boden verankert sind. Diese Leitern verbindet man, und schon steht das Grundgerüst des Hauses. Dann werden die Zwischenräume mit horizontalen Holzlatten und Lehmziegeln gefüllt. Am Ende sieht das Ganze in der Draufsicht so aus wie die Kletterwand einer Turnhalle.
Nun flicht man noch Reisigbündel zwischen die Latten und lässt da und dort Raum für Fenster beziehungsweise Türen. Und schließlich wird noch der Putz so darauf verstrichen, dass er alles überdeckt. Ein ausgeklügeltes System von – teils diagonalen – Stützlatten zwischen den Balken macht die Wände stabil und widerstandsfähig. Dann kommt auf dieses Haus aus »Holzbausteinen« ein ausladendes Sparrendach.
Der Großteil des antiken London wurde auf diese Weise im »Ikea-Stil« errichtet. Doch unsere dreißig Reiter staunen nicht nur über die Häuser Londiniums, sondern auch über dessen Bewohner.
Die Leute versammeln sich nämlich zuhauf auf der Straße, um diesen Trupp Soldaten in ihren strahlend roten Mänteln vorüberreiten zu sehen. Nur sehen die Leute hier ganz anders aus als die Menschen, die unsere Hilfssoldaten kennen: Ihre Haut ist hell, fast weiß, häufig übersät mit Sommersprossen. Und das Haar der Londoner leuchtet blond oder rot. Dunkle Haare, gar Locken, oder braune Haut sind kaum zu sehen. Falls doch, so handelt es sich um Sklaven, Händler oder Soldaten. Wenn man es recht überlegt, ist diese Stadt das Gegenbild zu den Mittelmeerstädten im Römischen Reich. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nur redet nie jemand darüber. Doch uns, die wir extra hierhergekommen sind, fällt dieser Unterschied sofort ins Auge.
Eine jugendliche Schönheit von achtzig Jahren und ihr schweres Los
London ist im Römischen Reich eine vergleichsweise junge Stadt: Ihre Gründung liegt noch nicht einmal achtzig Jahre zurück! Britannien ist dem Reich schließlich erst relativ spät eingegliedert worden. Nur um die Ereignisse in einen zeitlichen Rahmen zu stellen: Als Jesus gekreuzigt wurde, war Britannien eine große Insel weit jenseits der Reichsgrenzen. Erst zehn Jahre später, also 43 n. Chr., entschied Kaiser Claudius, die Insel zu besetzen. Eine Art umgekehrter D-Day also. Die Legionen und Händler rückten dann allmählich nach.
Bald darauf wurde Londinium gegründet. (Die Reste einer Abflussrinne an einer Römerstraße verweisen auf das Jahr 47 n. Chr.) Aber es erforderte schon viel Mut, um zu jener Zeit in der Stadt zu wohnen: Sie lag direkt an der Grenze zum Gebiet feindlicher Stämme. Und tatsächlich wurde London schon zehn Jahre nach seiner Gründung von einer Frau in Schutt und Asche gelegt: Boudicca führte die Stämme an, die den Aufstand gegen das Römische Reich wagten.
Man schrieb damals das Jahr 60 n. Chr., und wie der Historiker Tacitus vermerkt, hatten die Rebellen schon eine Stadt zerstört: Camulodunum (das heutige Colchester). Sie hatten eine Legion römischer Soldaten geschlagen und marschierten auf London zu. Die Legionäre, die man zur Verteidigung der Stadt sandte, waren zu wenige, um das riesige Heer aufzuhalten. Und so beschlossen sie, die Stadt zu opfern, um die Provinz zu retten. Tacitus schreibt: »Auch durch den Jammer und die Tränen der ihn um Hilfe anflehenden Bewohner ließ er (der römische General Sueton) sich nicht davon abbringen, das Zeichen zum Auf bruch zu geben und nur Leute mitzunehmen, die er in den Heereszug einreihen konnte; wen dagegen sein wehrloses Geschlecht, Altersschwäche oder die Annehmlichkeit des Ortes zurückhielt, der wurde vom Feind niedergemacht.«1
Die Reaktion der Römer ließ nicht lange auf sich warten. In einer gewaltigen Schlacht fegten Suetons Soldaten die Rebellen fort, und Boudicca nahm sich mit Gift das Leben. Tacitus berichtet von siebzigtausend Toten: Es war ein wahres Blutbad.
Das London, das wir mit unserem Reitertrupp besuchen, ist eine junge Stadt, die aber schon einiges mitgemacht hat.
Begegnung mit dem Statthalter
Unsere turma durchquert die Stadt und hält erst vor dem an der Themse liegenden Palast des Statthalters, des Prätors, an. Die Soldaten stellen sich auf dem Platz vor dem Palast auf, so wie sie es in der Kaserne tun: drei Reihen zu je zehn Soldaten. Der Dekurio nimmt seine Position seitlich von seinen zehn Mann ein.