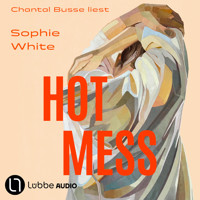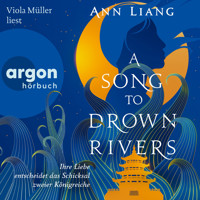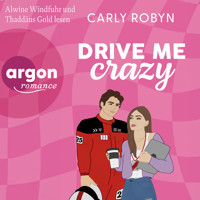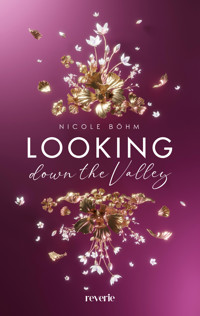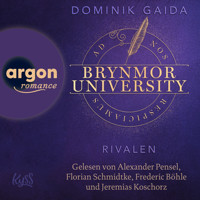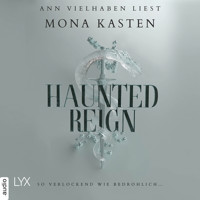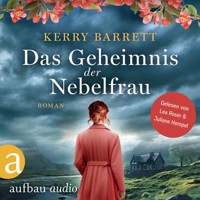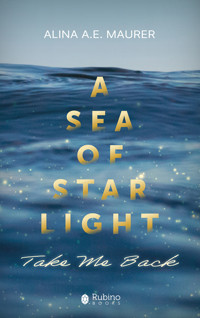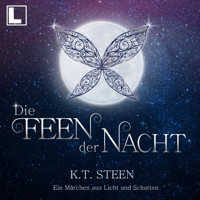Der Freizeitplaner E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: buch+musik
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Dieses Buch liefert die Basis für eine gute und effektive Planung, Durchführung und Nacharbeit von Freizeiten. Freizeiten verändern Leben. Freizeiten sind der beste Ort für Glaubensvermittlung. Freizeiten sind Gabenspielfelder. (Chris Pahl, Projektleiter des Jugendevents CHRISTIVAL22) Um dafür die besten Voraussetzungen zu schaffen, erklärt dieses praxisorientierte Nachschlagewerk alle für die Freizeitarbeit wichtigen organisatorischen und inhaltlichen Themen in den Bereichen Organisation, Finanzen, Werbung, Information, Freizeitstart, Freizeitteam, Schulung und Kompetenzen, Programmplanung, Programmelemente und Nacharbeit. 20 kompakt beschriebene Freizeitmodelle für Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene bieten viel Inspiration. Checklisten und Downloads helfen bei der konkreten Umsetzung. Alle Inhalte sind für praktisch jede Kinder-, Teen-, Jugend-, Erwachsenen-, Familien-, Gemeinde- und Seniorenfreizeit anwendbar, unabhängig von Form, Ort und Dauer. Der Freizeitplaner ist ein Standardwerk für alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die richtig gute Freizeiten anbieten, sich dabei aber auf das Wesentliche konzentrieren wollen, um mehr Zeit für den Kern der Freizeitarbeit zu haben: Glauben vermitteln und Beziehungen leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In unseren Veröffentlichungen bemühen wir uns, die Inhalte so zu formulieren, dass sie Frauen und Männern gerecht werden, dass sich beide Geschlechter angesprochen fühlen, wo beide gemeint sind, oder dass ein Geschlecht spezifisch genannt wird. Nicht immer gelingt dies auf eine Weise, dass der Text gut lesbar und leicht verständlich bleibt. In diesen Fällen geben wir der Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes den Vorrang. Dies ist ausdrücklich keine Benachteiligung von Frauen oder Männern.
Die Herstellung dieser Arbeitshilfe wurde gefördert aus Mitteln des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS).
Dieser Titel ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem REISE-WERK, www.reise-werk.de, und dem Deutschen Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC), www.ec-jugend.de.
Impressum
© 1. Auflage 2020 buch+musik ejw-service gmbh, Stuttgart 2020
All rights reserved.
buch+musik ejw-service gmbh, Stuttgart www.ejw-buch.deISBN Buch 978-3-86687-259-2 ISBN E-Book 978-3-86687-260-8
Born-Verlag, Kassel www.bornverlag.deISBN Buch 978-3-87092-608-3
Lektorat: buch+musik – Claudia Siebert, Kassel Umschlaggestaltung: buch+musik – Daniela Buess, Stuttgart Satzprogrammierung: X1-Publishing, Stuttgart Satz Downloads: buch+musik – Daniela Buess, Stuttgart Bildrechte Umschlag, Inhalt: istock: Gearstd, Dimitrios Stefanidis, eriksvoboda; pixabay: JoDesign, JAKO5D, 3D_Maennchen
Ich liebe Freizeiten!
Ich hasse Freizeiten. Irgendwann vor, während oder nach jeder meiner über vierzig Freizeiten kam ich zu dieser Erkenntnis. Das war zum Beispiel, ...
als der nächste Mitarbeiter vor der Freizeit alle Fristen „vergessen“ hatte.
als ich wegen einer Buspanne mitten in Frankreich mit vierzig Teens festsaß.
als ein Teilnehmer so ausrastete, dass wir ihn nach Hause schicken mussten.
als ich in Kroatien vergeblich auf das Küchenteam wartete, das einfach nicht kam und nicht erreichbar war (und es kam auch nie).
als ich müde und kaputt in meiner Einsamkeit des Freizeitlochs saß.
Bevor du dieses Buch gleich demotiviert zur Seite legst: Es gab diesen Moment meist nur einmal pro Freizeit, aber Hunderte Male pro Freizeit gab es die Momente, in denen ich dachte: „Ich liebe Freizeiten!“
Doch bevor ich dir gleich von meiner Freizeitliebe berichte, muss ich ehrlich sein: Freizeiten sind ein echter Kraftakt. Gerade, wenn du sie gut vorbereitest, kostet dich das Zeit, Nerven, Liebe und manche Gebete. Aber ich verspreche dir, es lohnt sich. Dieses Buch ist eine geniale Hilfe, damit du an alles denkst und super Vorlagen nutzen kannst.
Vier Gründe, warum ich Freizeiten liebe:
Freizeiten verändern Leben.
Wäre ich heute Christ, ohne die vielen Freizeitmitarbeitenden, die in mich investiert haben? Wäre ich heute so ein Mann und Leiter, wenn ich nicht diese Freizeiterfahrungen gehabt hätte? Sicher nicht. Mich haben Freizeiten tief verändert. Und es gibt so viele Stories von Menschen, die auf Freizeiten Liebe und Annahme erlebt haben, Jesus Christus kennengelernt haben, Heilung und Trost erfahren haben, Ehepartner gefunden haben, Gaben entdeckt haben ... Der größte Lebensveränderer heißt Jesus. Er und seine Liebe prägen christliche Freizeiten, wenn die Mitarbeitenden dafür offen sind. Nehmen wir ihn deshalb bewusst von der ersten Planung bis zur letzten Abrechnung mit hinein.
Freizeiten sind der beste Ort für Glaubensvermittlung.
Glaubensvermittlung braucht Vertrauen, Echtheit und gute Worte. Für all das ist auf Freizeiten richtig viel Zeit und Raum. Die Teilnehmenden erleben mich von morgens bis abends, wir lachen, spielen, streiten. Nur so bekommen wir das Recht, in ihr Leben sprechen zu dürfen. Oft müssen wir viele Stunden Fußball oder UNO spielen, damit wir dann das Vertrauen für eine Andacht oder ein Seelsorgegespräch haben. Auf Freizeiten erlebe ich Teens immer wieder erstaunlich offen, da sie fernab von Schulstress, oft mit viel frischer Luft und Auslauf, spüren, dass es wichtigere Themen als Schule und YouTube gibt. Deswegen dürfen wir klar und deutlich biblische Geschichten erzählen, für ein Leben mit Jesus werben und tiefe Fragen stellen. Lasst uns diese Chancen nutzen.
Freizeiten sind „Gabenspielfelder“.
Am Anfang meiner Freizeiten habe ich unser Team oft mit einem Werkzeugkoffer verglichen. Es gibt da den Hammer (Ulf, 40, kann gut Zelte aufbauen und rohe Kartoffeln zerquetschen), den ganz kleinen Uhrmacher-Schraubenzieher (Ilse-Dore, 17, kann super gut Handlettering und flüstern) und die Multi-Tools (Chris, 38, kann alles ein bisschen, aber nichts richtig genial). Auf Freizeiten braucht man so viele Gaben und es ist die Chance, sich auszuprobieren. Ich ermutige dich: trau Leuten etwas zu. Es muss nicht immer dieselbe Person die Andacht halten. Und probiere dich selbst mutig aus. Gott hat geniale Gaben in dich und dein Team gelegt. Manche sieht man, viele sind noch verborgen.
Freizeiten müssen nicht perfekt sein.
Dieses Buch kann dir richtig gut helfen, aber vielleicht auch das Gefühl geben, dass du an alles denken musst. Ja, du sollst dir Gedanken machen und nicht leichtfertig das Essen oder die Versicherung weglassen. Aber du wirst beim Planen und Leiten einer Freizeit Fehler machen. Gott liebt es, gnädig zu sein. Sei du es auch: mit dir, den Teilnehmenden und deinen Mitarbeitenden.
Jetzt darfst du loslegen und deine Liebe zu Freizeiten entdecken oder vertiefen. Fang doch vielleicht gleich mit Kapitel 10 an. Denn das ist der größte Schwachpunkt bei vielen Freizeiten: die Nacharbeit.
Gott segne dich und dein Team bei deiner nächsten Freizeit.
Chris Pahl Projektleiter des Jugendevents CHRISTIVAL22 E-Mail: [email protected], Instagram und YouTube: @christipahl
Der Freizeitplaner
„Freizeiten planen – da gibt es kein fertiges Rezept!“ Das stimmt wohl. Dennoch möchten wir mit dem Freizeitplaner die Zutaten für eine gute Basis der Planung, Durchführung und Nacharbeit liefern. In zehn Kapiteln finden sich alle wichtigen organisatorischen und inhaltlichen Themen, die für praktisch jede Kinder-, Teen-, Jugend-, Erwachsenen-, Familien-, Gemeinde- und Seniorenfreizeit angewendet werden können; ob im In- oder Ausland, nur für ein Wochenende oder zwei Wochen in den Ferien. Die erste Ausgabe des Freizeitplaners erschien 2014. Seitdem ist viel passiert. Deshalb haben wir die Kapitel und Themen für diese überarbeitete Neuauflage nicht nur neu strukturiert, sondern auch aktualisiert und um neue Themen (z. B. „Führungszeugnis“, „Beziehungen gestalten“, „Datenschutz“ oder „Inklusion“) ergänzt. Im neuen 11. Kapitel sind ganz verschiedene Freizeitmodelle für Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene als Inspiration beschrieben.
Alle Inhalte sind als Hinweise zu sehen, die erfahrene Freizeitleute geben möchten. Die große Autorenschaft bringt auf ganz unterschiedliche Weise und mit verschiedenen Blickrichtungen ihr Wissen für gelingende Freizeiten ein.
Um das Lesen und Anwenden der Hinweise zu vereinfachen, ist das Buch mit verschiedenen Hilfen versehen:
Thematisch durch das Buch
Auf den folgenden Seiten findet sich zunächst ein klassisches Inhaltsverzeichnis, das Kapitel für Kapitel und Thema für Thema durch das Buch leitet. Hier gibt es die Schwerpunkte Organisation, Finanzen, Werbung, Information, Freizeitstart, Freizeitteam, Schulung und Kompetenzen, Programmplanung, Programmelemente und Nacharbeit. In dieser überarbeiteten Neuauflage haben wir bei den Kapiteln noch mehr Wert auf die thematischen Schwerpunkte und Zusammenhänge gelegt.
Chronologisch durch das Buch
Nach dem klassischen Inhaltsverzeichnis folgt eine chronologische Übersicht, die die Themen und somit Aufgaben nach dem „Erledigungszeitpunkt“ sortiert. So gibt es Aufgaben, die bereits lange im Voraus anstehen, andere wiederum sind erst ein paar Tage davor oder direkt während der Freizeit vorzubereiten oder zu erledigen. Diese Übersicht ist auch als Download (s. unten) verfügbar.
Der „Erledigungszeitpunkt“ ist auch am Ende jedes Beitrags noch einmal vermerkt.
Checklisten
Am Ende vieler Beiträge befinden sich Checklisten, die in Kürze die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Diese Checklisten gibt es ebenfalls als Download (s. unten). Bei den Checklisten unterscheiden wir grundsätzlich „Absprachen“ – das sind Fragen, die mit anderen zu klären sind – und „Aufgaben“, die zum Handeln auffordern. Die Checklisten sind jeweils entsprechend benannt und somit leicht auseinanderzuhalten.
Verweise
Darüber hinaus wird in einigen Beiträgen auf andere Bücher und/oder Onlineangebote verwiesen, die die Autorin / der Autor empfiehlt.
Downloads
Unter www.ejw-verlag.de/download sowie www.bornverlag.de/downloads können die in diesem Buch enthaltenen Checklisten sowie zusätzliche Informationen als digitale Daten heruntergeladen werden. Der Kauf des Buches berechtigt zum Downloaden, Ausdrucken, Kopieren und Verwenden dieser Daten, sofern sie zur Vorbereitung und Durchführung der Inhalte dieses Buches verwendet werden. Eine Vervielfältigung, Verwendung oder Weitergabe darüber hinaus ist ohne Erlaubnis ausdrücklich nicht gestattet.
Rechtliche Hinweise
Die Informationen in diesem Buch stellen keine Rechtsberatung dar. Die Autorinnen und Autoren, die Herausgeberinnen und Herausgeber sowie der Verlag übernehmen keine Gewähr und somit keine Haftung für die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen.
Redaktioneller Stand: Oktober 2019.
Für in diesem Titel enthaltene Links auf Websites/Webangebote Dritter übernehmen wir keine Haftung, da wir uns deren Inhalt nicht zu eigen machen, sondern sie lediglich Verweise auf den Inhalt darstellen. Die Verweise beziehen sich auf den Inhalt zum Zeitpunkt des letzten Zugriffs: 04.10.2019.
Frohe Vorbereitungen und immer gute Ideen wünschen die Herausgeber
Björn Knublauch, Jessica Leng, Ingo Müller und Claudia Siebert
Kapitel 1: Organisation
1.1 Ziele
Was bewegt uns dazu, eine Freizeit anzubieten? Auch wenn die spontane Antwort auf diese Frage „Weil unsere Gemeinde schon immer eine Skifreizeit macht, das ist Tradition.“ oder auch „Es ist eine wichtige Einnahmequelle für die Jugendkasse.“ sein mag, so kommen hoffentlich bei genauerem Überlegen tiefere Beweggründe auf. Früher oder später wird sich diese Frage stellen – spätestens, wenn es an die Programmplanung (s. „Kapitel 8: Programmplanung“) geht.
Wozu soll die Freizeit dienen?
Was wollen wir unseren Teilnehmenden bieten? Eine Woche voll Jubel, Trubel, Heiterkeit? Eine Abwechslung von Zuhause? Entspannung? Action? Tiefgang? Mögliche Freizeitziele:
Die Freizeit soll die Gemeinschaft fördern und den Teamgeist stärken.
Die Teilnehmenden sollen Jesus kennenlernen und erste Schritte im Glauben gehen.
Die Freizeit soll den Teilnehmenden helfen, ihren Glauben persönlich zu vertiefen und darin zu wachsen.
Während der Freizeit soll ein Projekt erarbeitet oder gestaltet werden.
Oft mischen sich diese Ziele natürlich. Trotzdem empfiehlt es sich, sich für eine Gewichtung zu entscheiden. Es ist oft gewinnbringender, ein „Freizeitprofil“ festzulegen, das eine bestimmte Zielgruppe ansprechen soll, als im Schrotflinten-Prinzip möglichst viele Interessen abzudecken. Man muss nicht alles anbieten.
Gleichzeitig sind die Ziele auch stark abhängig von der Zielgruppe. Wer kommt denn (wahrscheinlich) überhaupt mit (s. Kap. „1.2 Zielgruppe“)? Was brauchen diese Leute?
Es ist empfehlenswert, diese Fragen frühzeitig im Mitarbeiterteam aufzuwerfen, einmal gemeinsam darüber zu brainstormen und zu beten, was Gott mit der Freizeit vorhaben könnte. Wenn es die fünfzehnte Freizeit nach demselben Schema ist, lohnt es sich vermutlich zu reflektieren, ob der Bedarf, den man im Umfeld wahrnimmt, noch von diesem Konzept gestillt wird, oder ob es Zeit für Neuerungen ist. Wenn es die erste Freizeit ist, die man plant, oder das erste Mal für eine bestimmte Gruppe, kann es sehr hilfreich sein, sich bei ehemaligen Mitarbeitenden und Teilnehmenden umzuhören: Wie war die Stimmung? Was waren Highlights und was Flops? In den meisten Fällen werden diese Fragen nach einer Freizeit reflektiert und bewertet, oft sogar mit Protokoll (s. Kap. „10.6 Auswertung und Evaluation“). Das sind wertvolle Infos, die bei der jetzigen Planung auf jeden Fall wieder beachtet werden sollten.
Zeitpunkt: noch über ein Jahr
Checkliste Absprachen
Wozu soll die Freizeit dienen?
Welche Hinweise geben die Protokolle von Nachbesprechungen und Feedbacks vergangener Freizeiten?
Wo nehmt ihr besonders starken Bedarf wahr (z. B. Zusammenhalt in der Gruppe)?
Jessica Leng
1.2 Zielgruppe
Eine der wichtigsten Fragen, die im Vorfeld einer Freizeit zu klären sind, ist die Frage nach der Altersbegrenzung der Teilnehmenden, vor allem im Kinder- und Jugendalter. Welche Altersgruppe an einer Freizeit teilnimmt, bestimmt das Programmangebot wesentlich mit. Seit Jahren bewährt hat sich die Aufteilung in Kinder (6 bis 11 Jahre), Teens (13 bis 16 Jahre), ältere Jugendliche (16 bis 19 Jahre) und Junge Erwachsene (18 bis 27 Jahre). Außerdem gibt es zunehmend Angebote für „Pre-Teens“ (10 bis 13 Jahre).1
„Nirgendwo sonst im Leben unterscheiden sich Gleichaltrige so deutlich voneinander wie im Jugendalter.“2
Schon diese jeweils relativ enge Altersbegrenzung umfasst Menschen mit sehr unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen, die eine hohe Anforderung an das planende und durchführende Team stellt.3 Doch immer wieder stellt sich aufgrund von Teilnehmerzahl oder guten Kontakten die Frage, ob diese enge Altersbegrenzung erweiterbar ist. Grundsätzlich gilt, dass das Entwicklungsalter oft nicht dem tatsächlichen Alter entspricht, eine Entscheidung im Einzelfall also durchaus begründet sein kann.
Gleichzeitig ist unbedingt zu beachten, dass Kinder und Teens sich sehr stark in den Bedürfnissen und Ansprüchen unterscheiden, die sie an eine Freizeit stellen. Eine Mischung der Altersgruppen kann für einzelne Tage oder bestimmte Aufträge sinnvoll und bereichernd sein, auf längere Sicht aber frustriert sie die Teilnehmenden.
Ob Teens und Jugendliche auf unterschiedliche Freizeiten fahren oder gemeinsam ihren Urlaub verbringen, hängt von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es reizvoll und lohnend, für Teens und Jugendliche jeweils ein eigenes, spezifisches Programm zu entwickeln. Dabei brauchen die Teilnehmenden umso mehr (tages-)strukturierende Angebote je jünger sie sind.
Bei der Ausweitung der Altersstruktur einer Junge Erwachsenen-Freizeit auf unter 18-Jährige ist zu beachten, dass Minderjährige andere Anforderungen an die Aufsichtspflicht stellen als die bereits Volljährigen. Das Gleiche gilt entsprechend für unter 16-Jährige. (Vgl. Kap. „7.8 Aufsichtspflicht“.)
Entwicklungspsychologische Basics
Für Kinder ist eine Freizeit häufig die erste Gelegenheit, bei der sie längere Zeit von ihren Eltern getrennt sind. Das ist für Kinder und Eltern eine Herausforderung! Wenn sie diese jedoch gut bewältigen, können sie andere Rollen als in ihrer Familie ausprobieren und in ihrem Selbstbewusstsein wachsen.
Die zentrale Frage für Teens, Jugendliche und auch Junge Erwachsene ist die Frage nach der eigenen Identität. Wer bin ich? Wen sehen die anderen in mir? Wer bin ich ohne meine Eltern? Eine Freizeit bietet einen idealen Rahmen für die Erforschung dieser Fragen, für neue Freundschaften und im besten Fall einen Schutzraum für ein Sich-selbst-Erproben!
Zeitpunkt: noch über ein Jahr
Checkliste Absprachen
Welche Altersgruppe habt ihr vor Augen?
Ist es sinnvoll, die Altersbegrenzung stärker einzugrenzen / zu erweitern?
Ist das Team breit genug aufgestellt, um alle Teilnehmenden anzusprechen?
Soll es besondere Angebote für Ältere/Jüngere oder Mädchen/Jungen geben?
Judith Otterbach
1 In der Vergangenheit zählte man die Pre-Teens zu den Kindern, doch weil die Pubertät immer früher einsetzt, unterscheiden sich die Interessen dieser Altersgruppen zunehmend.
2 Oerter, Ralf / Montada, Leo: Entwicklungspsychologie, Beltz, Weinheim 41998, S. 335.
3 Insbesondere bei den Pre-Teens ist in der Programmplanung zu beachten, dass Mädchen in diesem Alter in der Regel körperlich und zum Teil auch geistig weiter entwickelt sind als Jungen.
1.3 Dauer und Entfernung
Die Festlegung auf einen Freizeitort bestimmt gleichzeitig einige weitere Fakten der Freizeit: Wie erreichbar sind die Ansprechpersonen im Notfall? Wie lang werden die Fahrten? Wie viel Zeit bleibt dann noch vor Ort? Freizeitdauer und Entfernung hängen deshalb unweigerlich miteinander zusammen. Dazu gibt folgende Übersicht einige Hinweise:
Dauer
Entfernung
Merkmale
Beispiel
kurz, 2 – 3 Tage
nah
in der Nähe des Wohnortes, geringe Anreisekosten, oft unabhängig von Schulferien oder Urlaub (breite Zielgruppe kann mitfahren), nicht weiter als 1 Stunde Anreise
Wochenendfreizeit, Gemeindefreizeit
mittel, 4 – 7 Tage
vor Ort
alle wohnen für eine Woche im Gemeindehaus und gehen von dort aus ihrer täglichen Beschäftigung wie Schule oder Beruf nach, man verbringt die Nachmittage und Abende zusammen
Alltagsfreizeit, Wohnwoche
mittel, 4 – 7 Tage
mittel
als „Zweiturlaub“ oder für ein schmales Budget, nicht mehr als 3 Stunden Fahrt entfernt oder sogar mit ÖPNV erreichbar (längere Anreisewege sind bei dieser Dauer meist unwirtschaftlich)
Zeltlager für Kinder
mittel, 7 – 10 Tage
weit
Aktivfreizeiten, oft verbunden mit hohen Kosten für Guides / Liftpass / Sportequipment u. Ä., deshalb nicht zu lang, bis zu 8 Stunden Fahrt (noch längere Anreisewege sind meist unwirtschaftlich)
Kletterfreizeit in Südfrankreich
lang, > 10 Tage
weit
Familien- oder Jugendfreizeit, Anreise bis zu 24 Stunden (inkl. z. B. Fährüberfahrt) im Verhältnis zur Dauer gerechtfertigt (in dieser Zeit erreicht man die meisten attraktiven Ziele innerhalb Europas)
Teencamp in Spanien
sehr lang, > 3 Wochen
weit
Einsatzfreizeit im weiteren Ausland, oft mit viel Eigenorganisation, eher für eine ältere Zielgruppe
Volontäreinsatz als Gruppe im Erstaufnahmelager
Zeitpunkt: noch über ein Jahr
Jessica Leng
1.4 Teilnehmerzahl
Wie viele Teilnehmende wollen und können wir mitnehmen? Keine leichte Frage, denn die Argumente sind auf beiden Seiten gut. Bei groß angelegten Freizeiten muss man weniger (oder keine) Personen abweisen, kommt bei Themen wie Essensplanung oder Busanmietung oft pro Kopf günstiger weg und die Möglichkeiten für gemeinsame Spiele und Aktionen sind groß. Kleine Freizeitgruppen sind oft einfacher in der Planung, schaffen ein engeres Gemeinschaftsgefühl und können vor Ort leichter ausgefallene Aktionen anbieten (eine Kanutour mit zwanzig Personen ist wesentlich entspannter als mit fünfzig). Aber es gibt häufig auch einfach „harte Fakten“, die die Teilnehmerzahl vorgeben.
Faktoren, die die Teilnehmerzahl einer Freizeit beeinflussen:
Größe der verfügbaren Zielgruppe
Fahren wir mit unserer fest bestehenden Gruppe? Dann ist die Teilnehmerzahl von Anfang an gesetzt und Unterkunft und Transport können dementsprechend ausgewählt werden. Wollen wir die Freizeit extern, vielleicht sogar überregional ausschreiben? Dann sollte die Kapazität dafür auch entsprechend vorhanden sein (vgl. Kap. „3.1 Marketing“). Haben wir Teilnehmende mit speziellem Betreuungsbedarf dabei? Dann müssen (zusätzliche) Mitarbeitende dafür eingeplant werden (vgl. Kap. „7.11 Inklusion“).
Altersgruppe der Teilnehmenden
Kinder und Teens benötigen in aller Regel weitaus mehr Betreuung, Aufsicht und Anleitung als Jugendliche oder Junge Erwachsene (vgl. Kap. „1.2 Zielgruppe“). Nicht weil sie „schwieriger“ wären, sondern weil bei ihnen je nach Alter nicht nur eine sicherheitsspezifische Aufsicht nötig ist (z. B. Regeln zum Verlassen des Geländes, vgl. Kap. „7.8 Aufsichtspflicht“ und Kap. „8.10 Freizeitregeln“), sondern auch sichergestellt werden muss, dass ihre Grundbedürfnisse gestillt werden, die sie selbst vernachlässigen würden. Zu den grundlegenden körperlichen Bedürfnissen zählen unter anderem Essen, Trinken, Hygiene, Schlaf und Wach-Ruhe-Rhythmus (s. Kap. „7.2 Bedürfnisse des Menschen“).
Anzahl der verfügbaren Mitarbeitenden
Bevor man Anmeldungen für eine Freizeit annimmt, sollte feststehen, wie viele Mitarbeitende mitfahren können. Daraus ergibt sich anhand des Betreuungsschlüssels schon früh ein deutliches Bild, wie viele Teilnehmende man überhaupt mitnehmen kann. Obwohl es keine rechtlich bindenden Regelungen zum Betreuungsschlüssel gibt, werden folgende Richtwerte4 empfohlen:
Teilnehmende bis 12 Jahre: max. 1 : 12 Teilnehmende ab 13 Jahre: max. 1 : 15
Dabei zählen nur die Mitarbeitenden, die Betreuungsaufgaben und Aufsichtspflichten übernehmen; das Küchenteam wird also beispielsweise separat dazugezählt. Außerdem stellt sich die Frage, ob Aktionen geplant sind, die entweder mehr Mitarbeitende benötigen (z. B. Ausflüge in Kleingruppen) oder speziell geschulte Mitarbeitende (z. B. Rettungsschwimmer, Kletterschein ...).
Schwierigkeitsgrad der geplanten Aktionen
Beinhaltet das Programm geplante Aktionen, die besondere Risiken bergen und deshalb eine verstärkte Aufsicht benötigen? Dies können sein: Ausflüge in große Städte, Schwimmen im offenen Meer, Rafting oder Outdoor-Übernachtungen. Dann sollte überlegt werden, die Teilnehmerzahl unter dem üblichen Betreuungsschlüssel zu halten, um die Aufsicht in diesen Situationen gewährleisten zu können.
Kapazität der Unterkunft und des Transportmittels
Wenn die Freizeit immer zum gleichen Ort, in dasselbe Haus geht, steht die Teilnehmerzahl damit bereits von Anfang an fest. Die Kapazität des Hauses gibt sie vor. Oft ist es jedoch so, dass erst Angebote für Häuser, Camps, Busse usw. eingeholt werden und man bei der Anfrage, spätestens jedoch bei Buchung eine verbindliche Personenanzahl nennen muss (s. Kap. „1.5 Ort und Unterkunft“ und Kap. „1.9 Fahrt“). Hier muss man auf jeden Fall die vertraglichen Vereinbarungen kennen! Kann die gebuchte Personenzahl später nicht mehr kostenfrei angepasst werden (z. B. wenn weniger Anmeldungen kommen als erhofft), empfiehlt es sich, erst einmal die Mindestteilnehmerzahl zu buchen und später bei Bedarf aufzustocken.
Zeitpunkt: noch über ein Jahr
Jessica Leng
4 Reisenetz, Deutscher Fachverband für Jugendreisen: Jugendreiseratgeber – Verbandsübergreifender Ratgeber für Sichere Jugendreisen, Berlin 2016, S. 18 – www.reisenetz.org.
1.5 Ort und Unterkunft
Freizeitunterkünfte können sehr unterschiedlich sein: Häuser mit Selbst- bzw. Vollverpflegung, Campingplätze, Segelschiffe, Baumhäuser, Wohnwagen ... Die Suche nach dem richtigen Ort und der richtigen Unterkunft ist oft einer der ersten Beschlüsse, die in der Freizeitplanung getroffen werden: „Lasst uns eine Campingfreizeit in Schweden veranstalten!“ Doch es ist gut, hier nicht in Aktionismus zu verfallen, sondern sich erst einmal bewusst zu machen, welche Faktoren die Wahl des Ortes und der Unterkunft beeinflussen:
Gruppengröße
Vor der Unterkunftssuche sollte zumindest eine grobe Vorstellung vorhanden sein, mit wie vielen Personen man unterwegs sein wird (s. Kap. „1.4 Teilnehmerzahl“).
Altersgruppe und Entfernung
Wie bereits in Kapitel „1.2 Zielgruppe“ erwähnt, muss bei Teilnehmenden unterschiedlicher Altersgruppen auf unterschiedliche Bedürfnisse verstärkt geachtet werden. Bei einer Kinderfreizeit ist es sicherlich ideal, im Nahbereich oder nahen Ausland (mit kurzer Anfahrt) eine Freizeit durchzuführen, sodass „Heimweh-Kinder“ im Notfall von den Eltern abgeholt werden können. Jugendliche haben oft bereits einen oder mehrere Urlaube ohne Eltern hinter sich, hier kann man flexibler sein, was die Entfernung angeht (vgl. Kap. „1.3 Dauer und Entfernung“).
Ziel und Aktivitäten
Wenn das Ziel (s. Kap. „1.1 Ziele“) der Freizeit ist, Alltag zu teilen, ist ein Camp mit Selbstverpflegung vermutlich besser geeignet als eine Jugendherberge mit vollem Service. Wenn es eine Zeit der Besinnung sein soll, ist ein entlegenes Haus am See vermutlich besser geeignet als ein Campingplatz mit 200 anderen Jugendlichen. Auch sollte man sich im Klaren sein, dass die Wahl der Unterkunft grundlegend bestimmt, welche Aktivitäten nachher durchführbar sind. Nicht nur Ausflugsmöglichkeiten werden damit vorgegeben; die Größe der Gruppenräume, des Geländes und die Umgebung beeinflussen die Programmplanung (s. „Kapitel 8: Programmplanung“) später erheblich.
Dauer und Termin
Wie erwähnt, sollten Freizeitdauer und Entfernung zur Unterkunft im Verhältnis stehen (s. Kap. „1.3 Dauer und Entfernung“).
Notfallmanagement
Ein Szenario, über das man am liebsten gar nicht nachdenken möchte, sind Notfälle während einer Freizeit. Aber bei der Auswahl von Ort und Unterkunft sollte dieser Gedanke zumindest einmal durchgespielt werden. Was wäre, wenn sich jemand schwer verletzt, die Gruppe ein schweres Unwetter erlebt oder in eine Situation kommt, in der sie auf Hilfe angewiesen ist? Es ist gut, diese Frage vorher zu stellen und dann die Eignung des Ortes abzuwägen (zumindest die Dinge, die man vorher in Erfahrungen bringen kann, z. B. die Entfernung zum Krankenhaus, Notunterkünfte; s. Kap. „5.6 Krisenmanagement“).
Preisniveau
Eine Freizeit in der französischen Schweiz wird sich nicht nur im Hauspreis von Bulgarien unterscheiden. Auch die Kosten für Ausflüge, Essen und Material werden je nach Preisniveau eines Landes oder einer bestimmten Gegend höher oder niedriger ausfallen.
Entscheidungshilfe
Bei der Suche eines Ortes und einer Unterkunft kann ein kurzer Fragebogen mit den wichtigsten Punkten hilfreich sein, die es zu klären gilt – je nach Präferenz können diese natürlich variieren. Wichtige Punkte sind:
Alleinbelegung der Unterkunft oder zusammen mit Fremden
Bettenanzahl, Zimmeraufteilung und Gruppenräume
Sportmöglichkeiten und Außengelände
Küchengröße und -ausstattung (bei geplanter Selbstversorgung)
Entfernung zum Strand / See / zur Stadt / zum nächsten Supermarkt ...
Erreichbarkeit (besonders bei Anreise mit eigenen Fahrzeugen oder ÖPNV)
Risiken (offenes Wasser, große Straßen, Abhänge ...)
Falls möglich, ist es ein großer Vorteil, den Ort und die Unterkunft vorab zu besichtigen. Falls das nicht möglich ist, sollte ein Anbieter (s. Kap. „1.6 Reiseanbieter“) gefunden werden, der die Unterkunft selbst sehr gut kennt und alle nötigen Auskünfte geben kann.
Checkliste Absprachen
Wie würde die „perfekte Unterkunft“ für eure Traumfreizeit aussehen?
Welche Dinge sind euch beim Ort / bei der Unterkunft so wichtig, dass sie nicht diskutierbar sind?
Zeitpunkt: noch über ein Jahr
Jessica Leng
1.6 Reiseanbieter
Bei der Freizeitplanung spaltet sich spätestens hier das Freizeitteam in zwei Lager:
Die „Selbermacher“ suchen online nach der perfekten Unterkunft, holen Angebote von verschiedenen Busunternehmen ein und nehmen die Ausflugsplanung in die eigene Hand. Sie stellen sich alle Komponenten selbständig zusammen. Unterkünfte werden dabei entweder direkt gebucht (bei der Hausverwaltung / dem Eigentümer) oder über einen Vermittler. Vermittler sind dabei oft Onlineplattformen, die viele Gruppenhäuser in ihrem Repertoire haben und sich praktischerweise nach Größe, Standort und anderen Faktoren filtern lassen (z. B. www.gruppenhaus.de). Der Vorteil dabei ist, dass man die Buchung mit einem deutschen Vertragspartner unter deutschem Recht durchführt – auch wenn die Unterkunft eigentlich im Ausland ist.
Und dann gibt es die „Paketbucher“, die sich einen Anbieter suchen, der eine für sie passende Unterkunft im Sortiment hat. Sie bekommen aus einer Hand und ohne viel eigenen Organisationsaufwand Unterkunft, Transport und weitere Serviceleistungen (das können Ausflüge, Infomaterial, Versicherungen o. Ä. sein) zusammengestellt, müssen sich dafür aber oft an einen vorgegebenen Termin anpassen und können so die Dauer nicht frei bestimmen.
Anbieter dieser Art kennen sich in den Zielgebieten sehr gut aus, können Empfehlungen aussprechen und durch ihre durchgehende Präsenz im Land oft günstigere Konditionen bekommen als es einer Einzelperson möglich wäre. Dasselbe gilt für Transportmittel, hier bekommen Großabnehmer häufig vergünstigte Preise angeboten, die sie im Optimalfall an ihre Kunden weitergeben. Zusätzlich sorgt der Wettbewerbsdruck unter Anbietern dafür, dass die zusammengestellten Pakete in vielen Fällen preiswerter sind als eine selbst organisierte Reise. Es empfiehlt sich einen Anbieter zu wählen, der auf die gewünschte Reiseart spezialisiert ist (und nicht z. B. auf Kreuzfahrten oder Safaris). Es gibt am deutschen Markt inzwischen viele Anbieter, die sich auf Jugendreisen eingestellt haben.
Eine Übersicht über Anbieter von Freizeitunterkünften ist in den Downloads zum Buch zu finden.
Zeitpunkt: noch über ein Jahr
Jessica Leng
1.7 Träger und Haftung
Die Frage nach dem Träger muss geklärt werden, bevor die Freizeit gebucht oder ausgeschrieben wird:
Der Träger bucht die Leistungen bei den Leistungsgebern. Daher ist bei der Buchung unbedingt darauf zu achten, dass der Träger korrekt und vollständig bezeichnet wird. Hierzu gehört auch eine zustellungsfähige Anschrift (Sitz des Trägers).
Der Träger muss in der Freizeitausschreibung (s. Kap. „
3.4 Freizeitausschreibung
“) und Anmeldung (s. Kap. „
3.5 Werbung und Anmeldung
“) als Veranstalter der Freizeit eindeutig bezeichnet werden.
Mögliche Träger
Als Träger können Institutionen wie eine Kirchengemeinde, Vereine und Verbände oder auch Privatpersonen (natürliche Personen) auftreten. Zu beachten sind dabei die Veranstalterpflichten und Haftungsrisiken, daher ist es für eine natürliche Person nicht sinnvoll, dies zu übernehmen. Institutionen haben in der Regel die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen und Versicherungen, um als Träger aufzutreten. Wichtig ist dabei auch, die Zustimmung vom verantwortlichen Gremium des Trägers einzuholen. Stimmt der Kirchenvorstand der Jugendfreizeit nicht zu, bleibt die Verantwortung bei den Mitarbeitenden hängen, die die Freizeit organisiert haben.
Bei der Entscheidung, wer als Träger der Freizeit auftritt, sollte auch die Frage nach Zuschüssen bedacht werden. Es ist sinnvoll vorher abzuklären, ob der entsprechende Träger berechtigt ist, Zuschüsse zu erhalten (s. Kap. „2.4 Zuschüsse“).
Gesetzliche Bestimmungen
Auch wenn der Träger ein gemeinnütziger Verein, eine Kirche usw. ist, gelten für ihn für die Durchführung von Freizeiten dieselben gesetzlichen Vorschriften wie für große Reiseveranstalter und Touristikunternehmen. Wesentlich ist dabei die Unterscheidung, ob die Freizeit eine Pauschalreise gemäß des gültigen Reiserechts (§ 651a ff. BGB) ist oder nicht. Details zur Pauschalreise und den damit verbundenen Vorschriften sind in Kapitel „3.4 Freizeitausschreibung“ zu finden.
Haftung
Im Fall von Sachschäden, Unfällen, Reisemängeln oder Ähnlichem haftet zunächst der Träger für die entstandenen Schäden und hat für Schäden aufzukommen. Je nach Fall wird der Träger bzw. dessen Versicherung selbst dafür aufkommen oder diese weiterbelasten, wenn zum Beispiel ein Sachschaden einer einzelnen Person oder einem Dienstleister zugeordnet werden kann.
Zeitpunkt: noch über ein Jahr
Checkliste Absprachen
Wer ist Träger der Freizeit?
Stimmt das verantwortliche Gremium des Trägers der Freizeit zu?
Ist die Freizeit gemäß Reiserecht eine Pauschalreise, für die die entsprechenden Pflichten eingehalten werden müssen?
Verweis
Kapitel C 1.1 und C 1.2 in Wilka, Wolfgang / Schmidt, Peter L.: Recht – gut informiert sein. Rechtsfragen in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit, buch+musik, Stuttgart 22018
Sandra Greeb
1.8 Kooperationspartner
Wann und warum soll oder kann eine weitere Kirchengemeinde / ein anderer Verein mit ins Boot geholt werden?
Wenn es nur eine sehr kleine Zielgruppe für die geplante Freizeit gibt.
Wenn sich kein geeigneter rechtlicher Träger für die geplante Freizeit findet.
Wenn es innerhalb der Gruppe zu wenig Potenzial für Mitarbeitende gibt.
Wenn eine Co-Leitung oder Mitarbeitende gewonnen werden soll/sollen, die in einer anderen Jugendgruppe mitwirkt/mitwirken.
Ein Kooperationspartner kann auf folgenden Ebenen gefunden werden:
Lokal: Vielleicht gibt es in derselben Stadt eine andere christliche Gruppe, die eine ganz ähnliche Zielgruppe hat und die gleichen Ziele mit ihrer Freizeit verfolgt, mit der aber noch nie eine gemeinsame Aktion angepackt wurde. Eine Freizeit ist ein überschaubares und genau begrenztes Projekt. Wenn es auf Leitungsebene miteinander funktioniert, kann das Projekt starten und ist vielleicht der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit ...
Regional, d. h. innerhalb der Kirche / des Kirchenkreises, des Gemeindeverbandes oder des Jugendverbandes. Vielleicht gibt es in der Region eine Gruppe, die eine ganz ähnliche Zielgruppe hat und die gleichen Ziele mit ihrer Freizeit verfolgt. Oder es gibt ein Freizeitwerk, das auf regionaler Ebene als Träger auftritt und einen gemeinsamen Freizeitprospekt herausgibt, wo man als Mitarbeiterteam mit ein paar Teilnehmenden willkommen ist.
Überregional: Manche Verbände haben eigene Freizeitwerke, mit denen eine Zusammenarbeit möglich ist. Darüber hinaus gibt es verschiedene Werke, die Freizeiten anbieten und offen sind, wenn sich Freizeitleitungen oder -teams anbieten. Hier ist es jedoch meist nötig, dass zumindest die Leitung dort bekannt ist, sie die inhaltliche Ausrichtung des Werks kennt und trägt und das Team entsprechend einbeziehen kann. Beispiele sind SMD (www.smd.org), Crossover (Marburger Kreis; www.crossover.info), Liebenzeller Mission (www.liebenzell.org), Aufwind-Freizeiten (www.aufwind-freizeiten.de).
Experimentell: So nenne ich den Vorschlag, auf Stadtteil- oder Dorfebene mit einem ganz anderen Träger zusammenzuarbeiten, z. B. der Jugendfeuerwehr, einem Sportverein ... Dazu braucht es aber genaue Absprachen über die Regeln und Inhalte der Freizeit. Natürlich kann man so Jugendliche erreichen, die sonst niemals auf eine christliche Freizeit mitfahren. Dafür muss das inhaltliche Programm wahrscheinlich auf „Schmalspur“ gefahren werden. Bei der Beantragung von Zuschüssen ist zu prüfen, ob es Einschränkungen in Bezug auf Kooperationspartner gibt (s. Kap. „2.4 Zuschüsse“).
Zeitpunkt: noch über ein Jahr
Fritz Ludwig Otterbach
1.9 Fahrt
Eigenanreise mit Privatfahrzeugen
Die Teilnehmenden und Mitarbeitenden kommen mit Privatfahrzeugen zum Freizeitort, vorwiegend in Fahrgemeinschaften5. Das Gepäck kann entweder auf die Fahrzeuge aufgeteilt oder gesammelt in einem „Materialauto“ oder Anhänger transportiert werden.
Wichtig: Werden eigene oder angemietete Fahrzeuge für öffentlich beworbene Tourismusangebote verwendet, muss das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) beachtet werden. Demnach wird der Veranstalter dieser Fahrten zum Unternehmer, wenn er eine „entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen“ anbietet. Das betrifft i. d. R. jeden Veranstalter, der eigene Kleinbusse einsetzt oder Fahrgemeinschaften für Freizeitfahrten organisiert (Ausnahmeregelung: es werden ausschließlich die Betriebskosten der Fahrt – Treibstoff, Öl, Verschleiß – berechnet). Daher muss er eine Genehmigung nach dem PBefG beantragen, deren Kostenaufwand nicht zu unterschätzen ist. Zusätzlich muss der Fahrzeuglenker eine „Fahrerlaubnis zur Personenbeförderung“ besitzen.
Vorteile
Nachteile
eigene Autos vor Ort für Ausflüge, Einkäufe und Notfälle
kann je nach Strecke und Personenanzahl günstiger sein als ein Reisebus
An- und Abreise flexibel planbar
viele Fahrerinnen/Fahrer nötig
rechtliche Absicherung durch PBefG nötig
Zollbestimmungen, Mautgebühren und Laderegelungen müssen selbst in Erfahrung gebracht und berücksichtigt werden
oft wenig Raum für Gepäck/Material
Eigenanreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Teilnehmenden und Mitarbeitenden kommen mit Zug, Flugzeug, Fähre oder öffentlichem Bus zum Freizeitort. Gepäck und Material kann von den Personen selbst transportiert oder mit einem separaten Fahrzeug gesammelt an den Zielort gebracht werden (s. Kap. „1.10 Begleitfahrzeug“). Die Reise kann dabei von jeder Person selbstorganisiert erfolgen (natürlich erst ab einem gewissen Alter) oder von der Freizeitleitung geplant sein, sodass die Gruppe immer zusammen bleibt.
Vorteile
Nachteile
umweltfreundlich und ohne Fahrerinnen/Fahrer möglich
Zugfahrten sind als Gruppenangebot oft günstig zu bekommen
unabhängig von Stau und Maut
nur bei erreichbaren Freizeitzielen möglich (z. B. wenn der Bahnhof in Laufnähe zum Haus ist)
durch Umstiege, Gepäckverluste und große Gruppen oft hoher Stressfaktor
Risiko: verpasst, verspätet, fällt aus o. Ä.
oft nicht erstattbare Kosten bei Stornierungen
Materialtransport aufwendig
Anreise mit Reisebus
Möchte man ein Busunternehmen beauftragen, ist die Frage, ob es sich nur um die An- und Abreise handelt oder ob der Bus die ganze Freizeit über vor Ort sein soll. Dabei spielt auch eine Rolle, ob die Fahrerin / der Fahrer vor Ort untergebracht werden muss. Es ist in beiden Fällen nötig, verschiedene Angebote einzuholen und sorgfältig zu vergleichen! Meist lohnt sich ein Bus (je nach Strecke) erst ab ca. 25 Personen. Gepäck und Material werden im Normallfall im Bus transportiert, bei sehr viel Ladung können meist Anhänger mitgemietet werden. Die Abfahrtszeiten sind flexibel, jedoch werden bei langen Strecken rechtlich vorgegebene Ruhezeiten für die Fahrerin / den Fahrer anfallen.
Vorteile
Nachteile
umweltfreundlich, ohne eigene Fahrerinnen/Fahrer und ohne Umstiege möglich