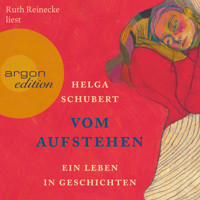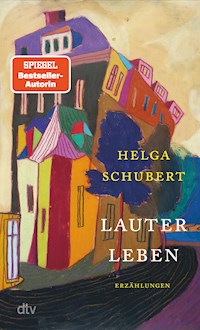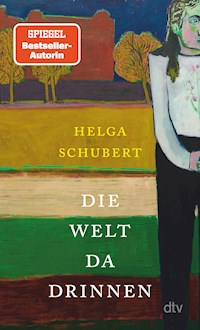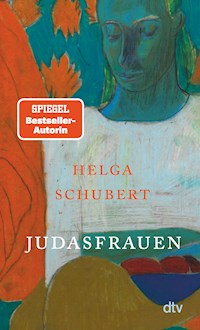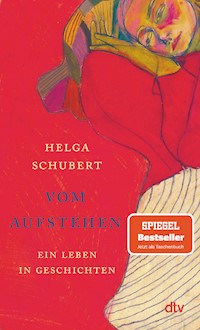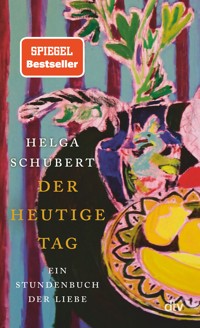
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Vielleicht ist einer von uns morgen schon nicht mehr da.« Über fünfzig Jahre lang teilen sie ihr Leben. Doch nun ist der Mann schwer krank. Lange schon wird er palliativ umsorgt; und so wird der Radius des Paares immer eingeschränkter, der Besuch seltener, die Abhängigkeit voneinander größer. Kraftvoll und poetisch erzählt Helga Schubert davon, wie man in solchen Umständen selbst den Verstand und der andere die Würde behält. »Helga Schubert erzählt davon, wie man Frieden machen kann mit diesem Leben. Sie zeigt, wie man Lebensgeschichte in Literatur verwandeln kann.« Insa Wilke »Ich war so berührt, dass ich dachte, man müsste eine neue literarische Skala eröffnen: den Schubert-Moment.« Katrin Schumacher
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Ähnliche
Helga Schubert
Der heutige Tag
Ein Stundenbuch der Liebe
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Darum sorgt nicht für den andern Morgen;
denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen.
Es ist genug, dass ein jeglicher Tag
seine eigene Plage habe.
Matthäus, Kapitel 6, Vers 34
Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant, sagt Derden zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer und an sein Pflegebett komme.
Wir sind seit 58 Jahren zusammen.
Zwei alte Liebesleute.
Ist es morgens oder abends, fragt er mich dann.
Ich gehe ins Badezimmer, fülle seinen Zahnputzbecher mit warmem Wasser und ein paar Tropfen Zahnputzwasser, spüle sein Gebiss, gehe damit in sein Zimmer, setze mich auf seine Bettkante, er rückt mühsam etwas zur Seite, damit ich es auf der Matratze weicher habe, ich gebe ihm den Zahnputzbecher und zum Ausspucken der Mundspülung einen leeren großen Joghurtbecher.
Ich schlage sein Deckbett zurück, leere den Bettbeutel des Blasenkatheters, fühle, ob die Windel nass ist.
Ich liebe ihn sehr.
Ich rolle den Rollstuhl ganz nah an das Pflegebett, ziehe ihn langsam zum Sitzen hoch, bei ihm dreht sich alles. Ich soll noch etwas warten, bis das vorbei ist.
Ich bringe ihm seinen flauschigen dunkelblauen Bademantel, helfe ihm, den rechten Arm in den Ärmel zu strecken, ziehe den Bademantel um seinen Rücken, denn der linke Arm findet sonst nicht den Eingang.
Dann stellt er die Bremsen am Rollstuhl fest, das muss zur Routine werden, sonst rollt der Rollstuhl weg, wenn er von der Bettkante umsteigen will.
Also bleibe ich nur stehen.
Nein, lass mich, sagt er, fass mich nicht an, ich verliere sonst das Gleichgewicht.
Dann stützt er sich auf die Lehnen des Rollstuhls, dreht sich in kleinen Schritten und lässt sich ächzend auf das Weichsitzkissen des Rollstuhls nieder.
Dann schiebe ich ihn an den Frühstückstisch im Wintergarten, hab vorher für uns alles gedeckt.
Dann arrangiert Derden seinen Frühstücksteller, jeden Morgen auf die gleiche Weise: mit einer Avocado, ausgelöffelt wie ein Ei, einer Mandarine, einem geschnittenen gekochten Ei, einem Brot mit salziger Butter und Kräutern. Und Kaffee mit drei Tabletten Süßstoff und warmer Milch, daneben kalter Tomatensaft und Ginger Ale zu den acht Morgen-Tabletten zum Entwässern, zum regelmäßigen Herzschlag und gegen alle möglichen Entzündungen.
An Ihrer Stelle würde ich Ihrem Mann einfach ein paar Tropfen Morphium mehr geben, das ist doch kein Leben mehr für ihn, riet mir der Spezialist in der Schlafforschung vor vier Jahren.
Er aber ist entschlossen, sich sofort umzubringen, wenn seiner Frau etwas zustoßen und sie daran sterben würde. Ohne sie wäre sein Leben sinnlos.
Ich machte ihn auf den Widerspruch aufmerksam.
Aber für ihn war es kein Widerspruch und nicht vergleichbar.
Derden trinkt so gern Kaltes und sitzt so gern in der Sonne und sieht den Amseln beim Nestbau zu und den Pferden nebenan, dem Fohlen, das sie durchgebracht haben, obwohl das Muttertier die Geburt kaum überlebte, und den Wildgänsen über uns in ihrem wundersamen Dreieck.
Er möchte, dass ich in der Sonne neben ihm sitze.
Beim lieben Gott will er ein gutes Wort für mich einlegen, gleich am Eingang sitzen bleiben, bis ich nachkomme, und sagen:
Da ist sie.
Ich kann nichts mehr, sagt Derden, und ich habe doch Bücher geschrieben. Und ich habe über 1300 Bilder gemalt. Über 1300 Ölbilder. Und im letzten Jahr nur zwei.
Ja, sage ich, wunderschöne Gemälde.
Und in diesem Jahr kann ich gar nicht mehr malen. Alle Ölfarben sind in den Tuben vertrocknet.
Und im letzten Jahr hast du eigentlich hundert Bilder gemalt in diesem einen Bild, das eine immer wieder übermalt: den Blick vom Pflegebett nach draußen in die großen Blüten der Magnolie. Auf dem Fensterbrett davor die beiden Barlach-Bronzen, der Flötenspieler und der Buchleser, dann noch der große geschnitzte Rabe aus Holz.
Dann wurde es Sommer, die Blüten der Magnolie fielen ab, dann Herbst, es fielen ihre Blätter, dann kam der Winter, und Schnee lag auf den Ästen, dann taute es, und der Magnolienbaum war ganz kahl. Mit deinem Bild bist du den Jahreszeiten gefolgt, viele Öl-Schichten übereinander.
Derden ist mir ein Menschenleben lang nah. Zum ersten Mal begegnete ich ihm vor 66 Jahren. Ich war eine, was Männer betrifft, vollkommen unerfahrene Siebzehnjährige.
Im Zeltlager nach der Zehnten hatte mich mal ein Junge auf den Mund geküsst, wir waren zu viert nach dem Eisessen an den Strand gegangen, er drehte mich an der Schulter zu sich und lächelte mich fragend an, ich weiß heute noch seinen Namen, er war so alt wie ich, mir viel zu ähnlich. So einen Bruder hätte ich gern gehabt. Wir verabredeten uns nicht wieder.
Derden dagegen hatte von Anfang an etwas Geheimnisvolles für mich. Er war damals ein dreißigjähriger Uni-Assistent am Berliner Psychologischen Institut und musste wie seine Kollegen mit uns Abiturienten Aufnahmegespräche für das Psychologie-Studium führen.
Ich war ihm zugeteilt. Er wirkte etwas gelangweilt und auch etwas hochmütig auf mich. Bis zum Abitur konnte ich mich einfach nicht für ein Fach entscheiden, weil mir eigentlich alles Spaß machte: Mathematik sowieso, dann auch Chemie (kommen Sie mal an die Tafel, Helga, erklären Sie der Klasse die Formel, Sie können chemisch denken), an Biologie hatte ich auch gedacht, dann an Germanistik, die Liebesszenen aus den Theaterstücken im Deutschunterricht sollte ich im Dialog mit dem Lehrer lesen, das wäre heute sicher verdächtig.
Ich war ein streng erzogenes Kind und hatte schließlich an das Fach Psychologie gedacht, gehofft, dass man beim Psychologie-Studium doch ein wenig mehr Menschenkenntnis erwirbt als nur beim Lesen von Dostojewski oder beim Zuhören in Gerichtsverhandlungen.
So antwortete ich auch auf Derdens Frage, wie ich denn ausgerechnet auf diesen Studienwunsch gekommen sei.
Ich hatte den Eindruck, dass er mir meine Illusion, Psychologie könnte ein interessantes Studienfach sein, von Anfang an austreiben wollte. Er sprach von der Anatomie des Zentralnervensystems, statistischen Prüfverfahren, Konzentrationsleistungstests und empfahl mir vor dem Studienbeginn ein Jahr ungelernte Arbeit in der Fabrik, um auf den Teppich zu kommen.
Vergessen Sie die Idee, ein Jahr Nachtwache in der Psychiatrie zu machen, sondern kommen Sie in Kontakt mit Menschen, die nicht immerzu lesen. Sie erhalten eine Vorimmatrikulation für das nächste Studienjahr. Bei Ihrem Zeugnis müssen wir Sie ja nehmen, sagte er abschließend.
Er hatte schwarze Haare, dunkle Augen, einen Schnurrbart, einen weißen Kittel an, auch Kreppschuhe, die hatte er offensichtlich aus Westberlin, die Mauer wurde ja erst vier Jahre später gebaut.
Ich hatte geplant, mit achtzehn sofort in den Westen zu gehen und dort weiterzustudieren. Das Abitur hätte man im Westen nämlich nachmachen müssen, weil wir es im Osten ja nach zwölf Jahren ablegten, während man als Ost-Studentin an eine westliche Uni in das entsprechende Semester wechseln konnte. So wollte ich ein Jahr Lebenszeit sparen.
Das hat mir dieser Assistent vermasselt, dachte ich damals ärgerlich.
Ich arbeitete dann tatsächlich ein Jahr am Band und lötete mit dreihundert anderen Frauen in einer Montagehalle an einer Punktschweißmaschine Fernsehempfangsröhren am Band, wurde von der Meisterin in der Endkontrolle und dann als Springerin eingesetzt.
Nach diesem sogenannten Praktischen Jahr durfte ich endlich studieren, hörte bei Derden Vorlesungen und bestand Prüfungen bei ihm.
Eine ältere Mitstudentin sagte mir einmal, dass er eine Strindberg-Atmosphäre hervorrufen würde. Das habe ihr eine Doktorandin anvertraut.
Ich war inzwischen mit einem Maler und Grafiker verheiratet, der großen Wert auf mein Äußeres legte, denn meine Vorgängerin war eine Modestudentin gewesen, meine jeweilige Nebenfrau, wie ich erst später erfuhr: Schauspielerin, Tänzerin, Aktmodell. Auf seinen Wunsch färbte ich meine Kleidung schwarz, meine Haare hennarot und trug violette Strümpfe aus Westberlin zum Kurs 1:6.
Derden erinnert sich noch heute an diese violetten Strümpfe, auch daran, dass beim Mittagessen in der Mensa einmal das Gespräch auf mich gekommen war mit dem Ergebnis, dass ich eine Frau zum Heiraten sei und einen sehr verheirateten Eindruck mache, da ich nicht flirtete. Und ich erinnere mich noch an eine irritierende Situation nach vierjährigem Studium: Ich kam aus der Instituts-Bibliothek, im Flur hing mein Mantel, ich nahm ihn vom Haken, in dem Moment kam Derden, der dort mit jemandem gesprochen hatte, zwei Schritte auf mich zu, fragte, ob er mir in den Mantel helfen dürfte.
Ich ließ es zu und bemerkte, dass er, ohne mich zu berühren, die Arme um mich legte, mich gleichsam mit meinem Mantel einhüllte. Es war eine unglaublich zärtlich respektvolle und ritterliche Geste. Wortlos ohne Zudringlichkeit.
Da war in Berlin schon die Mauer gebaut, er hatte zwei kleine Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und ich einen kleinen Sohn.
Im folgenden Jahr, dem letzten in meinem Studium, betreute er meine Diplomarbeit, ganz sachlich, und später, als ich schon arbeitete, besuchte ich einen Kongress in Dresden, an dem er sich nach seinem Vortrag mit einem Kollegen zu mir setzte.
Sie fragten mich, ob ich auch zu dem vorgesehenen Tanzabend käme. Ja, das hatte ich vor.
Dort forderte er mich zum Tanz auf – und plötzlich war es leicht, ganz leicht. Wir hatten noch nie zusammen getanzt. Er war nicht hochmütig, nicht ironisch, nicht verstellt, ganz selbstverständlich und mir vertraut.
Er sagte: Sie haben ja eine Weichheitsstruktur. Das war sieben Jahre nach meinem Aufnahmegespräch.
An dem Abend gingen wir viele Stunden an der Elbe entlang, unten am Wasser, unter den Brücken, und erzählten uns unser Leben, zwei erwachsene, verheiratete Menschen, er 37 und ich 24. Und wir wussten, dass es ernst mit uns wird. Und hielten noch Abstand in dieser Nacht. Ein Tor hatte sich für mich geöffnet, in eine Welt vor meinem eigenen Leben: Er hatte die Nazizeit als Jugendlicher schon bewusst erlebt, war Soldat gewesen, Kriegsgefangener der Amerikaner in einem belgischen Bergwerk, hatte die Eltern verloren, sie waren auf der Flucht gestorben. Und er war das Jüngste von ihren vier Kindern, das alles durfte, das geliebt wurde.
Ein Tor in seine Welt, in die er mich einlud und auch heute noch einlädt.
Wenn ich abends alles Notwendige an ihm gerichtet und für die Nacht vorbereitet hatte, auf seiner Bettkante saß, nur seine Nachttischlampe an war, wir unsere Hände ineinander verschränkten, seine kalten in meine warmen, begann unsere schönste Tageszeit: Er sagte, dass ich seine Mutter, Schwester, sein großer Bruder, die alle tot sind, sein Mann und seine Frau sei. Alles. Ich fragte ihn, ob er auch keine Schmerzen habe, und freute mich schon auf das Hochfahren des Laptops, vorher das Begrüßungsbild von hohen Wellen an einem Fort im Atlantik. Eigentlich ist es egal, wo ich lebe, dachte ich, Hauptsache, er ist da, und wenn er nicht mehr in diesem Pflegebett liegen würde, zufrieden und gesättigt und ohne Schmerzen, sondern sein Körper tot wäre und ich in einer Einzimmerwohnung, vielleicht in einem Heim oder einer Alten-WG in den Niederlanden oder an der Nordsee oder in Berlin leben würde, wäre er ja auch immer da, denn er ist ja in mir.
Als ich das Licht der Nachttischlampe ausknipste, ihn küsste und aufstand, sagte er tatsächlich in der Dunkelheit, aber ganz dunkel war es nicht, denn erstens leuchtete der Adventsstern innen an seinem Fenster, zweitens schien das Wohnzimmerlicht immer nachts durch die geöffnete Tür, drittens war in meinem Arbeitszimmer schon das Licht an und um die Ecke sichtbar, schließlich blinkte auch das Babyphone, er sagte leise:
Dû bist mîn, ich bin dîn.
des solt dû gewis sîn.
dû bist beslozzen
in mînem herzen,
verlorn ist das sluzzelîn:
dû muost ouch immêr darinne sîn.
Und als der ehrenamtliche Hospizbesuchsdienst neulich an unserem Kaffeetisch saß und wir über unsere Anfänge sprachen, fielen Derden plötzlich die Morgenstern-Gedichte ein, die wir beim Zelten vor einem halben Jahrhundert alle auswendig konnten, von dem Schluchtenhund und dem Seufzer auf dem Eis und dem Traum der Magd mit dem Schluss:
»Halt’s –
halt’s Maul!«, so spricht die Frau, »und geh
an deinen Dienst, Zä-zi-li-e!«
Es war so viel mehr Gemeinsamkeit und Anziehung als durch das Miteinanderschlafen, ja, das wollte ich jeden Tag und er auch, es hat mir Spaß gemacht, ihn unvermutet zu verführen, wenn die Gäste unten an der Klingelanlage im Hochhaus durch die Sprechanlage schon mit uns in Kontakt waren, sie mussten ja erst von unserem Türöffner, wir hörten das Surren, in den Fahrstuhl- und Briefkasten-Eingangsbereich gelangen, dann den Fahrstuhl rufen, warten, bis einer der drei Fahrstühle kam, dann in den neunten Stock fahren, dann durch einen Gang bis zu unserem Aufgang, noch eine halbe Treppe und bei uns klingeln: Genug Zeit für uns. Ich wollte immer mit ihm verbunden sein, und wenn es mein Fuß an seinem war unterm Tisch, mein Knie an seinem Oberschenkel. Die leichte Distanz, der Anflug von Hochmut, den ich oft bei ihm spürte, war dann überwunden.
Zu DDR-Zeiten, sie überwachten mich schon, das Telefon tickte merkwürdig, die Briefumschläge krümelten am vorher gummierten Verschluss, waren also schon geöffnet worden, und Derden war schon Professor an der Uni und wir waren verheiratet, kam er eine ganze Weile amüsiert nach Hause und erzählte, wie wieder eine andere wirklich hübsche Studentin ihn auf der Treppe in der Mensa angesprochen und gefragt habe, ob er auch zum Mittagessen gehe. Und ob sie sich ihm anschließen könne, denn sie wollte schon immer so gern einmal in die Professoren-Mensa gehen. Und als er sie auf ihren Wunsch dort mit hineinnahm, fragte sie ihn, ob man sich nicht auch einmal außerhalb der Uni treffen könnte. Das sei ihm in vergleichbarer Art schon mehrmals angeboten worden. »Dann hab ich ja wirklich Schlag bei Frauen«, erzählte er mir und lachte.
Ich hatte keinen Zweifel daran.
Als dann nach dem Ende der DDR die Akten des Ministeriums für Staatssicherheitsdienst geöffnet wurden und wir unsere Akten einsehen durften, das heißt, die Dienststelle des Bundesbeauftragten fragte mich, wann ich kommen wollte, denn erst sollte ich alles lesen, mein Mann sei vor allem bearbeitet worden, weil er mit mir lebte, und sollte seine Akte erst später lesen, sagte ich, meinetwegen könnten wir zusammen kommen, sie brauchten nichts abzudecken und zu schwärzen, eine Ehe, die eine Diktatur nicht übersteht, sei keine Ehe. So konnten wir nebeneinander in dem Aktenraum sitzen und staunten, wer alles über mich berichtet hatte: ein Literaturwissenschaftler mit dem Decknamen Adler, er war SS-Mann gewesen, ein passender Deckname also, dann jemand in der Uni, und auch unser Wohnungsnachbar. Dann fanden wir den Abschluss-Vermerk der Staatssicherheit: Er ist ein Frauentyp, willigt in gemeinsames, vom Informellen Mitarbeiter vorgeschlagenes Mittagessen in der Mensa ein, lehnt aber vorgeschlagene private Treffen ab. Er scheint der Schubert treu zu sein.
Außerdem stand noch in seiner Akte, dass er einen beruhigenden Einfluss auf mich ausübe, in politischer Hinsicht. Das stimmte, denn ich wollte dauernd mit ihm in den Westen, und er war der Meinung, die vernünftigen Leute müssten im Osten bleiben, besonders diejenigen aus dem medizinischen Bereich und die Pastoren.
Trotz jahrelanger Bemühung, das stand auch noch in meiner Akte, sei es nicht gelungen, in meinem privaten Bereich einen Informellen Mitarbeiter zu platzieren, weil ich ausschließlich von Menschen umgeben sei, die ebenfalls operativ bearbeitet werden.
Die Diktatur der Gartenzwerge hatte unsere Ehe also heil überstanden, und der Offizier dieser observierenden Abteilung XX gegen politischen Untergrund (oder so ähnlich) entschuldigte sich später, in den Neunzigern, sogar bei mir, er fühle Reue und Scham wegen seiner Maßnahmen.
Er scheint der Schubert treu zu sein, dieser Satz ist deshalb so demaskierend, weil er ein verachtenswertes Menschenbild offenbart: Ein untreuer Mann hat solche Angst vor seiner Frau, dass er erpressbar wird und in der Folge seine Frau bespitzelt und verrät, um sich ja nicht mit ihr auseinandersetzen zu müssen, wenn es herauskommt.
Fast dreißig Jahre vor diesem Aktenfund und eine Woche nach unserem nächtlichen Spaziergang am Elbufer rief mich Derden in meiner Dienststelle an. Er sei von der Uni beauftragt, sich im Rahmen der Absolventenlenkung zu erkundigen, wie zufrieden die Amtsärzte mit den Absolventen des Psychologischen Instituts seien, die in den neugeschaffenen Stellen arbeiteten. Da ich dazugehörte, und zwar in der Beratungsstelle für Nerven- und Gemütskranke des Stadtbezirks Berlin-Weißensee, wollte er mit mir beginnen. Nachdem er mit dem Amtsarzt gesprochen hatte, der meine Absolventenstelle in eine feste umwandeln wollte, weil ich mich bei den sechshundert Kindergarten- und Schuleignungsuntersuchungen der Jugendärztin in jenem Jahr nützlich gemacht hatte – ich verfügte über mehr Zeit und mehr Testmöglichkeiten als sie, mich verhaltensauffälligen Kindern und deren Eltern zu widmen – kam er zu mir, und wir gingen nach Dienstschluss noch ein wenig zum Weißen See, dann zur Straßenbahn, fuhren zum Alexanderplatz und von dort mit der S-Bahn bis zum Bahnhof Karlshorst. Ich wohnte da – mein Sohn ging in Bahnhofsnähe in den Kindergarten. Derden musste aber für seinen weiteren Heimweg noch in eine Regionalbahn umsteigen und eine Stunde fahren, südlich um Berlin herum, weshalb man den Zug auch Sputnik nannte; die Mauer war ja drei Jahre zuvor gebaut worden, die S-Bahnverbindung nach Potsdam durch Westberlin gekappt.
Und wir begannen, uns für die halbstündige S-Bahnfahrt vom Alexanderplatz zum Bahnhof Karlshorst manchmal zu verabreden. Bei einer dieser Fahrten war ich in größter Sorge um mein dreijähriges Kind, das am Vortag in die Intensivstation gekommen war.
Es war ein Freitag. Und seit Montag jener Woche hatte ich täglich entweder einen ärztlichen Notdienst gerufen oder war mit dem hustenden Kind in die Sprechstunde der Kinderärztin gegangen. Als mein Sohn sich zuhause weigerte, den verordneten Hustensaft zu trinken, sein Vater ihn vor Verzweiflung mit Gewalt und Schütteln dazu zwingen wollte und ich im Gegenlicht sah, wie beim Husten feine Eitertropfen aus dem Mund kamen, rief ich wieder den Kinderarzt-Notdienst. Die diensthabende Ärztin vermutete eine Blinddarmvereiterung, weil sich das Kind mit großen Schmerzen nicht mehr anfassen lassen wollte, und verordnete eine Krankenhauseinweisung. Dort sahen die Ärzte im Röntgenbild die Vereiterung der Lunge, ein Lungenempyem, und zogen den Eiter aus der Lunge ab, legten mein Kind auf die Intensivstation und ließen sich unsere Telefonnummer geben. Die Anzieh-Sachen gaben sie uns mit, weil auf der Intensivstation kein Platz dafür war. Am nächsten Nachmittag, also an dem betreffenden Freitag, sollten wir anrufen.
Das alles erzählte ich Derden auf der Fahrt, und er sagte etwas so Tröstliches, dass ich es ihm bis heute nicht vergesse: Meine Kinder bekommen von ihrer Großmutter aus dem Westen öfter Gummibärchen geschickt, davon könnte ich Ihnen ein Tütchen für Ihren Sohn mitbringen, wenn meine Kinder damit einverstanden sind.
Noch einen Tag zuvor hatte mein damaliger Ehemann in der Wohnungstür gestanden, mich hasserfüllt angesehen und gemurmelt: Er stirbt jetzt, und du hast Schuld.
Wie konnte ich schuld sein am Tod meines Kindes?, dachte ich. Wie konnte dieser Mensch, der da in der Tür stand und mit dem ich merkwürdigerweise verheiratet schien, mich beschuldigen? Was würde aus diesem Mund noch kommen?
Ich glaube, es waren die Gummibärchen, die selbstverständliche Hoffnung aufs Weiterleben meines Kindes, die Ruhe und die Menschenfreundlichkeit Derdens, für die ich bis heute dankbar bin. Die mir Mut machten, mich aus dieser ersten und zerstörerischen Ehe zu lösen.
Morgens betrachte ich Derden besorgt, wie er sich bei der Pflegeschwester bedankt, die ihn eben geduscht hat, ihn nun im Rollstuhl an den gedeckten Frühstückstisch fährt und sagt: Sehen Sie mal, wie schön Ihre Frau den Frühstückstisch gedeckt hat für Sie.
Jeden Morgen bedankt er sich bei der Schwester, die gerade Dienst hat, und sagt: Vielen Dank für Ihre Mühe, das haben Sie besonders gut gemacht, es hat nicht weh getan. Und wenn sie gegangen ist und sich noch im Vorflur den Schutz von den Straßenschuhen streift, die Tür noch gar nicht geschlossen hat, seine Frage also noch hören kann, fragt er mich: Wer war das? War sie schon einmal da? Ja, seit vier Jahren, antwortete ich früher. Aber inzwischen nicke ich nur und sage Ja.
Pfleger Markus ermahnte mich nämlich, bei allen meinen Worten darauf zu achten, dass sie mit Liebe ausgesprochen werden.
Sie müssen immer überlegen, bei jeder Handlung: Was ist gut für ihn? Wenn Sie die Zahl der Jahre nennen, könnte es ihn beschämen.
Es genüge, Ja zu sagen.
Ich frage die Pflegeschwester, wie sie es erträgt, nicht erkannt zu werden. Das ist die Krankheit, sagt sie, man darf es nicht auf sich beziehen.
Aber ich will von meinem Mann erkannt werden, sage ich zu ihr.
Als meine Großmutter im Sterben lag und ich Sechzehnjährige allein an ihrem Bett stand, sagte sie flehend zu mir: Komm her zu mir, Ella.
Das war ihre schon lange verstorbene ältere Schwester. Und ich widersprach nicht, ließ sie im Glauben, ging an ihr Bett und streichelte ihre Hand ganz leicht, bis sie starb.
Ich war ausgetauscht, und es war richtig. Ich konnte sie gehen lassen in die andere schmerzlose Welt.
Aber Derden ist ein Teil von mir, das ist etwas anderes als damals am Ende der elften Klasse, als meine Welt weit war und das Leben noch vor mir.
Vor einigen Jahren kam Derden in die Betreuung der ambulanten Palliativschwestern und -ärzte. Alle zwei Tage besuchten sie ihn, verschrieben Morphium gegen die Knieschmerzen. Er nahm bis auf 58 Kilogramm ab, seine Unterschenkel bekamen Wunden. Weil sein Herz so schwach ist und die Nieren es nicht mehr schafften, erklärten sie mir.
Ich sollte die Beine mit Wacholder und Meersalz baden.
Das können Sie hier zuhause nicht steril schaffen, meinte der Palliativarzt schließlich und wies ihn auf die Palliativstation ein. Tagelang nahm ich den frühesten Bus in die Stadt und durfte still bei ihm sitzen bis zum letzten Bus. Durfte ihn mit dem Rollstuhl durch den Park um die Klinik fahren; hier hatten sie im Zweiten Weltkrieg Kranke wie Derden getötet. Ich kaufte Derden für den stationären Aufenthalt ein einfaches Handy: Er rief mich damit nachts an. Immer wieder. Weil ich ihn in Sicherheit wusste, stellte ich zuhause nachts meinen Anrufbeantworter an. Derden weckte seinen Nachbarn und bat ihn um Rat: Zuhause sei statt seiner Frau eine fremde Stimme am Telefon. Und er sprach viele Stunden mit dem Anrufbeantworter, sagte sein Zimmernachbar und bat um Verlegung. Sie schlichen das Morphium aus und stellten einen Dringlichkeitsantrag für das Hospiz.
Ich bestellte ein Taxi vom Krankenhaus zum Hospiz und brachte Derden mit dem Rollstuhl hinein, damit er sich ein Bild machen konnte.
Am Eingang eine Kerze und das Kondolenzbuch für die an diesem Tag Gestorbenen.
Wir gingen in den Raum der Stille, weil wir durch die bodentiefen Fenster sahen, dass die Mitarbeiter gerade zu einer Dienstbesprechung versammelt waren.
Wir beteten dort.