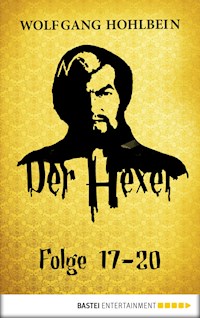
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Im Bann des Puppenmachers" - Folge 17 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
"Haltet Euch bereit, Brüder." Balestranos Stimme bebte vor Erregung, und auch die Bewegungen des alten Mannes hatten viel von der Ruhe verloren, die de Laurec immer so an ihm geschätzt und bewundert hatte. Seine Finger zitterten, als er langsam auf den niedrigen, altarähnlichen Tisch zutrat, und in seinen Augen stand ein Glitzern, das vielleicht nur Anspannung ausdrücken mochte. Vielleicht aber auch Angst. Angst vor dem, dachte de Laurec schauderte, was sich außer den sieben Großmeistern der Templer-Loge noch in dem kleinen, fensterlosen Raum aufhielt. Dem Geist des Satans.
"Das Mädchen aus dem Zwischenreich" - Folge 18 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
"Ratten!" John Penwicks Stimme zitterte in einer Mischung aus Triumph und grimmiger Befriedung, während er den Stiel seiner Schaufel immer und immer wieder auf die Ratte heruntersausen ließ. Das Tier war längst tot, aber Penwick schlug noch fast ein halbes Duzend Mal zu, ehe er die Schaufel endlich schweratmend sinken ließ, einen Schritt von dem frisch ausgehobenen Grab zurücktrat und sich kampflustig umsah. Seine schwieligen Hände umspannten den Schaufelstiel viel fester, als nötig gewesen wäre. "Ratten!" sagte er noch einmal. "Wie ich diese Biester hasse! Nicht einmal die Toten können sie in Frieden lassen."
"Wenn der Stahlwolf erwacht ..." - Folge 19 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Der Mann war lautlos aus den Schatten einer Seitengasse getreten, in denen er gelauert und die Straße beobachtet haben musste. Jetzt stand er reglos da, wie eine grässliche Statue, die nur zu dem Zweck erschaffen worden war, jedes menschliches Leben, jedes menschliche Gefühl und jede Ähnlichkeit mit dem Wesen, nach dessen Vorbild sie gefertigt worden war, zu verhöhnen. Von den Füßen aufwärts bis zu den Schultern war er ein ganz normaler Mensch; ein massiger Mann mittleren Alters, in einfache zerschlissene Hosen und eine schwarze Arbeitsjacke gekleidet. Doch auf den breiten, leicht vorgebeugten Schultern ruhte der spitz, von drahtigen braunem Fell bedeckte Schädel einer Ratte.
"Engel des Bösen" - Folge 20 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Das rote, flackernde Licht der Fackel schien den toten Schädel in Blut zu tauchen, und die zuckende Schatten der hin und her tanzenden Flamme füllten die leeren Augenhöhlen mit scheinbarem Leben. Nur scheinbar? Howard erstarrte. Die Fackel in seiner Hand begann zu zittern. Ganz plötzlich bewegte sich der Schädel! Ein helles, schabendes Geräusch drang durch den grauen Knochen, und mit einem Male rollte der Totenschädel zur Seite, wippte noch ein paarmal hin und her, und der Unterkiefer klappte zu einem hässlichen Grinsen herab. Aus dem offenstehenden Mund des Schädels kroch eine haarige, schwarze Ratte und huschte davon...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Im Bann des Puppenmachers
Der Hexer – Das Mädchen aus dem Zwischenreich
Der Hexer – Wenn der Stahlwolf erwacht …
Der Hexer – Engel des Bösen
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 17-20:
Der Hexer – Im Bann des Puppenmachers
Der Hexer – Das Mädchen aus dem Zwischenreich
Der Hexer – Wenn der Stahlwolf erwacht …
Der Hexer – Engel des Bösen
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 17–20
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1572-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 17-18
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 17 bis 18.
DER HEXER – das ist die Geschichte Robert Cravens, eines Mannes, der sich einer ungeheuren dämonischen Bedrohung entgegenstellt. Diese Bedrohung, die GROSSEN ALTEN, sind eine Schöpfung des Autors Howard Phillips Lovecraft, der von 1890 bis 1937 lebte. Der große Erfolg blieb ihm zu Lebzeiten verwehrt, er veröffentlichte seine Geschichten in billigen Magazinen mit geringer Leserzahl. Erst in den Jahrzehnten nach seinem Tod wurde er zu einem der bekanntesten und meistgelesenen Autoren der Fantastik, was nicht zuletzt seinem Fan August Derleth zu verdanken war, der dafür sorgte, dass Lovecrafts Werke ständig nachgedruckt wurden, und sie mit eigenen, neuen Romanen ergänzte. Seine wohl berühmteste Schöpfung ist der Cthulhu-Mythos, eine Sammlung von Geschichten und Romanen um die GROSSEN ALTEN, finstere Dämonengötter, die die Erde Millionen von Jahren vor den Menschen beherrscht haben. Aber in ihrer Machtgier überschätzten sie sich selbst und rührten an Mächte, die auch ihnen verboten waren. In einem schrecklichen Krieg wurden sie von den ÄLTEREN GÖTTERN besiegt, doch auch diese vermochten die GROSSEN ALTEN nicht zu töten, sondern nur zu bannen. Seit dieser Zeit warten sie in ihren Verliesen jenseits der Wirklichkeit auf den Tag ihrer Auferstehung, um die Erde erneut in Besitz zu nehmen. Wer sich allzu intensiv mit dem Wissen um die GROSSEN ALTEN oder ihren im Verborgenen lauernden Hinterlassenschaften beschäftigt, kann von Glück sagen, wenn er nicht nur mit dem Leben, sondern auch mit einem heilen Verstand davon kommt, was bei Lovecraft eher selten der Fall ist. Meist bringt das Erbe der alten Dämonengötter dem Unglücklichen, der damit konfrontiert wird, Tod oder zumindest Wahnsinn. Vielleicht ein Grund für den mangelnden Erfolg, den Lovecraft lange hatte. Bei ihm gibt es keine strahlenden Helden, die das Böse bezwingen, sondern bestenfalls Überlebende. Lovecraft selbst hat schon frühzeitig andere Autoren aufgefordert, eigene Geschichten zum Cthulhu-Mythos beizusteuern; seine Korrespondenz, die ungleich umfangreicher als sein literarisches Werk ist, ist legendär. Aber gerade die Beschäftigung anderer, zum Teil weitaus populärerer Autoren als er selbst, mit dem Mythos verhalf diesem zu stetig wachsender Bekanntheit.
In diese Fußstapfen trat 1983 auch der deutsche Autor Wolfgang Hohlbein, der zu dieser Zeit noch am Beginn seiner Karriere stand und mit Büchern wie »Märchenmond« und dem »Enwor-Zyklus« gerade erste Erfolge feierte.
Das Ergebnis war die vollkommen neuartige Serie DER HEXER.
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 17Im Bann des Puppenmachers
»Haltet Euch bereit, Brüder.«
Balestranos Stimme bebte vor Erregung, und auch die Bewegungen des alten Mannes hatten viel von der Ruhe verloren, die de Laurec immer so an ihm geschätzt und bewundert hatte. Seine Finger zitterten, als er langsam auf den niedrigen, altarähnlichen Tisch zutrat, und in seinen Augen stand ein Glitzern, das vielleicht nur Anspannung ausdrücken mochte.
Vielleicht aber auch Angst.
Angst vor dem, dachte de Laurec schaudernd, was sich außer den sieben Großmeistern der Templer-Loge noch in dem kleinen, fensterlosen Raum aufhielt.
Dem Geist des Satans.
Sarim de Laurec versuchte den Gedanken zu vertreiben und schalt sich im Stillen einen Narren. Das kristallene Gebilde, das auf dem Tisch vor Bruder Balestrano stand, hatte absolut nichts mit dem Antichristen zu tun; weder im übertragenen noch im wörtlichen Sinne. Es war nichts als das Artefakt einer Rasse von vielleicht unglaublich mächtigen, aber nichtsdestotrotz sterblichen Wesen, prähistorischen Monstrositäten, denen sie in Ermangelung einer besseren Bezeichnung den Namen die GROSSEN ALTEN gegeben hatten und deren Macht an die von Göttern heranreichen mochte.
Sie hatten nichts mit dem Teufel zu tun.
Es war nicht das erste Mal, dass sich de Laurec dies einzureden versuchte. Und es war auch nicht das erste Mal, dass der Gedanke die beruhigende Wirkung, die er eigentlich haben sollte, verfehlte.
Vielleicht gab es Dinge zwischen Himmel und Hölle, die schlimmer waren als der Teufel.
»Kommt näher, Brüder.« Balestrano war stehen geblieben. Jetzt hob er die Arme und streckte die Hände in einer beschwörend wirkenden Geste über das gehirnähnliche Kristallgebilde aus.
Lautlos traten die sechs anderen Master des Templer-Ordens neben ihn, bildeten einen weit auseinandergezogenen Kreis um den Stein und das Kristallgehirn und ergriffen sich bei den Händen.
De Laurec fuhr unmerklich zusammen, als er die Hand Bruder Looskamps berührte. Sie war kalt wie Eis und trotzdem schweißfeucht, und als de Laurec aufsah und dem Blick des dunkelhaarigen Flamen begegnete, bemerkte er die gleiche Nervosität darin, die er schon in Balestranos Augen zu sehen geglaubt hatte.
Irgendwie beruhigte es ihn, dass er nicht allein mit seiner Furcht war.
»Jetzt, meine Brüder«, flüsterte Balestrano.
De Laurec wusste nicht genau, was Balestrano tat. Obwohl er einer der sehr wenigen Templer war, die jemals den Rang eines Masters erreicht hatten, hatte er nie verstanden, was es war, das ihn und die anderen hier im Raum von normalen Sterblichen unterschied. Er war ein ebenso begabter Magier wie die anderen hier, aber anders als Balestrano – oder auch Looskamp – bediente er sich der Kräfte, die ihm zur Verfügung standen, rein instinktiv. Er hatte niemals logisch begründen können, woher seine Macht kam. Vielleicht wollte er es auch nicht.
Aber gleich, was es war – de Laurec spürte, wie irgendetwas geschah. Unsichtbare Energien brachten die verbrauchte Luft in dem kleinen Zimmer zum Knistern. Ein unheimlicher grünlichblauer Schein ließ die Luft erglühen, ohne dass de Laurec hätte sagen können, woher er kam, und im gleichen Moment glaubte er ein sanftes Tasten und Fühlen zu spüren, die unsichtbare Berührung der sechs anderen Geister, die sich gleich ihm auf die magische Welle des Kristallgehirnes einzuschwingen versuchten …
De Laurec unterdrückte ein Schaudern. Es war – seines Wissens nach – erst das dritte Mal in der gesamten Geschichte des Templerordens, dass sich eine so mächtige Loge zusammenschloss. Bei den beiden anderen Versuchen war es um nichts Geringeres als die Rettung der Welt gegangen. Und jetzt?
»Bruder Laurec!« Balestranos Stimme schnitt wie ein Peitschenhieb in seine Gedanken, und de Laurec fuhr erschrocken zusammen. Verwirrt ließ er Looskamps Hand los und wandte sich an den Großmeister. »Herr?«
In Balestranos Augen blitzte es zornig. »Beherrsche dich, Bruder«, sagte er streng. »Unsere Aufgabe ist wichtig. Das Leben zahlloser Menschen kann vom Gelingen unserer Mission abhängen. Diszipliniere deine Gedanken und beherrsche dich!«
De Laurec senkte ehrfurchtsvoll das Haupt, griff wieder nach den Händen seiner Nebenmänner und flüsterte eine Entschuldigung. Balestrano hatte recht. Ihre Aufgabe war zu wichtig, als dass er seinen Gedanken erlauben konnte, auf eigenen Wegen zu wandeln.
Erneut machte sich das lautlose Knistern und Beben magischer Energien in dem kleinen Kellerraum bemerkbar. Die Luft begann stärker zu glühen, bis der unheimliche grüne Schein das Licht der Kerzen überstrahlte und selbst durch de Laurecs geschlossene Lider stach. Der Franko-Araber glaubte ein ganz sachtes Vibrieren zu spüren, dann begann das Licht zu pulsieren; zuerst langsam, dann rascher und beinahe wütend, bis es in einen dunklen, an das Schlagen eines gewaltigen Herzens erinnernden Rhythmus fiel.
De Laurec öffnete die Augen – und stieß einen gellenden Schrei aus!
Das Zimmer hatte sich auf grässliche Weise verändert. Auch aus dem Inneren des Kristallgehirns erstrahlte jetzt ein pulsierendes, giftiges Licht; sein Schein war so grell und gnadenlos, dass er die Gestalten der sechs anderen Templer zu flachen grauen Schemen verblassen und de Laurec die Tränen in die Augen steigen ließ. Schatten von unbestimmbarer Gestalt huschten in irrwitzigem Hin und Her durch den Raum, und plötzlich hatte de Laurec das Gefühl, in einen gewaltigen, grundlosen Schacht zu blicken, der sich vor ihm auftat.
Warum merken die anderen nichts?, dachte de Laurec verwirrt.
Er versuchte, Looskamps Hand loszulassen, aber es ging nicht. Die Finger des Flamen waren steif geworden, und als de Laurec in sein Gesicht sah, erkannte er, dass das Antlitz des Mannes zu einer Maske des Entsetzens erstarrt war.
Mit verzweifelter Kraft riss er sich los, fuhr herum – und keuchte abermals vor Schrecken.
Er war der Einzige, der sich noch bewegen konnte!
Nicht nur Looskamp war wie zur Salzsäule erstarrt. Außer de Laurec selbst standen die Mitglieder der Templer-Loge reglos wie menschengroße Statuen da, mit verzerrten Gesichtern und zum Teil in grotesken Haltungen, aber unfähig, sich zu bewegen oder auch nur einen Muskel zu rühren.
»Balestrano!« keuchte de Laurec »Brüder! Was ist mit euch?« Aber er bekam keine Antwort. Und plötzlich fiel ihm auch die Stille auf.
Es war keine normale Stille, sondern ein Schweigen von gewaltiger, allumfassender Tiefe. Er hörte … nichts!
Verwirrt drehte sich der Puppet-Master des Templer-Ordens einmal um seine Achse, ließ den Blick über die Gestalten der Brüder schweifen und starrte schließlich wieder auf das Kristallgehirn hinunter.
Etwas hatte sich daran verändert, aber er vermochte nicht zu sagen, was. Zögernd machte er einen Schritt auf den niedrigen Altartisch zu, ließ sich auf ein Knie sinken und streckte die Finger nach dem riesigen Diamantgebilde aus.
Im gleichen Augenblick zerbrach die Wirklichkeit.
Es war, als zersplittere die Welt unter einem ungeheuren Hammerschlag. Ein greller Blitz löschte das grüne Leuchten aus, und plötzlich waren überall Flammen und rotes, heißes Licht. Dann …
Es war wie die Berührung einer unsichtbaren Hand, ein Tasten und Wühlen und Suchen in de Laurecs Gehirn, als drehe etwas jeden einzelnen seiner Gedanken herum, sondiere seine Seele bis in die tiefsten Tiefen und hinterließe nichts als Chaos. Er spürte die Gegenwart einer fremden, unglaublich bösen Macht, das plötzliche, fast explosive Auftreten finsterer Energien, die aus den Abgründen der Zeit emporstiegen wie glühende Lava aus dem Schlund eines Vulkanes.
Das Kristallgehirn begann zu pulsieren. Kleine graue Flecke erschienen mit einem Mal in der Luft, wuchsen in rasendem Wirbel heran und bildeten zerfaserte Nebelgebilde, die wie mit dünnen grauen Spinnfäden miteinander verbunden waren.
Und plötzlich begriff Sarim de Laurec, was er da beobachtete.
Die grauen Wirbel waren Tore.
Was er sah, war das Entstehen der gefürchteten Tore der GROSSEN ALTEN, jener unbegreiflichen Verbindungen zwischen den Dimensionen, über die das Kristallgehirn herrschte!
De Laurec keuchte vor Schrecken, als er sah, wie sich Dutzende der faustgroßen grauen Gebilde zu zwei, drei mannshohen grauen Nebelflecken zusammenschlossen. Plötzlich waren sie nicht mehr leer, sondern von wogender Bewegung erfüllt. Dann bildeten sich Dinge im Inneren der Tore, Dinge von namenlos schrecklichem Aussehen – graue, miteinander verwobene Arme, schreckliche Fratzen mit zu vielen Augen und in falschen Farben.
Und es war noch nicht vorbei.
Plötzlich ertönte ein scharfer, peitschender Knall – und aus einem der Tore zuckte ein oberschenkelstarker, grünlicher Fangarm, tastete einen Moment blind hin und her und bewegte sich dann zielstrebig auf Bruder Balestrano zu. Der Krakenarm erreichte die erstarrte Gestalt des greisen Tempelritters, wickelte sich in einer fast spielerisch erscheinenden Bewegung um seine Schultern – und begann, ihn langsam, aber unbarmherzig auf das pulsierende graue Tor zuzuzerren!
De Laurec schrie auf, warf sich nach vorne und riss verzweifelt an dem grüngrauen Strang. Aber seine Anstrengungen waren vergeblich. So schleimig und nachgiebig der Tentakel aussah, war seine Haut hart wie Stahl und seine Kraft die eines Giganten.
Erneut erscholl dieser peitschende, schreckliche Laut, und ein zweiter Tentakel ringelte sich aus einem der Tore, packte einen weiteren Templer und begann ihn auf den Dimensionsriss zuzuziehen. Und kaum eine Sekunde später griff auch aus dem dritten Tor einer der schrecklichen Krakenarme heraus. Für eine Sekunde glaubte de Laurec ein fürchterliches, unmenschliches Lachen zu hören.
Verzweifelt fuhr der Tempelritter herum. Seine Gedanken überschlugen sich. Balestrano hatte das Tor fast erreicht. Es konnte nur noch Sekunden dauern, bis er in den grauen Wogen verschwand!
De Laurec dachte in diesem Moment nicht mehr, sondern handelte rein instinktiv. Mit einem gellenden Schrei riss er das Zeremonienschwert aus dem Gürtel, schwang die Waffe mit beiden Händen hoch über den Kopf – und ließ die Klinge mit aller Macht auf das Kristallgehirn heruntersausen!
Es war ein Gefühl, als hätte er auf Stahl geschlagen. Der Hieb prellte ihm das Schwert aus der Hand und zuckte als vibrierender Schmerz bis in seine Schultern hinauf; die Klinge flog davon und zerbrach noch in der Luft, und das höhnische Lachen, das de Laurec gerade noch gehört hatte, verwandelte sich urplötzlich in ein panikerfülltes, zorniges Kreischen.
Ein greller Blitz zerriss das gehirnähnliche Kristallgebilde. De Laurec sah noch, wie die peitschenden Krakenarme verblassten und sich die Tore wie zuckende Wunden schlossen, dann traf ihn ein Splitter des Kristallhirns an der Schläfe, und er verlor das Bewusstsein.
Vor dem Fenster des Eisenbahnabteils zog die Landschaft vorbei, grau und schaukelnd und halb verborgen hinter niedrig hängenden Regenwolken, aus denen es schon seit dem frühen Morgen wie aus Eimern goss. Obwohl das Erste-Klasse-Abteil geheizt war, glaubte ich die Kälte zu fühlen, die wie ein klammer Hauch über dem Land lag und dem Sommer, der dem Kalender nach schon vor über einem Monat Einzug gehalten hatte, eine lange Nase drehte.
Seit meiner Abreise aus Amsterdam war das Wetter beständig schlechter geworden. Es regnete ununterbrochen, und die Temperaturen schienen mit jeder Meile, der ich mich Paris näherte, zu sinken. Es hätte mich nicht einmal mehr verwundert, die Seinestadt unter Eis und Schnee vorzufinden.
Missmutig wandte ich mich vom Fenster ab, blickte einen Moment auf die zerlesene englische Zeitung mit dem Datum vom 23. Juli 1885, die auf dem freien Platz neben mir lag, und ließ mich zurücksinken. Ich hatte sie vor meiner Abreise in Amsterdam erstanden und kannte sie auswendig. Ich hatte mich dazu entschlossen, mit der Bahn nach Paris zu reisen, wo ich Howard zu treffen hoffte. Es gab bequemere Arten des Reisens, auch komfortablere – aber kaum eine schnellere. Und im Moment war Zeit das, was ich am allerwenigsten hatte. Es war nicht mehr weit bis Paris – nicht einmal mehr achtzig Minuten, hatte der Schaffner gesagt –, aber nach zwanzig Stunden, die ich nahezu ununterbrochen unterwegs gewesen war, erschien mir selbst diese kurze Spanne wie eine Ewigkeit.
Paris … Ich wiederholte den Namen ein paar Mal in Gedanken und versuchte vergeblich, ihm etwas von dem geheimnisvollen Flair abzugewinnen, das man der Stadt an den Ufern der Seine nachsagte. Für mich hatte dieser Name eher einen düsteren Klang. Bestenfalls würde ich Howard dort wiederfinden und gleich ein halbes Dutzend Wunder bewirken müssen, um ihn vor einer Riesendummheit zu bewahren, und schlimmstenfalls …
Ich verscheuchte den Gedanken, schloss die Augen und versuchte zu schlafen, was natürlich misslang. Nicht, dass ich nicht müde gewesen wäre; im Gegenteil. Aber wer einmal mit der französischen Eisenbahn gefahren ist, weiß, wovon ich spreche. Die Eisenbahngesellschaft wirbt auf ihren Plakaten mit der Bequemlichkeit und Schnelligkeit ihrer Züge. Was das Tempo angeht, hat sie sicherlich recht. Aber die Bequemlichkeit? Der Marquis de Sade hätte seine helle Freude an diesem Beförderungsmittel gehabt.
Der Zug wurde langsamer. Ein schriller, misstönender Pfiff ertönte von der Lokomotive her, dann griffen die Bremsen mit einem Geräusch, als kratze eine Gabel über den Kochtopfboden. Der Zug verlangsamte weiter und hielt mit einem letzten, magenumstülpenden Ruck vor einem einstöckigen Bahnhofsgebäude.
Neugierig beugte ich mich vor und spähte aus dem Fenster. Das schlechte Wetter schien den Leuten hier auch die Lust am Bahnfahren vergällt zu haben, denn der Bahnsteig war nahezu leer; nur ein ältliches Ehepaar und ein schlanker, mittelgroßer Mann unbestimmbaren Alters standen frierend neben den Gleisen. Das Ehepaar verschwand irgendwo im hinteren Teil des Zuges, wo die Wagen der zweiten und dritten Klasse waren, während der Mann einen Moment lang unschlüssig stehen blieb, sich plötzlich mit einem Ruck umwandte und zielstrebig auf mein Abteil zusteuerte. Ein Schwall eisiger Luft und Feuchtigkeit drang herein, als er die Tür öffnete.
Ich nickte ihm zu, wie es die Höflichkeit verlangt, wenn man einen Fremden während einer Bahnfahrt trifft, und wollte ebenso höflich den Blick wieder abwenden – aber dann fiel mir irgendetwas an ihm auf. Ich konnte nicht sagen, was es war, aber irgendetwas an ihm war sonderbar. Ich vermochte den Gedanken nicht gleich zu fassen, aber irgendwo hinter meiner Stirn begann eine schrille Alarmglocke anzuschlagen, als der Mann mit seltsam eckigen Bewegungen in das Abteil kletterte und die Tür hinter sich schloss.
Dann wusste ich, was es war.
Er war zu schwer. Die Bodenbretter ächzten unter seinem Gewicht, als hätte er Blei gefrühstückt, und die Wucht, mit der er die Zugtür schloss, ließ das Glas klirren, obwohl die Bewegung eher langsam war. Instinktiv richtete ich mich ein wenig im Sitz auf und musterte ihn genauer.
Der Mann drehte sich herum, erwiderte meinen Blick für die Dauer eines Atemzugs mit steinernem Gesicht und ließ sich in den Sitz genau mir gegenüber fallen. Die Bank zitterte wie unter einem Hammerschlag. Ich glaubte die Sprungfedern in den Polstern unter seinem Gewicht ächzen zu hören. Er musste der schwerste Mann sein, dem ich jemals begegnet war. Dabei war er nicht einmal so groß wie ich und sogar noch eine Spur schlanker.
Plötzlich wurde ich mir der Tatsache bewusst, dass ich den Fremden noch immer unverwandt anstarrte, lächelte entschuldigend und wandte hastig den Blick ab. Mein Gegenüber war nicht ganz so höflich – er starrte mich weiter mit unbewegtem Gesicht an, und obwohl ich mich fast krampfhaft bemühte, nicht in seine Richtung zu sehen, spürte ich seinen Blick mit fast unangenehmer Deutlichkeit.
Von draußen ertönte wieder der schrille Pfiff der Lokomotive. Ein erster, noch sanfter Ruck ging durch den Zug, dann fassten die Räder.
Als ich wieder aufblickte, starrte mich der Fremde noch immer an. Diesmal hielt ich seinem Blick stand; wenn auch nicht sehr lange. Der Blick seiner grauen, blitzenden Augen war … unangenehm. Sie sahen gar nicht aus wie lebende Augen, sondern wirkten vielmehr wie bunt bemalte Glaskugeln, und die Härte, die ich darin las, ließ mich schaudern.
Schließlich senkte ich ein zweites Mal den Blick, griff nach der Zeitung neben mir und tat so, als lese ich. Aber ich spürte seinen Blick weiter.
Schließlich wurde es mir zu bunt. Mit einer Geste, die selbst dem dümmsten Trottel klargemacht hätte, dass meine Geduld am Ende war, senkte ich die Zeitung und blickte mein Gegenüber feindselig an. »Excusez-moi, Monsieur«, begann ich, wurde aber sofort von dem Fremden unterbrochen.
»Sie können ruhig Englisch sprechen, Mister«, sagte er und entblößte dabei ein wölfisches Gebiss, das wie poliertes Silber blitzte. »Das erleichtert die Sache. Ich spreche Ihre Sprache.«
Ich nickte überrascht. Meine Französischkenntnisse waren mit den beiden Worten, die ich gesagt hatte, in der Tat so gut wie erschöpft, aber der hochmütige Ton, in dem der Bursche sprach, brachte irgendetwas in mir zum Kochen. Er war nicht einmal aggressiv – aber er sprach mit einer Kälte, als wäre sein Stimmapparat aus dem gleichen Stahl, aus dem sein unappetitliches Gebiss bestand. Trotzdem schluckte ich die scharfe Entgegnung, die mir auf den Lippen lag, noch einmal herunter, bedachte die Silberzähne meines Gegenübers mit einem bewusst angewiderten Blick und fragte: »Woher wissen Sie, dass ich Engländer bin?«
»Sie lesen eine englische Zeitung«, antwortete er.
»Scharf beobachtet.«
»Nicht besonders«, sagte der Fremde. »Es fällt auf, wenn jemand in Frankreich eine englische Zeitung liest. Ich bin nicht dumm.«
Diesmal kostete es mich wirklich meine ganze Selbstbeherrschung, ihm nicht die Antwort zu geben, die er verdiente.
Wütend faltete ich die Zeitung ganz auseinander, lehnte mich in die Polster zurück und hielt das Blatt vor das Gesicht, um wenigstens seinem unangenehmen Blick entzogen zu sein.
Aber mein eisenzähniger Mitreisender gab nicht so leicht auf. Zwei, vielleicht drei Minuten lang spürte ich seine bohrenden Blicke durch das Papier der Zeitung hindurch, dann räusperte er sich so lautstark, dass ich unwillkürlich die Zeitung sinken ließ und ihn ansah.
»Bis Paris kommt jetzt keine Haltestelle mehr«, sagte er.
»Und?«
»Nichts und.« Er zuckte mit den Achseln und grinste.
Dabei sah ich, dass seine Zähne wirklich aus Eisen waren. Nun ja, das war sein Problem. Paris war schließlich nicht nur eine Stadt der High-Society, sondern auch der Sonderlinge, um nicht zu sagen Spinner. Und vermutlich kam ich ihm mit meiner weißen Strähne im Haar genauso verrückt vor wie er mir. Ich seufzte und verkroch mich wieder hinter meiner Zeitung.
»Es ist praktisch, dass wir nicht mehr halten«, sagte Eisenzahn kalt. Eigentlich sprach er gar nicht wie ein Mensch, sondern zählte Tatsachen auf. Kalt, sachlich und ohne die geringste Spur irgendeines Gefühles. »Dann kann mich wenigstens niemand stören.«
»Wobei?«, fragte ich in bewusst gelangweiltem Ton.
Diesmal antwortete er nicht – worüber ich nicht sonderlich böse war –, aber nach ein paar Sekunden hörte ich die Sitzpolster quietschen; dann schien das ganze Abteil zu erbeben, als er aufstand und mit einem schwerfälligen Schritt auf mich zutrat.
Vollends am Ende meiner Geduld angelangt, ließ ich die Zeitung sinken, starrte wütend zu ihm empor – und erstarrte.
Eisenzahn stand breitbeinig vor mir. Seine Hände waren halb erhoben und geöffnet, als wolle er mich packen. Sein Gesicht war noch immer so reglos wie eine Wachsmaske, aber in seinen Augen war plötzlich ein Glanz, der mich schaudern ließ.
»Was soll das?«, fragte ich. »Was haben Sie vor?«
»Was soll ich schon vorhaben, Craven?«, sagte Eisenzahn. »Ich bringe Sie um – was denn sonst?«
Und dann geschah alles gleichzeitig.
Seine Hände zuckten nach meinem Hals. Die Finger waren wie tödliche Krallen gekrümmt. Im gleichen Augenblick stieß sein Knie hoch und versuchte mich zwischen die Oberschenkel zu treffen.
Dem Kniestoß wich ich im letzten Moment durch eine blitzartige Drehung aus; seinen Händen nicht mehr.
Die Krallen verfehlten zwar meine Kehle, aber seine Linke fuhr wie eine stählerne Forke neben mir in das Sitzpolster und zerfetzte es, während sich die Finger seiner Rechten in meine Schulter gruben und zudrückten, dass ich glaubte, meine Knochen knirschen zu hören. Ich schrie auf, warf mich im Sitz zur Seite und schlug ihm gleichzeitig die Faust gegen das Kinn.
Ein Hieb gegen massiven Fels hätte kaum weniger Erfolg gezeigt. Ein greller Schmerz explodierte in meiner Hand und ließ mich erneut aufschreien, während Eisenzahns Gesicht nicht einmal zuckte. Mit einem wütenden Ruck zerrte er mich herum.
Verzweifelt bäumte ich mich auf, warf mich gleichzeitig zur Seite und nach vorne und versuchte seinen Griff zu sprengen. Aber der Bursche war stark wie ein Elefant. Und er schien immun gegen jegliche Art von Schmerz zu sein. Seine Rechte umklammerte noch immer meine Schulter und schien sie zermalmen zu wollen, und die wütenden Hiebe, die ich immer wieder gegen sein Gesicht und seinen Hals abschoss, schien er nicht einmal zu spüren.
Er gab sich nicht einmal die Mühe, meine Schläge abzuwehren. Sein Kinn war voller Blut, aber es war mein Blut, das aus meinen aufgeplatzten Knöcheln quoll, und als ich mich herumwarf und ihm das Knie gegen den Leib schmetterte, zuckte er noch nicht einmal.
Dafür löste er endlich die Linke aus den zerfetzten Polstern, ballte sie zur Faust und schlug mit aller Macht nach meinem Gesicht.
Im letzten Moment drehte ich den Kopf beiseite. Seine Faust streifte meine Schläfe und zerschmetterte die Abteilwand.
Die Berührung ließ meinen Schädel wie eine angeschlagene Glocke dröhnen. Rot flammende Kreise tauchten vor meinen Augen auf und trübten meinen Blick, und für eine schrecklich lange Sekunde drohte ich, das Bewusstsein zu verlieren.
Eisenzahn riss mich wie eine Puppe in die Höhe, schleuderte mich in die Polster zurück und hob die Faust zum letzten, entscheidenden Hieb. Ich wusste, dass ich sterben würde, würden mich seine schrecklichen Fäuste auch nur ein einziges Mal mit aller Kraft treffen.
Ein harter, plötzlicher Ruck ging durch den Boden, als der Zug über eine Weiche hüpfte und sich die Erschütterung über die ungefederten Achsen bis in die Abteile fortpflanzte. Ich spürte es kaum, denn ich lag halb ausgestreckt und hilflos auf der Sitzbank, aber Eisenzahn, der mit leicht gespreizten Beinen über mir stand, wankte wie eine angeschlagene Statue und drohte für einen Moment nach vorne zu kippen.
Ich reagierte, ohne zu denken. Im gleichen Moment, in dem er seinen Sturz abzufangen versuchte, zog ich die Knie an den Körper, raffte das letzte bisschen Kraft, das mir geblieben war, zusammen – und trat ihm mit aller Gewalt zwischen die Beine.
Es war wie vorhin, als ich nach seinem Kinn geschlagen hatte – der Bursche musste Betonplatten unter der Kleidung tragen, denn ich hatte das Gefühl, vor einen Felsen getreten zu haben. Ein grässlicher Schmerz zuckte bis in meinen Rücken hinauf und drohte ein zweites Mal, mir das Bewusstsein zu rauben.
Aber ich sah immerhin, wie Eisenzahn wie ein gefällter Baum nach hinten kippte, in der gleichen grotesken Haltung, in der er über mir gestanden hatte – die Arme ausgestreckt und die Hände halb geöffnet –, auf die gegenüberliegende Sitzbank fiel und das Möbelstück mit seinem ungeheuren Gewicht kurzerhand zerschmetterte.
Als er sich aus den Trümmern der Bank zu befreien versuchte, war ich über ihm. Seine Hand griff nach mir, aber ich wich ihr aus, warf mich mit meinem ganzen Körpergewicht auf ihn und schlug ihm drei, vier, fünf Mal hintereinander die Handkante gegen den Hals. Schon ein einziger dieser Hiebe hätte gereicht, selbst einen Giganten wie Rowlf zu betäuben – aber Eisenzahn schien sie nicht einmal zu spüren!
Dafür schnappte seine Hand nach meiner Kehle. Ich warf mich zurück, fühlte, wie seine Finger an meinem Hals entlangschrammten und dabei einen Teil meiner Haut mitnahmen, warf mich verzweifelt aus der Reichweite seiner schrecklichen Hände und griff blindlings um mich. Meine Finger ertasteten etwas Hartes, Schweres und klammerten sich darum. Es war ein Eisenstück; ein zollstarker, mehr als armlanger Stab, der aus der zerborstenen Bank herausschaute und an einem Ende mit den scharfkantigen Resten abgebrochener Bolzen versehen war.
Blind vor Angst schlug ich zu.
Eisenzahn versuchte den Hieb abzuwehren, aber er war nicht schnell genug. Meine improvisierte Stachelkeule traf seinen Schädel mit vernichtender Wucht, schmetterte ihn abermals zu Boden – und wurde mir durch die schiere Wucht meines eigenen Schlages aus der Hand geprellt.
Und im gleichen Moment zuckte Eisenzahns Hand nach vorne und schloss sich wie eine stählerne Klammer um meinen Unterarm!
Noch einmal bäumte ich mich auf. Aber diesmal versuchte ich nicht mehr, seinen Griff mit Gewalt zu sprengen, sondern warf mich im Gegenteil in die Richtung, in die er mich zu zerren versuchte, drehte mich gleichzeitig um meine eigene Achse und brachte ihn mit einem plötzlichen Ruck in die entgegengesetzte Richtung aus der Balance.
Eisenzahns eigene Kraft wurde ihm zum Verhängnis. Den Zug seiner eigenen übermenschlich starken Muskeln ausnutzend, hebelte ich ihn über meinen Rücken hinweg, half der Entwicklung noch durch einen kräftigen Stoß nach – und schleuderte ihn quer durch das Abteil gegen die Außenwand!
Die Tür schien wie von einer Kanonenkugel getroffen und zerschmettert zu werden. Eisenzahns Gewicht zermalmte das massive Blech wie Papier, ließ die Fensterscheibe in einem Hagel von Glassplittern explodieren und beulte die halbe Abteilwand ein. Er griff mit hilflos rudernden Armen um sich, klammerte sich am Türrahmen fest – und verlor abermals das Gleichgewicht, als seine Finger das Eisenblech wie Pergament zerfetzten.
Sein Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse, aber über seine Lippen kam nicht der geringste Laut, als er in einer grotesken Bewegung weiter nach hinten kippte und aus dem fahrenden Zug fiel.
Dunkelheit und die Geräusche zahlreicher Menschen waren um ihn herum, als sich seine Sinne klärten. Eine Hand machte sich an seiner Schläfe zu schaffen und linderte geschickt den quälenden Schmerz, der dort tobte, und eine Stimme redete auf ihn ein. Er verstand die Worte nicht, aber sie beruhigten ihn irgendwie. Nach einer Weile hörte auch der irre Veitstanz auf, den seine Gedanken aufführten, und Sarim de Laurec tastete sich langsam in die Wirklichkeit zurück.
Das Erste, was er sah, als er die Augen aufschlug, war das faltenzerfurchte Gesicht Jean Balestranos. Seine Lippen waren zu einem Lächeln verzogen, aber de Laurec sah trotzdem den Ausdruck von Sorge, der in den Augen des alten Mannes geschrieben stand.
»Was … ist geschehen?«, fragte de Laurec mühsam. Er wollte die Hand heben, um nach der Schläfe zu tasten, aber Balestrano drückte seinen Arm mit sanfter Gewalt herunter.
»Es ist alles in Ordnung, Bruder«, sagte er. »Du hast uns alle gerettet.«
»Ich?« De Laurec versuchte zu lächeln, aber es misslang, Schmerz und Schock ließen nur eine Grimasse daraus werden. Verwirrt stemmte er sich auf die Ellbogen hoch, fuhr plötzlich zusammen und drehte mit einem erschrockenen Laut den Kopf, um zum Altarstein und dem Kristallgehirn hinüberzublicken.
Der schwarze Steintisch stand unberührt da, aber das Kristallgehirn war zur Seite gefallen und halb von der Platte heruntergerutscht. De Laurec sah deutlich die Stelle, an der sein Schwert eine Scharte in den diamantharten Kristall geschlagen hatte. »Was ist passiert?«, murmelte er. »Ich … erinnere mich kaum.«
Balestrano lächelte. »Das ist normal«, sagte er. »Ich fürchte, du hast eine schwere Gehirnerschütterung, Bruder Laurec.« Er schwieg einen Moment, und als er weitersprach, waren seine Augen dunkel vor Sorge. »Es ist meine Schuld«, sagte er. »Ich hätte diesen Versuch niemals zulassen dürfen.«
De Laurec hörte seine Worte kaum. Es fiel ihm schwer, sich auf den alten Mann zu konzentrieren. Seine Gedanken begannen sich zu verwirren, und für einen ganz kurzen Moment fragte er sich vollen Ernstes, wer er überhaupt war und wie er hierherkam.
Verwirrt hob er die Hand an den Kopf und tastete mit den Fingerspitzen über die Schläfe. Warum hatte er plötzlich das Gefühl, eine lautlose Stimme in seinem Schädel flüstern zu hören?
»… unterschätzt«, sagte Balestrano. De Laurec fuhr zusammen und sah den Großmeister schuldbewusst an. Er begriff erst jetzt, dass Balestrano die ganze Zeit mit ihm gesprochen hatte. Er hatte die Worte nicht einmal gehört!
»Deine Befürchtungen waren nur zu berechtigt«, fuhr Balestrano fort. »Dieses Ding« – er verzog angewidert das Gesicht und deutete auf das beschädigte Kristallgehirn – »ist Teufelswerk. Wir hätten es niemals berühren dürfen!«
De Laurec schwieg. Was hätte er auch sagen sollen? Sie waren zusammengekommen, um das Kristallgehirn, das seinem Besitzer Gewalt über die magischen Tore der GROSSEN ALTEN gab, unter ihre Kontrolle zu bringen. Aber das Geschehen bewies, dass sich das magische Artefakt sehr wohl zu schützen vermochte, selbst gegen eine Loge der Tempelritter.
»Um ein Haar wären wir alle gestorben«, fuhr Balestrano fort, »hättest du es nicht zerschlagen.«
De Laurec blickte unsicher an Balestrano vorbei auf das schimmernde Kristallgebilde. »Ist es … zerstört?«, fragte er.
Balestrano schwieg einen Moment, dann zuckte er mit den Achseln. »Ich weiß es nicht«, gestand er. »Zumindest ist es im Augenblick ungefährlich. Und ich werde dafür sorgen, dass es so bleibt.« Er schürzte entschlossen die Lippen. »Wir haben an Kräften gerührt, die nicht für Menschen sind«, sagte er bestimmt. »Um ein Haar hätten wir den Preis dafür gezahlt.«
»Was wollt ihr tun?«, fragte de Laurec. »Es … vernichten?« Warum erschrak er so sehr bei diesem Gedanken? Bei der Vorstellung, das kristallene Gebilde zu zerstören, verspürte er eine beinahe körperliche Angst.
Balestrano schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, »denn dazu ist es zu wertvoll. Ich bezweifle auch, dass wir es könnten. Aber ich werde es an einen sicheren Ort bringen und dafür sorgen, dass niemand seine Kräfte weckt, ehe wir nicht genau wissen, womit wir es zu tun haben.« Er stand auf, wartete, bis auch de Laurec sich erhoben hatte, und deutete mit einer befehlenden Geste zur Tür.
»Geht«, sagte er. »Geht alle hinaus. Lasst mich allein. Was zu tun ist, muss ich allein tun.«
De Laurec starrte den weißhaarigen Tempelritter sekundenlang an. Seine Verwirrung wuchs mit jeder Sekunde. Er hatte plötzlich eine absurde Angst davor, dass Balestrano trotz seiner gegenteiligen Worte das Gehirn zerstören würde, und sei es nur aus Angst vor dessen Macht.
Aber er sprach nichts davon aus, sondern drehte sich schließlich ebenso wie die anderen um und wollte den Kellerraum verlassen. Doch diesmal war es Balestrano selbst, der ihn zurückhielt.
»Noch einen Moment, Bruder Laurec«, sagte er. De Laurec blieb gehorsam unter der Tür stehen und wandte sich noch einmal um. Balestrano war dicht an den Tisch mit dem kristallenen Gehirn herangetreten, und auf seinem Gesicht lag ein angespannter, konzentrierter Ausdruck. »Fühlst du dich wieder kräftig genug, einen Moment mit mir zu reden?«, fragte er.
De Laurec nickte. »Natürlich.«
»Dann warte draußen auf mich«, sagte Balestrano. »Wir müssen noch bereden, was mit Bruder Howard geschieht. Du weißt, dass er in Paris ist?«
De Laurec nickte. »Seit geraumer Zeit. Und dieser Narr Craven ist ebenfalls auf dem Weg hierher.«
Balestrano machte eine unwillige Geste. »Craven interessiert uns nicht«, sagte er. »Er ist nicht unser Feind, Laurec.«
»Er ist –«, begann de Laurec, aber Balestrano fiel ihm sofort ins Wort:
»Er hat uns einen großen Dienst erwiesen, vergiss das nicht.«
»Ohne es zu wollen!«, entgegnete de Laurec ärgerlich. Den Zorn, den er bei diesen Worten empfand, verstand er selbst nicht ganz. Er wusste sehr wohl, dass Robert Craven schlimmstenfalls unbedeutend und bestenfalls ein potenzieller Verbündeter in ihrem unablässigen Kampf mit dem Antichristen war. Warum empfand er eine solche Wut, wenn er nur an diesen Namen dachte?
»Muss ich dich erinnern, was Bruder DeVries geschehen ist?«, sagte Balestrano streng. »Er hat gegen meinen Willen versucht, Craven zu töten.«
Und dafür mit dem Leben bezahlt, fügte de Laurec zornig in Gedanken hinzu. Aber er senkte gehorsam den Blick. »Craven wird nichts geschehen, Bruder«, sagte er demütig. Dann wandte er sich um und verließ den Raum, um draußen zu warten.
Der Schmerz in seiner Schläfe wurde stärker.
Mit einem einzigen Satz war ich bei der Tür. Der Zug schaukelte und hüpfte wie ein bockendes Muli unter meinen Füßen, sodass ich um ein Haar das Gleichgewicht verloren und hinter Eisenzahn hergefallen wäre. Der Fahrtwind trieb mir die Tränen in die Augen, als ich mich an der verbeulten Kabinenwand festklammerte und hinausbeugte.
Im ersten Moment sah ich nichts als die Schatten der vorüberhuschenden Landschaft, dann drehte ich das Gesicht aus dem Wind, blickte zum Heck des Zuges zurück – und sah, wie sich eine Gestalt unmittelbar neben den Bahngleisen in die Höhe stemmte und mit einem unglaublich kraftvollen Satz direkt auf den fahrenden Zug sprang!
Hätte es nach allem noch eines endgültigen Beweises bedurft, dass mein unheimlicher Gegner alles andere als ein normaler Mensch war, dann wäre es dieses Bild gewesen.
Eisenzahn versuchte nicht, sich auf eine der Plattformen zu schwingen, die die Wagen der ersten und zweiten Klasse abschlossen, sondern ging die Sache entschieden direkter an. Wie ein lebendes Geschoss krachte er gegen den Zug. Seine Hand zerschmetterte das Blech einer Abteiltür und fand irgendwo drinnen Halt, während er selbst das Gleichgewicht verlor, mit den Füßen auf den Schotter neben den Geleisen geriet und ein gutes Stück mitgeschleift wurde, ehe er auch mit der anderen Hand sicheren Halt fand und sich in die Höhe ziehen konnte. Wie eine Spinne kletterte er an der Außenwand des Zuges entlang, wobei sich seine Finger und Zehen in das lackierte Stahlblech gruben und kleine runde Löcher darin hinterließen.
Der Anblick war so unglaublich, dass ich für einen Moment sogar die Gefahr vergaß, in der ich mich befand.
Der Unheimliche war zu weit entfernt, als dass ich Einzelheiten erkennen konnte – aber, zum Teufel, er war bei einer Geschwindigkeit von beinahe fünfzig Meilen aus einem fahrenden Zug gestürzt und musste sich alle Knochen dabei gebrochen haben! Und trotzdem kroch er langsam, aber stur wie eine Maschine, über die Außenseite des Zuges weiter auf mich zu!
Erst als Eisenzahn schon fast die Hälfte des Zuges überwunden hatte und den Kopf hob, um sich zu orientieren, wurde ich mir der Tatsache wieder bewusst, dass er dieses Kunststück nicht aus reinem Sportsgeist aufführte, sondern zurückkam, um zu Ende zu bringen, was er begonnen hatte, ehe ich ihn aus dem Zug warf – nämlich mich umzubringen!
Erschrocken prallte ich von der Tür zurück und sah mich hastig nach einer Waffe oder einem Fluchtweg um.
Das Abteil bot einen Anblick, als wäre eine Granate darin explodiert, aber es gab nichts, was sich auch nur annähernd als Waffe angeboten hätte. Wie unempfindlich der Fremde gegen Hiebe mit Eisenstangen oder ähnlichen Spielzeugen war, hatte er ja bereits bewiesen.
Und es gab auch keinen Fluchtweg. In Gedanken verfluchte ich mich dafür, eines jener Erste-Klasse-Abteile gewählt zu haben, die nur von außen zu betreten waren. Ich hatte mir auf diese Weise eine ungestörte Fahrt sichern wollen, aber es konnte gut sein, dass ich mir eine Karte zu meinem eigenen Grab gelöst hatte …
Hastig trat ich zu dem Trümmerhaufen, der von meiner Sitzbank übrig geblieben war, zog den Stockdegen aus meinem Reisekoffer und verstaute ihn sicher unter meinem Gürtel.
Einen Moment lang blieb mein Blick auf dem roten Bügel der Notbremse haften, aber ich verwarf den Gedanken, sie zu ziehen, schnell wieder. Nein, es gab nur einen Weg. Auch wenn mir allein bei dem Gedanken daran schon der kalte Angstschweiß ausbrach.
Eisenzahn war bis auf eine gute Wagenlänge herangekommen, als ich abermals an die Tür trat und mich – vorsichtig mit beiden Händen an dem zerfetzten Rahmen Halt suchend – hinausbeugte. Seine Augen waren starr geöffnet, trotz des rasenden Fahrtwindes, und ich sah jetzt, als er näher gekommen war, dass sein Gesicht ein bisschen eingedrückt zu sein schien.
Der Anblick ließ mich auch meine letzten Hemmungen vergessen. Vorsichtig beugte ich mich weiter hinaus, griff mit beiden Händen nach oben, bis meine Finger irgendwo an dem verbeulten Blech Halt fanden, löste den linken Fuß vom Boden und schwang mich mit einer kraftvollen Bewegung aus dem Zug.
Eine endlose, grauenerfüllte Sekunde lang schwebte ich über dem Nichts. Der Fahrtwind schlug mir wie eine unsichtbare Faust entgegen und nahm mir den Atem, und der Zug sprang und zitterte unter mir wie ein bockendes Pferd, das mit aller Kraft versucht, einen Reiter abzuschütteln.
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Eisenzahn seine Anstrengungen verdoppelte und schnell näher kam. Seltsamerweise kam er immer noch nicht auf den Gedanken, das Nächstliegende zu tun und auf das Zugdach hinaufzuklettern, um mich dort in aller Ruhe zu erwarten, sondern krabbelte weiter wie eine Spinne an der Außenseite des Waggons entlang.
Der Anblick gab mir zusätzliche Kraft. Meine Füße fanden irgendwo Halt, ich ließ mit der linken Hand los, tastete blind nach oben und fühlte die Krümmung des Daches, dann etwas Kleines, Spitzes, das stabil genug schien, mein Körpergewicht zu tragen, und zog mich mit einem verzweifelten Ruck nach oben.
Zwei, drei Sekunden blieb ich reglos liegen, rang nach Atem und wartete darauf, dass meine Hände und Knie zu zittern aufhörten. Dann stemmte ich mich vorsichtig hoch, kroch bis in die Mitte des Daches und sah zurück.
Über der Kante des Zugdaches erschien eine Krallenhand, grub sich mit einem schmetternden Knall in und durch das Blech und fand an einem Träger darunter festen Halt. Sekunden später erschien ein dunkler Haarschopf über dem Dach, und kalte, polierte Glasaugen starrten mich an.
Ich schluckte einen Fluch herunter, sprang auf die Füße und wirbelte herum. Der Wagen, auf dessen Dach ich mich befand, war der letzte gleich hinter der Lokomotive, sodass mir keine andere Wahl blieb, als an Eisenzahn vorbei wieder in Richtung Zugende zu rennen, wobei seine Hand um ein Haar mein Bein erwischt hätte und ich mich nur durch einen riskanten Hüpfer in Sicherheit bringen konnte.
Eine höchst zweifelhafte Sicherheit allerdings, wie sich bald herausstellte. Ich hatte kaum ein Dutzend Schritte zurückgelegt, da hatte ich auch schon das Ende des Wagens erreicht – und das Dach des dahinter liegenden war gute zwei Yards entfernt und sprang und hoppelte wie ein wild gewordener Maulesel auf und ab!
Zwei Yards sind vielleicht kein besonders wagemutiger Sprung für einen durchtrainierten Mann wie mich, unter normalen Umständen. Aber ein Fehltritt würde einen Sturz unter die Räder des Zuges bedeuten, bestenfalls auf den Schotter des mit mehr als fünfzig Meilen vorbeirasenden Bahndammes – und wahrscheinlich wäre das eine so tödlich wie das andere.
Hinter mir erscholl ein splitterndes Geräusch, und als ich zurückblickte, sah ich, wie sich Eisenzahn umständlich auf die Beine erhob und mit ausgebreiteten Armen auf mich zugetapst kam. Seine Füße hinterließen tiefe Dellen im Blech des Daches.
Ich vergaß meine Furcht, spannte die Muskeln – und stieß mich ab.
Es war leichter, als ich befürchtet hatte. Der Wagen schien mir noch entgegenzuspringen. Ich kam ungeschickt auf, fiel auf die Knie, fing den Sturz mit beiden Händen auf und stieß mich wie ein Hundert-Meter-Läufer am Start ab. Verzweifelt rannte ich los, während Eisenzahn mir auf die gleiche Weise folgte; zwar wenig elegant, dafür aber erheblich lauter.
Es war aussichtslos. Ich rannte, so schnell es der schwankende Untergrund zuließ, sprang von Wagendach zu Wagendach und vergrößerte die Entfernung zwischen mir und meinem unheimlichen Verfolger allmählich.
Schließlich hatte ich das Ende des Zuges beinahe erreicht und blieb unsicher stehen. Vor mir lag ein letzter Wagen und dann nichts mehr. Es sah aus, als wäre meine Flucht zu Ende, ehe sie richtig begonnen hatte. Verzweifelt drehte ich mich herum, tastete nach dem Stockdegen unter meinem Gürtel und blickte meinem Gegner mit einer Mischung aus Entsetzen und trotzigem Zorn entgegen. Ich wusste weder, wer der Bursche war, noch, was er von mir wollte, aber ich würde mein Leben so teuer wie möglich verkaufen.
Dann sah ich den Schatten am vorderen Ende des Zuges; noch weit vor der Lokomotive. Ein verzweifelter Plan begann hinter meiner Stirn Gestalt anzunehmen. Hätte ich Zeit gehabt, ihn in allen Einzelheiten zu durchdenken, hätte ich es vermutlich zehn Mal lieber auf einen Kampf mit dem Unheimlichen ankommen lassen, aber gottlob blieb mir keine Zeit.
So wandte ich mich noch einmal um, sprang auf den letzten Wagen und wirbelte abermals herum, kaum dass ich sicheren Stand gefunden hatte. Der Stockdegen glitt wie von selbst aus seiner Umhüllung und funkelte wie ein gefangener Blitz in meiner Hand. Der Schatten erreichte die Lokomotive und jagte über sie hinweg. Noch zwei Sekunden, schätzte ich. Allerhöchstens.
Eisenzahn blieb stehen, kaum einen Schritt vom Ende des Wagendaches entfernt. Seine kalten Glasaugen musterten die Waffe in meiner Hand, und für einen Moment zögerte er, als schätze er ihre Gefährlichkeit ab. Dann machte er eine wegwerfende Handbewegung, spannte sich – und sprang.
Ich ließ mich zur Seite fallen, schloss die Augen – und stürzte mit angehaltenem Atem vom Wagendach herunter. Was dann geschah, ging so unglaublich schnell, dass ich selbst hinterher nicht sicher war, es wirklich gesehen oder mir nur eingebildet zu haben.
Der Boden raste auf mich zu. Eisenzahn landete wie ein lebender Amboss auf dem Dach und beulte es ein, fand mit wild wedelnden Armen sein Gleichgewicht wieder. Sein Stahlgebiss blitzte.
Aber nur für eine halbe Sekunde.
Hinter ihm jagte der Schatten heran. Die Lokomotive stieß einen schrillen Pfiff aus, dann fiel der Schatten der Brücke direkt über unseren Wagen. Eisenzahn versuchte noch zu reagieren, wirbelte mit übermenschlicher Schnelligkeit herum und duckte sich gleichzeitig, aber obwohl er sich mindestens doppelt so schnell bewegte wie ein normaler Mensch, hatte er die Drehung nicht einmal halb beendet, als der Zug unter der Brücke hindurchdonnerte.
Es war eine sehr niedrige Brücke.
So niedrig, wie ich gehofft hatte …
»Pardon, Monsieur – wie war doch gleich Ihr Name?« Der livrierte Lakai, der nach dem dritten Klopfen unter der Tür des Hauses in der Rue des Gascogne No. 17 erschienen war und den beiden sonderbaren Besuchern den Einlass verwehrte, legte demonstrativ seine Stirn in Falten. »Oh-ahr?«
»Howard«, sagte der Ältere der beiden, ein hagerer, eher konservativ gekleideter Gentleman mit scharf geschnittenen Zügen, der einen erbärmlich stinkenden Zigarillo rauchte und mit der anderen Hand mit einem Stockschirm spielte. »Howard Phillips Lovecraft, um genau zu sein. Aber Howard dürfte genügen. Wenn Sie mich jetzt bitte Monsieur Benoit melden würden?«
Der Lakai hob in einer abwehrenden Geste die Hände. »Ich fürchte, Sie unterliegen einem bedauernswerten Irrtum, Monsieur«, sagte er und warf Howards Begleiter, einem bulligen, vierschrötigen Kerl mit der Gestalt eines Preisboxers samt der dazu passenden breitgeschlagenen Nase, einen fast ängstlichen Blick zu.
»Hier wohnt kein Monsieur Benoit«, fuhr er hastig fort. »Dies ist das Stadthaus von Monsieur Guy de Mortignac. Von einem Monsieur – äh … Benoit habe ich noch nie gehört. Vielleicht war er der Vorbesitzer des Hauses.«
»Un seit wann wohnta hier, dieser Monsö Moritkack?«, erkundigte sich Howards Begleiter in einem Französisch, das noch zerschlagener wirkte als sein Gesicht. »Vielleicht holnsen ma her. Kann ja sein, dasser was übba Bennoa weiß.«
Der Lakai erbleichte, schien aber nach einem weiteren Blick auf Rowlfs schaufelgroße Hände zu der Ansicht zu kommen, dass es besser wäre, die Beleidigung zu überhören. »Ich fürchte, auch das wird nicht möglich sein, Monsieur«, erwiderte er steif. »Die Herrschaften sind auf ihr Landgut gefahren, und ich weiß nicht, wann sie wiederkommen«, fügte er hastig hinzu.
Rowlf setzte zu einer wütenden Entgegnung an, aber Howard legte ihm rasch und beruhigend die Hand auf den Unterarm. »Lass gut sein, Rowlf«, sagte er und fügte an den Lakai gewandt hinzu: »Bitte entschuldigen Sie die Störung. Vielleicht habe ich mich wirklich in der Hausnummer getäuscht. Es ist lange her, dass ich in Paris war. Au revoir.«
»Au revoir, Monsieur.« Verwirrt blickte der Lakai den beiden Männern nach, die auf dem Absatz kehrtmachten und auf die um diese Tageszeit beinahe leere Rue de Gascogne hinaustraten. Von hinten boten ihre so ungleichen Gestalten – der eine ein Kleiderschrank von einem Mann, der andere eine wahre Bohnenstange – einen fast komischen Anblick. Der Lakai begann sich zu fragen, warum er sich jemals vor diesen beiden gefürchtet hatte. Aber als er mit einem Kopfschütteln die schwere, reich verzierte Eichentür wieder schloss, überlief ihn ein merkwürdiger Schauer, der auch nicht vergehen wollte, nachdem er sich ausgiebig an dem Likörkabinett seiner Herrschaften bedient hatte.
Die beiden Männer, das spürte er, waren der Verzweiflung nahe gewesen. Und Verzweifelte taten oft Dinge, die irrational und gefährlich waren.
»Die wievielte Adresse war das?«
Rowlfs grollende Stimme riss Howard Lovecraft aus seinen düsteren Gedanken. Sie waren von der Rue de Gascogne abgebogen und promenierten nun die belebtere Rue de Rivoli entlang. Junge, vorwiegend weiß gekleidete Damen an den Armen ihrer Kavaliere, Kinder in blauen Matrosenanzügen und zart rosa gerüschten Kleidchen, die vornehm herausgeputzt zwischen ihren Eltern von Auslage zu Auslage der teuren Geschäfte stolzierten, zwei- und vierspännig gezogene Kutschen – es war ein Treiben, das das Herz eines jeden Flaneurs höher schlagen lassen musste. Nur Rowlf und er schienen nicht so recht hierher zu passen. Sie waren zu düster für dieses heitere Treiben, zwei schwarze Farbtupfer in diesem hellen Gemisch aus Licht, Luft und den schwerelosen Farben des Sommers.
Aber schließlich war Howard nicht nach Paris gekommen, um den Sommer in dieser ungekrönten Hauptstadt der zivilisierten Welt zu genießen. Er war gekommen, weil er sich einem Gericht stellen wollte, dessen Schergen ihn von Kontinent zu Kontinent verfolgt und zu töten versucht hatten. Aber jetzt, da er an den Ort seiner Aburteilung zurückgekehrt war, wollten sie offensichtlich nichts mehr von ihm wissen.
Seufzend zündete er sich einen neuen Zigarillo an dem alten, fast bis zu den nikotin- und teerverfärbten Fingern heruntergebrannten Stummel an. Er inhalierte tief, bis sein Kopf von einer bläulichen, übel riechenden Wolke eingehüllt war. »Ich verstehe das einfach nicht mehr, Rowlf«, sagte er. »Seit einer Woche klappern wir jetzt alle alten Kontaktadressen ab, und überall scheint plötzlich eine Mauer zu sein. ›Nie gehört, den Namen.‹ ›Nein, der ist unbekannt verzogen.‹ ›Monsieur Lasalle? Nein, den gibt es hier nicht, und ich wohne seit zehn Jahren hier.‹ – Es ist zum Verrücktwerden!«
»Stimmt«, pflichtete Rowlf seinem Herrn und Meister bei. Wie immer, wenn sie allein waren, hatte er sein Pidgin-Englisch vergessen und sprach ohne Akzent, und auch der dümmliche Ausdruck war von seinen Zügen verschwunden. »Aber wie ich dich kenne, gibst du nicht auf, wie?«
Lovecraft lachte rau, was ihm die verwunderten Blicke einiger Passanten einbrachte. »Nein, Rowlf«, antwortete er. »Natürlich werde ich nicht aufgeben. Aber vielleicht bleibt mir bald nichts anderes mehr übrig. Die Adressenliste wird allmählich kürzer. Offen gestanden weiß ich nur noch eine einzige Möglichkeit, doch noch Kontakt mit meinen ehemaligen Brüdern« – er spie das Wort beinahe aus – »aufzunehmen.«
»Und die wäre?«, fragte Rowlf. Sein Blick spiegelte eine sanfte Sorge. Er hatte bisher kein Geheimnis daraus gemacht, wie wenig er mit dem einverstanden war, was Howard tat.
»Gaspard«, antwortete Howard. »Immer vorausgesetzt, dass er nicht ebenso verschwunden ist wie alle anderen, wäre es mir sehr … unangenehm, zu ihm gehen zu müssen. Aber es scheint, als gäbe es keine andere Möglichkeit mehr.« Er seufzte enttäuscht.
»Warum reisen wir nicht zurück nach London?«, schlug Rowlf vor. »So, wie es aussieht, scheinen sie kein Interesse mehr an dir zu haben.«
Howard nickte böse. »Du drückst es schon ganz richtig aus, Rowlf – so, wie es aussieht.« Er schüttelte heftig den Kopf, trat an den Straßenrand und hielt nach einer Kutsche Ausschau. »Hast du vergessen, was in London passiert ist?«, fragte er. »DeVries kam nicht aus freien Stücken. Ich kann es nicht riskieren, dass noch mehr Unschuldige meinetwegen in Gefahr geraten.« Er erspähte eine freie Mietkutsche, hob die Hand und wartete schweigend, bis der Wagen vor ihnen angehalten hatte und der Kutscher vom Bock sprang, um den Schlag aufzureißen. Rasch sagte er ihm eine Adresse, die Rowlf nicht genau verstand, wartete, bis sein hünenhafter Begleiter in den Wagen gestiegen war und kletterte schnaubend hinterher.
»Wohin fahren wir?«, fragte Rowlf, als sich die Kutsche schaukelnd in Bewegung setzte. »Ins Hotel?«
Howard schüttelte den Kopf. »Zu Gaspard«, sagte er nach kurzem Zögern. »Oder zumindest dorthin, wo er gewohnt hat, als ich das letzte Mal hier in Paris war.«
»Du hast den Namen nie erwähnt«, bemerkte Rowlf. »Was ist das für ein Mann? Ein … Freund von dir?«
Ein sonderbarer Ausdruck von Trauer huschte über Lovecrafts hagere Züge. »Freund?«, wiederholte er. Dann lächelte er, aber auch dieses Lächeln wirkte traurig. »Ja, wir … waren einmal Freunde«, antwortete er, aber er sprach in einem Ton, als rede er mit sich selbst. »Gute Freunde sogar. Aber dann habe ich seine Freundschaft missbraucht, und jetzt würde ich mich schämen, ihm unter die Augen zu treten.«
»Und trotzdem fahren wir hin?«
Howard nickte. »Nach allem, was vorgefallen ist, kann er mich eigentlich nur noch hassen«, sagte er leise. »Er würde mir bestimmt mit Freuden helfen, Kontakt mit den Templern herzustellen. Er weiß, dass das hiesige Templerkapitel mich zum Tode verurteilt hat. Und wenn er mich zu ihnen bringt, kann er sich wenigstens an mir rächen. Ohne auch nur einen Finger zu krümmen.«
Rowlf runzelte die Stirn und setzte dazu an, eine weitere Frage zu stellen, aber dann fiel ihm der sonderbare Ausdruck in Howards Augen auf und er schwieg. Er war lange mit Howard zusammen, vielleicht länger, als irgendein anderer Mensch vor ihm. Und vielleicht kannte er ihn besser als irgendein anderer. Aber es gab noch immer eine Menge Dinge, die er nicht wusste. Und er hatte das sichere Gefühl, dass Howard ohnehin schon mehr gesagt hatte, als er wollte.
Länger als eine halbe Stunde fuhren sie schweigend weiter, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Die Kutsche rollte über das gepflegte Kopfsteinpflaster der Pariser Straßen, fuhr über den Montmartre und ein paar Minuten lang an den Ufern der Seine entlang, dann begann die Umgebung ganz langsam an Pracht und Schönheit zu verlieren. Die Kleider der Passanten, an denen sie vorüberkamen, waren nicht mehr ganz so teuer und exklusiv. Hier und da tauchte ein Karren mit Gemüse oder Kohlen zwischen den Mietdroschken auf, eine Schlägermütze zwischen den weißen Hüten der Damen, eine schwarze Arbeiterjacke unter den maßgeschneiderten Ausgehanzügen ihrer Kavaliere.
Als die Kutsche schließlich anhielt, schienen sie nicht nur in einem anderen Teil, sondern in einer anderen Stadt zu sein. Rowlf sah sich misstrauisch um, als sie aus dem Wagen stiegen und von der Bordsteinkante zurücktraten. Die Straße war schmal, flankiert von düsteren, im Laufe der Jahrzehnte schwarz gewordenen Häusern und von Schlaglöchern übersät. Ein unangenehmer, leicht fauliger Geruch hing in der Luft und die wenigen Menschen, die ihnen begegneten, bedachten Howards vornehme Kleidung mit eindeutig feindseligen Blicken. Rowlf spannte sich instinktiv, als Howard mit weit ausgreifenden Schritten auf ein Gebäude am anderen Ende der Straße zuhielt.
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte er.
Howard zuckte mit den Achseln. »Was die Adresse angeht – ja. Allerdings war die Gegend vor fünf Jahren noch nicht so heruntergekommen wie jetzt. Ich hoffe nur, Gaspard wohnt noch hier.«
Sie überquerten die Straße, wichen einer großen, ölig schimmernden Pfütze aus und blieben schließlich vor einem winzigen Ladengeschäft stehen. Auf den blind gewordenen Scheiben verkündete abblätternde Farbe:
François Gaspard
An- und Verkauf von Büchern, Antiquariat
Okkulte Schriften
»Er scheint wirklich noch hier zu wohnen«, murmelte Howard. Seine Stimme war so leise, als spräche er mit sich selbst, und auf seinen Zügen lag mit einem Mal ein Ausdruck von Schmerz, den sich Rowlf nicht erklären konnte.
»Vielleicht ist es besser, wenn ich erst einmal allein hineingehe«, bot sich Rowlf an. »Es könnte eine Falle sein.«
Howard drehte mit einer ruckartigen Bewegung den Kopf. Dann lächelte er verzeihend. Kaum«, sagte er. »Wenn dort drinnen eine Gefahr auf mich warten sollte, dann bestimmt keine, vor der du mich schützen kannst, Rowlf.«
Rowlf verstand nun überhaupt nichts mehr. Aber Howard machte keine Anstalten, seine Worte zu erklären, sondern straffte mit einem Seufzer die Schultern, streckte die Hand nach der Türklinke aus und drückte sie übertrieben kräftig herunter.
Kühle, Halbdunkel und der charakteristische Geruch alter Bücher schlugen ihnen entgegen, als sie den kleinen Laden betraten. Der Raum hinter den Scheiben mochte in Wahrheit groß sein, aber er war derart vollgestopft mit Regalen und Tischen, auf denen sich Bücher und Folianten aller nur denkbaren Art und Größe stapelten, dass Rowlf beinahe Platzangst bekam. Eine kleine Glocke über der Tür kündete ihr Kommen an, und schon nach Sekunden ertönten aus dem Hintergrund des Raumes schlurfende Schritte. Howard spannte sich. Seine Finger zupften mit kleinen, nervösen Bewegungen am Saum seines Gehrockes.
Die Schritte kamen näher, dann schälte sich ein Schatten aus dem Gewirr von Bücherregalen und -stapeln. Rowlf erkannte einen grauhaarigen, hageren Mann schwer bestimmbaren Alters. Sein Gesicht war zu einem knappen, berufsmäßigen Lächeln verzogen, und seine Haut hatte den kränklichen, wächsernen Farbton eines Menschen, der zu selten an frischer Luft und Sonne war.
»Monsieur?«, begann er. »Was kann ich für Sie –«
Der Mann stockte. Das Lächeln auf seinen Zügen erlosch und wurde dann zur Grimasse. Seine Augen flammten auf, und Rowlf sah, wie sich seine Hände blitzartig zu Fäusten ballten und dann wieder öffneten.
»Hallo, Gaspard«, sagte Howard leise.
Gaspard schwieg. Sein Gesicht zuckte, und in seinen Augen wechselten sich in Sekunden Hass und Unglauben und Schrecken und Verzweiflung ab, so rasch, dass Rowlf nicht zu sagen wusste, welches Gefühl nun die Oberhand behielt.
»Du … du bist tatsächlich gekommen«, sagte er schließlich. »Du hast es wirklich gewagt.« Seine Stimme bebte.
Der Ausdruck von Trauer auf Howards Zügen vertiefte sich. »Du hasst mich noch immer, Gaspard«, sagte er leise. »Ich hatte gehofft, dass –«
Gaspard unterbrach ihn mit einer wütenden Handbewegung. »Hassen?«, schnappte er. »Wie kommst du darauf, Howard? Ich hasse dich nicht. Ich verachte dich. Und ich verfluche den Tag, an dem ich dich kennen gelernt habe. Du bist es nicht wert, dass ich dich hasse.«
Lovecraft fuhr wie unter einem Schlag zusammen. »Es tut mir leid, Gaspard«, flüsterte er. »Ich hatte gehofft, dass die Zeit die Wunde ein wenig geheilt hat, aber ich sehe, dass du mir nicht vergeben hast.«
»Was willst du?«, schnappte Gaspard. Sein Gesicht war jetzt zur Maske erstarrt, und seine Stimme klang kalt und schneidend wie die einer Maschine.
Howard atmete hörbar ein. »Ich brauche deine Hilfe, Gaspard.«
»Meine Hilfe?« Gaspard lachte, aber es klang nicht sehr amüsiert. »Wobei, mein Freund?«, fragte er. »Ich habe nur eine Tochter. Wenn du auf ein Abenteuer aus bist, kann ich dir leider nicht dienen. Aber Paris ist groß.«
Howard krümmte sich wie unter einem Hieb. »Bitte, Gaspard«, sagte er, beinahe flehend. »Ich kann nicht mehr sagen, als dass es mir leid tut. Und es war niemals ein Abenteuer für mich, das musst du mir glauben. Ich habe es ernst gemeint.«
Gaspard nickte. »Das habe ich auch gedacht, damals. Und Ophelie auch. Bis zu dem Morgen, an dem du verschwunden warst.«
Rowlf blickte verwirrt zwischen Howard und dem grauhaarigen Franzosen hin und her. Ophelie?, dachte er. Er hatte diesen Namen noch niemals gehört.
»Ich hatte keine andere Wahl«, antwortete Howard leise. »Ich musste Paris verlassen. Ich war in Gefahr. Und Ophelie und du wäret es auch gewesen, wenn ich geblieben wäre.«
»Wäre sie auch in Gefahr geraten, wenn du geschrieben hättest?«, fragte Gaspard kalt. »Oder hattest du kein Geld mehr, um das Porto zu bezahlen?«
Howard seufzte. »Ich hatte keine Wahl«, sagte er noch einmal. »Du weißt nicht, was damals geschehen ist.«
»Doch«, sagte Gaspard ruhig. »Du scheinst mich für einen Narren zu halten, Howard. Deine Brüder kamen zu mir, keine Woche, nachdem du Ophelie im Stich gelassen hattest.«
Howard erschrak sichtlich. »Sie waren hier?«, keuchte er. Haben sie … haben sie Ophelie etwas getan?«
Gaspard schürzte die Lippen, schüttelte den Kopf und starrte Howard mit unverhohlenem Hass an. »Nein«, sagte er. »Sie haben ihr nichts getan. Aber das war kaum dein Verdienst. Was willst du?«, fragte Gaspard noch einmal. »Ophelie ist nicht hier. Sie ist nicht einmal in Paris.« Er schnaubte. »Wenn du gekommen bist, um sie zu sehen, hast du den Weg umsonst gemacht. Sie will dich nie wiedersehen. Und ich auch nicht.«
»Ich bin nicht ihretwegen hier«, murmelte Howard. »Ich versuche seit einer Woche, Kontakt mit dem Orden aufzunehmen. Bisher ist es mir nicht gelungen.«
»Und jetzt glaubst du, ich könnte dir dabei helfen?« Gaspard lachte hart. »Wenn das alles ist – warte.« Er drehte sich um, verließ den Raum durch eine Seitentür und kam kaum eine Minute später zurück, ein kleines, in braunes Papier eingeschlagenes Päckchen unter dem Arm.
»Was ist das?«, fragte Howard verwirrt, als Gaspard ihm das Paket entgegenhielt.
»Woher soll ich das wissen?«, schnappte Gaspard. »Es wurde für dich abgegeben, vor ein paar Tagen.«
Howard griff zögernd nach dem zigarrenkistengroßen Päckchen. »Abgegeben?«, vergewisserte er sich. »Von wem?«
»Einem Fremden«, antwortete Gaspard. »Einem Mann, den ich vorher nie gesehen habe. Er hat mir fünfhundert Francs gegeben und das Päckchen.« Sein Gesicht verzog sich, als spräche er über eine Obszönität. Plötzlich griff er in die Innentasche seines abgewetzten Rockes, zog ein zusammengefaltetes Bündel Geldscheine hervor und schleuderte es Howard vor die Füße. »Das sind die fünfhundert Francs«, sagte er angewidert. »Nimm sie und gib sie ihm wieder. Ich will nichts, was irgendwie mit dir zu tun hat, behalten. Er sagte, du würdest kommen und es holen!« Er wartete, bis Howard das Päckchen an sich genommen hatte, dann deutete er mit einer Kopfbewegung zur Tür.
»Aufmachen kannst du es draußen«, sagte er kalt. »Geh. Und komm nicht wieder!«
Eine endlose Sekunde lang starrte Howard den grauhaarigen Franzosen noch an, dann drehte er sich auf dem Absatz herum und stürmte aus dem Laden, so schnell, dass Rowlf Mühe hatte, überhaupt mit ihm Schritt zu halten.
Der Aufprall hatte mir das Bewusstsein geraubt, aber es konnte kaum mehr als eine Minute vergangen ein, denn das Erste, was ich wahrnahm, war das schrille Pfeifen der Lokomotive. Sekundenlang blieb ich reglos liegen und wartete darauf, dass der hämmernde Schmerz in meinem Hinterkopf nachließ, dann öffnete ich die Augen, erkannte einen Ausschnitt regengrauen Himmels über mir und fand mich langsam mit der Tatsache ab, noch am Leben und – wenigstens einigermaßen – unverletzt zu sein.
Mühsam richtete ich mich auf. Das quälende Hämmern in meinem Schädel ließ rasch nach, aber in meinem Körper schien kein einziger Muskel zu sein, der nicht irgendwie geprellt, gestaucht oder überdehnt war. Als ich versuchte, mich auf Hände und Knie zu erheben, unterdrückte ich nur mit Mühe einen Schmerzensschrei.





























