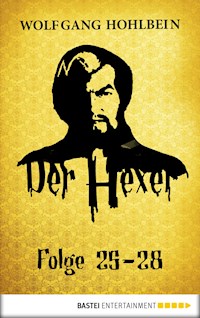
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Die Prophezeiung" - Folge 25 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Der Augenblick der Rache war gekommen. Er wusste längst nicht mehr, wie lange er auf diesen Tag gewartet hatte - waren es Jahrtausende gewesen, Jahrmillionen, Jahrmilliarden? Es spielte keine Rolle. Jetzt nicht mehr. der Tag der Entscheidung war da. Er wusste nicht, wie die Welt aussehen würde, wenn dieser Tag vorüber war. Selbst er, dessen Macht der eines Gottes glich, konnte nicht mit letzter Bestimmtheit sagen, welche Seite den Sieg davontragen würde, und wenn, ob es die richtige war. Er wusste nur, dass die Welt hinterher anders aussehen würde. Wenn sie dann noch existierte.
"Gefangen im Dämonen-Meer" - Folge 26 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Es war wie an den Abenden zuvor, und doch wieder anders: Die unheimlichen, tanzenden Lichter weit draußen auf See waren heller, der sonderbare Singsang, der mit dem Wind heranwehte, lauter, der Hauch der Kälte, der sich wie ein Dieb vom Meer herangeschlichen hatte, deutlicher geworden. Und mit der Nacht kamen die Boote. Sehr sonderbare Boote; Boote, wie sie Eldekerk nie zuvor erblickt hatte. Boote mit seltsamen, knöchernen Gestalten, Wesen mit zu großen Köpfen und zu dürren Gliedern, mit Haut wie aus Strahl oder poliertem Holz, und mit Gesichtern, die nicht die von Menschen waren...
"Wer den Tod ruft" - Folge 27 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Die Puppe war klein; nicht größer als die Faust, dazu so roh gefertigt, dass man kaum ihre menschlichen Umrisse erkennen konnte. Leib, Arme und Beine bestanden aus Sackleinen, das mit groben Stichen zusammengenähte war, der Kopf eine ungleichmäßige Kugel, auf die ungelenken Strichen die Züge eines menschlichen Gesichtes gemalt worden waren. Das einzig Auffällige war das Haar der Puppe: Ein Bündel schwarzgefärbten Strohs, in das, beginnend vom Haaransatz über dem linken Auge, eine weiße, blitzförmig gezackte Strähne eingeflochten war...
"Der achtarmige Tod" - Folge 28 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Es war ein Bild wie aus einem üblen Alptraum. Hinter der runden, leicht nach außen gebogenen Scheibe des Taucherhelms sollte ein Gesicht sein, schmal und von der Krankheit, die den Mann seit Wochen auszehrte, gezeichnet. Aber dort hinter dem Glas wogte nur eine graue, schreckliche Masse, hin und her zuckend und von einer schwerfälligen brodelnden Bewegung erfüllt. Ein waberndes Etwas blaugrauen Schreckens, das den Menschen, der noch vor Stunden in der monströsen Tauchermontur steckte, verschlungen hatte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Ähnliche
Inhalt
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Die Prophezeiung
Der Hexer – Gefangen im Dämonen-Meer
Der Hexer – Wer den Tod ruft
Der Hexer – Der achtarmige Tod
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 25-28:
Der Hexer – Die Prophezeiung
Der Hexer – Gefangen im Dämonen-Meer
Der Hexer – Wer den Tod ruft
Der Hexer – Der achtarmige Tod
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 25–28
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1574-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 25-27
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 25 bis 27.
Die Bedrohung durch den Fischgott Dagon nimmt allmählich konkrete Züge an. Das gigantische Schiff, das seinen Namen trägt und mit dem er sich und seine Anhänger in einer fremden Welt vor den Thul Saduun in Sicherheit bringen möchte, ist fertig gestellt und zum Aufbruch bereit.
Robert Cravens Lage hingegen ist denkbar ungünstig. Zwar hat er erfahren, dass seine Freunde Howard Lovecraft und dessen Diener Rowlf noch leben, doch sind sie unheilbar an der Tollwut erkrankt und eine Gefahr für jeden, mit dem sie zusammentreffen, sodass sie sich nur in Nemos hermetisch abgeschlossenen Tauchanzügen bewegen können. Die NAUTILUS ist beschädigt, liegt manövrierunfähig auf dem Grund des Meeres und wird von einem gigantischen Shoggoten bedroht. Und um seine Freunde zu retten, bleibt Robert selbst nichts anderes übrig, als sich ebenfalls an Bord der DAGON zu begeben und den Fischgott auf seiner Reise ins Ungewisse zu begleiten.
Aber noch andere Mächte haben ein gefährliches Interesse an der DAGON entwickelt. Inzwischen weiß Robert um die Gefahr durch die SIEBEN SIEGEL DER MACHT, von denen die GROSSEN ALTEN in ihren Kerkern jenseits der Wirklichkeit gebannt werden. Und eines der SIEGEL befindet sich an Bord der DAGON!
Necron schickt seine Drachenkrieger unter der Führung von Roberts früherem Freund Shannon aus, es unter allen Umständen an sich zu bringen, während ein geheimnisvolles Wesen dies unter allen Umständen verhindern will. Um sich und das Leben der Menschen an Bord der DAGON zu retten, beginnt der Hexer ein gefährliches Spiel, bei dem er zwischen allen Fronten steht.
Mit knapper Not gelingt es ihm, von Bord des Schiffes zu fliehen. Es verschlägt ihn zurück ins Jahr 1883 und auf eine kleine Vulkaninsel namens Krakatau, wo er nicht nur erneut auf Dagon trifft, sondern auch auf eine Gruppe fanatischer Tempelritter. Hier, an den Flanken des Vulkans, wird sich im nächsten Buch in einemwahrhaft »feurigem« Zyklus-Finale sein Kampf um die Zukunft der Menschheit entscheiden …
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 25Die Prophezeiung
Der Bug des Schiffes deutete ins Nichts. Zeit und Raum hatten ihre Bedeutung verloren, seit ich das steil aufragende Achterkastell der DAGON betreten und das Gesicht in den Wind gedreht hatte, um zu sehen, wohin wir fuhren. Hinter und neben uns war die ölglatte See nördlich des englischen Kleinkontinents, aber vor dem Schiff, dort, wo eigentlich Norden sein sollte, war – nichts.
Es war mir unmöglich, einen anderen Ausdruck dafür zu finden, ein anderes Wort für die wirbelnden grauweißen Schemen, die dort tobten, wo der Himmel und das Meer sein sollten.
Es hatte begonnen, nachdem die DAGON die Küste verlassen und Kurs auf das offene Meer genommen hatte. Zuerst war es nicht mehr als eine dünne, mit bloßem Auge kaum sichtbare Linie gewesen, wie ein Haar, das senkrecht über den Horizont gelegt worden war, so dünn, dass es sich dem Blick zu entziehen schien, wenn man versuchte, es genauer zu betrachten.
Dann war es gewachsen.
Aus dem Haar war eine klar erkennbare Linie geworden, aus der Linie eine Schlucht, die in der Wirklichkeit klaffte, und zum Schluss ein gewaltiges, alles verschlingendes Maul, das ein Viertel des Horizontes einnahm. Brodelnde weiße Nebelschwaden quollen wie wolkiges Blut aus dieser Wunde, die allein düstere Magie geschlagen hatte, und mit ihnen wehte ein Hauch unheimlicher Kälte heran, der durch meine Kleider und meine Haut drang und irgendetwas in mir zum Erstarren brachte.
Es fiel mir schwer, den Blick von dem Etwas zu lösen, auf das die DAGON zusteuerte. So sehr mich der Anblick erschreckte, so sehr faszinierte er mich zugleich.
Vor uns lag eine andere Welt.
Vielleicht nicht direkt, sondern nur der Weg dorthin, die Bresche, die Dagon mit seiner erschreckenden Magie in die Barriere zwischen den Wirklichkeiten geschlagen hatte, um sich und den seinen den Weg zu ebnen.
Mit aller Gewalt riss ich mich von dem Anblick los und stieg die steile Treppe zum Hauptdeck hinunter. Ich habe Schiffe niemals besonders gemocht, und das, was ich auf der NAUTILUS und jetzt auf ihrem schrecklichen Gegenspieler erlebt hatte, trug nicht dazu bei, meine Abneigung gegen alles, was schwimmt, zu verringern. Dazu kam, dass ich mich alles andere als wohl fühlte, unabhängig von der Furcht, die der Anblick des Dimensionsrisses in meine Seele gepflanzt hatte. Ich hatte während der letzten fünf Tage so viel Schlaf bekommen wie ein ehrlicher Christenmensch normalerweise in einer Nacht, und obwohl ich eine alles andere als schwächliche Konstitution habe, begann mein Körper nun nachhaltig die Ruhe zu monieren, die ich ihm vorenthalten hatte. Ich hätte meinen rechten Arm für eine Stunde Schlaf gegeben. Aber gleichzeitig wusste ich auch, dass ich keine Ruhe finden würde – wie konnte ich auch!
Müde machte ich ein paar Schritte, blieb stehen und blinzelte aus entzündeten Augen über das Deck. Die DAGON war groß, das mit Abstand größte Schiff, das ich jemals gesehen hatte, wahrscheinlich das größte Schiff, das jemals auf den Weltmeeren gefahren war, und ihr Hauptdeck erstreckte sich wie drei aneinander gelegte Fußballplätze vor und unter mir, unterbrochen von zahllosen Aufbauten, deren Bedeutung ich nur zum allergeringsten Teil kannte, und auf mehreren neben- und übereinanderliegenden Ebenen angeordnet. Die gigantischen, erdfarbenen Segel blähten sich über mir, obgleich die See noch immer fast windstill war, und das Gewirr aus Kabeln und Drahtseilen, das sie hielt, war so straff gespannt, dass ich das Summen des belasteten Materials hören konnte.
Trotzdem war ich allein auf Deck.
Die knapp zweihundert Männer und Frauen, die zusammen mit Dagon an Bord des gleichnamigen Schiffes gekommen waren, waren irgendwo in seinen unergründlichen Tiefen verschwunden, und ich hatte wenig Lust, mit einem von ihnen zusammenzutreffen. Mit Ausnahme Jennifers hatte ich mit niemandem mehr geredet, und mir stand auch nicht der Sinn danach, denn es wäre ein Gespräch gewesen, das ohnehin keinen Sinn hatte. Die Menschen, die Dagon folgten, waren Fanatiker, und es hat noch niemals zu irgendetwas anderem als Zorn und Kopfschmerzen geführt, mit einem Fanatiker diskutieren zu wollen. Außerdem hatte ich keine sonderliche Lust, mit McGillycaddy zusammenzutreffen – wer unterhält sich schon gerne mit einem Mörder?
Trotzdem bereute ich meinen Entschluss, an Deck zu kommen, in diesem Moment schon fast wieder. Die unnatürliche Kälte war unter Deck zwar genauso unangenehm zu spüren wie hier und die DAGON war groß genug, trotz der sicherlich zwanzig Knoten, mit der sie die Wellen pflügte, ruhig wie ein Stein im Wasser zu liegen, sodass mich sogar die Seekrankheit verschonte, unter der ich normalerweise schon litt, wenn ich nur Wasser rauschen hörte. Aber es war etwas anderes, das mich erschreckte.
Es war die Einsamkeit.
Ich habe sie normalerweise nie gefürchtet; im Gegenteil. Ich schätze das Alleinsein sehr, aber die Stille an Deck der DAGON hatte etwas Unheimliches. Es war keine wirkliche Stille; keine Stille der Geräusche. Das Schiff war voll von Lauten – dem Knarren der Maste und Spieren, dem gelegentlichen Flappen der Segel, das sich anhörte wie das langsame Schlagen gigantischer lederner Flügel, dem Sirren und Singen der straff gespannten Kabel und Taue, dem Klatschen der Wellen, die an den haushohen Flanken des Schiffes zu weißem Schaum zerbarsten – und trotzdem, so absurd es mir selbst in diesem Moment vorkam, war das Schiff still. Es war eine Stille jenseits des Hörbaren, ein Schweigen, als wäre ein Stück der Wirklichkeit um mich herum erloschen. Dafür war etwas anderes da. Etwas, das weder mit Worten noch mit Gedanken zu beschreiben war und das mich tief erschreckte. Es war, als wisperten die Schatten, als erzählten die Dunkelheit und das Schweigen düstere Geschichten; Geschichten von verbotenen Dingen und verfluchten Orten, an denen dieses Schiff gewesen war und zu denen es wieder fuhr …
Mühsam schüttelte ich den Gedanken ab, drehte mich auf dem Absatz herum, um nun doch wieder nach unten zu gehen – und erstarrte.
Am Fuße der Treppe lag ein Mann.
Ich war absolut sicher, dass er vor wenigen Augenblicken noch nicht dort gelegen hatte – schließlich war ich vor weniger als einer Minute selbst die steile Holztreppe hinuntergestiegen –, ebenso wie ich vollkommen sicher war, keine Schritte gehört zu haben.
Aber jetzt war er da.
Und er war tot.
Ich hätte die dunkle Blutlache, die sich langsam unter seinem Körper ausbreitete, nicht einmal zu sehen brauchen, um das zu wissen. Man erkennt einen Toten, wenn man ihn sieht.
Der Mann lag verkrümmt da, mit dem Gesicht in der größer werdenden Pfütze seines eigenen Blutes, die rechte Hand um den Griff eines armlangen Säbels geschlossen und die andere zu einer Kralle verkrümmt, als hätte er in seinen letzten Sekunden versucht, sich an die harten Planken des Schiffsrumpfes zu klammern.
Zehn, fünfzehn Sekunden lang stand ich vollkommen reglos da und starrte den Toten an. Es war nicht der Anblick der Leiche, der mich so erschreckte – der Anblick eines Toten, der noch dazu auf gewaltsame Weise ums Leben gekommen ist, ist niemals sehr erbaulich, und er gehört wohl zu den wenigen Dingen, an die man sich nie gewöhnen kann –, aber es war etwas an ihm, was diesen Schrecken überdeckte und mich mit schierem Entsetzen erfüllte.
Seine Kleidung.
Der Mann trug einen schwarzen Umhang, bestickt mit dünnen, silbernen Fäden, die die Umrisse eines stilisierten Drachen abbildeten, darunter ebenfalls schwarze Hosen und eine Art lose fallender Bluse in der gleichen Farbe, dazu Stiefel und Handschuhe und eine turbanähnliche Kopfbedeckung, an der ein Tuch befestigt war, das sein Gesicht bis auf einen knapp fingerbreiten Streifen über den Augen bedeckte. Alles an ihm war schwarz.
Ich kannte diese Kleidung. Ich war Männern wie ihm begegnet, vor nicht einmal sehr langer Zeit; die mir trotzdem vorkam, als läge sie Ewigkeiten zurück. Und ich hatte zu allen mir bekannten Göttern gebetet, sie nie, nie wiedersehen zu müssen.
Einen Moment lang versuchte ich mit aller Gewalt, mir einzureden, dass ich mich täuschte, dass meine Erinnerungen und meine überreizten Nerven mir einen bösen Streich spielten. Aber ich sah rasch ein, dass das nicht stimmte.
Der Gedanke war völlig widersinnig; das Geschehen hier hatte keinerlei Beziehung zu ihnen und selbst wenn, hätten sie nicht hier sein dürfen. Aber der Tote war da, und alles Leugnen brachte ihn nicht fort. Es gab nur eine Gruppe von Menschen auf der Welt, die sich auf diese Weise zu kleiden pflegten.
Necrons Drachenkrieger!
Ich starrte den Toten an, unfähig, irgendetwas anderes zu denken als diese beiden Worte, unfähig, etwas anderes zu empfinden als Erschrecken und Unglauben und Zorn und einen langsam aufkeimenden, immer stärker und stärker werdenden Hass.
Necron.
Wenn es einen Namen auf der Welt gab, der für mich alles Schlechte und Böse und Verabscheuungswürdige versinnbildlichte, dann diesen.
Necron, der geheimnisumwitterte Herr der Drachenburg.
Der Meistermagier, Herr des Bösen und aller dunklen Kräfte.
Und der Mann, der mir den einzigen Menschen genommen hatte, den ich jemals wirklich geliebt hatte …
Meine Priscylla.
Es war wie ein Schlag in den Magen, schnell, warnungslos und so hart, dass ich mich für Sekunden krümmte, als hätte ich wirklich einen Hieb bekommen, der mir den Atem nahm.
Die Vergangenheit hatte mich eingeholt, endgültig und in einem Moment, in dem ich am allerwenigsten damit gerechnet hatte. Der Tote vor mir war mehr als ein Toter, mehr als das Opfer eines heimtückischen Mordes. Er war ein Fanal, ein boshafter Wink des Schicksals, mit dem es mir mit aller Brutalität zeigte, wie wenig ich ihm hatte davonlaufen können. Der Anblick seiner schwarzen Kleidung und das, was sie für mich bedeutete, ließ die Vergangenheit auferstehen, die Bilder, die ich mit aller Macht aus meinem Bewusstsein zu verdrängen versucht hatte, und plötzlich begriff ich, dass alles, was ich seither erlebt und getan hatte, all diese verrückten und haarsträubenden Abenteuer, alle Gefahren, in die ich mich kopfüber gestürzt hatte, nur diesem einen Zweck gedient hatten – dem Vergessen.
Ich hatte versucht, meine Vergangenheit zu begraben, sie mit einem Gebirge aus Gefahren und Abenteuern zu erschlagen. Aber das ging jetzt nicht mehr. Der Tote lag vor mir, und er war real.
Nachdem die erste Woge von Zorn und Hass – der in Wahrheit wohl nur ein Ausdruck meiner eigenen Hilflosigkeit sein mochte – vorüber war, begannen mir tausend Fragen durch den Kopf zu schießen. Wie kam der Mann hierher? Und – und das war das Wichtigste – warum?
Zögernd kniete ich nieder, drehte ihn auf den Rücken und besudelte mir dabei die Hände mit seinem Blut.
Als ich in sein Gesicht blickte, hätte ich um ein Haar aufgeschrien.
Er war tot, aber seine Kehle war nicht durchschnitten worden, wie ich bisher angenommen hatte. Was ich sah, waren nicht die Spuren eines Messers, sondern Wunden, wie sie nur furchtbare Raubtierfänge schlagen konnten. Schaudernd drehte ich mich in der Hocke um, löste das Schwert aus seinen schlaffen Fingern und hielt die Klinge ins Licht. Auf dem rasiermesserscharfen Stahl war nicht der kleinste Blutstropfen zu sehen. Der Drachenkrieger war nicht einmal dazu gekommen, sich zu wehren. Ich hatte Männer wie ihn im Kampf erlebt und wusste, wozu sie fähig waren. Ein Wesen, das einen solchen Krieger derart rasch und auf so furchtbare Weise zu töten vermochte, musste zehn Mal gefährlicher als ein Tiger sein.
Als ich an diesem Punkt meiner Überlegungen angekommen war, hörte ich Schritte. Gleichzeitig legte sich ein riesiger, verzerrter Schatten auf den Körper des Toten.
Mit einem Schrei wirbelte ich herum, sprang in die Höhe, hob gleichzeitig das Schwert – und brach die Bewegung im letzten Moment wieder ab, als ich den Mann erkannte, der hinter mir aufgetaucht war. »Bannermann!«
Der ehemalige Kapitän der Lady of the Mist nickte, lächelte auf die flüchtige, unechte Art, in der man lächelt, um jemanden zu begrüßen, und wurde sofort wieder ernst. Sein Blick huschte über das bleiche Gesicht des Toten; glitt über die noch immer zum Schlag erhobene Klinge in meiner Hand und blieb auf meinem Gesicht haften.
Hastig senkte ich das Schwert und trat einen halben Schritt vom Leichnam des Drachenkriegers fort. »Verzeihen Sie«, sagte ich mit einer Kopfbewegung auf die beidseitig geschliffene Klinge. »Das … das galt nicht Ihnen. Ich bin ein wenig nervös.«
Bannermann schien meine Worte gar nicht zu hören. »Haben Sie ihn getötet?«, fragte er leise.
Ich starrte ihn an, blickte dann erschrocken auf das Schwert in meiner Hand und meine blutigen Finger und ließ die Klinge hastig zu Boden fallen. »Nein«, sagte ich. »Er … er lag plötzlich da. Ich weiß nicht, wer ihn umgebracht hat. Ich weiß nicht einmal, wer er ist.«
Bannermann musterte mich noch einen Moment lang stirnrunzelnd, ging dann ohne ein weiteres Wort vor dem Toten in die Hocke und untersuchte mit kundigen Bewegungen die Wunde an seinem Hals. Als er fertig war, waren seine Finger ebenso blutbesudelt wie meine.
»Nein«, sagte Bannermann, nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte. »Sie haben ihn nicht getötet. Das war kein Mensch.«
»Danke, dass Sie es mir bestätigen«, sagte ich, schärfer, als ich eigentlich beabsichtigt hatte. Aber Bannermanns Worte hatten mich mit einem Zorn erfüllt, den ich mir selbst nicht so recht zu erklären vermochte. Ich begann erst jetzt zu spüren, wie nervös ich war.
»Wo kommt dieser Mann her?«, fragte Bannermann. »Er war nicht bei den Leuten, die heute Morgen an Bord gekommen sind. Ich hätte ihn bemerkt.«
»Zum Teufel, das weiß ich nicht«, antwortete ich gereizt. »Ich weiß ja nicht einmal, wer –« Ich stockte, sah Bannermann einen Herzschlag lang beinahe misstrauisch an und begann dann, in verändertem Tonfall, von neuem: »Wo kommen Sie überhaupt her, Bannermann? Was tun Sie an Bord dieses Schiffes?«
»Ich bin schon eine ganze Weile hier«, antwortete Bannermann eine Spur zu rasch. »Reden wir später darüber. Im Moment –« Er deutete auf den Toten. »– gibt es Wichtigeres. Wir müssen herausfinden, was ihn umgebracht hat. Und warum.« Er seufzte, kniete abermals neben dem Leichnam nieder und begann rasch und methodisch, seine Taschen zu durchsuchen. Seine Ausbeute war mager – der Krieger trug genug Waffen bei sich, um eine kleine Armee auszurüsten, aber das war auch schon alles. Bannermann schüttelte enttäuscht den Kopf und stand wieder auf. »Nichts.«
»Was haben Sie erwartet?«, fragte ich spöttisch. »Einen Passport und eine gültige Schiffspassage, erster Klasse und Einzelkabine?«
»Nein«, antwortete Bannermann ungerührt. »Ein schriftlicher Marschbefehl von Necron hätte gereicht.«
Eine Sekunde lang starrte ich ihn nur an, und schon wieder stieg eine Woge heißen, vollkommen unbegründeten Zornes in mir empor. Dann senkte ich betreten den Blick.
»Verzeihen Sie, Bannermann«, sagte ich. »Ich bin nervös. Nehmen Sie mich nicht zu ernst.«
Bannermann winkte ab. »Schon gut, Craven. Dazu ist im Moment wirklich keine Zeit. Helfen Sie mir.«
Er bückte sich nach dem Toten, griff schnaufend unter seine Arme und machte eine ungeduldige Kopfbewegung, als ich zögerte, seine Beine zu ergreifen.
»Was haben Sie vor?«, fragte ich, ohne mich von der Stelle zu rühren.
»Wir müssen ihn fortschaffen«, sagte Bannermann. »Fassen Sie an.«
Ich reagierte noch immer nicht. »Was soll das heißen?«, fragte ich. »Wir müssen den anderen Bescheid sagen und –«
»Und eine kleine Panik auslösen, wie?«, fiel mir Bannermann ins Wort. »Natürlich werden wir die anderen warnen, Craven. Aber was glauben Sie, was hier los ist, wenn jemand zufällig hier heraufkommt und diesen Mann findet, so, wie er aussieht? Helfen Sie mir, ihn über Bord zu werfen.«
Zwei, drei Sekunden lang blickte er mich auffordernd an, dann stieß er ein zorniges Schnauben aus, lud sich den leblosen Körper des Drachenkriegers allein auf die Arme und trug ihn, schwankend, aber sehr schnell, zur Reling.
»Zum Teufel, Bannermann, warten Sie!«, rief ich. »Ich –«
Es war zu spät. Bannermann hob den schwarz verhüllten Leichnam ächzend über die Reling und ließ ihn los. Wie ein Stein stürzte er in die Tiefe. Bannermann grunzte zufrieden, kam zurück und bückte sich nach den Waffen, die er aus der Kleidung des Toten gezogen hatte. Nacheinander schleuderte er alles über Bord und behielt nur einen zweischneidigen Dolch und eine Anzahl kleiner, fünfzackiger Wurfsterne zurück, die er mir reichte.
»Was soll ich damit?«, fragte ich verwirrt.
Bannermann winkte ungeduldig mit der Hand. »Stecken Sie sie ein, Craven. Vielleicht sind Sie bald froh, überhaupt eine Waffe zu haben. Was immer diesen Mann getötet hat, ist noch an Bord, vergessen Sie das nicht. Und jetzt kommen Sie. Ich denke, wir sollten Dagon berichten, was hier geschehen ist.«
Der Raum um Necron war still wie immer. Die Geräusche der Außenwelt hatten hier keine Bedeutung, und die gleiche Macht die ihn vor dem Griff der Zeit schützte, bewahrte ihn auch vor den Geräuschen des Draußen, vor seinen Lauten und Störungen, vor jedem Einfluss, der das Unwandelbare hätte wandeln können.
Und doch hatte sich etwas geändert, hier, wo nichts verändert werden durfte, dachte Necron schaudernd. Wie alle wirklich großen Veränderungen war sie noch nicht sichtbar, begann sie lautlos und unsichtbar, beinahe unbemerkt. Niemand würde sie spüren, bis es zu spät war, niemand mit Ausnahme einiger weniger Berufener. Oder Verfluchter.
Necron wusste selbst nicht zu sagen, zu welcher Gruppe er gehörte. Manchmal, in all den ungezählten Jahren, die er gelebt hatte, hatte er begonnen zu zweifeln, hatte mit dem Schicksal gehadert und sich gewünscht, der Verlockung der Macht nicht nachgegeben zu haben, in diesem einen, einzigen Moment vor so langer Zeit, der sein Leben so vollkommen geändert hatte. Seines und das zahlloser anderer Männer und Frauen …
Ein Schatten bewegte sich vor ihm; nicht wirklich, nicht so, als bewege sich wirklich etwas in der großen, stillen Kammer. Es war nur ein Huschen von Dunkelheit, ein flüchtiger, zeitloser Augenblick, als griffe ein Finger aus Finsternis aus den Dimensionen jenseits der Nacht hervor und richte sich drohend auf ihn, aber Necron verstand die Warnung. Er hatte den GROSSEN ALTEN einmal zu hintergehen versucht, und Cthulhu würde keinen zweiten Verrat dulden. Nicht einmal einen Moment des Zweifels.
Gehorsam wandte er seine Gedanken von solcherlei verbotenen Dingen ab und ging mit gemessenen Schritten zur anderen Seite der Kammer, wo zwei übermannslange, rechteckige Behältnisse aus Glas auf schwarzen Marmorsockeln aufgestellt waren.
Seine harten, grausamen Gesichtszüge spiegelten sich verzerrt in dem glasklaren Kristall, als er sich über den ersten beugte und das Gesicht des schlafenden Mädchens darin musterte. Er hatte es oft getan in den letzten Monaten, zahllose Male, und doch hatten die schmalen, beinahe eingefallen wirkenden Züge dieses kindlichen Wesens nichts von ihrem Geheimnis verloren. Necron konnte es sich nicht erklären, aber das Antlitz der schlafenden Frau faszinierte ihn; weit mehr, als es beim Anblick einer schönen Frau normal gewesen wäre.
Was ihn so in seinen Bann schlug, war das … Geheimnis, das ihre Züge zu verbergen schienen.
Necron richtete sich auf und wandte sich dem zweiten Kristallsarg zu. Unter dem spiegelnden Deckel lag die entkleidete Gestalt eines jungen Mannes, schlank, aber so wohlproportioniert, wie sie nur sein konnte, das Gesicht kantig und hart, dabei aber von einer offenen, freundlichen Art; ein Gesicht, zu dem man sofort Zutrauen fassen musste. Ein Jungengesicht, trotz der harten Züge, die um Kinn und Mund lagen. In Necron löste es nichts anderes als eine Woge brodelnden Zornes aus. Shannon!, dachte er hasserfüllt.
Sein bester Schüler. Seine größte Hoffnung seit so vielen Jahrhunderten.
Und seine größte Enttäuschung.
Was hätte er darum gegeben, ihn vernichten zu können, ihn bezahlen zu lassen für den zweifachen Verrat, den er begangen hatte!
Aber er durfte es nicht. Noch nicht.
Mit einer entschlossenen Bewegung drehte sich Necron herum, ging zu einem niedrigen Tisch auf der anderen Seite des Raumes und kam kurz darauf zurück, einen braunen Lederbeutel in der Hand. Seine Lippen formten lautlose Worte, während er den Beutel öffnete und mit spitzen Fingern eine winzige Prise eines grauen Pulvers hervornahm, um es über den Sarg zu streuen.
Etwas Sonderbares geschah: Als wäre der Deckel aus stahlhartem Kristall gar nicht vorhanden, glitt das Pulver hindurch, senkte sich leicht wie fallender Schnee auf das Gesicht des bewusstlosen Mannes und schien in seine Haut einzudringen wie Wasser in einen Schwamm.
Necron trat zurück, knotete sorgfältig seinen Beutel wieder zu und wartete. Es dauerte lange – zehn, fünfzehn, schließlich zwanzig Minuten, aber dann begann sich die leblose Gestalt unter dem spiegelnden Kristall zu verändern; erst langsam, dann immer schneller und schneller. Seine Haut verlor ihre leichenhafte Blässe, wurde dunkler und nahm einen kräftigen, beinahe gesunden Farbton an, und schließlich hob sich seine Brust in einem ersten, noch mühsamen Atemzug.
Necron machte einen halben Schritt auf den Sarg zu und brach die Bewegung im letzten Moment wieder ab. Er musste sich gedulden. Er hatte so lange gewartet – was machten da wenige Minuten?
Trotzdem wurde die Zeit für ihn zur Qual, bis der Junge endlich die Lider hob. Sein Blick war noch trüb, es war der Blick eines Menschen, der aus einem tiefen, unendlich tiefen Schlaf erwachte und sich nicht gleich in der Wirklichkeit zurechtfand. Er versuchte die Hand zu heben, aber seine Kraft reichte nicht.
Mit einem entschlossenen Schritt trat Necron an den Kristallsarg heran und berührte den Deckel. Seine Lippen formten ein einzelnes, düster klingendes Wort, und wie von Geisterhand bewegt schwang die mannslange Kristallscheibe nach oben und zur Seite.
»Steh auf«, sagte Necron befehlend.
Shannon gehorchte. Seine Bewegungen waren ungelenk und steif wie die eines Kindes, das noch nicht richtig gelernt hatte, seinen Körper zu beherrschen, aber bereits während er aus dem gläsernen Sarg stieg und sich nach den bereitgelegten Kleidern bückte, auf die Necron schweigend deutete, wurde aus dem abgehackten Rucken seiner Glieder mehr und mehr ein fließendes, ungemein elegantes Gleiten. Als er sich schließlich herumdrehte und seinen Herrn ansah, schien seine Gestalt Kraft zu verströmen wie eine unsichtbare, dafür aber umso deutlicher fühlbare Aura. Necron spürte einen flüchtigen Anflug von Stolz, als er die schlanke Gestalt des jungen Mannes betrachtete, die Art von Stolz, die ein Vater beim Anblick seines wohlgeratenen Sohnes empfinden mochte oder ein Künstler beim Betrachten seines bisher besten Kunstwerkes. Shannon war sein Geschöpf, ganz allein. Er hatte ihn zu sich genommen, als er nicht einmal alt genug gewesen war, aus eigener Kraft zu stehen, und alles, was dieser junge Magier wusste, all die unglaublichen Kräfte, die tief in ihm schlummerten und die er zum allergrößten Teil noch nicht einmal selbst entdeckt hatte, jedes bisschen Wissen, stammte von ihm. In einem gewissen Sinne war Shannon viel mehr Necron als Shannon, vielleicht mehr als Necron selbst.
Und trotzdem würde er ihn zerstören müssen, wenn alles vorbei war. Selbst in Gedanken scheute Necron vor dem Wort töten zurück, denn für ihn war Shannon immer ein Werkzeug gewesen, erst in zweiter Linie ein Mensch, wenn überhaupt. Er hatte zweimal versagt, und er würde wieder versagen, wenn er nicht sehr Acht gab. Und Necron wusste, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem Shannon seine wahre Macht begriffen und sich ihrer zu bedienen gelernt hatte. Vielleicht würde er dann nicht mehr stark genug sein, seiner Herr zu werden. Aber bevor es soweit war, würde er ihn zerstören; ein Werkzeug, eine Waffe, die furchtbar in ihrer Wirkung war, und trotzdem misslungen. Er würde eine neue bauen. Einen neuen Shannon, irgendwann einmal. Er hatte Zeit.
Trotzdem stimmte ihn der Gedanke auf sonderbare Weise traurig. Obwohl er Shannon ob seines zweifachen Verrates hasste, gab es noch einen Rest von Zuneigung in ihm, eine Sympathie, die mit den Jahren gewachsen war und sich jeder Logik entzog.
Necron vertrieb den Gedanken und drehte sich mit einem Ruck um. Auf einen stummen Wink seiner Hand hin folgte ihm Shannon. Sie gingen zu einem niedrigen, mit Büchern und vom Alter brüchig gewordenen Pergamentrollen übersäten Tisch; Necron deutete mit einem dürren Finger auf eine Karte, die ausgerollt und an den Ecken mit Steinen beschwert worden war. Die Linien und Symbole darauf zeigten keine bekannte Landschaft dieser Welt und hätten auf jeden anderen den Eindruck eines sinnlosen, aber sonderbar düster wirkenden Gekritzels gemacht. Für den, der sie zu lesen verstand, waren sie die Konturen der Wirklichkeit, die Gezeitenströmungen zwischen den Welten.
»Der Moment ist gekommen«, sagte Necron. »Der Verräter Dagon flieht, Shannon, und mit ihm die, die ihm anhängen. Er hat sein Versteck verlassen und sich auf den Weg in eine andere Welt gemacht.« Er lächelte dünn. »Du weißt, was das bedeutet.«
Shannon nickte. Er antwortete nicht, denn er war nicht dazu aufgefordert worden, aber Necron wusste, dass er jedes Wort verstand.
»Du wirst gehen«, fuhr er fort. »Ich gebe dir noch einmal die Chance, dich zu bewähren, Shannon. Das, wonach wir so lange gesucht haben, befindet sich an Bord seines Schiffes. Nimm sechs Krieger deiner Wahl und hole es.«
Shannon nickte gehorsam, und Necron ließ mit einem neuerlichen, triumphierenden Lächeln die Hand auf die brüchige Karte klatschen. »Das erste der SIEBEN SIEGEL DER MACHT!« Seine Stimme zitterte vor Erregung. »Bring es mir, Shannon, und dein Verrat sei dir vergeben. Du weißt, wie viel davon abhängt.«
Shannon nickte abermals, trat einen halben Schritt von dem mit Karten und Büchern übersäten Tisch zurück und fragte: »Wann soll ich aufbrechen?«
»Jetzt gleich«, antwortete Necron. »Und beeile dich, denn du hast nicht viel Zeit. Ich werde diesen Fischgott bestrafen für das, was er unseren Herrn angetan hat«
»Was werdet Ihr tun, Herr?«, fragte Shannon.
Necron blickte ihn scharf an. In dem Ausdruck in Shannons großen, wasserklaren Augen war kein Falsch, kein Verrat, nicht einmal Zweifel – aber er hatte ihm nicht befohlen, diese Frage zu stellen. Hastig verstärkte er die geistige Fessel um Shannons Geist um eine Winzigkeit. Nicht so viel, dass seine Fähigkeit, logisch zu denken und blitzschnelle Entscheidungen zu fällen, in irgendeiner Form beeinträchtigt worden wäre, aber doch genug, auch noch den letzten Rest seines freien Willens zu ersticken. Dann antwortete er trotzdem.
»Das Schiff wird vernichtet, Shannon. Und mit ihm Dagon und alle, die bei ihm sind. Ich werde beginnen, sobald du fort bist. Du hast vier Stunden Zeit. Nicht mehr.«
Auf Shannons Gesicht war nicht die geringste Regung zu erkennen, als er nickte.
Necron deutete auf den Glassarg, in dem der junge Magier gelegen hatte. »Deine Waffen liegen bereit. Nimm sie, und dann geh.«
Shannon nickte abermals, wandte sich um und ging mit schnellen Schritten durch den Raum, um Necrons Befehl auszuführen. Als er fertig war und sich wieder umwenden wollte, streifte sein Blick die schlafende Mädchengestalt in dem zweiten Kristallsarg. Er stockte.
»Wer ist sie?«, fragte er. »Sie … ist sehr schön.«
Necron starrte ihn an. »Niemand, für den du dich zu interessieren hättest«, sagte er scharf. »Und nun geh – du hast deine Befehle.«
Gehorsam wandte sich Shannon um, durchquerte den Raum und zog die Tür hinter sich zu, ohne sich auch nur noch ein einziges Mal umzudrehen. Aber der Ausdruck in Necrons Augen war um eine weitere Winzigkeit besorgter geworden. Er hatte die Fessel um Shannons Geist so eng zusammengezogen, wie es nur ging, wollte er ihn nicht zu einer zwar gehorsamen, aber vollkommen nutzlosen Puppe machen; und trotzdem war es ihm nicht gelungen, eine hundertprozentige Kontrolle über Shannon zu erlangen. Vielleicht würde ihm das nie mehr gelingen. Vielleicht war Shannon schon jetzt stärker, als er selbst zu hoffen gewagt hätte.
Aber für das, was er tun musste, konnte das nur von Vorteil sein. Und wenn er zurückkam, dachte Necron entschlossen, würde er ihn zerstören.
Es war sonderbar – aber der Seegang war unter Deck der DAGON weitaus stärker zu spüren als oben. Die Treppe schien wie ein lebendes Wesen unter meinen Füßen zu beben und zu hüpfen, und wenn ich nicht Acht gab, dann versuchte sie mich abzuwerfen wie ein bockendes Pferd. Meine Knie zitterten, als ich endlich die letzte Stufe überwunden hatte und stehen blieb, um auf Bannermann zu warten.
Gegen das hell erleuchtete Rechteck des Aufganges war seine Gestalt nur als Schatten zu erkennen. Er bewegte sich mit der Leichtigkeit des erfahrenen Seemannes über die schwankenden Stufen, aber gleichzeitig strahlten seine Bewegungen eine ungemeine Kraft und Geschmeidigkeit aus.
»Wohin?«, fragte ich, als er neben mir angelangt war.
Bannermann deutete mit einer Kopfbewegung nach vorne, tiefer in die künstliche Nacht hinein, die das Innere der DAGON beherrschte. »Dort hinunter. Er ist bei den anderen, in den Passagierkabinen.«
Ich folgte ihm; schweigend und in einigem Abstand. Alles war so schnell gegangen, dass ich bis zu diesem Augenblick kaum Zeit gefunden hatte, auch nur einen einigermaßen klaren Gedanken zu fassen. Und nichts schien einen Sinn zu ergeben; das Hiersein eines Drachenkriegers ebenso wenig wie das plötzliche Auftauchen Bannermanns.
Ich beschloss, wenigstens eine dieser Fragen zu klären, und holte mit einigen raschen Schritten auf. »Wie lange sind Sie an Bord dieses Schiffes?«, fragte ich.
Bannermann hob andeutungsweise die Schultern. »Keine Ahnung, Craven. Ich … erinnere mich kaum. Ich bin in einer schmierigen Kaschemme aufgewacht, nachdem Frane und seine Schläger mich überwältigt haben, und danach …« Er stockte, suchte einen Moment vergeblich nach Worten und schüttelte den Kopf. »Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht haben sie mir irgendein Zeug gegeben, damit ich mich nicht richtig erinnere. Da war ein Boot, und ich glaube, für eine Weile war ich in einem Haus.« Er sah mich an. »Aber die nächste klare Erinnerung ist die DAGON. Ich bin seit ein paar Tagen hier, aber es ist verdammt schwer zu sagen, wie lange genau.« Er lächelte. Es wirkte hilflos. »Die Zeit scheint hier anders abzulaufen, verstehen Sie?«
»Ja«, sagte ich und schüttelte den Kopf. Bannermann lächelte erneut.
»Ich kann es auch nicht genau sagen«, fuhr er fort. »Manchmal bin ich stundenlang herumgelaufen, und es schien überhaupt keine Zeit vergangen zu sein, dann wieder …« Er stockte abermals. »Ach verdammt, wie soll ich Ihnen etwas erklären, das ich selbst nicht verstehe?«
Nun, zumindest in diesem Punkt verstand ich ihn, sehr gut sogar. Mir erging es ja auch nicht sehr viel besser.
»Und Sie?«, fragte er, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Wie kommen Sie hierher, Craven? Was haben Sie mit diesen Verrückten aus Firth’en Lachlayn zu schaffen?«
»Nichts«, antwortete ich ausweichend. »Ich bin aus … aus einem anderen Grund hier.«
Bannermann nickte. »Die NAUTILUS.«
Überrascht blieb ich stehen. »Woher wissen Sie davon?«
»Ich weiß eine Menge«, antwortete Bannermann lächelnd. »Ich hatte nicht sehr viel zu tun in den letzten Tagen. Und Dagon ist ein redseliger Bursche.«
»Sie kennen ihn?«
»Warum nicht?«, erwiderte Bannermann. »Ich weiß, dass Sie ihn für ein Ungeheuer halten, und wahrscheinlich haben Sie verdammt Recht damit, Craven. Aber er ist trotzdem ein Mensch. Ein ziemlich einsamer Mensch.« Plötzlich trat ein sonderbarer Ausdruck in seine Augen. »Wissen Sie, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht bei ihm bleiben will?«
»Und was haben Sie geantwortet?«, fragte ich.
»Noch nichts«, sagte Bannermann, ohne mich dabei anzusehen. »Die DAGON ist ein phantastisches Schiff. Und sie werden Seeleute brauchen, dort, wo sie hingehen.«
»Sind Sie verrückt, Bannermann?«, entfuhr es mir. »Reicht es nicht, dass diese Wahnsinnigen dort unten mit offenen Augen in ihr Unheil rennen?«
»Wer sagt das?«, erwiderte Bannermann ruhig. »Woher wollen Sie wissen, dass nicht Sie es sind, der sich irrt, und diese Menschen Recht haben?« Er lachte, aber es klang alles andere als amüsiert. »O ja, Craven, ich kann mir sehr gut vorstellen, was Sie jetzt denken. Aber Sie begehen einen Fehler, wenn Sie von sich auf alle anderen schließen. Nicht jeder hat so viel zu verlieren wie Sie. Die meisten dieser Leute sind ihr Leben lang bitterarm gewesen, und der einzige Luxus, den sie jemals kennen gelernt haben, war der, einmal ein paar Tage ohne Angst zu leben oder keinen Hunger zu haben.«
»Sie übertreiben, Bannermann«, sagte ich.
Bannermann machte eine zornige Handbewegung. »Mag sein, aber es ist trotzdem so. Wieso maßen Sie sich an, diesen Menschen das letzte bisschen Hoffnung zu nehmen, das ihnen geblieben ist?«
»Und McGillycaddy?«, fragte ich.
Bannermanns Gesicht verdüsterte sich. »Er und seine Mörderbande sind Verbrecher«, sagte er. »Kriminelle, die die Macht ausgenutzt haben, die ihnen gegeben wurde. Früher oder später werden sie ihre gerechte Strafe erhalten. Diese Menschen dort unten haben noch nicht gelernt, wie es ist, ohne Furcht zu leben. Aber sie werden es lernen.«
Ich sah ihn ungläubig an. »Das … hört sich an, als hätten Sie sich bereits entschlossen, was Sie Dagon antworten werden«, murmelte ich.
Bannermann antwortete nicht, aber er wich meinem Blick auch nicht aus, sondern starrte mich so fest und beinahe trotzig an, dass schließlich ich es war, der sich umwandte und schnell weiterging.
Als ich die Treppe hinunter zum Passagierteil in Angriff nehmen wollte, hielt mich Bannermann noch einmal zurück. »Hören Sie, Craven«, begann er. »Ich denke, es ist besser, wenn Sie noch niemandem sagen, was dort oben vorgefallen ist. Wir sollten eine Panik vermeiden.«
Ich widersprach nicht. Das war nicht der wahre Grund, das spürte ich genau, aber ich glaubte auch zu wissen, dass Bannermann seine Gründe hatte, so zu handeln. Und, verdammt, ich musste allmählich aufhören, hinter jedem Gesicht und jedem freundlichen Wort Verrat und Betrug zu wittern. Wenn ich schon anfing, meinen eigenen Freunden zu misstrauen, konnte ich gleich aufgeben!
»Und noch etwas«, sagte Bannermann, als ich weitergehen wollte. »Sagen Sie McGillycaddy und seiner Bagage noch nicht, dass ich hier an Bord bin. Er hat nämlich keine Ahnung, und ich möchte noch eine kleine Überraschung für ihn vorbereiten.«
Das Tor hatte sich wieder geschlossen. Wo vor Sekunden noch das grünliche Flimmern der Ewigkeit gewogt und Schatten aus dem Nirgendwo in die Welt der Lebenden gegriffen hatten, war jetzt wieder eine massive, aus uralten rissigen Bohlen gefertigte Tür. Das einzige Auffallende an ihr war das komplizierte, aus Gold und edlen Steinen gefertigte Siegel, das dort prangte, wo ihr Schloss sein sollte.
Shannon und die sechs Krieger waren gegangen, um im gleichen Augenblick an einem Ort, mehr als zehntausend Meilen entfernt und auf der anderen Seite der Welt, wieder aufzutauchen.
Necron taumelte.
Es war ihm niemals leicht gefallen, nur kraft seines Willens ein Tor zu öffnen, etwas, wozu andere wochenlange Beschwörungen und die kompliziertesten Vorbereitungen nötig gehabt hätten. Aber heute war es ungleich schwerer gewesen; ein Vorhaben, das selbst seine Kräfte beinahe überstieg und ihn ausgelaugt und bis an die Grenze echten körperlichen Schmerzes erschöpft zurückließ.
Die wuchtige Eichenholztür und die graue, spröde gewordene Wand, in die sie eingelassen war, begannen vor seinen Augen zu verschwimmen, und auf seiner Zunge lag ein widerlicher Geschmack wie nach Kupfer. Sein Herz jagte. Dabei war es nicht einmal so sehr die Anstrengung gewesen, das Siegel zu öffnen. Aber er hatte das Andere gespürt, den fremden Einfluss, der plötzlich da war wie eine unsichtbare Hand, die seinen Griff sprengen und das Tor in etwas Anderes, Fremdes verwandeln wollte.
War es schon soweit?
Er hatte sehr lange auf diesen Augenblick gewartet, aber jetzt, als er heran war, musste er sich eingestehen, dass er nichts über ihn wusste. Die Sterne standen günstig, und alle Zeichen sagten, dass dies der Moment war, aber keines von ihnen sagte ihm, was er tun musste, welche Gefahren ihm auf dem Weg begegnen mochten und wie er ihnen widerstehen konnte.
Schaudernd wandte sich der alte Mann um und ging zurück zu seinem Tisch, auf dem der Stapel von Büchern und Pergamenten weiter gewachsen war. Auch sie halfen ihm nicht weiter. Selbst die ältesten der alten Schriften schwiegen, und selbst im NECRONOMICON selbst, dem Buch der Bücher, war nichts über die SIEBEN SIEGEL DER MACHT zu finden, nicht mehr, als er ohnehin wusste: dass es sie gab und dass er sie brauchte, wollte er nicht scheitern und einen furchtbaren Preis dafür zahlen.
Sein Blick suchte die Schatten, die wie finstere Spinnentiere in den Ecken nisteten. Natürlich waren sie leer, und natürlich waren sie nichts weiter als die Abwesenheit von Licht – und trotzdem erfüllten sie ihn mit einer unglaublichen Furcht, wusste er doch, was sich dahinter verbarg.
Du bist noch nicht fertig, wisperten die Schatten, da ist noch etwas, das du tun musst.
Necron nickte. Er war sich nicht sicher, ob er die Stimme wirklich gehört hatte oder ob sie seiner Phantasie entsprang, aber das blieb sich gleich. Ob er zu ihm sprach oder nicht, er war da, körperlos und unsichtbar, überall zugleich und doch nirgends, und nicht die geringste seiner Handlungen, nicht der geheimste seiner Gedanken konnte seiner Aufmerksamkeit entgehen.
Fast hätte er gelacht. Was würden sie wohl denken, all die Unzähligen, die sich vor Furcht krümmten, wenn sie auch nur seinen Namen hörten? Was würden sie sagen, wenn sie wüssten, dass auch ihm, Necron, dem Herrn der Schatten und der Nacht, dem Mann, dessen Name Furcht und Tod war, die Angst ein wohlvertrauter Freund war? Dass auch er seine Tage in Furcht verbrachte; Furcht vor einem Wesen, das so schrecklich war, dass sein bloßer Anblick einen normalen Menschen um den Verstand gebracht hätte?
Aber sie wussten es ja nicht.
Necron atmete tief ein, beugte sich wieder über das aufgeschlagene Buch und begann mit seinem dürren Zeigefinger die Linien auf dem brüchigen Pergament abzufahren. Die Buchstaben, die er sah, gehörten zu keiner bekannten Sprache, zu keiner Schrift, die irgendein anderer Mensch auf der Welt zu entziffern in der Lage gewesen wäre. Für ihn waren sie so klar wie gedruckte Worte. Nur tausend Mal furchtbarer in ihrer Bedeutung.
Selbst er zögerte, als sein Finger die gesuchte Zeile fand und unter den unheiligen Worten verharrte. So mächtig er war, hatte er bisher nie gewagt, diesen Fluch auszusprechen, den Bann zu lösen und den UNAUSSPRECHLICHEN zu befreien.
Aber sein Zögern währte nur einen Augenblick. Was getan werden musste, duldete keinen Aufschub. Seine Feinde waren listig und schlau, und Necron hatte nie zu denen gehört, die den Fehler begingen, ihre Gegner zu unterschätzen. Er konnte sich keinen Fehler leisten. Wenn er versagte, dann erwartete ihn ein Schicksal, das hundert Mal schlimmer war als die Hölle der Christen.
Mit einem entschlossenen Ruck stand er auf, legte beide Hände mit gespreizten Fingern auf die aufgeschlagenen Buchseiten und begann Worte zu sprechen. Worte in einer uralten, seit Millenien vergessenen Sprache.
Worte, die scheinbar ohne die geringste Wirkung blieben. Hier, tief unter den natürlich gewachsenen Grundmauern der Drachenburg, war dem auch so.
Aber zehntausend Meilen entfernt und auf der anderen Seite der Welt stießen sie die Tore des Chaos auf.
Das, was Bannermann als Passagierkabine bezeichnet hatte, war in Wirklichkeit ein gewaltiger, beinahe schiffsgroßer Saal, dessen Decke sich gute fünfzig Fuß hoch spannte und gewölbt wie die einer Katakombe war. Die knapp zweihundert Männer und Frauen, die im ersten Licht des Morgens an Bord der DAGON gegangen waren, saßen verteilt auf einer Anzahl hölzerner Stühle und Bänke, die sich vergeblich bemühten, dem Raum einen Anstrich von Wohnlichkeit zu verleihen. Er war zu groß dafür, und das nackte Holz seiner Wände ließ mich eher an einen Viehtransporter denken denn an ein Schiff, in dem Menschen in eine neue Welt reisen wollten.
Ich vertrieb den Gedanken, blieb unter der Tür stehen und sah mich aufmerksam um. Von Jennifer und ihrer Mutter war keine Spur zu entdecken, wie ich mit einem leisen Gefühl der Enttäuschung feststellte. Dafür entdeckte ich McGillycaddy und seinen Schlägertrupp.
Es waren nicht einmal sehr viele. Nachdem Frane verschwunden war – ich hatte einen Teil des Morgens damit zugebracht, vergeblich nach ihm Ausschau zu halten – blieben McGillycaddy ein knappes halbes Dutzend Männer. Es war mir ein Rätsel, wie es diese Hand voll Krimineller jemals geschafft hatte, ein ganzes Dorf zu tyrannisieren.
Aber selbst jetzt verbreiteten sie noch Furcht wie einen üblen Geruch. Obwohl der Saal gewaltig war, waren zweihundert Menschen doch mehr als genug, ihn zu füllen; an den meisten Tischen herrschte drückende Enge, und nicht wenige hatten sich in Ermangelung eines Sitzplatzes auf dem Fußboden oder den Tischplatten niedergelassen. Aber McGillycaddy und seine Kumpane saßen allein, inmitten eines unregelmäßigen Kreises leer gebliebener Stühle und Bänke.
McGillycaddys Gesichtsausdruck nach zu schließen, schien er dieses Gefühl der Macht sichtlich zu genießen.
Rasch näherte ich mich dem Tisch, den er mit seinen Kumpanen besetzt hatte, starrte demonstrativ an ihm vorbei und ging weiter, in Richtung auf die zweite, etwas schmalere Tür, die tiefer ins Schiff hineinführte.
Ich war nicht sonderlich überrascht, als McGillycaddy sich im letzten Moment herumdrehte und das Bein vorstreckte, sodass ich entweder einen größeren Schritt machen oder darüber fallen musste, wäre ich weitergegangen.
Ich tat keines von beiden, sondern blieb stehen.
»Wo wollen Sie hin, Craven?«, fragte er lauernd. »Da hinten ist absolut nichts, was Sie interessieren dürfte.«
Einen Moment lang überlegte ich ernsthaft, ihn schlichtweg zu hypnotisieren, um mir so freie Bahn zu verschaffen.
McGillycaddy hatte viel von seinem unheimlichen Flair verloren. In der Nacht am See, während er im Schein des Scheiterhaufens gestanden und mit hoch erhobenen Armen seine Beschwörungsformel rezitiert hatte, war er selbst mir unheimlich und mächtig erschienen, viel weniger Mensch als ein Dämon, den die Nacht ausgespieen hatte. Jetzt machte er auf mich nur noch den Eindruck eines gemeinen Verbrechers. Und mehr war er wohl auch nicht. Der Gedanke, ihm zu suggerieren, dass er in Wirklichkeit ein Kaninchen war, um ihn dann zur allgemeinen Belustigung mit komischen Sprüngen durch die Messe hüpfen zu lassen, gefiel mir immer besser. Aber dann verwarf ich ihn wieder. Für solcherlei Spielereien war im Moment weiß Gott keine Zeit.
»Geben Sie den Weg frei«, sagte ich steif. »Ich muss zu Dagon.«
»Ach?«, sagte McGillycaddy. »Das müssen Sie? Davon hat er mir nichts gesagt.«
Allmählich begann meine Geduld nachzulassen. Behutsam streckte ich einen geistigen Fühler aus und tastete sein Bewusstsein ab. »Es gibt etwas, was er wissen muss«, sagte ich. »Und zwar sofort!«
McGillycaddy schüttelte stur den Kopf. »Glaub ich nicht«, sagte er und grinste. »Er weiß alles, was auf diesem Schiff vorgeht, Craven. Hauen Sie ab, ehe ich ungemütlich werde.«
Nein, dachte ich zornig. Ein Kaninchen war ein zu hübsches Tier. Einen Moment lang musterte ich McGillycaddy durchdringend, dann fand ich den passenden Vergleich und verstärkte meinen geistigen Druck ein wenig. McGillycaddy zuckte zusammen. Seine Augen wurden rund vor Schreck. Er wollte aufstehen, aber stattdessen fiel er plötzlich nach vorne, presste das Gesicht gegen die raue Tischplatte und begann lautstark zu schnüffeln, wobei er grunzende Laute ausstieß. Seine Kumpane starrten ihn mit wachsender Verwirrung an, während McGillycaddy vergeblich versuchte, mit einem nicht vorhandenen Schweineschwanz zu wedeln.
»Hör mit dem Unsinn auf, Robert Craven!«, sagte eine scharfe Stimme.
Gehorsam entließ ich McGillycaddy aus der Vorstellung, ein Schwein zu sein, drehte mich um und stieg über sein noch immer vorgestrecktes Bein hinweg, wobei ich ihm ganz aus Versehen kräftig auf die Zehen trat. Die Tür hatte sich geöffnet, und unter der Öffnung war eine hochgewachsene, fischgesichtige Gestalt erschienen.
»Wieso Unsinn?«, fragte ich. »Ich wollte ihm nur helfen, auch so auszusehen, wie er sich benimmt.«
Ich war nicht ganz sicher – aber für einen Moment glaubte ich beinahe, ein amüsiertes Lächeln über Dagons fremdartige Züge huschen zu sehen. Aber er wurde sofort wieder ernst. »Komm«, sagte er nur.
Verfolgt von McGillycaddys zyankalitriefenden Blicken verließ ich den Raum und ging hinter Dagon durch einen schier endlosen, niedrigen Gang. Ich versuchte nicht, mir den Weg einzuprägen, denn das war auf der DAGON ziemlich sinnlos. Ich war mir nicht einmal sicher, ob dieses phantastische Gebilde überhaupt ein Schiff war oder nur etwas, dem Dagon aus Gründen, die ich nicht einmal zu erraten mochte, dieses Aussehen gegeben hatte.
Wir gingen eine Treppe hinauf, durchquerten einen mit Kisten und Säcken vollgestopften Raum und betraten eine kleine, überaus prachtvoll eingerichtete Kabine, die im Heck des Schiffes liegen musste, denn durch drei gewaltige, mit farbigem Bleiglas versehene Fenster an der Rückseite fiel helles Tageslicht herein.
Wir waren nicht allein – auf einem mit seidenen Kissen drapierten Diwan links der Tür saß Jennifer, nicht mehr nackt, wie ich sie unter Wasser gesehen hatte, sondern mit einem goldbestickten Umhang bekleidet und über und über behängt mit den kostbarsten Schmuckstücken. Und beiderseits der Fenster hockten zwei von Dagons Kaulquappenkreaturen wie riesige schwammige Kröten.
Dagon winkte ungeduldig mit der Hand, die Tür zu schließen, ging zu einem Stuhl unter dem Fenster und ließ sich hineinfallen. Mir fiel auf, wie fahrig seine Bewegungen wirkten und wie fiebrig der Glanz seiner Augen war. Entweder war er nervös, dachte ich – oder krank.
»Was willst du?«, fragte Dagon. »Ich habe dir gesagt, dass ich dich rufen werde, wenn du gebraucht wirst.«
Einen Moment lang starrte ich ihn verwirrt an. Er musste doch wissen, weshalb ich gekommen war. In diesem Punkte hatte McGillycaddy durchaus Recht – was immer auf diesem Schiff vorging, konnte Dagon nicht verborgen bleiben. Immerhin las er meine Gedanken.
Aber sein Blick sagte mir, dass das nicht stimmte. Er hatte keine Ahnung!
»Es ist … etwas geschehen«, sagte ich stockend. »Oben an Deck.«
»So?«, fragte Dagon lauernd. »Was?«
Verwirrt blickte ich erst ihn, dann Jennifer und dann wieder ihn an, fuhr mir nervös mit der Zungenspitze über die Lippen und setzte von neuem an. »Ich war oben, Dagon. Ich wollte mich umsehen, und –«
»Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?«, unterbrach mich Dagon.
»Zum Teufel, ich habe einen Toten gefunden!«, fuhr ich auf. »Einen Mann, der auf diesem Schiff absolut nichts zu suchen hat! Einen von Necrons Drachenkriegern!«
Fünf, zehn, fünfzehn Sekunden lang starrte mich Dagon schweigend an, und es war ein Blick, unter dem ich mich zunehmend unwohler zu fühlen begann. »Einen Toten?«, wiederholte er schließlich. »So. Und wie kommt es, dass ich nichts davon weiß?«
Jetzt war ich an der Reihe, perplex zu sein. Dagon sagte die Wahrheit. Es war verrückt – er las meine Gedanken, so mühelos, wie ich ein Buch zu lesen imstande war, aber er wusste nichts von dem Toten, den ich gefunden hatte.
Plötzlich verzerrte sich sein Gesicht vor Zorn. »Versuche nicht, mich zu betrügen, Robert Craven!«, sagte er mit einer Stimme, die mehr dem Zischeln einer wütenden Schlange ähnelte als der eines Menschen. »Wir haben eine Abmachung getroffen, und obwohl ich es nicht einmal nötig hätte, halte ich mich daran. Deine Freunde sind frei, und ich habe ein Übriges getan und dem Narren Lovecraft und seinem Begleiter ein neues Leben geschenkt. Jetzt halte auch du deinen Teil. Oder versuche wenigstens, ein bisschen intelligenter zu sein, wenn du mich schon belügen willst«, fügte er hämisch hinzu.
»Aber ich … ich habe ihn gesehen!«, verteidigte ich mich. »Er war da, und irgendetwas hat ihn auf furchtbare Weise umgebracht, Dagon. Etwas, das noch an Bord des Schiffes ist. Ich habe ihn berührt, mit eigenen Händen, und –«
Ich hob die Arme, streckte Dagon beinahe anklagend die Hände entgegen und sprach nicht weiter. Ich erinnerte mich gut an das furchtbare Gefühl, als ich den Toten angefasst hatte. An die widerliche Wärme und Klebrigkeit seines Blutes, das meine Finger verschmierte.
Aber davon war jetzt keine Spur mehr zu sehen. Meine Hände waren sauber, als hätte ich sie stundenlang geschrubbt.
Der Raum musste sich tief im Leib des Schiffes befinden, denn unter dem hölzernen Gitter, das den Boden bildete, schwappte Wasser, und die Luft schmeckte abgestanden und bitter. Dann und wann war ein dumpfes, stöhnendes Ächzen zu hören, das aus den Wänden zu dringen schien.
Der Kreis grünlicher Helligkeit war da aufgeflammt, wo bis vor Sekunden noch undurchdringliche Schwärze gewogt hatte, ein mannsgroßes Rad flirrenden grünen Lichtes. Der Vorgang war lautlos, aber es schien, als fauche ein körperloser Wind aus dem Riss in der Wirklichkeit hervor, der Kälte mit sich brachte, den Hauch einer anderen Welt.
Die Männer waren nacheinander aus dem Tor getreten, so lautlos und schnell, wie sie sich immer zu bewegen pflegten, mit der Eleganz von Raubkatzen. Die eine oder andere Bewegung wirkte noch nicht ganz koordiniert, und hier und da glaubte Shannon ein schmerzhaftes Flackern in einem Blick zu bemerken, Schweißtropfen auf einer halb von schwarzem Tuch verhüllten Stirn trotz der beißenden Kälte, das Zittern einer behandschuhten Hand.
Auch Shannon fühlte ein starkes körperliches Unwohlsein, etwas, das sich wie ein Schmerz in seinen Gliedern eingenistet hatte. Der Durchgang durch das Tor war anders gewesen als die Male zuvor. Die Schmerzen, die Kälte und das furchtbare Gefühl eines nicht enden wollenden Sturzes durch das Nichts waren wie immer gewesen, aber etwas hatte sie begleitet, etwas wie ein Schatten aus den Dimensionen des Irrsinns, die sie durchschnitten hatten. Für einen kurzen Moment ergriff die Angst von seinem Herzen Besitz.
Der grüne Kreis hinter der Reihe seiner Krieger begann sich rascher zu drehen, verwandelte sich in ein Flammen speiendes Rad, das dünne feurige Finger bis zur Decke und den Wänden schickte. Auch das war nicht normal, wusste Shannon. Er wartete.
Ewigkeiten schienen zu vergehen, Ewigkeiten, die in Wahrheit nur Minuten waren, aber so, wie die Tore den Raum verzerrten, verbogen und verwandelten sie auch die Zeit. Schließlich begann das helle Zentrum des Lichtkreises zu vibrieren. Etwas Dunkles, Körperloses erschien wie die Pupille eines Dämonenauges im Zentrum des Rades und wuchs rasend schnell heran.
Es war wie ein brodelnder Ball aus Nebel, der lautlos aus dem Tor herausglitt, flackernd und ohne fest umrissene Konturen. Ein dünner, rauchiger Strang begann aus dem Ball hervorzuwachsen, tastete sich ziellos wie ein blinder Wurm durch die Luft und näherte sich Shannons Gesicht.
Der junge Magier musste sich mit aller Macht beherrschen, als der Nebelfaden seine Stirn berührte. Er spürte … Kälte. Zorn. Den Willen, zu töten. Schlimmer, zu vernichten. Alles zu zerstören, was Bestand hatte, nicht nur das Leben, sondern die Materie selbst zu zerstören, bis nur noch Chaos zurückblieb.
Dann etwas wie ein Tasten. Ein Suchen und Sondieren und Erkennen, dann ein plötzliches, beinahe schmerzhaftes Zurückziehen des fremden Etwas, das seinen Geist durchleuchtet hatte.
Der Strang aus Nebel und Nichts löste sich von seinem Gesicht, tastete weiter blind umher und berührte den ersten seiner Männer. Shannon sah die Furcht in seinen Augen aufflammen, als er die Berührung des UNAUSSPRECHLICHEN spürte, aber so wie bei ihm zuvor, zog sich der Arm nach einer kleinen Weile zurück, glitt weiter, berührte den nächsten Krieger, den übernächsten …
Als es vorbei war, waren sie sicher. Das Wesen hatte sie als Verbündete erkannt. Shannon wusste es mit der gleichen, durch nichts begründeten Sicherheit, mit der er wusste, was dieser Ball aus brodelnder Schwärze bedeutete.
Aber es war eine Sicherheit, die nicht lange währte. Vier Stunden, hatte Necron gesagt. Vier Stunden, das SIEGEL zu finden und zu holen. Dann würde mit dem UNAUSSPRECHLICHEN das Chaos über dieses Schiff hereinbrechen.
Und über alles und jeden, der sich an Bord befand. Mit einem Ruck drehte sich Shannon herum und begann lautlos auf den Ausgang zuzuhuschen. Seine Männer folgten ihm, und kurz nachdem sie den Raum verlassen hatten, begann das Tor endgültig zu erlöschen, der Ball aus dunklem Nebel zu verblassen.
Lautlos folgte er den sieben schwarz verhüllten Gestalten der Drachenkrieger. Er war jetzt unsichtbar.
Aber da, wo er entlangglitt, begann sich die Wirklichkeit zu verändern …
Ich war wieder an Deck gegangen. Die Kälte hatte zugenommen und die brodelnde Wand aus Nebel, der Riss in der Wirklichkeit, auf den die DAGON zusteuerte, war breiter geworden, eine klaffende Schlucht, die das Schiff und alles, was darauf war, verschlingen würde.
Trotzdem zog ich den Anblick dem der Menschenmenge unter Deck des Schiffes vor. Ich wusste, dass ich mich irrte, aber mich erinnerten die gut zweihundert Männer und Frauen im Rumpf der DAGON immer mehr an eine Schafherde, die sich widerstandslos zusammentreiben lässt, um zur Schlachtbank zu ziehen. Was, dachte ich, wenn Dagon gelogen hatte? Wenn nicht eine neue Welt, sondern der Tod oder Schlimmeres auf diese Menschen wartete?
Der Gedanke, der daraus folgerte, war furchtbar.
Wenn es – so war, dann trug ich die Schuld am Tode von zweihundert Menschen, denn all seine Macht hätte Dagon nichts genutzt, wäre ich nicht freiwillig an Bord dieses Schiffes gekommen.
Meine Hand glitt beinahe von selbst in die rechte Tasche meines Rockes, schloss sich um das goldene Amulett und zog es hervor. Es fühlte sich kühl an, sehr schwer und so glatt, als wäre es sorgsam poliert worden, dabei war seine Oberfläche alles andere als eben, sondern von verwirrenden Linien und Mustern zerfurcht.
Die Vorstellung, dass dieses so harmlos aussehende Stück Edelmetall über das Schicksal eines ganzen Dorfes entscheiden sollte, erschien mir lächerlich. Dagon hatte mir bisher – trotz meiner bohrenden Fragen – nicht gesagt, welche Bewandtnis es mit diesem Amulett hatte.
Ich drehte das scheinbar nutzlose Ding ein paar Mal in den Händen, seufzte tief und wollte es wieder wegstecken, als ich eine Bewegung wahrnahm. Als ich mich umdrehte, erkannte ich Bannermann, der offensichtlich hier oben auf mich gewartet und bisher hinter einem der mächtigen Masten gestanden hatte. Jetzt trat er auf mich zu, lächelte flüchtig und deutete mit der Hand auf den goldenen Stern in meinen Fingern.
»Ist es das?«, fragte er.
»Was?«
»Andaras Amulett«, antwortete Bannermann.
Ich nickte, machte Anstalten, es vollends einzustecken, aber Bannermann streckte fordernd den Arm aus, und nach kurzem Zögern ließ ich den goldenen Stern in seine Hand fallen.
»Woher wissen Sie davon?«, fragte ich.
Bannermann strich fast behutsam mit den Fingerspitzen über die dünnen Linien, die in das Gold graviert worden waren. »Ihr Vater hatte es bei sich, als wir mit der Lady Schiffbruch erlitten haben«, sagte er. »Ich erinnere mich daran. Ich bin zwar alt, aber mein Gedächtnis funktioniert noch ganz gut.« Er lächelte, hielt den goldenen Stern in die Sonne und reichte ihn mir dann zurück. »Außerdem hat mir Dagon erklärt, dass er ihn braucht«, fügte er hinzu.
»Wozu?«, fragte ich.
Bannermann zuckte mit den Achseln. »Sind Sie hier der Hexer oder ich?«, fragte er in halb scherzhaftem, halb ernstem Ton. »Vielleicht reicht es schon, wenn es an Bord ist.« Er seufzte, drehte sich herum und blickte aus zusammengekniffenen Augen in den wogenden Nebel vor dem Bugspriet des Schiffes. »Wahrscheinlich sogar«, fuhr er fort, leise und ohne mich dabei anzusehen. »So, wie ich diesen wandelnden Hering einschätze, würde er es nicht zulassen, von irgendjemandem abhängig zu sein. Von Ihnen schon gar nicht.«
Ich antwortete nicht. Bannermanns bewusst scherzhafter Ton täuschte mich keine Sekunde. Er hatte nicht nur auf mich gewartet, um Konversation zu machen, sondern aus einem ganz bestimmten Grund.
Plötzlich drehte er sich herum, sah mich durchdringend an und fragte ganz leise: »Warum haben Sie es getan, Robert?«
»Was?«, erwiderte ich verwirrt.
Bannermann deutete mit einer fast zornigen Geste auf die Tasche, in der ich den goldenen Stern hatte verschwinden lassen. »Sie wissen, dass Dagon dieses Amulett braucht«, sagte er. »All seine Vorbereitungen und Zauberkunststückchen hätten ihm nichts genutzt ohne dies. Vielleicht wäre er jetzt schon tot.«
Ich wollte widersprechen, aber ich konnte es nicht, denn in Bannermanns Worten lag ein unüberhörbarer Vorwurf, der sich wie eine glühende Messerklinge in meine Brust bohrte.
»Was … was soll das, Bannermann?«, stammelte ich hilflos. »Vor nicht einmal einer halben Stunde haben Sie praktisch das Gegenteil behauptet. Sie waren es, der –«
»Ich weiß, was ich gesagt habe, Craven«, unterbrach mich Bannermann zornig. »Und was die Leute aus Firth’en Lachlayn betrifft, bleibe ich dabei. Aber das war nicht der Grund, aus dem Sie hier sind. Sie hatten es in der Hand, Dagons Flucht zu verhindern. Sie hatten es in der Hand, ihn zu vernichten, ihn und seine ganze schwarze Brut.« Er schüttelte den Kopf, drehte sich wieder herum und starrte in den grauen Nebel, aber nur, um sich nach Sekunden erneut an mich zu wenden. Seine Stimme klang verändert, als er weitersprach. »Verzeihen Sie, Craven. Ich wollte Sie nicht verletzen. Es war wegen Howard und Rowlf, nicht wahr?«
»Gibt es irgendetwas, was Sie nicht wissen?«, fragte ich.
Bannermann lächelte. »Nicht viel«, gestand er. »Aber ich verstehe nicht alles von dem, was ich weiß. Wie kommt es, dass Sie das Leben von zweihundert Männern und Frauen aufs Spiel setzen, um das von zwei Männern zu retten?«
»Sagten Sie nicht selbst, dass sie nicht in Gefahr sind?«, fragte ich trotzig.
Bannermann nickte. »Natürlich. Aber das konnten Sie nicht wissen, als Dagon Sie vor die Alternative stellte.«
»Ich habe ihr Leben nicht aufs Spiel gesetzt«, verteidigte ich mich. »Ich habe –«
»Nicht einmal daran gedacht, als Sie sich entschieden«, unterbrach mich Bannermann. »Nicht wahr?«
Ich starrte ihn an, ballte in hilflosem Zorn die Fäuste – und nickte. Bannermann hatte Recht. Als ich Dagon gegenüberstand und die Alternative hatte, ihn aufzuhalten oder das Leben meiner Freunde zu retten, hatte ich an nichts anderes gedacht als an Howard und Rowlf, die beiden einzigen Freunde, die mir geblieben waren.
»Was soll das, Bannermann?«, murmelte ich betroffen. »Ein Verhör? Zu einem Tribunal fehlen Ihnen noch ein paar Mann.«
»Kein Verhör«, verbesserte mich Bannermann sanft. »Ich versuche mir nur darüber klar zu werden, was in Ihrem Kopf vorgeht, Craven. Ich versuche, Ihre Beweggründe zu begreifen. Ihr Handeln ist nicht logisch.«
»Das Wort Freundschaft haben Sie wohl noch nie gehört, wie?«, fragte ich böse.
»Doch«, antwortete Bannermann, »Aber ich verstehe nicht, warum Sie –«
Der Rest seines Satzes ging in einem urgewaltigen Dröhnen unter, das die DAGON erschütterte.
Es ging unglaublich schnell, und Dutzende von Dingen schienen gleichzeitig zu geschehen:
Über dem Schiff erlosch der Himmel. Wo gerade noch strahlender Sonnenschein gewesen war, erstreckte sich plötzlich eine nachtschwarze Kuppel aus Licht schluckender Finsternis, durchzuckt von Blitzen, die wie spinnenfingrige blauweiße Hände über den Himmel rasten. Rings um die DAGON begann das Meer zu kochen, warnungslos, von einer Sekunde auf die andere. Haushohe Gischtwolken stoben auf, Wogen, höher als die Bordwand des Schiffes, rasten über die See, und mein erschrockener Aufschrei ging im ununterbrochenen Krachen und Bersten apokalyptischer Donnerschläge unter. Ein ungeheures Wimmern und Heulen erfüllte die Luft, und hoch über unseren Köpfen blähten sich die gewaltigen Segel der DAGON mit einem Schlag, der das Schiff bis in den letzten Winkel erzittern ließ.





























