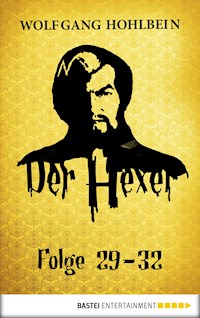
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Unter dem Vulkan" - Folge 29 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Über das Meer wehten Schreie heran, Schreie voller Angst und Tod und Wahnsinn. Die Nacht war zerrissen vom Peitschen der Schüsse und dem Prasseln und Krachen der brennenden Häuser, und dann und wann durchbrach ein fürchterlicher, brüllender Laut das höllische Crescendo; ein Geräusch, das den Männern an Bord der ZUIDERMAAR einen eisigen Schauer über den Rücken jagte und ihre Seelen erstarren ließ. Denn es war kein Laut, wie ihn die Kehle irgendeines lebenden Wesens hervorbringen konnte...
"Krieg der Götter" - Folge 30 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Das Wesen bewegte sich träge in der Strömung. Sein Leib, aufgequollen und unförmig, erinnerte eher an ein von der Brandung zerschlagenes Stück Treibholz, eingewoben in ein Netz von Fäden und knotigen Anhängseln, die sich erst bei genauerer Betrachtung als Gliedmaßen erwiesen. Endlos lange hatte es wie tot dagelegen, nicht geatmet, sich nicht bewegt. Nur die Strömung hatte dann und wann mit einem seiner Glieder gespielt, die mächtigen, ledrigen Schwingen gepackt und entfaltet oder seinen gewaltigen Leib gegen den Felsen geschleudert. Und doch lebte es. Ein schreckliches, unheiliges Leben...
"Die Hand des Dämons" - Folge 31 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Der Wald war wie eine düstere Wand aus ineinander verwobenen Schatten und mannshohem Unterholz, die nicht nur das Licht, sondern auch jeden Laut wie ein gewaltiger Schwamm aus gestaltgewordener Nacht verschluckte. Die Kronen der knorrigen, uralten Bäume waren im Lauf der Jahrhunderte zu einem fast undurchdringlichen Dach zusammengewachsen, da auch am hellen Tage noch einen Zustand beständiger Dämmerung erzeugte, und angesehen vom monotonen Prasseln der Regentropfen auf den Blättern war es totenstill. Nicht einmal Vogelzwitschern war zu vernehmen, als spürte selbst die Tiere die verderbliche Magie dieses Ortes.
"Im Netz der toten Seelen" - Folge 32 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Wie ein Leichentuch aus gewobener Finsternis hüllte die Nacht Arcenborough ein. Schwere, dunkle Wolken hatten sich vor die schmale Sichel des Mondes geschoben, als wollte selbst er sich vor dem Schrecken verbergen, der sich lautlos durch das kleine Dorf bewegte. Die schmalen Gassen waren menschenleer, nur die vereinzelt aufgestellten Laternen warfen verschwommene Lichtflecken auf das nasse Pflaster. Dort konnten sie die Nacht nicht erhellen. Es war, als verschlucke ein substanzloser Schleier ihr Licht bereits nach wenigen Yards. Und es war still. Unheimlich still ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Ähnliche
Inhalt
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Unter dem Vulkan
Der Hexer – Krieg der Götter
Der Hexer – Die Hand des Dämons
Der Hexer – Im Netz der toten Seelen
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 29-32:
Der Hexer – Unter dem Vulkan
Der Hexer – Krieg der Götter
Der Hexer – Die Hand des Dämons
Der Hexer – Im Netz der toten Seelen
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 29–32
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1575-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 29-30
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 29 bis 30.
Mit den drei E-Books (28 bis 30) endet der erste große Zyklus innerhalb der Hexer-Serie, wahlweise Dagon- oder Krakatau-Zyklus genannt, und das auf äußerst spektakuläre Weise, die auch bei den Lesern bei der Erstveröffentlichung großen Anklang fand. Der Abschlussband – ursprünglich Heft 21 »Krieg der Götter« – belegte seinerzeit bei einer Umfrage nach den beliebtesten Romanen der ersten dreißig Hefte unangefochten den ersten Platz.
Wie bei vielen anderen Ereignissen innerhalb der Serie vermischen sich auch hier Fiktion und Realität. Der Ausbruch des Krakatau am 27. August 1883 ist geschichtlich belegt und gilt noch heute als eine der schrecklichsten Naturkatastrophen aller Zeiten. Mehr als 36.000 Menschen fanden dabei den Tod, hauptsächlich aufgrund der gut dreißig Meter hohen Flutwelle, die die Küsten der umliegenden Inseln verwüstete.
Innerhalb des Hexer-Universums handelt es sich jedoch nicht um eine reine Naturkatastrophe, sondern um den Höhepunkt im Krieg dämonischer Götter. Dagon und die anderen Magier von Maronar versuchen zusammenmit abtrünnigen Tempelherren auf der Vulkaninsel die Thul Saduun zu erwecken, mächtige Dämonen und Erzfeinde der GROSSEN ALTEN, was diese unter allen Umständen verhindern wollen.
Bereits im vorherigen Buch wurde Robert Craven durch ein magisches Tor zurück ins Jahr 1883 geschleudert. Um ihn zu retten, offenbart Howard Lovecraft nun seine magischen Kräfte. Er war einst der Time-Master des Templerordens und besitzt die Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren. Mit Hilfe des geheimnisvollen Mädchens Jennifer versetzt er die NAUTILUS um zwei Jahre in die Vergangenheit.
Genau wie Robert gerät auch das Unterseeboot unter dem Kommando des legendären Kapitän Nemo in den Krieg der uralten Dämonenrassen, in dem nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und alle Beteiligten müssen inmitten des ausbrechenden Infernos um ihr Leben kämpfen.
Erleben Sie einen der großen Höhepunkte der Hexer-Saga, die in den folgenden Bänden mit Roberts Jagd nach den SIEBEN SIEGELN DER MACHT ihre Fortsetzung findet.
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 29Unter dem Vulkan
Über das Meer wehten Schreie heran, Schreie voller Angst und Tod und Wahnsinn. Die Nacht war zerrissen vom Peitschen der Schüsse und dem Prasseln und Krachen der brennenden Häuser, und dann und wann durchbrach ein fürchterlicher, brüllender Laut das höllische Crescendo; ein Geräusch, das den Männern an Bord der Zuidermaar einen eisigen Schauer über den Rücken jagte.
Denn es war kein Laut, wie ihn die Kehle irgendeines lebenden Wesens hervorbringen konnte …
»Was muss noch passieren, damit Sie mir endlich glauben?«, fragte ich gepresst. »Dort drüben sterben Menschen, Harmfeld. Unschuldige Menschen!«
Der Kapitän der Zuidermaar antwortete nicht auf meine Worte, aber er sah mich auch nicht an, sondern wich meinem Blick aus, und ich spürte, dass er innerlich ganz und gar nicht so unbewegt war, wie er zu sein vorgab. Seine Hände schmiegten sich so fest um die Reling, als wolle er das armdicke Holz zerbrechen.
Es war kalt auf dem Deck des gewaltigen Kriegsschiffes. Die Nacht lag wie ein Vorhang aus Schwärze ringsum auf dem Meer, und bis auf die Todesschreie der sterbenden Stadt war es vollkommen still. Selbst das Rauschen und Murmeln des Meeres war verstummt. Man hätte glauben können, in einer anderen Welt zu sein. Vielleicht waren wir es auch.
»Zum Teufel, lassen Sie endlich Segel setzen!«, sagte ich, obwohl ich ganz genau wusste, wie sinnlos meine Worte waren. »Wir müssen von hier verschwinden!«
Kapitän Harmfeld richtete sich an der Reling auf, riss seinen Blick mit sichtlicher Anstrengung von dem schrecklichen Schauspiel am Ufer los und sah mich an. Obwohl die Nacht sehr dunkel war, konnte ich sehen, wie eingefallen und blass sein Gesicht wirkte. Es war drei Stunden her, dass wir den Angriff der Shoggoten – oder was immer Dagon uns sonst auf den Hals gehetzt hatte – abgeschlagen hatten, aber der Schrecken saß dem Holländer noch so tief in den Knochen, als wäre es erst Augenblicke her.
»Das kann ich nicht, Craven«, sagte er. Es klang beinahe bedauernd. »Ich muss warten, bis die Boote zurück sind.« Er ballte die Faust und blickte abermals zur Insel hinüber. »Wenn man wenigstens etwas sehen könnte!«
»Ich kann Ihnen sagen, was dort drüben geschieht«, antwortete ich wütend. »Es sind die gleichen Ungeheuer, die die Zuidermaar angegriffen haben. Sie sind gerade dabei, die Stadt auszulöschen. Und Ihre Männer dazu.«
Harmfeld wurde noch blasser. Sein Adamsapfel hüpfte nervös, und ich sah, wie sich seine Rechte zur Faust ballte. Aber er sagte kein Wort, sondern wandte sich nur mit einem Ruck ab und fuhr fort, die brennende Stadt anzustarren.
Es hatte vor einer halben Stunde begonnen. Harmfeld und ich hatten in der Kapitänskajüte gesessen, einerseits, um unsere Wunden verbinden zu lassen – von denen wir wahrlich genug abbekommen hatten, auch wenn keine davon wirklich gefährlich war –, andererseits, weil ich geglaubt hatte, dass der Kapitän nach allem, was geschehen war, endlich Vernunft annehmen würde. Aber das war nicht der Fall. Ich hatte ihm so ziemlich alles erzählt, was nach meiner Ankunft auf Krakatau geschehen war; aber natürlich hatte er mir kein Wort geglaubt. Vielleicht hätte ich umgekehrt auch nicht anders reagiert.
Dann hatten uns die ersten Schreie an Deck gelockt. Trotz des bleichen Mondes war die Nacht zu dunkel, als dass wir irgendwelche Einzelheiten erkennen konnten, aber bei dem ersten Schrei war es nicht geblieben. Schon nach Augenblicken hatten Schüsse die Stille zerrissen, und wenig später waren die ersten Brände aufgeflammt.
Im Grunde hatte Harmfeld nichts anderes als seine Pflicht getan, als er alle fünf Pinassen der Zuidermaar mit fast der Hälfte seiner Marinesoldaten bemannen ließ, um sie zum Ufer zu schicken. Und trotzdem war es das Falscheste, was er überhaupt tun konnte. Ich hatte versucht, ihn zu warnen. Aber natürlich hatte er nicht auf mich gehört.
Ich war sehr sicher, dass er keinen einzigen seiner Männer lebend wiedersehen würde. Selbst die hell lodernden Brände, die im Laufe der letzten halben Stunde auf die ganze Stadt und den Hafen und sogar auf das Meer übergegriffen hatten, als triebe brennendes Öl auf den Wogen, ließen uns nicht erkennen, was dort drüben wirklich geschah.
Aber das war auch nicht nötig. Meine Fantasie reichte durchaus, mir das zu zeigen, was meine Augen nicht sehen konnten: Es waren Dagons Kreaturen, die gleichen protoplasmischen Ungeheuer, die die Zuidermaar angegriffen und die Majundes verschleppt hatten, und vermutlich auch einige seiner fürchterlichen Ssaddit, wie die überall aufflammenden Brände bewiesen.
Nein – Harmfeld würde nicht einen seiner Männer wieder sehen. Und wenn wir noch lange hier blieben, waren vermutlich auch wir verloren. Wir hatten den ersten Angriff der Ungeheuer abgeschlagen, aber das besagte nicht viel. Ich kannte Dagon zu genau, um mir auch nur eine Sekunde lang einzubilden, dass er so leicht aufgeben würde.
»Dann nehmen Sie mir wenigstens die Handschellen ab!«, sagte ich. »Die Dinger sind nicht besonders bequem.«
Harmfeld runzelte die Stirn, sah einen Moment auf die dünne silberne Kette herab, die meine Handgelenke aneinanderband, als müsse er ernsthaft überlegen, wozu sie überhaupt da war, dann schüttelte er den Kopf. »Das ist auch nicht der Sinn von Handschellen«, sagte er.
»Zum Teufel, Harmfeld, ich habe Ihnen das Leben gerettet!«, fuhr ich auf.
Harmfeld fuhr zusammen wie unter einem Hieb. »Sie werden unfair, Craven«, sagte er. »Ich bin Ihnen wirklich dankbar, aber …« Er sprach nicht weiter, sondern seufzte abermals und starrte wieder zur Küste hinüber. »Ich kann es nicht«, sagte er. Es klang wie eine Entschuldigung. »Ich habe meine Befehle, und ich muss mich daran halten. Sie wissen, warum wir Sie und Ihren Freund gefangen genommen haben«, begann er.
»Nein«, sagte ich zornig. »Aber Sie werden es mir gleich sagen.«
Harmfelds Miene verdüsterte sich. »Warum machen Sie es sich und mir so schwer?«, fragte er. »Sie werden nicht bestreiten, dass Sie Eldekerk gekannt haben. Sie sind zusammen gesehen worden.«
»Aber ich habe ihn nicht umgebracht!«, fauchte ich. »Und Shannon auch nicht. Im Gegenteil, Harmfeld. Eldekerk stand auf unserer Seite!«
»Unserer Seite?«, hakte Harmfeld nach. »Was heißt das?«
»Warum erzählen Sie mir nicht einfach, was passiert ist?«, fragte ich anstelle einer direkten Antwort. »Was bringt Sie auf die Idee, dass Shannon und ich Eldekerk ermordet haben sollen?«
»Seine eigene Aussage«, antwortete Harmfeld. »Er wurde gefunden, Craven, mit einem Messer im Bauch. Er konnte gerade noch Ihren Namen sagen, ehe er starb.«
»Und das reicht für Sie, mich eines Mordes zu bezichtigen?«, keuchte ich. »Sind Sie von Sinnen?«
Harmfeld lächelte. »Nein. Vielleicht sind Sie ja wirklich unschuldig, Craven. Aber wenn, dann frage ich mich, warum Sie und Ihr sonderbarer Freund nicht einfach mit uns gekommen sind. Sie müssen zugeben, dass es etwas befremdlich wirkt, wenn jemand, der sich nichts vorzuwerfen hat, unter ziemlich dramatischen Umständen flieht, kaum dass ich auftauche.«
»Aber ich habe es Ihnen erklärt!«, sagte ich wütend. »Mehr als einmal.«
Harmfeld bedachte mich mit einem fast mitleidigen Blick; ein Blick, der den dumpfen Zorn, der in mir brodelte, zu neuer Glut entfachte. Für einen Moment war ich nahe daran, ihn schlichtweg zu hypnotisieren, wie Shannon es zuvor getan hatte. Aber ich tat es nicht. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich es gekonnt hätte, denn was immer Tergard mit meinem Geist angestellt hatte, wirkte noch immer nach; meine magischen Kräfte waren längst noch nicht wieder vollkommen regeneriert.
Aber ich hätte es wohl auch nicht getan, wäre ich im Vollbesitz meiner Fähigkeiten gewesen. Es hat mir schon immer widerstrebt, einen Menschen zu Dingen zu zwingen, die er nicht wollte; und in diesem Falle wäre es allerhöchstens schädlich gewesen. Hypnose ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann einen Mann dazu bringen, seine eigene Mutter auf dem Sklavenmarkt zu verkaufen, aber egal, wie perfekt man ist, jemand, der unter Hypnose handelt, ist wenig mehr als eine Puppe, kaum zu eigenen Entscheidungen fähig. Ich wusste noch immer nicht genau, was auf dieser Insel vorging, aber was immer es war, es war etwas Gewaltiges; etwas, bei dem ich keine Helfer brauchen konnte, die mit Mühe und Not bis drei zählen können.
Vom Gipfel des Krakatau her erscholl ein dumpfes, drohendes Grollen, wie um meine Gedanken zu unterstreichen. Harmfeld sah auf und blickte aus eng zusammengepressten Augen zur Caldera des Riesenvulkanes hinauf. Flammen und rot glühendes Gestein, das durch die große Entfernung wie ein Schwarm harmloser kleiner Fünkchen aussah, schossen gegen die tief hängenden Wolken. Für einen Moment glaubte ich ein sanftes, aber ungemein machtvolles Zittern und Beben unter den Füßen zu spüren.
»Der Berg ist unruhig«, murmelte Harmfeld.
»Wird er ausbrechen?«, fragte ich.
»Ausbrechen?« Der Kapitän der Zuidermaar wiederholte das Wort mit sonderbarer Betonung, sah mich an und schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht«, sagte er. »Ich bin seit mehr als zehn Jahren hier, aber er ist noch nie ausgebrochen. Ein bisschen Gerümpel, ein paar Flammen … aber das war auch alles.« Er seufzte, wandte sich mit einem Ruck ab und blickte wieder zur Stadt hinüber. Die Flammen tobten wie eh und je, aber das Schießen und Schreien hatte abgenommen. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich ein gutes Zeichen war.
Plötzlich erscholl über uns der helle Laut einer Schiffspfeife. Harmfeld sah rasch zum Mast hinauf, wandte sich dann wieder der Insel zu und lehnte sich über die Reling, so weit er konnte. »Die Boote kommen zurück!« Einen Moment lang blickte er aus zusammengepressten Augen hinaus in die Dunkelheit, dann wandte er sich halb um und machte ein Zeichen mit der Hand. Sekunden später ertönte ein scharfer Knall, und ein Magnesiumgeschoss stieg vom Deck der Zuidermaar auf und warf zuckendes, grell weißes Licht auf das Meer.
Harmfeld stieß einen entsetzten Schrei aus.
Statt der erwarteten Flotte kleiner Pinassen trieb nur ein einziger, massiger Umriss auf die Zuidermaar zu. Und es war auch kein Boot, sondern ein grässliches, braunschwarz glitzerndes Etwas, zuckend und peitschend wie ein Klumpen ekelhafter Gallerte, der auf einem Dutzend grotesk missgestalteter Beine über das Meer herangestakst kam!
»Das … das ist das Ungeheuer, das die Majundes entführt hat!«, keuchte ich. »Um Gottes willen, Harmfeld – wir müssen hier verschwinden!«
Aber es war, als würde der Kapitän der Zuidermaar meine Worte überhaupt nicht hören. Gelähmt und starr vor Schrecken stand er da und starrte die näher kommende Scheußlichkeit an. Die Leuchtkugel brannte aus, aber beinahe sofort stieg ein zweites Geschoss vom Deck des Schiffes auf und illuminierte das Ungeheuer.
Und endlich erwachte Harmfeld aus seiner Erstarrung.
Wenn auch auf andere Art, als mir lieb gewesen wäre. Plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, fuhr er herum, begann wie wild mit den Armen zu fuchteln und Befehle in seiner Heimatsprache zu schreien. Sekunden später brach auf Deck der Zuidermaar eine geradezu hektische Aktivität los. Männer hetzten hierhin und dorthin, kletterten behände wie Affen in die Wanten hinauf oder schleppten Dinge durch die Gegend. Das Schiff begann zu zittern, als schlüge tief in seinem Rumpf ein gewaltiges, nervöses Herz.
Harmfeld wandte sich wieder der Reling zu. Über dem Meer verzischte die vierte Leuchtkugel und wurde von einer neuen abgelöst, und in ihrem flackernden Schein konnte ich erkennen, dass das protoplasmische Ungeheuer schon mehr als die Hälfte der Entfernung zur Zuidermaar zurückgelegt hatte. Sein aufgedunsener Körper zuckte und bebte unentwegt, und was im ersten Augenblick wie staksende Spinnenbeine ausgesehen hatte, erwies sich beim näheren Hinsehen als ein ganzer Strang peitschender, mannsdicker Tentakel, mit deren Hilfe es sich mit fantastischer Geschwindigkeit durch das Wasser wühlte. Noch wenige Augenblicke, dann würde es die Zuidermaar erreicht haben!
Aber es kam nicht dazu.
Harmfeld schrie einen Befehl, und augenblicklich stieß eine orangerote Flamme aus dem Rumpf des Schiffes. Ein ungeheures Krachen erscholl, und eine Sekunde später spritzte dicht vor dem Monstrum das Meer auf. Die Luft stank plötzlich durchdringend nach Pulverdampf. Harmfeld hob den Arm, und eine zweite Kanone entlud sich donnernd. Diesmal war der Schuss besser gezielt.
Das Ungeheuer bäumte sich auf. Seine Tentakel begannen wie wild zu peitschen, und plötzlich war das Meer schwarz vom grässlichen Blut der Spottgeburt; große Brocken zerfetzten Plasmas wirbelten durch die Luft und klatschten ins Wasser zurück, und ich sah, wie einer der schrecklichen Fangarme abgerissen wurde und zuckend im Meer versank. Ich wusste zwar, dass diesen Ungetümen mit mechanischer Gewalt kaum beizukommen war – aber allein die Wucht der Kanonenkugel hatte gereicht, seinen Körper nahezu in zwei Stücke zu zerreißen und es meterweit zurückzutreiben.
»Jetzt!«, schrie Harmfeld.
Die Zuidermaar feuerte eine ganze Salve auf das Ungeheuer. Und jeder einzelne Schuss saß im Ziel.
Das Monstrum wurde regelrecht zerfetzt. Eine gewaltige Säule aus kochendem Meerwasser und schwarzem, stinkendem Schleim schoss in die Höhe und sank in weitem Umkreis auf das Meer herab. Das Schiff zitterte unter dem Rückschlag seiner eigenen Kanonen, legte sich träge auf die Seite und kippte wieder in die Waagerechte zurück.
Als sich der Pulverdampf verzog, war der Ozean leer. Nur hier und da schwamm noch ein kleiner Brocken schwarzschleimiger Materie, und tief unter dem Wasser schien etwas Gewaltiges, Körperloses zu zucken und zu beben.
Harmfeld ließ sich mit einem erschöpften Seufzer auf die Reling sinken, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und sah mich an. »Sehen Sie, Craven«, sagte er. »So viel zu Ihren unbesiegbaren Horror-Monstern. Eine gute niederländische Kanone schafft zur Not auch noch die. Es ist vorbei.«
Ich antwortete nicht, sondern drehte mich – eigentlich ohne so recht zu wissen, weshalb – herum und blickte in die entgegengesetzte Richtung. Über dem Meer waren die Wolken auseinandergerissen. Und im gleichen Moment, in dem das Mondlicht das Meer berührte, wusste ich, dass Harmfeld Unrecht hatte.
Es war nicht vorbei. Im Gegenteil.
Es begann erst.
Es war sehr warm hier unten, tausend Yards unter der Erde und zweimal tausend Yards unter dem Flammen speienden Krater des Krakatau. Und es war eine unangenehme, auf schwer in Worte zu fassende Weise bedrohlich wirkende Wärme, ein erstickender Hauch, der aus den Wänden, der Decke und dem Boden drang, aus den brodelnden Lavaseen emporstieg und mit dem Zischen flammender Feuergeysire die Luft durchwob.
Seit einer Stunde stand Dagon reglos am Ufer des gewaltigen Lavasees und starrte auf das Wogen und Kriechen unter sich hinab. Die Oberfläche des rot glühenden Sees war in beständiger, zuckender Bewegung. Aber es war nicht nur das Brodeln glühenden Gesteines, nicht nur der Pulsschlag des Vulkanes. Gewaltige, wurmähnliche Dinge bewegten sich unter der Hitze atmenden Oberfläche, stießen manchmal wie im Spiel hindurch und versanken wieder, Spritzer geschmolzenen Steines zehn, fünfzehn Yards hoch in die Luft schleudernd. Dann und wann drang ein tiefes, beunruhigendes Grollen an Dagons Ohr, und manchmal reckte sich der augenlose Schädel eines Ssaddit aus dem geschmolzenen Stein wie ein Fisch, der nach Luft schnappt.
Ihre Zahl war wieder gestiegen. Dagons Diener hatten ihm Opfer gebracht, genug, selbst die Gier jener in der Tiefe zu befriedigen. Der Moment, auf den er all die Jahre gewartet hatte, war nicht mehr weit.
Dagon verspürte einen leisen Schauer von Furcht, als er daran dachte, wie viele Leben zerstört worden waren, um diese Armee des Schreckens zu schaffen. Selbst er, für den das Leben eines Menschen oder irgendeiner anderen Kreatur weniger galt als der Schmutz unter seinen Füßen, bekam Angst, als er daran dachte, welcher Art die Wesen waren, die zu erwecken er hergekommen war.
Aber es war zu spät, um jetzt noch zurückzukönnen. Er hatte den entscheidenden Schritt noch nicht getan, aber die Tür ins Land der Schrecken war bereits einen Spalt breit aufgestoßen. Er hatte den eisigen Hauch der Hölle gespürt, und seine Hände, die jetzt sorgsam unter dem lang wallenden Umhang verborgen waren, legten Zeugnis davon ab.
Dagon vertrieb den Gedanken mit einem ärgerlichen Schnauben, erwachte endlich aus seiner Erstarrung und wandte sich mit einem Ruck ab. Als würden die Ssaddit das Gehen ihres Meisters – aber war er das überhaupt? – spüren, begann der See aus geschmolzenem Gestein heftiger zu brodeln und zu zischen. Die Lava spritzte so hoch, dass seine Diener, die sich im Kreis um den gewaltigen flammenden Krater aufgestellt hatten, ein paar Schritte zurückwichen, und die Schatten begannen hektischer hin und her zu huschen.
Einer seiner Diener vertrat ihm den Weg, als Dagon die schmale steinerne Treppe ansteuerte, die hinab in jenen Bereich des Krakatau führte, den zu betreten nur ihm allein gestattet war. Es war ein kleiner hagerer Mann, dessen nackter Oberkörper vor Schweiß glänzte und dessen Gesicht vor Schmutz starrte und gezeichnet war vom Tod; wie die Gesichter aller, die zu lange hier unten nahe des schlagenden Herzens des Berges waren. Der Krakatau war wie ein feuriger Gott, der kein anderes Leben in seiner Nähe duldete. Er tötete, allein durch seine Nähe.
»Was gibt es?«, herrschte Dagon den Mann an.
»Verzeiht, wenn ich Euch störe, Herr«, antwortete der Sklave. »Aber wir haben einen Eindringling gefasst.«
»Einen Eindringling?« Dagon zog eine Grimasse. »Dann tötet ihn.«
Er wollte weitergehen, aber wieder hob der Mann schüchtern die Hand, und Dagon blieb abermals stehen. »Was ist noch?«, fauchte er ungeduldig.
»Ihr solltet ihn … Euch ansehen, Herr«, antwortete der Sklave kleinlaut. »Er ist … anders als die anderen.«
»Anders?« Dagon runzelte die Stirn. »Was soll das heißen?«
Aber diesmal antwortete der Mann nicht mehr. Sein Blick flackerte vor Angst.
»Gut«, sagte Dagon. »Ich sehe ihn mir an. Führe mich zu ihm.«
Der Sklave nickte heftig, drehte sich herum und ging so schnell voraus, dass Dagon fast Mühe hatte, ihm überhaupt zu folgen. Sie durchquerten die Höhle in entgegengesetzter Richtung und betraten einen niedrigen, von blutig rotem Licht erfüllten Stollen, der tiefer hinein in das steinerne Herz des Berges führte.
Sie erreichten eine hohe, domartig gewölbte Kammer, die als bisher einziger Raum etwas wie eine Möblierung aufwies – in einer Ecke gab es eine niedrige, mit feuchtem Stroh gedeckte Bettstatt, davor einen einzelnen Stuhl.
Auf dem Bett lag ein Mann. Er war an Händen und Füßen gefesselt und so grob hingeworfen worden, dass Dagon sein Gesicht nicht erkennen konnte. Und trotzdem spürte er sofort, warum ihn der Sklave geholt hatte.
Etwas an diesem Mann war sonderbar. Dagon glaubte die Gefahr, die er verströmte, beinahe greifen zu können. Es war bizarr, ja, beinahe lächerlich: Der schwarz gekleidete Fremde war an Händen und Füßen gebunden – und trotzdem hatte Dagon das Gefühl, einer tödlichen Viper gegenüberzustehen, nicht einem hilflosen Mann …
»Er hat vier von uns getötet, Herr«, sagte der Sklave leise. »Mit bloßen Händen. Wir mussten ihn zu zehnt angreifen, um ihn zu überwältigen.«
Dagon nickte. »Es ist gut«, sagte er. »Du kannst gehen.«
Der Sklave entfernte sich schweigend, und Dagon trat vollends an das Bett heran. Der Mann rührte sich nicht, und sein Atem ging langsam und so gleichmäßig wie der eines Schlafenden. Aber davon ließ sich Dagon nicht täuschen.
»Wir sind allein«, sagte er. »Sie brauchen sich nicht mehr zu verstellen. Ich weiß, dass Sie wach sind.«
Einen Moment lang schien es, als würde der Gefangene weiter den Schlafenden spielen, und Dagon spürte einen raschen Anflug von Ungeduld, ja, beinahe Zorn. Aber dann hob der Mann den Kopf, drehte sich auf den Rücken und setzte sich auf; mit einer Behändigkeit, als spüre er die stramm angelegten Fesseln gar nicht. Dagon sah, wie er sich spannte, obgleich sein Gesicht vollkommen ausdruckslos blieb.
»Versuchen Sie es nicht«, sagte Dagon ruhig. »Meine Diener haben mir berichtet, wie gefährlich Sie sind. Aber ich bin viel stärker als ein Mensch.«
Der Fremde sah auf, und während sein Blick über das Gesicht Dagons huschte, nutzte der Fischgott seinerseits die Gelegenheit, sich seinen Gefangenen eingehender zu betrachten.
Der Fremde war überraschend jung; nicht mehr als zwanzig, allerhöchstens einundzwanzig Jahre nach der Zeitrechnung der Menschen und von schlankem, aber sehr kräftigem Wuchs. Seine Hände waren von jener Sehnigkeit, die große Kraft verriet, und der Blick seiner hellblauen, wasserklaren Augen war wie Stahl. Selbst Dagon begann sich unter diesem Blick unwohl zu fühlen.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Shannon«, sagte der junge Mann. »Mein Name ist Shannon.«
»Shannon …« Dagon wiederholte den Namen ein paarmal, als versuche er, sich an seinen Klang zu gewöhnen. Dann nickte er. »Ich erinnere mich. Du bist der junge Magier, der zusammen mit Robert Craven kam. Was willst du?«
Der Fremde antwortete nicht, sondern starrte ihn nur weiter an. Plötzlich huschte ein sonderbares, schwer zu deutendes Lächeln über sein Gesicht.
»Du bist Dagon«, sagte er.
Dagon nickte. »Das ist richtig. Du kennst mich?«
»Nicht persönlich«, antwortete der Fremde. »Aber ich habe von dir gehört. Ich bin hier, weil ich dich gesucht habe.«
Dagon lächelte dünn. »Du hast mich gefunden. Aber ich glaube nicht, dass du Grund hast, dich darüber zu freuen. Was willst du?«
»Mit dir reden«, antwortete der Fremde. »Dir einen Vorschlag machen.«
»Einen Vorschlag?« Dagon schüttelte den Kopf. Er war ein wenig enttäuscht. »Was immer es ist, es interessiert mich nicht.«
»Warum hast du mich dann nicht gleich umbringen lassen?«, fragte Shannon ruhig.
»Vielleicht aus Interesse«, antwortete Dagon. »Ich wollte den Mann sehen, der meine Sklaven in Furcht zu versetzen vermag. Aber ich habe etwas anderes erwartet.«
Shannon nickte, richtete sich noch ein wenig weiter auf – und hob plötzlich die Hände hinter dem Rücken hervor. »So etwas, zum Beispiel?«, fragte er ruhig.
Dagon keuchte vor Überraschung. Shannon hatte die Fesseln nicht etwa zerrissen; obwohl sie aus daumendicken Hanfstricken bestanden, hätte Dagon dies kaum erschreckt, denn Kraft war etwas Relatives und die Menschen waren im Allgemeinen so schwach. Nein – die Fesseln waren verschwunden. Genauer gesagt, sie hatten sich verwandelt!
Aus den zerfaserten braunen Stricken waren zwei dünne, schwarzgrün glänzende Schlangen geworden, die sich zischend und züngelnd um Shannons Handgelenke wanden!
Es dauerte Sekunden, bis Dagon seine Fassung wiederfand. »Das ist … beeindruckend«, sagte er stockend. »Aber mehr auch nicht. Glaubst du, dein Leben mit ein paar Taschenspielertricks retten zu können?«
»Das wird kaum nötig sein, Dagon«, antwortete Shannon, und irgendetwas war in seiner Stimme, was den Fischgott abermals aufblicken und das glatte Jungengesicht seines Gegenübers genauer ansehen ließ. Täuschte er sich, oder hatte es sich verändert? Dagon vermochte es nicht genau zu sagen, aber es schien, als wäre Shannons Gesicht reifer geworden, härter und …
Ja, dachte er verstört. Älter.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte er scharf.
Shannon lächelte, aber es war ein ganz und gar grausames Lächeln, ohne die mindeste Spur eines echten menschlichen Gefühles.
»Ich habe dir einen Vorschlag zu machen, Dagon«, sagte Shannon. »Einen Vorschlag, der wahrscheinlich dein Leben retten wird. Ich bin nicht hier, um dich zu vernichten. Wäre ich deshalb gekommen, dann wäre ich kaum so närrisch gewesen, mich von deinen Dienern fangen zu lassen, glaube mir.« Er setzte sich vollends auf, schwang die Beine vom Bett und stand nach sekundenlangem Zögern auf. Dagon bemerkte, dass seine Bewegungen viel von ihrer Eleganz verloren hatten. Sie wirkten noch immer schnell und kraftvoll, aber es waren nicht mehr die eines jungen Mannes. Und die Fesseln an Händen und Füßen waren nun vollends verschwunden.
»Du hast es mir sehr schwer gemacht, Dagon, dich zu finden«, fuhr Shannon fort. »Aber noch ist es nicht zu spät. Wenn du tust, was ich dir sage, dann kann ich die Verwandlung aufhalten.«
Dagon keuchte. »Die …«
In Shannons Augen glomm ein rasches, kaltes Lächeln auf. »Spiel nicht den Narren. Ich kenne dein Geheimnis, Dagon.« Er deutete mit einer Kopfbewegung auf den Mantel des Fischgottes. »Es hat bereits begonnen, nicht?«
Dagon starrte ihn an. Seine schillernden Fischaugen waren weit vor Schrecken, und plötzlich, beinahe gegen seinen Willen und in einer Bewegung, die er nicht einmal aufhalten konnte, als er es versuchte, hob er die Hände unter dem Mantel hervor und streckte sie dem schwarz gekleideten Magier entgegen.
Es waren nicht die Hände eines Menschen – aber das waren sie ja nie gewesen –, aber auch nicht mehr die Hände Dagons, des Fischgottes. Die schlanken, mit durchscheinenden Schwimmhäuten verbundenen Finger waren zu plumpen, schwärzlichbraun glitzernden Pranken geworden, verkrümmt und knotig und von Pusteln und nässelnden Geschwüren übersät. Aus seinen Daumen wuchsen grässliche Raubtierkrallen hervor, und auch die anderen Nägel waren blutig; das schimmernde Weiß frischer Nägel, die sich zu Fängen auswuchsen, glänzte durch das zerfetzte Fleisch.
Und die Veränderung war nicht allein auf seine Hände beschränkt. Wie braune, unterschiedlich lange Handschuhe zog sich die fürchterliche Färbung seine Arme hinauf.
Einen Moment lang betrachtete Shannon die Krallenhände des Fischgottes interessiert, dann trat er zurück, seufzte und fuhr sich mit den Fingern über das Gesicht. Seine Haut schien dunkler zu werden, und abermals hatte Dagon das Gefühl, den jungen Mann vor seinen Augen altern zu sehen.
»Es ist schon schlimmer, als ich dachte«, sagte Shannon. »Aber nicht zu schlimm.« Er lächelte kalt. »Sie beginnen, dich in einen der Ihren zu verwandeln, nicht wahr?«
Dagon nickte. »Woher … woher weißt du das?«
»Ich weiß manches«, antwortete Shannon unwillig. »Und ich kann manches. Ich kann dir zum Beispiel helfen.«
»Du?«, keuchte Dagon. »Du kannst –«
Shannon schnitt ihm mit einer unwilligen Bewegung das Wort ab. »Hör mir zu«, sagte er. »Es ist nicht mehr viel Zeit. Bald wird sich das Tor vollends öffnen, und die Thul Saduun werden auferstehen. Wenn dies geschieht, wirst du zu einem der Ihren, nicht nur körperlich, und du weißt es. Dann wirst du deinen Plan wohl kaum noch ausführen können.« Er lächelte abermals, legte eine ganz genau berechnete Pause ein und fuhr mit ebenso genau berechneter, veränderter Stimme fort: »Es sei denn, du nimmst meine Hilfe an.«
»Deine Hilfe?«, wiederholte Dagon. »Die Hilfe meines Feindes?«
»Feind!« Shannon lachte. »Du bist ein Narr, Dagon. Ich wollte dir Robert Craven auf einem silbernen Tablett servieren, aber dieser Trottel hat plötzlich sein Gewissen entdeckt und ist zurückgerannt, um sich umbringen zu lassen. Ich bin nicht dein Feind. Im Gegenteil – wir sind gewissermaßen Verbündete. Du kennst mich.«
Er trat einen Schritt zurück, hob die Arme und begann leise, unverständliche Worte zu murmeln. Worte, die selbst in Dagon ein spürbares Schaudern hervorriefen.
Dann begann er sich zu verändern.
Es ging ganz schnell. Rings um die hohe, in die Farbe der Nacht gekleidete Gestalt des jungen Magiers ballten sich Schatten und Finsternis zusammen, sein Gesicht verschwand hinter einem Schleier aus huschender Dunkelheit, und etwas geschah mit seiner Gestalt. Sie schien zu schrumpfen, sich auf unbeschreibliche Weise zu verbiegen und zu drehen. Der bizarre Vorgang dauerte nur wenige Sekunden.
Aber als er beendet war, war aus dem jungen, hünenhaft gebauten Mann ein vom Alter gebeugter Greis geworden, ein Mann mit einem Gesicht aus Runzeln und Falten, in dem einzig die Augen noch zu leben schienen.
»Du kennst mich, Dagon«, sagte er noch einmal, und plötzlich sprach er mit einer zitternden Greisenstimme. »Wenn auch nicht unter dem Namen Shannon. Dieser Körper war nicht mehr als ein Mantel, in den ich schlüpfte, um das Vertrauen dieses Narren Craven zu erringen – und dich zu finden. Mein wahrer Name ist Necron.«
Das Meer glühte. Ein unheimliches, rotgelbes Licht brannte irgendwo tief unter seiner Oberfläche, und dahinter, nur als verschwommener Schatten wahrzunehmen, schoss ein kolossales Etwas heran, ein Ding wie ein Wal, aber dreimal so groß und schnell wie ein Pfeil. Eine schaumige Spur markierte seine Bahn; eine weiße, wie mit einem Lineal gezogene Linie, die geradewegs aus dem offenen Meer kam – und genau auf die Zuidermaar deutete!
Harmfeld bemerkte die neue Gefahr eine halbe Sekunde nach mir. Und diesmal reagierte er ungleich schneller als beim ersten Mal. Mit einem Satz war er herum, hetzte über das Schiff und begann gleichzeitig Kommandos zu brüllen. Unter mir wurden knallend die Geschützluken geöffnet, Männer schrien, und überall flammten plötzlich Fackeln und kleine brennende Lunten auf.
Mit einem Satz war ich bei Harmfeld und versuchte ihn zurückzureißen. »Sind Sie wahnsinnig, Kapitän?«, schrie ich. »Was immer dort herankommt, es ist größer als Ihr Schiff!«
Harmfeld fuhr herum. Seine Hände zuckten, als wolle er mich packen. »Was soll ich tun, Ihrer Meinung nach?«, fauchte er.
»Hier verschwinden!«, antwortete ich ebenso zornig wie er.
Harmfeld schnaubte. »Sie sind ja verrückt! Die Zuidermaar ist ein Kriegsschiff, Sie Witzbold, kein Paddelboot! Ich brauche eine halbe Stunde, um das Schiff auch nur von der Stelle zu bekommen.« Er ballte die Faust, blickte die näher kommende Leuchterscheinung und die schäumende Bugwelle an und schüttelte noch einmal den Kopf. »Was immer dort herankommt – wir werden kämpfen müssen.«
Und es sah ganz so aus, als hätte er Recht.
Ich versuchte in Gedanken die Zeit abzuschätzen, die noch bis zum Zusammenprall vergehen musste – eine, allerhöchstens zwei Minuten, dann würde uns dieses Ding vermutlich in den Meeresboden hineinrammen. Ich legte die aneinandergebundenen Hände auf die Reling und spreizte instinktiv die Beine, um mich auf den Anprall vorzubereiten – eine, logisch betrachtet, höchst lächerliche Reaktion in Anbetracht dieses schwimmenden Berges.
Aber dann wurde der Schatten langsamer. Das unheimliche, rotgelbe Licht, das er ausstrahlte, glühte heller auf, tastete wie der Strahl eines Scheinwerfers hierhin und dorthin und glitt, eine Handbreit unter der Wasseroberfläche, über den Rumpf der Zuidermaar. Noch immer war der Riese nur als verschwommener Schatten unter dem Meer zu erkennen, aber ich sah deutlich, wie er langsamer und langsamer wurde und schließlich in einem engen Halbkreis herumschwenkte, bis er sich nahezu parallel zu unserem Schiff bewegte. Die Bugwelle verlief sich allmählich, aber über seinem Rücken begann mit einem Male das Wasser zu brodeln, wie bei einem Wal, der Luft abbläst. Der gewaltige Schatten begann zu wachsen, als das Ungetüm der Wasseroberfläche entgegenstrebte. Ich erkannte mehr Einzelheiten: den schlanken, zackenbesetzten Leib, die riesige Heckflosse, unter der das Meer sprudelte, den fürchterlichen Rammsporn an seinem Schädel, die beiden gewaltigen, runden Augen, die grelle Lichtnadeln durch das Meer stießen …
Und plötzlich wusste ich, was wir vor uns hatten!
»Es taucht auf!«, sagte Harmfeld. Und dann, etwas lauter: »Kanoniere – Achtung. Feuer frei, sobald es oben ist.«
Sekunden vergingen, bis seine Worte in mein Bewusstsein drangen. Dann fuhr ich herum, packte Harmfeld bei den Rockaufschlägen und deutete wild auf das Meer hinaus. »Um Gottes willen, nicht!«, keuchte ich. »Das ist kein Ungeheuer, Kapitän! Das ist –«
Harmfeld versetzte mir einen Stoß vor die Brust, der mich zurück und gegen die Reling taumeln ließ. Wütend hob er die Hand, als wolle er mich schlagen. »Sind Sie übergeschnappt, Craven?«, schrie er. »Noch ein Wort, und ich lasse Sie in Ketten legen und unter Deck bringen!«
»Aber das ist –«
Harmfeld machte eine blitzschnelle Bewegung mit der Hand, und zwei seiner Marinesoldaten packten mich und zerrten mich grob zurück. Ich wehrte mich verzweifelt, aber mit gefesselten Händen hatte ich keine große Chance gegen die beiden kräftigen Männer. Rasch wurde ich über das Deck und in Richtung des Achterkastells gezerrt.
»Harmfeld!«, schrie ich verzweifelt. »Nicht schießen! Das ist kein Ungeheuer! Sie werden –«
Meine Worte gingen in einem ungeheuren Krach unter, als sich die Bordgeschütze der Zuidermaar nahezu gleichzeitig entluden. Zwei, dreihundert Yards weiter draußen auf dem Meer spritzte das Wasser auf, Schaum und weiße Gischt schossen in die Höhe, und zwischen dem weißen Brodeln stoben Funken in die Luft, als die Kanonenkugeln gegen zolldicken Stahl schlugen. Die beiden Männer, die mich hielten, blieben unwillkürlich stehen, um dem fantastischen Schauspiel zuzusehen.
Das Donnern der Geschützsalve war verstummt, aber das Meer kochte weiter und gebar weißen Schaum, als der Gigant weiter auftauchte. Die Zuidermaar begann zu zittern, als gewaltige Wellen das Meer kräuselten und gegen ihre Flanke prallten.
Und plötzlich erhob sich vom Deck des Schiffes ein vielstimmiger, gellender Aufschrei, denn inmitten der sprudelnden Gischt erschien ein Albtraumschädel, gewaltig und schwarzgrün schimmernd, von einem Zackenkamm gekrönt und aus zwei riesigen, grell lodernden Augen glotzend.
»Feuer frei!«, brüllte Harmfeld. Seine Stimme überschlug sich fast. Ich konnte die Angst darin beinahe greifen.
Die Backbordgeschütze der Zuidermaar feuerten eine zweite Salve. Wieder spritzte das Meer auf, und wieder sah ich Funken und Metallsplitter davonfliegen, als die Geschosse gegen den stählernen Schädel des vermeintlichen Ungeheuers prallten und zersplitterten. Dann stach eine orangerote Flamme aus der brodelnden Gischt, ein helles, boshaftes Sirren erklang – und zwanzig Yards über unseren Köpfen löste sich ein Teil des Mastes in einer feurigen Wolke auf. Brennende Trümmerstücke prasselten auf das Deck, und das gewaltige Kriegsschiff erbebte wie unter einem Hammerschlag.
Die beiden Männer, die mich hielten, waren für einen Moment abgelenkt, und ich nutzte die Chance, die sich mir bot. Blitzschnell riss ich mich los, packte den einen und schleuderte ihn wuchtig gegen seinen Kameraden. Die beiden Matrosen gingen zu Boden. Ich rannte zu Harmfeld zurück, packte ihn an den Schultern und riss ihn herum.
»Hören Sie endlich auf, Sie Idiot!«, brüllte ich. »Stellen Sie das Feuer ein, ehe Sie uns alle umbringen!«
Harmfeld keuchte und versuchte sich aus meinem Griff zu befreien, aber die Wut gab mir zusätzliche Kraft. Ich stieß ihn gegen die Reling, versetzte einem seiner Soldaten, der mich zurückzerren wollte, einen Stoß mit dem Ellbogen und packte Harmfeld erneut am Kragen.
»Das da draußen sind nicht unsere Feinde!«, keuchte ich. »Ihr sogenanntes Seeungeheuer hätte uns mit dem ersten Schuss versenken können, ist Ihnen das klar? Es ist ein Unterseeboot, verdammt!«
Harmfeld wollte antworten, aber in diesem Moment erscholl ein ungeheures Pfeifen und Dröhnen, und eine Sekunde später rollte eine menschliche Stimme über das Meer heran, verzerrt und von einer fantastischen Technik hundertfach verstärkt. Eine Stimme, die ich nur zu gut kannte!
»Achtung, Kapitän der Zuidermaar! Hier spricht Kapitän Nemo von Bord der NAUTILUS. Stellen Sie das Feuer ein!«
Harmfeld erstarrte. Bleich vor Schrecken wandte er sich um, starrte aus hervorquellenden Augen auf den vermeintlichen Monsterschädel – der nichts anderes als der Turm des Unterseebootes war – und versuchte, Worte hervorzubringen. Aber alles, was über seine Lippen kam, war ein unartikuliertes Stöhnen.
»Stellen Sie das Feuer ein, und streichen Sie Ihre Flagge!«, fuhr die hundertfach verstärkte Bassstimme Nemos fort. »Sie haben genau eine Minute Zeit, sich zu ergeben. Danach versenken wir Sie.«
Harmfeld begann am ganzen Leibe zu zittern. »Die … die NAUTILUS?«, wimmerte er. »Das ist … das ist vollkommen unmöglich. Das ist …«
»Noch fünfundvierzig Sekunden!«, schrien die Lautsprecher der NAUTILUS.
»Zum Teufel, Kapitän, antworten Sie!«, sagte ich. »Nemo meint es ernst.«
»Aber das ist unmöglich!«, keuchte Harmfeld. Seine Stimme klang schrill, fast kreischend. Sein Blick flackerte. »Die NAUTILUS ist eine Legende. Seemannsgarn. Es gibt dieses Schiff nicht!«
»Noch dreißig Sekunden«, sagte Nemo.
»Ihre Legende wird uns bis auf den Mond sprengen, wenn Sie nicht kapitulieren!«, sagte ich verzweifelt. »Geben Sie Befehl, die Flagge zu streichen!«
Aber Harmfeld schien meine Worte gar nicht zu hören. Gelähmt vor Schrecken starrte er abwechselnd die NAUTILUS und mich an.
»Ihre Bedenkzeit ist um, mon ami«, sagte Nemo freundlich. »Ich bedauere es zutiefst, aber Sie zwingen mich, Dinge zu tun, die mir im Grunde meiner Seele widerstreben. Pardonnez-moi.«
Und damit stach eine zweite, feurige Lanze zwischen den Bullaugen der NAUTILUS hervor. Ein ungeheures Krachen erklang, und für einen Moment wurde die Nacht zum Tage, als hoch über unseren Köpfen die niederländische Flagge mitsamt einem Teil des Hauptmastes in Flammen aufging.
Mein Herz schien mit einem schmerzhaften Sprung direkt in meinen Hals hinaufzuhüpfen und dort wie ein toll gewordenes Hammerwerk weiterzuschlagen. Verzweifelt sah ich mich nach einer Fluchtmöglichkeit um. Für einen Moment war ich nahe daran, schlichtweg über Bord zu springen, um das rettende Ufer schwimmend zu erreichen. Aber ich verwarf den Gedanken, kaum dass er mir gekommen war. Wenn Nemo wirklich einen seiner schrecklichen Torpedos auf die Zuidermaar abschoss, würden von diesem Schiff kaum mehr Trümmerstücke übrig bleiben.
Aber die tödliche, alles auslöschende Explosion, auf die ich wartete, kam nicht. Stattdessen begann plötzlich dicht vor der Reling das Meer zu brodeln, und eine Anzahl gewaltiger, schwarz glänzender Körper durchbrach die Wasseroberfläche. Harmfeld taumelte von der Reling zurück und fuchtelte wild und unkontrolliert mit den Händen umher. An Bord des Schiffes begann eine Panik auszubrechen. Der Einzige, der nicht versuchte, eine möglichst große Entfernung zwischen sich und die Reling zu bringen, war ich.
Im Gegenteil. So rasch es mir mit meinen gefesselten Händen möglich war, ergriff ich eine der zusammengerollten Strickleitern, die längs der Reling lagen, warf sie über Bord und sah zu, wie die Riesengestalten hintereinander daran emporzuklettern begannen. Trotz ihres plumpen Äußeren bewegten sie sich äußerst geschickt und schnell. Schon nach wenigen Sekunden stiegen die ersten Männer über die Reling.
Es waren wahrhaftig Giganten. Keiner von ihnen war kleiner als zwei Meter, und ihre Schulterbreite betrug beinahe das Doppelte eines normalen Menschen. Selbst auf mich, der wusste, dass ihr monströses Äußeres nur auf die schweren Tiefsee-Monturen zurückzuführen war, die sie trugen, wirkte der Anblick fast beängstigend.
Während sich die Männer der NAUTILUS im Halbkreis um die Strickleiter verteilten und warteten, bis auch der letzte an Bord gekommen war, trat ich auf Harmfeld zu. Der Kapitän der Zuidermaar war fast bis zur gegenüberliegenden Reling zurückgewichen und starrte aus hervorquellenden Augen auf die Horrorgestalten. Ein Teil seiner Mannschaft hatte sich um ihn geschart; die meisten bewaffnet, aber ebenso erstarrt vor Schrecken wie ihr Kapitän.
»Geben Sie Ihren Männern Befehl, die Waffen zu senken«, sagte ich hastig. »Ein einziger Schuss löst eine Katastrophe aus!«
Natürlich reagierte Harmfeld auch jetzt nicht auf meine Worte. Aber seine Männer hatten sie verstanden, und der Anblick der finsteren Giganten unterstrich meine Worte und überzeugte sie davon, dass es besser war, auf mich zu hören. Einer nach dem anderen senkten sie ihre Gewehre. Ich atmete innerlich auf.
Mittlerweile war auch der letzte Mann der NAUTILUS an Bord gekommen, und als ich mich umwandte, traten drei der monströsen Gestalten auf Harmfeld und mich zu. Eine von ihnen überragte selbst die schwarzgekleideten Riesen noch um mehr als Haupteslänge. Ich hätte noch nicht einmal durch die Frontscheibe ihres Helmes blicken müssen, um sie zu erkennen.
»Rowlf!«, sagte ich erleichtert. »Ihr hättet wirklich keine Minute später kommen dürfen!«
Howards Leibdiener trat auf mich zu und blickte kopfschüttelnd zu mir herab. »Issoch immers selbe mit dir«, sagte er. »Kaum lässt ma dichn Moment ausse Augen, bisse wieda inne Klemme.« Er seufzte, nahm umständlich seinen Helm ab und legte ihn vor sich auf das Deck.
»Was … was bedeutet das, Craven?«, krächzte Harmfeld. »Sie kennen diese … diese Männer?«
»Das will ich meinen, mon ami«, sagte eine der beiden anderen Gestalten. »Sie sind der Kapitän dieses famosen Schiffes, nehme ich an?«
Harmfeld starrte den Mann im Taucheranzug an und sagte kein Wort. Nach wenigen Sekunden hob der Mann – wie Rowlf zuvor – die Hände an den Kopf, löste seinen Helm und reichte ihn an seinen Begleiter weiter. Das schmale, ausgezehrt wirkende Asketengesicht mit dem weißen Haar, das unter dem Taucherhelm zum Vorschein kam, wirkte über den monströsen Schultern der Tiefseemontur beinahe lächerlich.
»Wenn ich mich vorstellen darf?«, fragte er. »Mein Name ist Nemo. Kapitän Nemo. Und Sie sind …«
»Harm … Harmfeld«, stammelte Harmfeld. »Sie … Sie sind Nemo? Der … der Nemo?«
»In der Tat, mein Lieber, der Nemo«, erwiderte Nemo mit einem raschen, flüchtigen Lächeln. Er hob den Arm, deutete mit der Metallklaue seines Anzuges auf seine übrigen Begleiter und schloss auch mich in die Geste ein. »Dies hier sind meine Leute, mon capitaine«, sagte er. »Und wie Sie schon ganz richtig vermutet haben, handelt es sich bei Monsieur Craven um einen guten alten Bekannten von mir. Man könnte beinahe sagen, einen Freund.« Er runzelte die Stirn. »Ich sehe, er ist in Ketten?«, fragte er. »Was hat er getan?«
Harmfelds Gesicht verlor noch ein wenig mehr an Farbe. »Nichts«, sagte er rasch. »Es handelt sich wohl um … um einen Irrtum.«
Nemo nickte. »Das scheint mir auch so, mon capitaine. Es tut mir übrigens ausgesprochen leid, dass ich Ihr prachtvolles Schiff ein wenig beschädigen musste, aber unsere Zeit ist knapp bemessen und Ihre Kanonen drohten die NAUTILUS in Mitleidenschaft zu ziehen.«
»Was … was wollen Sie von uns?«, stammelte Harmfeld.
»Das ist in der Kürze der Zeit und unter den gegebenen Umständen leider nicht so einfach zu erklären«, antwortete Nemo knapp. »Aber ich darf Sie vielleicht bitten, mich an Bord meines Schiffes zu begleiten, mein lieber Freund. Dort werden Sie alles erfahren, was vonnöten ist.«
»Ich … ich bin Ihr Gefangener?«, fragte Harmfeld.
Nemo seufzte. »Ich hätte vielleicht ein anderes Wort dafür gefunden«, sagte er. »Aber ja, sicher, man könnte es so nennen. Sagen wir der Einfachheit halber, dass Sie Ihr prachtvolles Schiff vorübergehend als geentert betrachten dürfen.«
»Dann ist es also wahr, was man sich über Sie erzählt!«, sagte Harmfeld wütend. Er hatte den ärgsten Schrecken überwunden und fand seine Fassung jetzt wieder. »Sie sind nichts als ein gemeiner Pirat!«
»Aber ich bitte Sie, mon ami!«, erwiderte Nemo in leicht beleidigtem Ton. »Nichts liegt mir ferner, als einen Akt der Piraterie zu begehen. Es ist nur so, dass wir aus einem ganz bestimmten Grund hier sind. Sie werden später alles erfahren, aber nehmen Sie jetzt damit vorlieb, dass wir Ihr Schiff brauchen.«
»Und wozu?«, fragte Harmfeld.
»Um diese Insel zu evakuieren«, antwortete Nemo.
»Evakuieren?« Harmfeld blinzelte irritiert. »Wie meinen Sie das? Was soll der Unsinn?«
»Ich fürchte, es ist alles andere als Unsinn«, sagte Nemo in eindeutig bedauerndem Ton. »Dies ist die Insel Krakatau, nicht wahr?«
Harmfeld nickte, und Nemo fuhr fort: »Der Vulkan wird ausbrechen, mon capitaine. In weniger als zwei Tagen wird fast die gesamte Insel in einer einzigen, gewaltigen Explosion vom Antlitz dieses Planeten getilgt werden.«
Das Wesen fraß sich tiefer und tiefer in die Erde. Längst hatte es den Leib des Berges über sich zurückgelassen, die Insel, ja selbst den Jahrmillionen alten Granit des Meeresbodens durchstoßen, aber immer noch fraß es sich weiter. Sein Leib, heiß wie das Netz einer Sonne, hatte eine feurige Wunde in die Erde gegraben, einen flammenden Kanal, erfüllt mit kochender Lava und Hitze, aber noch hatte es sein Ziel nicht erreicht.
Der Ssaddit hielt für einen Moment in seinem gierigen Fressen und Graben inne, um neue Kraft zu schöpfen. Rings um den schrecklichen Lavawurm herum glühte der Fels, und mit dem winzigen, nur von Instinkten beherrschten Etwas, das er anstelle eines Verstandes trug, spürte er die Verlockung des feurigen Erdinneren wie einen düsteren Ruf, der von tief, tief unten erscholl. Dort war sein Ziel. Dort, im kochenden Herzen der Erde, in dem die Erinnerung an die Jugend dieses blauen Planeten noch frisch war, würde er seine Erfüllung finden. Selbst er würde sterben, wenn ihn die Umarmung des flammenden Magmas umfing, aber das spielte keine Rolle. Den Weg dorthin zu graben war der einzige Zweck seines Daseins. Seines und dem seiner zahllosen Artgenossen, die sich jetzt noch tatenlos in den sprudelnden Lavaseen des Krakatau suhlten, abwartend, aber bereit, ihm zu folgen, wenn er den Ort der Bestimmung erreicht hätte.
Dann geschah etwas. Die verkümmerte Intelligenz des Ssaddit reichte nicht aus, die Veränderung zu erkennen, aber er spürte immerhin, dass irgendetwas in seiner Nähe geschah, dass Bewegung war, wo keine sein durfte, nicht hier, tief unter der Meeresoberfläche.
Der Ssaddit kroch weiter. Sein schreckliches Maul verschlang Felsen und Erz und verflüssigte es, während er, zuckend und sich windend wie ein bizarrer Wurm, weiter in die Tiefe glitt.
Und plötzlich war der massive Fels unter ihm verschwunden, sein schnappendes Maul griff ins Leere, und dann stürzte die gewaltige Kreatur dreißig Yards weit in die Tiefe und schlug auf dem Boden einer Höhle auf, eines natürlichen, vor Jahrmilliarden entstandenen Hohlraumes, der noch nie das Licht der Sonne erblickt hatte. Das Wesen spürte keinen Schmerz, denn dazu war es nicht fähig, sondern wand sich nur ein paarmal wie ein getretener Wurm, hob seinen augenlosen Schädel und kroch schwerfällig zur Mitte der gewaltigen Gesteinsblase.
Dann …
Ein dünner, hellgrün glühender Faden aus Licht teilte die äonenalte Finsternis, berührte den Ssaddit und tötete ihn in Bruchteilen von Sekunden. Das unheimliche Glühen des Feuerwurmes erstarb, und mit einem Male war die Albtraumkreatur nicht mehr als ein Stück verkrümmt daliegender schwarzer Schlacke.
Aber das Licht erlosch nicht, sondern wanderte weiter, glitt hierhin und dorthin und verharrte schließlich in der Mitte der Höhle, genau unter der flammenden Wunde, die Dagons Kreatur in ihre Decke geschlagen hatte. Es begann zu pulsieren, wuchs, schrumpfte wieder zusammen und dehnte sich aus, bis aus der flammenden Lichtnadel ein ellipsoides Etwas aus purer Helligkeit geworden war.
Im Inneren der unheimlichen Erscheinung begannen sich Schatten zu bilden. Eine Weile tanzten sie hektisch hin und her, als wären die Kräfte, die sie lenkten, noch nicht stark genug, sie zu einem Körper zu ballen. Dann ertönte ein heller, peitschender Laut, und aus den Schatten wurde ein drei Meter hohes, monströses Etwas, ein Ding, tausend Mal schlimmer als ein Fiebertraum, Tentakel peitschend und geifernd, mit riesigen, blutig roten Augen. Mit einem einzigen Schritt trat der Gigant aus dem leuchtenden Tor heraus. Unter seinen Füßen bebte der Boden, und als er an den verendeten Ssaddit herantrat und ihn mit einem seiner zahllosen Gliedmaßen berührte, zerfiel der Kadaver zu feiner, grauer Asche.
Für eine Weile stand der Riese einfach da, starrte ins Nichts und schien zu lauschen. Dann, mit einer Bewegung, die seinem plumpen Äußeren Hohn sprach, drehte er sich herum und trat wieder in das Tor hinein. Das grüne Lichtmeer zuckte und wogte wie bewegtes Wasser hinter ihm, und kaum war sein Körper mit dem Glühen verschmolzen, schrumpfte es wieder zu einem Lichtfaden zusammen. Dann erlosch es.
An der Decke der Höhle begann der Fels abzukühlen. Nach einer Weile glühte der Fels nur mehr in sanftem, sehr dunklem Rot, und etwas später erlosch auch dieses. Die Wunde, die der Erde geschlagen worden war, war wieder verheilt. Die Dunkelheit, die seit Äonen die unterseeische Höhle beherrscht hatte, nahm ihr Reich wieder in Besitz. Es schien, als wäre nichts geschehen.
Und doch hatte sich etwas verändert. Niemand wusste es, niemand spürte es, nicht einmal die, die sein Kommen herbeigefürchtet hatten, und doch war der Tod dieses einen Ssaddit die erste Schlacht gewesen. Eine Schlacht, die vielleicht die endgültige Entscheidung über das Schicksal dieser Welt herbeiführen würde.
Denn der UNAUSSPRECHLICHE war zurückgekehrt in die Wirklichkeit, die zu bewachen ihm aufgetragen worden war. Bewachen.
Nicht beschützen.
Die NAUTILUS war längsseits gegangen. Das gewaltige Turmluk hatte sich geöffnet, und einer von Nemos Männern hatte eine Laufplanke ausgelegt, sodass wir das Unterseeboot trockenen Fußes erreichen konnten. Harmfeld hatte sich nicht mehr gesträubt, Nemos »Einladung« Folge zu leisten und an Bord der NAUTILUS überzuwechseln – wenn auch höchstwahrscheinlich weniger aus Einsicht als vielmehr, weil er von dem Gehörten und Erlebten viel zu schockiert war, um überhaupt zu so etwas wie Widerspruch fähig zu sein. Ich war ein wenig enttäuscht, Howard nicht im Turm vorzufinden, aber Nemo erklärte mir, dass er im Salon auf mich und den Kapitän der Zuidermaar warten würde, und ich beeilte mich, die gewendelte Eisentreppe hinunter in die Kommandozentrale der NAUTILUS zu laufen.
Unser Wiedersehen war so herzlich, wie man es nach allem, was in der Zwischenzeit geschehen war, erwarten konnte. Howard schloss mich schlichtweg in die Arme und presste mich so heftig an sich wie eine Mutter, die ihren tot geglaubten Sohn wiedergefunden hat. Einen Moment lang ließ ich seine stürmischen Freudenbezeugungen über mich ergehen, dann löste ich mich aus seiner Umarmung, trat einen Schritt zurück und musterte ihn von Kopf bis Fuß.
Howard sah nicht gut aus; aber das konnte man von einem Mann, der Wochen an einer tödlichen Krankheit gelitten hat, auch schwerlich erwarten. Tiefe graue Schatten lagen auf seinen Wangen, und seine Augen hatten einen fiebrigen Glanz, der wohl nur zum Teil auf seine Erregung zurückzuführen war. Seine Hände zitterten ganz leicht, als er einen Zigarillo aus der Rocktasche nahm und anzündete.
»Wie schön, dich wiederzusehen, Junge«, sagte er – zum wahrscheinlich dreißigsten Male. »Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben.«
»Du weißt doch: Unkraut vergeht nicht«, antwortete ich.
Howard lächelte pflichtschuldig, aber der ernste Ausdruck in seinen Augen nahm eher zu. Er setzte sich, schnippte die Zigarrenasche auf den Boden und wies mich mit einer einladenden Geste an, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Ich sah zur Tür zurück, ehe ich gehorchte. Das halbrunde Stahlschott hatte sich hinter mir wieder geschlossen.
»Ich habe darum gebeten, dass man uns für einige Minuten in Ruhe lässt«, sagte Howard, der meinen Blick richtig deutete. »Wir haben eine Menge zu bereden. Und nicht sehr viel Zeit. Was ist passiert?«
Ich zögerte einen Moment zu antworten. Mir brannten selbst tausend Fragen auf der Zunge, angefangen mit der, wieso die NAUTILUS plötzlich hier aufgetaucht war – nicht nur tausende von Meilen von der schottischen Küste entfernt, sondern noch dazu zwei Jahre in der Vergangenheit. Aber ich kannte Howard auch gut genug, um zu wissen, dass ich ohnehin keine Antwort bekommen würde, ehe nicht sein Wissensdurst gestillt war. So fügte ich mich denn und erzählte ihm alles, was seit unserer letzten Begegnung geschehen war, über die verzweifelte Odyssee der DAGON und mein Zusammentreffen mit dem geheimnisvollen Feind der GROSSEN ALTEN, bis hin zu dem, was sich auf Krakatau selbst zugetragen hatte. Howard sagte während der ganzen Zeit kein Wort, aber er hatte seine Physiognomie nicht gut genug unter Kontrolle, dass ich nicht darin hätte lesen können. Nicht sehr viel von dem, was er hörte, schien ihn zu überraschen.
Auch als ich zu Ende berichtet hatte, schwieg Howard weiter; und schließlich hielt ich es nicht mehr aus und platzte heraus: »Was hat das alles zu bedeuten, Howard? Wie kommt die NAUTILUS hierher? Woher wusstet ihr überhaupt, wo ich bin, und was hat Nemo damit gemeint: Diese Insel wird vom Angesicht des Planeten getilgt werden?«
Howard lächelte, wurde aber sofort wieder ernst. »Mein alter Freund Nemo befleißigt sich manchmal einer etwas blumenreichen Ausdrucksweise«, sagte er. »Aber er hat Recht, Robert. Sagt dir der Name Krakatau wirklich so wenig? Denk zurück – zwei Jahre ungefähr.«
Ich überlegte einen Moment, schüttelte aber dann den Kopf. Vor zwei Jahren hatte ich friedlich in London gelebt und versucht, mich in die Geheimnisse einzuarbeiten, die mir mein Vater zusammen mit seinem Riesenvermögen hinterlassen hatte. Ich hatte während dieser Zeit kaum etwas von dem mitbekommen, was rings um mich herum auf der Welt vorging.
»Zwei Jahre in der Vergangenheit, das ist jetzt«, sagte Howard. »Der Vulkan wird ausbrechen, in einer der größten Eruptionen seit Menschengedenken.«
»Das ist unmöglich!«, protestierte ich. »Der Berg ist völlig ruhig, und –«
»Und doch ist es geschehen. Oder wird geschehen«, sagte Howard. »Ich weiß es. Und Nemo und alle anderen auch.«
»Und es gibt … keine Möglichkeit, es … es zu verhindern?«
Howard schüttelte traurig den Kopf. »Wie willst du etwas verhindern, was schon geschehen ist, Robert?«, fragte er. »Wir können nur versuchen, so viele Menschen wie möglich von der Insel fortzuschaffen, ehe die Katastrophe hereinbricht.«
»Deshalb hat Nemo die Zuidermaar einfach entern lassen«, sagte ich.
Howard nickte. »Ja. Für lange Erklärungen bleibt keine Zeit. Wir haben achtundvierzig Stunden, um Krakatau zu evakuieren, von hier zu verschwinden und so weit aufs Meer hinauszufahren, wie wir nur können. Dieses holländische Kriegsschiff hat sogar noch weniger Zeit. Es muss einen Hafen erreichen, ehe die Flutwelle kommt. »Er seufzte, stand auf und kam mit einer zerknitterten Seekarte wieder. Ich sah, dass er einige Punkte darauf mit roten Strichen markiert hatte.
»Einen Vorteil haben wir«, sagte er, während er die Karte auseinanderfaltete und mit dem Handrücken glatt strich. »Wenn auch einen kleinen. Da wir wissen, wo und wie schlimm die Springflut zugeschlagen hat, können wir dem Kapitän des Schiffes ziemlich genau sagen, wohin er segeln muss, um zu überleben.«
»Und … alles andere?«, fragte ich stockend. »Dagon und Shannon und …«
»Dazu bleibt keine Zeit«, unterbrach mich Howard leise, aber sehr ernst. »Auf dieser Insel leben an die tausend Menschen. Wir werden kaum alle retten können, aber jeder Moment ist kostbar. Dein fischgesichtiger Freund wird zusammen mit dem Vulkan in die Luft fliegen.«
»Und Shannon auch«, fügte ich düster hinzu.
Howard wich meinem Blick aus. »Ich fürchte es«, murmelte er. Er schwieg einen Moment, sah mich dann doch an und fragte: »Du magst ihn sehr, wie?«
»Ich … ich weiß nicht«, antwortete ich ausweichend. »Bis vor ein paar Tagen dachte ich, er wäre mein Freund, aber jetzt …« Ich suchte vergeblich nach den passenden Worten. Wie hätte ich die Enttäuschung, ja, das Entsetzen, mit dem mich Shannons so plötzliche Verwandlung erfüllt hatte, auch ausdrücken sollen?
»Wir können nichts für ihn tun«, sagte Howard leise. »Nicht, wenn er wirklich zu Dagon gegangen ist.«
»Ich könnte versuchen, ihn herauszuholen«, sagte ich. Howard lachte. Es klang nicht besonders amüsiert. »Nach allem, was du mir erzählt hast? Du bist verrückt, Junge.«
»Aber er ist wenigstens kein Verräter!«, sagte eine Stimme hinter mir.
Howard fuhr auf und presste wütend die Lippen zusammen – und auch ich drehte mich herum – und unterdrückte im letzten Augenblick einen erschrockenen Ausruf.
Das Schott hatte sich lautlos wieder geöffnet, und Nemo, Rowlf und Kapitän Harmfeld waren hereingekommen, begleitet von zwei Matrosen der NAUTILUS, die wie zufällig rechts und links von Harmfeld standen. Und einem jungen, dunkelhaarigen Mädchen, das Howard und mich abwechselnd mit Zorn sprühenden Blicken anstarrte.
»Jennifer!«, entfuhr es mir. »Sie? Wie … wie kommen Sie hierher?« Ich sprang auf und eilte ihr entgegen, aber Jennifer ignorierte mich und ging mit schnellen Schritten auf Howard zu.
»Halten Sie so Ihr Wort, Lovecraft?«, fauchte sie. »Wir hatten etwas anderes vereinbart.«
»Unsinn«, verteidigte sich Howard. »Wir haben versichert, dass wir Sie hierher bringen, mehr nicht. Und selbst wenn – es stehen Menschenleben auf dem Spiel, was gilt da ein gegebenes Wort?«
»Was hat das alles zu bedeuten?«, fragte ich verstört. »Wie kommen Sie hierher, Jenny?«
»Das fragen Sie besser Ihren Freund Howard«, schnappte Jennifer wütend. »Wir hatten eine Abmachung.«
»Eine Abmachung?« Ich sah Howard an.
»Das stimmt«, gestand er. »Wir … haben versprochen, sie zu Dagon zu bringen. Als Gegenleistung hat sie uns verraten, wo du bist. Und wann«, fügte er mit sonderbarer Betonung hinzu.
»Und Sie betrügen mich«, sagte Jennifer böse. »Ich habe mein Wort gehalten und Sie zu Craven geführt. Jetzt bringen Sie mich zu Dagon.«
»Kindchen«, begann Howard, »das ist –«
Jennifer fuhr ihm mit einer wütenden Bewegung ins Wort. »Das ist, was wir vereinbart haben, Lovecraft. Ich habe mein Wort gehalten, jetzt halten Sie das Ihre. Wenn nicht –« Sie sprach nicht weiter, aber vielleicht war es gerade das, was ihren Worten ein solches Gewicht verlieh. Howard presste die Lippen aufeinander, aber ich spürte, dass sein Zorn nicht ganz echt war und dass sich eine Furcht dahinter verbarg, die ich nicht verstand.
Ehe er antworten und damit alles nur noch schlimmer machen konnte, trat ich zwischen ihn und das schwarzhaarige Mädchen, um so wenigstens den Blickkontakt zwischen den beiden ungleichen Kampfhähnen zu unterbrechen.
»Jenny«, sagte ich, »warum erzählen Sie mir nicht einfach, was geschehen ist. Vielleicht finden wir eine Lösung.«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, antwortete sie wütend. »Ich hatte eine Abmachung mit Lovecraft und Nemo. Ich habe ihnen gesagt, wo Sie zu finden sind, und dafür haben sie sich verpflichtet, mich zu Dagon zu bringen.«
»Warum?«, fragte ich. »Was versprechen Sie sich davon?«
»Das geht Sie nichts an«, antwortete sie wütend.
»Ich denke doch«, widersprach ich. »Sehen Sie, mir ist auch daran gelegen, Dagon zu finden, ehe hier alles in die Luft fliegt, aber wenn ich Ihnen helfen soll, dann muss ich wissen, auf welcher Seite Sie stehen, Jenny.«
»Siehst du das wirklich nicht, Robert?«, fragte Howard leise. »Schau sie dir doch an. Sie liebt ihn. Sie liebt dieses Ungeheuer!«
Seine Stimme troff dabei so von Verachtung, dass Jenny wie von der Tarantel gestochen herumfuhr und es für einen Moment so aussah, als wolle sie sich auf ihn stürzen.
»Wollen Sie es bestreiten?«, fragte Howard kühl.
Ich drehte mich wütend herum. »Howard, zum Teufel, was soll das?«, schnappte ich.
Ich bekam keine Antwort, aber das zornige Funkeln in Howards Augen verstärkte sich weiter. Einen Moment lang erwiderte ich seinen Blick, dann drehte ich mich wieder zu Jennifer um und versuchte zu lächeln. Ganz gelang es mir nicht.
»Ist es wahr?«, fragte ich. »Lieben Sie Dagon?«
Das Mädchen schürzte wütend die Lippen. »Und wenn?«, fragte sie.
»Wenn«, antwortete ich, sehr leise und in aufrichtig bedauerndem Ton, »kann ich Ihnen nicht helfen, Jenny. Das müssen Sie einsehen. Dagon ist unser Feind; und nicht nur unserer.«
»Ach?«, fragte Jennifer. »Ist er das?«
Ich stutzte. Ihre Worte waren genau in dem Ton vorgebracht, in dem ein störrisches Kind reden mochte, das ausprobierte, wie weit es gehen kann. Und trotzdem ließ mich etwas darin aufhorchen.
»Wie meinen Sie das?«, fragte ich.
In Jennifers Augen blitzte es. »Warum kommen Sie nicht mit mir und fragen ihn selbst?«, sagte sie.
Ich wollte antworten, aber ich konnte es nicht. Jennifer hasste mich, das war mir klar, im gleichen Moment, in dem ich in ihre Augen sah. Sie hasste Howard, Nemo, mich – überhaupt jeden hier, denn in den letzten Augenblicken hatte sie vermutlich die größte Enttäuschung ihres Lebens erlebt. Ich wusste noch immer nicht genau, was Howard und sie vereinbart hatten – aber es schien, als hätte sie ihren Teil dieses sonderbaren Handels eingehalten. Wenn Howard jetzt die Vereinbarung brach, dann musste ihr dies wie Betrug vorkommen. Genau genommen war es das wohl auch. Und genau genommen konnte ich es nicht gutheißen, ganz gleich, aus welchen Gründen heraus Howard und Nemo handeln mochten. Auch ein Betrug an einem Feind bleibt ein Betrug, egal wie man es dreht und wendet.
Aber da war noch mehr. Über diese Tatsache hinaus konnte ich Jennifer nur zu gut verstehen. Ich wusste aus eigener schmerzlicher Erfahrung, wie eng Liebe und Leid miteinander verbunden sind. Auch ich hatte eine Enttäuschung erlebt, die ich selbst jetzt, nach mehr als zwei Jahren, noch nicht vollends verwunden hatte.





























