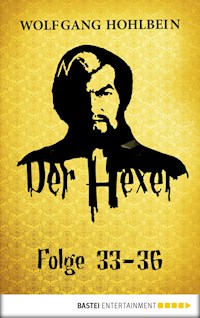
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Der Zug, der in den Albtraum fuhr" - Folge 33 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Vor einer Sekunde war die Gasse noch leer gewesen; nicht als eine Lücke zwischen zwei Häusern, in der sich der Schmutz und der Unrat von Jahrzehnten angesammelt hatten. Jetzt war etwas da. Es war nicht genau zu definieren, was es war. Es war schwarz und formlos und bewegte sich, auf eine widerwärtige, kriechende Art. Es lebte nicht und war doch nicht tot. Es dachte nicht und hatte trotzdem einen Auftrag. Töten. Keine Macht dieser Welt konnte es von der Erfüllung dieses Auftrag abhalten. Mein Pech. Denn ich war der Mann, den es töten sollte ...
"Ein Gigant erwacht" - Folge 34 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Für lange Zeit hatte der Gigant geschlafen. Wie lange, das wusste er nicht. Zeit war etwas, was keine Bedeutung für ihn hatte; vielleicht, weil sein Bewusstsein nicht imstande war, diesen Begriff zu verarbeiten. Er dachte nur in Perioden von Hunger, Schlaf und wohligem Gesättigtsein. Meist, wenn er erwachte, hatte er Hunger. Und immer war sein Erwachen von etwas begleitet, das er kannte. Der Klang der Flöte. Stets hatte ihn die sanfte Melodie zu Beute und damit Fressen geführt. Dies wusste er: Die Flöte bedeutete Jagd und Blut und Fleisch, das er fressen konnte. Die Flöte bedeutete Nahrung. Jetzt hörte er sie. Und der Gigant erwachte.
"Die Gruft der weissen Götter" - Folge 35 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Swen Liefenstahl hatte seine Runde beendet, verharrte einen Moment lang regungslos auf der Stelle und ging dann denselben Weg zurück, den er gekommen war. Er war groß, selbst für einen Mann seines Volkes, und seine mächtigen Schultern sprengten beinahe den dunklen Lederharnisch. Sein Gesicht wirkte müde und übernächtigt, aber die dunklen Augen unter dem Helm blickten aufmerksam und wach. Drei Tage war es her, dass Erik ihn und die anderen Ratsmitglieder zusammengerufen hatte, um seine düsteren Vorahnungen mit ihnen zu teilen. Seid wachsam, hatte er gemahnt, denn das Ende unserer Herrschaft steht bevor. Hätte ein anderer Mann als Erik Weltuntergangsstimmung verbreiten wollen, hätte er sich Swens beißenden Spott zugezogen. Nicht so Erik. Seine Ahnungen hatten noch nie getrogen. Und das erfüllte Swen mit einer ungewissen nagenden Furcht.
"Todesvisionen" - Folge 36 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Der Laut kam mit dem Wind heran, leise erst, kaum wahrnehmbar; ein Raunen in der Ferne, weit hinter den zerklüfteten Felsen und jenseits der Schlucht, in der wir unser Lager aufgeschlagen hatten. Dann schwoll er an, wurde lauter und lauter- und schien sich gleich darauf zu entfernen. Fast wie das Rauschen des Ozeans, der sich an einem fernen Gestade bricht... Mit einem Ruck fuhr ich fuhr ich auf, als ich endlich erkannte, was es war. STIMMEN! Ein monotoner Singsang wie aus Hunderten von Kehlen; ein dumpfer Ton, der einen fast hypnotischen Rhythmus folgte. Ein indianisches Totenlied! Und während ich reglos auf meine Ellbogen gestützt dalag und dem klagenden, fernen Lied lauschte, schwoll das Singen abermals an, wurde drängender, fordernder, ja wütender. Und es kam näher!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Der Zug, der in den Albtraum fuhr
Der Hexer – Ein Gigant erwacht
Der Hexer – Die Gruft der weißen Götter
Der Hexer – Todesvisionen
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 33-36:
Der Hexer – Der Zug, der in den Albtraum fuhr
Der Hexer – Ein Gigant erwacht
Der Hexer – Die Gruft der weißen Götter
Der Hexer – Todesvisionen
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 33–36
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1576-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 33
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Hier das Vorwort zu Band 33.
Obwohl ich eigentlich nur als Bearbeiter für die gedruckte Hexer-Sammler-Edition fungierte, kam ich dem Vorschlag Wolfgang Hohlbeins, für diese Bände ein Vorwort zu schreiben, gerne nach. Der Grund dafür liegt darin, dass die ursprünglichen Hefte 22 »Die Hand des Dämons« und 23 »Im Netz der toten Seelen« die ersten von insgesamt sechs Hexer-Romanen aus meiner Feder erschienen sind.
Fast zur gleichen Zeit, als der erste Hexer-Roman im Gespenster-Krimi erschien, gelang es mir – damals noch als Schüler – meinen ersten eigenen Grusel-Roman an einen Verlag zu verkaufen. Wenig später erschien innerhalb einer anderen Serie ein Leserbrief von mir. Wie Wolfgang in früheren Vorworten ja bereits erzählt hat, gab es zur damaligen Zeit ein sehr aktives Fandom: Fans dieser Art von Geschichten, die sich in zahlreichen Clubs organisiert hatten. Als Folge dieses Leserbriefes wurde ich vom Leiter eines dieser Clubs angerufen, der sich wie ein Schneekönig freute, nicht nur ein neues Mitglied, sondern sogar einen angehenden Autor geworben zu haben. Er lud mich zu einem bald darauf stattfindenden Treffen zahlreicher Fans und Autoren ein.
Auf diesem Treffen lernte ich viele der Autoren zum ersten Mal persönlich kennen, deren Romane ich über Jahre hinweg begeistert verschlungen hatte. Die für mich beeindruckendste Erfahrung damals war, dass es sich keineswegs um Halbgötter handelte, sondern um ganz normale Menschen, mit denen man in aller Ruhe ein paar Bier trinken, sich unterhalten, scherzen und über die Arbeit austauschen konnte; die mich als noch völlig unbekannten Neuling sofort freundschaftlich akzeptierten und mir für das Schreiben wertvolle Tipps gaben.
Einer dieser Autoren, mit denen ich mich auf Anhieb besonders gut verstand, war Wolfgang Hohlbein, der zu diesem Zeitpunkt gerade mit seinen ersten Büchern den Grundstein für seine beispiellose Karriere gelegt hatte. Wir beschlossen, uns auch mal privat zu treffen, woraus eine bis heute andauernde Freundschaft entstand.
Eines der am meisten diskutierten Themen innerhalb des Fandoms war zu dieser Zeit die Frage, wer der geheimnisvolle Robert Craven sein mochte. Wolfgang hat selbst bereits beschrieben, wie auch ich zusammen mit ihm die wildesten Spekulationen zu diesem Thema angestellt habe. Er muss sich wirklich königlich amüsiert haben. Genau wie er bedauere ich es aufrichtig, dass gerade kein Fotoapparat zur Hand war, um meinen vermutlich selten dämlichen Gesichtsausdruck festzuhalten, als ich während eines Besuchs bei ihm die Wahrheit schließlich erfuhr …
Nun, zu dieser Zeit zeichnete sich bereits ab, dass Wolfgang aufgrund seiner zusätzlichen Buchprojekte die mit einer vierzehntägig erscheinenden Serie anfallende Arbeit nicht allein würde bewältigen können. Da ihm meine bisherigen Romane gefallen hatten, bot er mir an, mich doch selbst einmal an einem Hexer-Roman zu versuchen.
Als ich meine Freudentänze schätzungsweise eine Woche später erschöpft einstellte und mit dem Schreiben begann, merkte ich erst, was für eine gewaltige Hürde ich da in Angriff nehmen wollte. Obwohl ich inzwischen einige weitere Romane veröffentlicht hatte, war ich noch ein blutjunger Anfänger, der nun den Stil und die Erzählweise eines der am meisten geschätzten Autoren nachahmen sollte, dessen Können sich nicht zuletzt im wachsenden Erfolg seiner Bücher zeigte.
Ich erfand eine Geschichte, die ursprünglich in Schottland angesiedelt war, doch entsprach sie noch keineswegs dem hohen Hexer-Standard. Mehrere gründliche Überarbeitungen waren nötig, und auch Wolfgang selbst hatte damit vermutlich fast ebenso viel Arbeit, als hätte er den Roman selbst geschrieben. In der letzten Fassung war schließlich ein Zweiteiler daraus geworden, der statt in Schottland in Kalifornien spielte, wo Robert mit der Suche nach Necrons Drachenburg begann.
Einerseits war ich überglücklich, direkt einen Zweiteiler zu meiner Lieblings-Serie beizutragen, doch obwohl gerade die zahlreichen Überarbeitungen eine zwar harte, aber äußerst lehrreiche Schule für mich darstellten, merkte ich anderseits auch, wie viel mir an handwerklichem Rüstzeug noch fehlte. Als Folge legte ich beim Hexer erst einmal eine Pause ein und wandte mich anderen Projekten zu, ehe ich in den vierziger Bänden schließlich ein Comeback beim Hexer startete. Umso niederschmetternder traf mich dann wenige Wochen später die Nachricht, dass die Serie mit Band 49 eingestellt würde. Gerüchte, dass es da einen direkten Zusammenhang gäbe, kann nur Cthulhu persönlich in die Welt gesetzt haben!
Mittlerweile habe ich mehr als hundert Heftromane und etwa zwei Dutzend Bücher veröffentlicht, einige davon gemeinsam mit Wolfgang Hohlbein, doch gerade meine ersten beiden Hexer-Romane haben stets eine besondere Bedeutung für mich gehabt. Hätte ich durch sie nicht so viel gelernt und hätte Wolfgang nicht so viel Zeit und Mühe investiert, mich immer wieder auf Schwächen und Fehler hinzuweisen, hätte ich es vermutlich nicht geschafft, das Schreiben zu meinem Beruf zu machen und bis zum heutigen Tag davon leben zu können. Dafür schulde ich ihm immer noch immensen Dank.
Im Rahmen dieser Edition habe ich dem Zeitpunkt, an dem ich diese beiden Romane bearbeiten musste, mit äußerst gemischten Gefühlen entgegengeblickt. Manches daran gefällt mir auch heute noch sehr gut, andere Passagen hätte ich am liebsten komplett neu geschrieben. Da das Ziel dieser Edition jedoch eine möglichst große Originaltreue ist, habe ich mich entschieden, nur geringfügige Eingriffe vorzunehmen, indem ich einige offensichtliche Fehler korrigiert und ein paar allzu ungeschickte Formulierungen geändert habe. Da die Romane bei ihrer Erstveröffentlichung keinen Proteststurm ausgelöst haben, bleibt mir die Hoffnung, dass sie auch vor dem kritischen Blick der heutigen Leser bestehen können. Falls nicht – die Termine für die nächsten Shoggoten-Fütterungen stehen im Anhang des Original-NECRONOMICON aufgelistet …
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 33Der Zug, der in den Albtraum fuhr
Irgendjemand verfolgte mich.
Ich hatte keinen Beweis dafür, nicht einmal ein Indiz, nicht den allergeringsten Hinweis.
Aber ich wusste es.
Seit dem frühen Morgen, seit ich mein Hotelzimmer verlassen hatte und in die Stadt gegangen war, war jemand hinter mir her; und wer immer es war, er stellte es sehr geschickt an, denn bisher hatte ich nicht einmal einen Schatten gesehen, geschweige denn meinen Verfolger selbst.
Dabei hatte ich alle Tricks zur Anwendung gebracht, die ich nur kannte, um einen Verfolger abzuschütteln; und deren waren es nicht gerade wenige.
Während meiner Jugend in den Slums von New York hatte ich gelernt, wie man Profi-Verfolger abschüttelt, und ich vermute, dass meinetwegen so mancher Angehörige der New Yorker Polizei am Rande eines Nervenzusammenbruches angelangt war, wenn ich ihm nach stundenlanger Verfolgungsjagd doch noch eine lange Nase gedreht hatte und entkommen war.
Diesmal schienen all meine Tricks nicht zu funktionieren.
Es war später Nachmittag, und seit nun fast acht Stunden vergnügte ich mich damit, vor jemandem davonzulaufen, den ich bisher nicht einmal zu Gesicht bekommen hatte. Bloß abgeschüttelt hatte ich ihn nicht.
Es war zum Wahnsinnigwerden! Ich sah niemanden, ich hörte niemanden, aber ich spürte seine Nähe, so deutlich, als stünde der Kerl neben mir und stänke nach Knoblauch wie ein ganzes Regiment besoffener Husaren!
Ich ging ein wenig schneller, tauchte – wohl zum hundertsten Male an diesem Tag – in den quirlenden Strom von Passanten ein, der die Main Street von San Francisco füllte, und wusste im gleichen Moment, dass mir auch dieses Manöver nichts anderes eintragen würde als einige weitere Knüffe in die Rippen und ein paar weitere Tritte auf die Zehen.
Ich erreichte eine Straßenkreuzung, blieb stehen und sah mich unschlüssig um. Auf geradem Wege setzte sich die Main Street fort, so weit ich blicken konnte, ehe sie sich im Dunst der Großstadt verlor. Zur Linken wurden die Häuser merklich schäbiger, und auch der Strom von Passanten nahm ab; zur Rechten erhoben sich einige Häuser, deren Äußeres zwar alles andere als Vertrauen erweckend war, die meinen Bedürfnissen aber schon näher kamen – es gab einen chinesischen Waschsalon, ein paar Bordelle, zwei oder drei Restaurants und, gleich schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite, einen Spielsalon, über dessen weit geöffnetem Eingang ein Schild die Millionen-Dollar-Chance versprach, was wohl höchstens für den Besitzer dieses Etablissements zutraf.
Ganz offensichtlich war ich an der Grenze des Vergnügungsviertels angelangt; eine Gegend, um die ich normalerweise nicht nur in Frisco, sondern auch in allen anderen Städten einen weiten Bogen gemacht hätte.
Nicht zuletzt, weil es noch gar nicht so lange her war, dass ich mir selbst meinen Lebensunterhalt damit verdiente, eben diese Gegenden unsicher zu machen. Im Moment allerdings schien mir die Straße genau das Richtige. Wenn ich überhaupt eine Chance hatte, meinen Verfolger irgendwie loszuwerden, dann hier.
Ich sah mich noch einmal um – natürlich ohne ihn zu erblicken –, griff in die Rocktasche und tat so, als überprüfe ich meine Barschaft; eine Geste, die mir genau richtig schien, den unbedarften Touristen zu spielen, der hierhergekommen war, um das große Abenteuer zu erleben. Dann überquerte ich forschen Schritts die Straße und trat durch den Eingang des Spielsalons.
Es war wie ein Schritt in eine andere Welt. Der Lärm und das Licht von San Francisco blieben hinter mir zurück, und vor mir, nur noch durch einen halb zurückgeschlagenen Vorhang getrennt, neben dem ein breitgesichtiger Schlägertyp herumlungerte, begann die glitzernde Plüschwelt des Spielsalons. Gedämpftes Stimmengemurmel drang in den Vorraum, das Klirren von Glas, das helle Klickern einer Roulettkugel, dazwischen ein helles Frauenlachen, der Geruch nach abgestandenem Qualm und Whisky …
Wie lange war es her, dass ich selbst in dieser Welt zu Hause gewesen war?
Wirklich schon fast vier Jahre? In diesem Moment kam es mir vor wie vier Tage. Ich kannte sie, diese Welt, die auf der anderen Seite des Vorhanges begann, wenngleich auch aus einer ganz anderen Sicht. Wie viele Nächte hatte ich in Lokalen wie diesem verbracht, hinter der Theke stehend und Gläser spülend, Spucknäpfe auswechselnd, hatte Leute Summen verspielen sehen, für die ich zehn Jahre hätte arbeiten müssen!
Ich verscheuchte den Gedanken, ging weiter und warf dem Muskelberg ein Lächeln zu, während er mich kalt betrachtete, mit geübtem Blick meine Kleidung und mein Auftreten einschätzte und zu dem Ergebnis kam, dass ich einzulassen wäre. Nach einer Sekunde faltete er sogar die Arme auseinander und verzog sein Gesicht zu etwas, das er für ein freundliches Lächeln halten mochte.
»Einen Tisch, Sir?«
Ich überlegte einen Moment, dann schüttelte ich den Kopf, deutete auf die Bar, die eine ganze Seitenwand des Raumes einnahm, und schnippte dem Breitgesicht im Weitergehen noch einen Vierteldollar zu.
Erneut nahm mich die glitzernde Welt des Spielsalons gefangen, kaum dass ich ein paar Schritte weitergegangen war; und für Augenblicke vergaß ich sogar meinen Verfolger und den eigentlichen Grund, aus dem ich hier hereingekommen war.
Es war wie eine Heimkehr. Die blitzende Strasswelt rings um mich herum stieß mich ab – und gleichzeitig zog sie mich an, auf eine schwer in Worte zu fassende, fast morbide Art.
Vielleicht war es einfach das Gefühl, zum ersten Mal im Leben auf der anderen Seite des Vorhanges zu stehen; in jeder Bedeutung des Wortes.
Ich ging zur Bar, setzte mich auf einen freien Hocker, bestellte ein Bier und sah mich noch einmal um, etwas gründlicher diesmal.
Der Raum war sehr groß, wirkte aber klein, denn an den zwei Dutzend unterschiedlich großen Spiel, und anderen Tischen drängelten sich an die zweihundert Menschen, wenn nicht mehr. Leicht gekleidete Mädchen bewegten sich zwischen den Tischen oder rückten den Spielern näher, die gewonnen hatten, ein altersschwacher Chinese wieselte umher und tauschte übervolle Aschenbecher und Spucknäpfe gegen frische aus, und wohl ein Dutzend Kellner balancierte mit einmaligem Geschick Tabletts durch das Menschengewühl.
Kurz, es war ein unglaubliches Chaos.
Genau das, was ich brauchte. Das Beste allerdings war die Tatsache, dass es mit Ausnahme zweier Türen hinter der Bar keinen weiteren Ausgang gab. Wenn mein unsichtbarer Verfolger nicht Gefahr laufen wollte, mich entweder zu verlieren oder so lange draußen zu stehen, bis er Wurzeln schlug, dann musste er wohl oder übel durch das Hauptportal hereinkommen.
Und ich wusste, dass ich ihn erkennen würde, im gleichen Moment, in dem er auch nur die Nase durch die Tür steckte.
Der Gedanke wirkte irgendwie ernüchternd auf mich, denn er führte einen zweiten, alles andere als angenehmen mit sich: die Frage nämlich, wer es war, der mir seit dem frühen Morgen an den Fersen klebte, und warum.
Prinzipiell gab es zwei Möglichkeiten. Die eine war, dass es sich schlichtweg um einen Gauner handelte, der aus meiner nicht gerade ärmlichen Kleidung und dem superteuren Hotel, aus dem ich gekommen war, auf ein Opfer schloss, dem er ohne großes Risiko den Geldbeutel abknöpfen konnte. Diese Version hätte ich vorgezogen.
Aber sie war nicht sehr wahrscheinlich. Kein Gelegenheitsdieb hätte das Geschick aufgebracht, mich den ganzen Tag über zu narren; die Geduld übrigens auch nicht.
Die zweite – und weitaus unangenehmere – Möglichkeit war, dass es sich um einen meiner alten Freunde handelte; einen von Necrons Drachenkriegern.
Diese Überlegung brachte mich vollends in die Wirklichkeit zurück.
Instinktiv blickte ich zur Tür, aber das Einzige, was ich sah, war das dümmliche Viertel-Dollar-Grinsen des Rausschmeißers. Ich erwiderte es, griff nach meinem Glas und nippte vorsichtig daran. Aber das Bier wollte mir nicht mehr schmecken.
Ich war nervöser, als ich zugeben wollte. Aber wenn meine Befürchtung zutraf, hatte ich auch Grund dazu. Es gibt ein paar Dinge, die noch tödlicher sind als ein Drachenkrieger mit einem Mordauftrag. Ein Hurrikan zum Beispiel, einer von den ganz großen. Oder ein Fallbeil, das auf den Mann unter der Guillotine zurast. Aber damit hörte die Auswahl auch schon beinahe auf.
Eigentlich nicht aus Lust an einem Spiel – ich habe niemals gern gespielt – ging ich zum Kassier, schob ihm eine zusammengefaltete Hundert-Dollar-Note in seinen vergitterten Affenkäfig und ließ mir dafür Jetons geben.
Unschlüssig drehte ich mich zweimal im Kreis, bis ich einen freien Platz an einem Tisch erspähte, von dem aus ich einen prachtvollen Blick auf den Eingang hatte.
Ich ging hin, ließ mich auf den Stuhl fallen und baute meine Jetons in vier gleichen Türmchen vor mir auf. Erst danach lehnte ich mich zurück und musterte die anderen Spieler, die noch am Tisch saßen.
Es waren fünf – vier Männer und eine Frau.
Aber es war nicht irgendeine Frau. Ihr Anblick schlug mich sofort in seinen Bann.
Sie war …
Schön allein wäre das falsche Wort. Ich war in meinem Leben einer Menge schöner Frauen begegnet, und gerade in Etablissements wie diesem war ein hübsches Gesicht etwas, das man geradezu erwarten konnte. Und doch war sie anders.
Ganz anders.
Sie hatte schwarzes, lang über die Schulter fallendes Haar, dunkle Augen, die eine Spur zu groß waren, und einen Teint, der mir den trivialen Vergleich mit Alabaster geradezu aufdrängte. Hier traf er zu. Ihr Gesicht war von einem sonderbaren, schwer zu beschreibenden Schnitt, im gleichen Maße sanft und natürlich wie … ja, es gab keine bessere Bezeichnung dafür: edel.
»Verzeihung, Sir.«
Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass die Worte keinem anderen als mir galten.
Verlegen fuhr ich zusammen, rettete mich in ein Lächeln und wandte mich dem Mann zu, der mich angesprochen hatte. »Meinen Sie mich?«
Der andere – ein hoch gewachsener, schwarzhaariger Schnauzbärtiger in piekfeiner Kleidung, mit manikürten Fingernägeln und dem unverkennbaren Ausdruck des Berufsspielers auf den Zügen – nickte. Schon dieses Nicken allein reichte, ihn mir auf Anhieb unsympathisch werden zu lassen. Vielleicht lag es auch nur daran, dass er zur Rechten der unbekannten Schönheit saß und ihre Hand in eindeutiger Manier auf seinem Unterarm lag.
»Ich meine in der Tat Sie, Sir«, antwortete der Mann ärgerlich. »Sind Sie gekommen, um zu spielen, oder meine Braut anzustarren?«
Die Art, in der er das Wort Braut betonte, machte ihn mir nicht gerade sympathischer. Aber ich verstand den Wink, lächelte noch einmal verzeihungsheischend und beeilte mich zu versichern: »Natürlich zum Spielen. Verzeihen Sie.«
»Schon gut«, antwortete der andere. Seine Begleiterin musterte mich mit einem Blick, in dem gleichzeitig ein sanftes Interesse wie auch Spott lag. Ein wenig zu hastig griff ich nach den Karten und begann zu mischen.
»Mein Name ist Teagarden«, stellte sich mein Gegenüber vor. »Ralph Teagarden. Und das ist meine Braut Annie.« Er deutete abermals auf die schwarzhaarige Göttin, dann zauberte er eine dekorative Falte zwischen seine Brauen. »Und mit wem haben wir das Vergnügen, wenn ich fragen darf?«
»Craven«, antwortete ich. »Robert Craven. Was spielen wir?«
»Haschmich bestimmt nicht«, versetzte Teagarden patzig und grinste.
Ich verbiss mir im letzten Moment die scharfe Antwort, die mir auf der Zunge lag. Teagarden wollte ganz offensichtlich ausprobieren, wie weit er mit dem unbeholfenen Gecken, der sich aus lauter Geltungsbedürfnis eine weiße Strähne ins Haar hatte färben lassen, gehen konnte. Unter normalen Umständen hätte ich das Spiel sicher mitgespielt und ihm eine Lektion erteilt, an die er noch am St. Nimmerleinstag denken sollte. Aber im Moment hatte ich andere Sorgen.
»Ich würde Schwarzer Peter vorschlagen«, antwortete ich eisig. »Als Einsatz einen Penny pro Runde. Einverstanden?«
Teagarden erbleichte, während es in den Augen seiner Begleiterin abermals spöttisch aufblitzte. Aber diesmal zog er es vor, die Sache nicht auf die Spitze zu treiben.
»Okay, Craven«, sagte er ruhig. »Wir sind quitt. Lassen Sie sehen, ob Sie beim Spielen genauso schlagfertig sind. Wir spielen Stud-Poker. Kein Limit. Mindesteinsatz zehn Dollar.« Er lächelte, sehr falsch und sehr kalt. »Mit dem Taschengeld da werden Sie nicht weit kommen«, fügte er mit einer Kopfbewegung auf die Jetons vor mir hinzu.
Ich zuckte mit den Achseln, forderte ihn mit einer Kopfbewegung auf, abzuheben – was er auf die gleiche Weise ablehnte –, und teilte Karten aus.
Ich hätte nicht einmal meine Hexer-Fähigkeit gebraucht, um schon beim ersten Spiel zu bemerken, dass Teagarden betrog. Er verlor auf Anhieb an die achtzig Dollar an mich, obgleich er das bessere Blatt hatte.
Nun – diesen Trick kannte ich ebenso gut wie er. Ich wäre nicht der erste Trottel, der ein paar Dollar gewinnt und dadurch leichtsinnig genug wird, um wie eine Weihnachtsgans ausgenommen zu werden.
Beim zweiten Spiel verlor ich, beim dritten gewann ich meinen Verlust zurück, samt zusätzlichen dreihundert Dollar. Einen Moment lang überlegte ich, jetzt schlichtweg aufzuhören und Teagarden mit einem dummen Gesicht und um fast vierhundert Bucks ärmer sitzen zu lassen, aber dann zuckte ich mit den Achseln, mischte erneut und gab Karten.
Teagarden nahm die seinen nicht einmal auf, sondern blickte mich mit einem sonderbaren Lächeln an. »Was halten Sie davon, einmal richtig zu spielen, Mister Craven?«, fragte er.
»Wie meinen Sie das?«
Teagarden deutete mit einer Kopfbewegung auf meine Jetons. »Das da ist doch nur Kleingeld. Was halten Sie von einem richtigen Einsatz, um die Sache spannend zu machen?« Er grinste, griff in die Jackentasche und zog ein Bündel Geldscheine heraus, das ungefähr dem Gegenwert eines kleinen Landhauses in England entsprechen mochte.
»Fangen wir mit tausend an«, schlug er vor. »Vorausgesetzt, Sie sind flüssig.«
Ich seufzte, tat so, als überlegte ich, dann griff auch ich in meinen Rock und zog meine Brieftasche hervor. Ich hatte längst nicht so viel Bargeld dabei wie er, aber zwischen den vier oder fünf Hundert-Dollar-Noten, die ich eingesteckt hatte, lag ein Kreditbrief der Bank of America; ohne Begrenzung. Ein Mann wie Teagarden musste sofort erkennen, dass er da praktisch einen Goldesel vor sich hatte.
»Ganz wohl ist mir nicht bei der Sache«, gestand ich mit gespieltem Zweifel. »Ich … spiele nicht oft. Und schon gar nicht um solche Beträge.«
»Dafür spielen Sie verdammt gut«, sagte Teagarden. »Vielleicht haben Sie ja auch nur eine Glückssträhne.«
»Ja, vielleicht«, bestätigte ich. »Aber Sie haben Recht – warum nicht einmal etwas riskieren?« Ich lächelte, winkte einen der Saaldiener herbei und bat ihn, mir beim Kassierer den Kreditbrief bestätigen zu lassen und Jetons für zehntausend Dollar zu holen, ganz bewusst im gleichen Ton, in dem Teagarden sich vielleicht einen Drink bestellt hätte.
Teagarden schluckte, während seine Begleiterin plötzlich sehr ernst aussah. Ja, der Blick, den sie mir zuwarf, war beinahe beschwörend. Fast hatte ich den Eindruck, dass sie mich davon abhalten wollte, weiterzuspielen.
»Fangen wir doch schon einmal an.« Ich nahm all meine Jetons und schob sie über den Tisch, ohne meine Karten auch nur anzusehen. »Dies als ersten Einsatz.«
Teagarden starrte mich an und presste die Lippen zu einem dünnen, blutleeren Strich zusammen. Dann nickte er, hielt mit und nahm, mit ganz leicht zitternden Fingern, seine Karten auf.
Wir warteten, bis der Saaldiener mit meinen Jetons zurück war. Dann schob ich – noch immer ohne meine Karten gesehen zu haben – drei weitere Eintausend-Dollar-Chips auf den mittlerweile schon beachtlich angewachsenen Stapel und nahm endlich meine Karten zur Hand.
Ich hatte zwei Asse und einen König. Immerhin mehr als Teagardens Damenpaar, das ich durch seine Augen gesehen hatte.
»Karte?«, fragte ich.
Teagarden nickte, warf drei Karten auf den Tisch und bekam von mir eine Sieben, die Kreuz-Acht und eine dritte Dame zu seinem Pärchen. Schließlich bin ich kein Unmensch.
»Und Sie?«, fragte Teagarden lauernd.
Ich schüttelte den Kopf und legte meine Karten aus der Hand. »Es reicht«, sagte ich leichthin – und schob weitere zweitausend Dollar auf den Stapel. Teagarden erbleichte ein ganz kleines bisschen, während seine Begleiterin mich erschrocken ansah. Aber er hielt mit.
Wenn auch nicht, ohne zu seinen drei Damen eine weitere hinzuzufügen, die aus seinem Ärmel kam. Er war nicht einmal sehr ungeschickt dabei.
Unser Spiel hatte mittlerweile eine gehörige Menge Neugieriger angezogen, denn auch hier wurde wohl selten um solche Beträge gespielt, aber außer mir – und Teagardens Begleiterin, da war ich sicher – bemerkte niemand den Betrug.
Ich zögerte. Eine innere Stimme sagte mir, dass es klüger wäre, aufzugeben. Ich konnte den Verlust verschmerzen, und ich glaubte zu spüren, dass Teagarden ein gefährlicher Mann war, nicht nur am Kartentisch. Aber es versetzte mich in Rage, dass dieser Tölpel glaubte, mich so leicht hereinlegen zu können.
Mit einem perfekt geschauspielerten, nachdenklichen Stirnrunzeln nahm ich meine Karten auf und betrachtete sie drei, vier Sekunden lang. Als ich sie wieder auf den Tisch legte, waren aus den zwei Assen vier geworden; was übrigens rein gar nichts mit Hexerei zu tun hatte. Aber ich hatte während meiner Ausbildung eine Menge Tricks gelernt, von denen ein zweitklassiger Falschspieler wie Teagarden nicht einmal träumen würde.
»Machen wir es spannend«, sagte ich – und schob den Rest meiner Jetons über den Tisch.
Teagarden erbleichte nun sichtlich. Wahrscheinlich überlegte er, wie er eine fünfte Dame zu seinen vier hinzufügen konnte, ohne dass es auffiel.
»Ist Ihnen der Einsatz zu hoch?«, fragte ich freundlich. »Oder sind Sie nicht flüssig? Ich helfe Ihnen gerne aus.«
Teagarden starrte mich geradezu hasserfüllt an, hob die Hand und winkte einen Saaldiener zu sich. »Ich brauche fünftausend«, sagte er grob. »Beeilung.« Dann wandte er sich wieder an mich. »Einen Moment Geduld, Mister Craven.«
»Ach, wozu?«, antwortete ich und deckte das erste As auf. »Für die paar Dollar sind Sie mir gut, mein Bester.«
Teagarden knirschte hörbar mit den Zähnen und deckte seine erste Dame auf. Ich nickte, zeigte mein zweites As und spielte den Beeindruckten, als Teagarden mit seiner zweiten Dame konterte.
Beim dritten As wurde er nervös. Seine Finger zitterten unmerklich, als er seine dritte Dame aufdeckte. Ein erstauntes Raunen ging durch die Reihen der Zuschauer.
Ich konnte spüren, wie der halbe Saal den Atem anhielt, als ich meine vierte Karte aufdeckte.
Es war eine Sieben. Das letzte As ließ ich vorerst noch unsichtbar.
Teagarden blinzelte, begann plötzlich zu grinsen wie ein Honigkuchenpferd und knallte seine vierte Dame so wuchtig auf den Tisch, dass die Ecke einknickte. Mit einem bösen Lachen beugte er sich vor und grabschte nach den Jetons.
»Einen Moment«, sagte ich ruhig.
Teagarden erstarrte. »Was ist denn noch?«, fragte er.
»Oh, nichts«, antwortete ich freundlich. »Ich hätte nur gerne Ihre letzte Karte gesehen. So, wie es aussieht, haben Sie nämlich verloren«, fügte ich bedauernd hinzu. »Es sei denn, Sie hätten noch eine fünfte Dame auf dem Tisch.«
Und mit diesen Worten deckte ich meine letzte Karte auf.
Teagarden schluckte, starrte erst mich, dann das As, dann wieder mich und wieder meine Karten an und fiel mit einem Ruck auf seinen Stuhl zurück. »Das … das ist …«
»Ja?«, fragte ich, als er nicht weitersprach.
In seinen Augen blitzte es auf. »Das ist unmöglich!«, behauptete er. »Sie … Sie betrügen, Craven.«
»Nicht mehr als Sie«, antwortete ich gelassen.
Für eine Sekunde schien Teagarden zu erstarren. »Was wollen Sie damit sagen?«, fragte er dann gefährlich leise. Seine rechte Hand verschwand unter dem Tisch. Aber auch damit hatte ich gerechnet. Ich spannte mich ein wenig.
»Wollen Sie behaupten, ich spiele falsch?«, fragte er lauernd.
»Aber, ich bitte Sie!«, sagte ich jovial. »Ein Ehrenmann wie Sie, Mister Teagarden? Sie haben Pech gehabt, das ist alles. Tragen Sie es mit Fassung.«
Teagarden brüllte vor Wut und riss die Pistole in die Höhe, die er aus der Jackentasche gezogen hatte.
Und ich ruckte den Tisch nach vorn.
Ich hatte selbst kaum damit gerechnet, dass der Trick funktionieren würde, denn ein Mann wie Teagarden war sicher nicht das erste Mal in einer solchen Situation.
Aber es klappte.
Teagardens Wutschrei wurde zu einem überraschten Keuchen, als ihm die Tischkante wegsackte. Er klappte nach vorn und kollidierte unsanft mit dem harten Holz, ehe ich dem Tisch einen zweiten, etwas heftigeren Stoß versetzte, der Teagarden vollends aus dem Gleichgewicht brachte und umkippen ließ.
Ich gab ihm keine Gelegenheit, wieder auf die Füße zu kommen, sondern setzte über den Tisch hinweg, trat ihm die Waffe aus der Hand und zerrte ihn grob in die Höhe.
Dann griff ich mit einer fast gemächlichen Bewegung in seinen Jackenärmel, zog hintereinander drei Karten heraus und machte Anstalten, sie ihm in den Hals zu stopfen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber es blieb bei dem Versuch.
Jemand packte mich grob am Arm, und eine halbe Sekunde später presste sich etwas Hartes, Rundes zwischen meine Schulterblätter. Das anschließende metallische Klicken wäre nicht einmal nötig gewesen, mich davon zu überzeugen, dass es sich um nichts anderes als einen Revolverlauf handelte.
»Keine Bewegung mehr, Mister«, sagte eine Stimme hinter mir. »Es wäre Ihre letzte.«
Ich ließ Teagardens Kragen los, hob ganz langsam die Hände in Schulterhöhe und drehte mich noch langsamer um. Der Revolverlauf, der sich gerade noch zwischen meine Schultern gepresst hatte, wanderte in die Höhe und verharrte einen Finger breit vor meinem rechten Auge.
Es war der Viertel-Dollar-Grinser. Aber der Ausdruck auf seinem stoppelbärtigen Gesicht war im Moment alles andere als freundlich.
»So, Sie sind also der Meinung, dass ich falsch spiele, Craven?«, fragte Teagarden lauernd. Er hatte jetzt wieder sichtlich Oberwasser – was bei einem Fünfundvierziger, der genau auf mein rechtes Auge gerichtet war, und einem Finger am Abzug dieser Waffe, der Teagarden vermutlich mehr gehörte als seinem eigentlichen Besitzer, kein sonderliches Wunder war. Die alte Überheblichkeit war in seine Stimme zurückgekehrt.
»Ich bitte dich, Ralph, lass ihn in Ruhe«, sagte seine Begleiterin.
»Wer sagt denn, dass ich ihm etwas antun will?«, entgegnete Teagarden feixend. »Ich möchte bloß eine Antwort auf meine Frage, meine liebe Annie.« Er wandte sich wieder an mich. »Also, Craven, wie war das? Sie glauben, ich spiele falsch?«
»Ja«, antwortete ich, einem Trotz gehorchend, für den ich mich selbst hätte ohrfeigen können. »Ich weiß es. So wie jeder hier.«
Teagarden antwortete nicht. Aber ich sah, wie er seinem Schläger einen Wink mit den Augen gab.
Der Fünfundvierziger sackte plötzlich ein Stück nach unten, beschrieb einen engen Bogen und näherte sich rasend schnell wieder meinem Gesicht.
Aber er traf nicht, denn ich duckte mich, vollführte gleichzeitig eine halbe Drehung und packte Teagarden bei den Rockaufschlägen. Er stolperte nach vorn – und bekam den Revolverlauf in den Magen, der ursprünglich für mich gedacht war.
Noch während er zurücktaumelte, fuhr ich abermals herum und trat dem Rausschmeißer vor das rechte Knie. Teagarden und sein gekaufter Schläger gingen gleichzeitig zu Boden.
Aber es war nur ein kurzer Triumph, den mir diese Dummheit einbrachte. Und ein höchst trügerischer dazu.
Denn statt des schadenfrohen Gelächters, das ich erwartet hatte, breitete sich ein fast geisterhaftes Schweigen um mich herum aus.
Als ich aufblickte, starrte ich in ein gutes Dutzend Revolvermündungen. Teagarden schien hier mehr Freunde zu haben, als ich geahnt hatte.
Ich fluchte lautlos in mich hinein, wich zwei, drei Schritte zurück und ahnte die Bewegung mehr, als dass ich sie sah. Blitzschnell duckte ich mich, spürte etwas an meinem Ohr vorbeipfeifen und stieß den Ellbogen zurück.
Ich traf, steppte einen Schritt in die andere Richtung und fuhr herum, im gleichen Moment, in dem der Mann, der mir den Gewehrkolben über den Schädel hatte ziehen wollen, keuchend zusammenbrach.
Eine Faust stieß nach meinem Gesicht. Ich fing sie auf, verdrehte sie samt dem dazugehörigen Arm und stieß den Angreifer zurück. Er fiel und riss dabei drei oder vier andere Männer mit sich.
Für einen Moment hatte ich Luft. Aus irgendeinem Grund verzichteten Teagardens Schläger noch darauf, ihre Waffen zu benutzen, und für die Dauer eines Atemzuges schöpfte ich sogar Hoffnung. Wenn ich nur zwei, drei Sekunden Zeit fand, mich zu konzentrieren, konnte ich diese ganze Bande unter meinen Willen zwingen und sie dazu bringen, sich gegenseitig zu verdreschen.
Aber mir blieben nicht einmal diese zwei Sekunden. Denn in diesem Moment stemmte sich Teagarden keuchend in die Höhe und deutete wild gestikulierend in meine Richtung.
»Packt ihn!«, brüllte er mit überschnappender Stimme. »Schlagt das Schwein tot!«
Und im nächsten Augenblick stürzten sich an die zwanzig Mann gleichzeitig auf mich, um seinem Wunsch nachzukommen …
Es wartete.
Sein Opfer war entkommen; zumindest, solange es sich in dieser Gestalt befand und auf die beschränkten Sinne eines menschlichen Körpers angewiesen war.
Trotzdem wusste es, wo das Opfer war.
Es spürte seine Nähe, und die bohrende Gier in seinem Inneren flammte zu neuer Wut auf, erreichte fast die Stärke eines wirklichen körperlichen Schmerzes und beruhigte sich nur langsam.
Das Opfer war in jenem Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Es hätte ihm folgen können, unerkannt und in der Gestalt eines Menschen, aber es spürte, dass es nicht richtig wäre.
Das Opfer war ein Mensch, und doch …
Er war gefährlich.
Irgendwie spürte er die Nähe des Jägers, das wusste es. Sein Auftrag lautete, ihn zu erlegen, so, wie es zahllose andere Opfer zuvor erlegt hatte.
Dann geschah etwas. Irgendetwas dort drüben in dem großen, abgedunkelten Gebäude.
Es spürte Erregung; eine Gewalt, die sich in einer unsichtbaren knisternden Woge im Inneren dieses Menschenhauses ausbreitete. Vielleicht wäre dies der Moment, hinüberzugehen und seinen Auftrag zu erfüllen, unerkannt und blitzschnell, wie es seine Aufgabe war.
Aber dann, als es schon darangehen wollte, die Straße zu überqueren, der nagenden Gier in seinem Inneren nachzugeben und das Wild endlich zu stellen, fühlte es die Nähe eines anderen, gefährlicheren Dinges.
Etwas, das es nicht verstand, das aber stark und gefährlich war und schnell näher kam.
Der Shoggote verharrte einen Moment reglos. Der Blick seiner dunklen Augen, perfekte Nachbildungen wirklicher menschlicher Augen in der perfekten Nachahmung eines wirklichen menschlichen Gesichtes, tastete über die Straße und blieb an einer kleinen, in helles Leder gekleideten Gestalt haften, die sich mit raschem Schritt dem Eingang des Spielsalons näherte.
Einen Moment lang starrte das Ungeheuer den schwarzhaarigen Menschen an, und fast – nur fast – wurde das finstere Etwas in ihm übermächtig, das ihn zwingen wollte, seinen eigentlichen Auftrag zu vergessen und sich auf diesen neuen, lohnenderen Gegner zu stürzen.
Aber dann wandte es sich um, trat auf den Gehsteig zurück und verschwand in einer Lücke zwischen zwei Gebäuden.
Wäre jemand dem unauffällig gekleideten, mittelgroßen Mann mit dem Dutzendgesicht nachgegangen, wäre er in diesem Moment sehr verwundert gewesen, denn die Gasse, in die er eintauchte, endete nach wenigen Schritten vor einer senkrechten Mauer ohne irgendeinen Durchgang.
Nichtsdestotrotz war der Mann verschwunden, als hätte es ihn niemals gegeben.
Wie ein Mann stürzten sich Teagardens Schläger auf mich. Ich riss die Arme hoch, schlug und trat nach Leibeskräften um mich und traf mehr als einmal, aber es war aussichtslos. Die Übermacht war zu groß. Ich wurde gepackt, ein Schlag traf meine Rippen und trieb mir die Luft aus den Lungen, dann verdrehten kräftige Hände meine Arme auf den Rücken. Schwielige Finger packten mein Haar und bogen meinen Kopf zurück.
Ein Schuss peitschte. Irgendwo hoch über mir klirrte Glas, und wie ein bizarres Echo aus einem Dutzend Kehlen gellte ein überraschter Schrei durch den Saal.
Mit einem Male war ich frei, denn die Männer, die mich gerade noch gepackt hatten, hatten es plötzlich sehr eilig, aus meiner Nähe zu entkommen.
Genauer gesagt, aus der Nähe des gewaltigen Kristalllüsters, der wie ein Geschoss einen halben Yard neben mir niederkrachte, dort, wo Teagarden und der Muskelprotz standen …
Auch die beiden hatten die Gefahr im letzten Moment bemerkt und versuchten sich in Sicherheit zu bringen.
Teagarden schaffte es.
Der Viertel-Dollar-Grinser nicht.
Neben mir schrie einer von Teagardens Killern zornig auf und riss ein Gewehr an die Wange. Wenigstens versuchte er es.
Ein zweiter Schuss krachte. Ein Stück des Gewehrkolbens platzte auseinander. Der Kerl brüllte auf und brach in die Knie.
Keiner der anderen versuchte mehr, eine Waffe zu heben. Selbst Teagarden erstarrte mitten in der Bewegung, und wieder breitete sich eine tiefe, diesmal sehr erschrockene Stille im Raum aus.
Verwirrt wandte ich mich um und sah in die Richtung, aus der die beiden Schüsse gefallen waren.
Unter der Tür des Spielsalons war eine geradezu abenteuerliche Gestalt erschienen. Der Mann war sehr groß, ganz in helles Wildleder und Fransen gekleidet und trug eine sonderbare Mischung aus gezwirbeltem Schnauz und fingerlangem Ziegenbart, die aber auf eigentümliche Weise zu seinem asketischen Gesicht passte. Sein dunkelbraunes Haar war sehr lang und quoll weit unter dem breitkrempigen Stetson hervor, der auf seinem Kopf thronte. Seine Kleidung und der überdimensionale Revolvergürtel, den er trug, blitzten unter dem Gewicht von buchstäblich Hunderten von silbernen Nieten, und an seinen Stiefeln klimperten die gewaltigsten Sporen, die ich wohl jemals zu Gesicht bekommen hatte.
Im Grunde war es eine höchst lächerliche Erscheinung. Aber es lachte niemand, was zum Teil an den beiden rauchenden Colts liegen mochte, die der Cowboy in den Händen schwenkte …
Der Vorhang bewegte sich, und ein zweiter Mann betrat den Salon, ähnlich gekleidet wie der erste, aber jünger und ein gutes Stück kleiner. In seiner rechten Armbeuge lag ein Gewehr.
Und den beiden auf dem Fuß folgte ein leibhaftiger Indianer.
Es war nicht irgendein Indianer. Schließlich war Amerika mein Heimatland, und auch wenn ich den größten Teil meiner Jugend in den Hafenslums von New York verbracht hatte, war es nicht die erste Rothaut, die ich zu Gesicht bekam.
Aber niemals hatte ich einen Indianer wie ihn gesehen.
Ich schätzte sein Alter auf etwa sechzig Jahre. Trotzdem bewegte er sich nicht wie ein alter Mann, sondern schritt im Gegenteil stolz und hoch aufgerichtet an den beiden Cowboy-Imitationen vorbei und näherte sich Teagarden und mir.
Und obwohl er keine Waffe trug, wichen die Männer und Frauen vor ihm respektvoll beiseite, sodass eine schmale Gasse entstand. Der ältere Cowboy folgte ihm, während der Dritte im Bunde mit einer scheinbar mühelosen Bewegung auf die Bar hinaufsprang und sein Gewehr ein wenig höher hob.
Teagarden spannte sich neben mir, als die beiden ungleichen Männer auf uns zuschritten, und auf seinem Gesicht erschien ein Ausdruck, der mir bewies, dass die beiden keine Fremden für ihn waren.
Auch seine letzten Schläger wichen zur Seite, als der alte Indianer und sein weißer Begleiter näher kamen. Der Weiße blickte mich nur flüchtig an, dann schob er seine Revolver in die mit silbernen Nägeln verzierten Holster an seinem Gürtel zurück und maß Teagarden mit einem abfälligen Blick.
»Nun, Ralph?«, fragte er spöttisch. »Überrascht, mich zu sehen? Ich sagte dir doch, dass ich dich noch einmal besuche, ehe wir die Stadt verlassen.«
»Verschwinde!«, fauchte Teagarden. »Was willst du hier? Du musst lebensmüde sein, hierherzukommen.«
»Möglich«, antwortete der Cowboy gelassen. »Und was ich will, weißt du genau. Stell dich nicht noch dümmer, als du bist.« Er lachte leise, drehte sich herum und wandte sich an Teagardens Begleiterin, die die ganze Szene mit schreckgeweiteten Augen verfolgt hatte.
»Wir fahren noch heute, Annie«, sagte er. »Kommst du mit?«
»Den Teufel wird sie tun!«, fauchte Teagarden. »Sie –«
»Warum lässt du sie nicht selbst antworten?«, unterbrach ihn der Cowboy ruhig. »Also?« Das letzte Wort galt der schwarzhaarigen Schönheit.
Das Mädchen wich seinem Blick aus. Ich konnte direkt sehen, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete.
»Ich … ich kann nicht, Bill«, sagte sie stockend. »Ich –«
»Du kannst nicht?«, fragte der mit Bill Angesprochene zweifelnd. »Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, dass die Süße mir noch die Kleinigkeit von neuntausendsiebenhundert Dollar schuldet«, mischte sich Teagarden ein.
Bill blickte ihn zweifelnd an, runzelte die Stirn und trat auf Annie zu. Er wollte sie am Arm ergreifen, aber sie wich mit einem raschen Schritt zurück. »Stimmt das?«, fragte er.
Annie nickte. Die Bewegung war kaum wahrnehmbar. »Es … es ist wahr«, gestand sie. »Ich … ich habe einen Schuldschein unterschrieben.«
»Siehst du?«, sagte Teagarden triumphierend. »Sie sagt es selbst.«
»Sie kann mich trotzdem begleiten«, beharrte Bill. Wie zufällig fiel seine rechte Hand dabei auf den Griff des Colts in seinem Gürtel herab.
Aber diesmal verfehlte die Geste ihre Wirkung. Teagarden lachte im Gegenteil noch lauter. »Na klar kann sie das«, sagte er. »Sobald sie ihre Schulden beglichen hat, ist sie frei. Also? Ich nehme an, du hast die paar Scheinchen bei dir? Ich begleite dich aber auch gerne zu deiner Bank«, fügte er spöttisch hinzu. »Und meine Jungs auch.«
Ich spürte, wie die Situation abermals gefährlich zu werden begann. Die beiden Schüsse und das überraschende Eingreifen der drei Männer hatten Teagardens Schlägertrupp eingeschüchtert, aber das Überraschungsmoment hielt nicht ewig. Hätte dieser Bill das Mädchen geschnappt und wäre mit ihr aus dem Lokal gestürmt, wäre sicher alles gut gegangen. Jetzt begannen Teagardens Killer allmählich zu begreifen, wie weit sie den drei Fremden überlegen waren.
Und gegen eine gut dreißigfache Übermacht hatten die beiden Cowboys und der Indianer keine besonders guten Aussichten.
Unauffällig drehte ich mich herum und sah zu dem dritten Mann zurück. Er hatte seinen Platz auf der Bar nicht verlassen, aber der Ausdruck auf seinem Gesicht hatte sich geändert. Seine Hände lagen ein wenig fester an Kolben und Lauf der Winchester. Ganz offensichtlich war er zu den gleichen Überlegungen gelangt wie ich.
»Was ist jetzt?«, fauchte Teagarden. »Hast du das Geld? Wenn nicht, wäre es besser, wenn du und diese dreckige Rothaut hier verschwindet, solange ihr es noch könnt.«
Der alte Indianer versteifte sich, als er diese Worte hörte, und ich sah, wie es in seinen Augen aufblitzte.
Rasch, noch bevor Teagarden seine offenkundige Absicht wahrmachen und endgültig einen Streit vom Zaun brechen konnte – der nur in einem Blutbad enden konnte –, trat ich zwischen ihn und den Indianer und wandte mich mit einem entschuldigenden Lächeln an Annie und ihren schnauzbärtigen Freund.
»Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische«, sagte ich. »Es geht mich ja nichts an, aber wenn es hier nur um das Geld geht, das Sie diesem Gentleman schulden …« Ich deutete auf Teagarden.
»Was mischen Sie sich ein, Craven?«, fauchte der Spieler. »Das hier geht Sie nichts an. Wir beide unterhalten uns nachher noch.«
Ich lächelte ihm zu, so freundlich ich konnte, und deutete dann mit einer Kopfbewegung auf den Spieltisch und die Jetons, die sich wie bunt gefärbter Schnee über ihn verteilt hatten.
»Wenn ich richtig rechne, liegen dort Jetons im Wert von zehntausendvierhundert Dollar, die mir gehören«, sagte ich. »Das dürfte genug sein, den Verpflichtungen der jungen Dame nachzukommen.«
Teagarden starrte mich an, und auch Annies und Bills Augen wurden groß vor Unglauben.
»Das … das ist –«, keuchte Teagarden.
»Etwas zu viel«, unterbrach ich ihn. »Ich weiß. Nehmen Sie den Rest als Schmerzensgeld.«
Teagarden schien plötzlich einen faustgroßen Stein im Hals zu haben, denn er schluckte ununterbrochen, aber ich gab ihm keine Gelegenheit, auf meine Worte zu reagieren, sondern drehte mich mit einer raschen Bewegung wieder zu Annie und ihrem Freund herum und deutete zum Ausgang.
»Dann wäre ja alles erledigt, nicht wahr?«, fragte ich ruhig. Und so leise, dass nur Bill und allenfalls noch der alte Indianer es hören konnten, fügte ich hinzu: »Zum Teufel, lasst uns hier verschwinden, solange wir noch können.«
Endlich verstand der Aushilfscowboy. Er nickte, ergriff Annie am Arm und schob sie vor sich her in Richtung Ausgang, während seine Linke drohend auf dem Colt lag. Der Indianer und ich folgten ihm dichtauf.
Niemand hielt uns auf. Als wir den Raum durchquert hatten, sprang Bills Begleiter von der Bar herunter und schloss sich uns an, allerdings rückwärts gehend und das Gewehr noch immer drohend erhoben.
»Heda!«, brüllte Teagarden plötzlich. »So geht das nicht. Ihr bleibt gefälligst –«
Der Rest der Worte ging in einem peitschenden Knall unter, als Bills Begleiter seine Winchester abfeuerte.
Genauer gesagt waren es drei Schüsse, aber sie erfolgten so rasch aufeinander, dass sie wie eine einzige, berstende Explosion klangen. Jeder einzelne traf.
Aus der Verfolgung, die Teagarden mit seinen Worten hatte einläuten wollen, wurde eine Panik, als gleich drei der riesigen Kristalllüster auseinanderplatzten und den Raum mit einem Hagel von Glassplittern überschütteten.
Der Fremde schoss noch einmal, aber ich sah nicht mehr, worauf er gezielt hatte, denn in diesem Moment hatten wir die Straße erreicht, und ehe ich auch nur Zeit fand, einen klaren Gedanken zu fassen, packten mich Bill und der alte Indianer bei den Armen, begannen zu rennen und zerrten mich mit sich, so schnell sie nur konnten.
Die beiden ließen mich erst los, als wir drei oder vier Straßen von Teagardens Etablissement entfernt waren und sicher schien, dass uns zumindest im Augenblick niemand verfolgte. Die beiden waren im wahrsten Sinne des Wortes gerannt wie die Teufel, und selbst ich war außer Atem, obgleich ich nicht einmal halb so alt war wie Bill, von seinem rothäutigen Begleiter ganz zu schweigen.
Trotzdem war ich der Einzige, der vor Erschöpfung keuchte.
»Die wären wir los«, sagte Bill, nachdem er ein Stück zurückgegangen war und einen Blick um die Straßenecke geworfen hatte, um die wir gerade gebogen waren. Er lächelte, schnippte sich ein nicht vorhandenes Stäubchen vom Jackenärmel und sah erst Annie und dann mich mit einem sehr sonderbaren Blick an.
»Ich glaube, ich … ich muss Ihnen danken, Mister …«
»Craven«, half ich aus. »Robert Craven.«
»Ich danke Ihnen, Mister Craven«, sagte Bill noch einmal. »Das war sehr großzügig. Ohne Ihre Hilfe hätte es schlecht ausgehen können.«
»Warum haben Sie das getan?«, fragte Annie leise. Sie sah mich an, und sie tat es noch immer auf die gleiche, ungläubig-entsetzte Art wie vorhin im Spielsalon. »Sie … Sie verschenken zehntausend Dollar, nur um einem Mädchen zu helfen, das Sie nicht einmal kennen?«
»Was tut man nicht alles für eine schöne Frau«, antwortete ich lächelnd, fügte aber, als ich Bills Blick bemerkte, noch hastig hinzu: »So viel war es nun auch wieder nicht. Und wie es aussah, hätte ich das Geld so oder so eingebüßt.« Ich zuckte mit den Schultern. »Meine Schuld. Was muss ich auch so dumm sein und mit meinem Geld angeben. Noch dazu in einem solchen Schuppen.«
»Ich werde es Ihnen nicht wiedergeben können«, sagte Annie ernst.
»Ich weiß«, antwortete ich. »Aber ich schenke es lieber Ihnen als Teagarden, glauben Sie mir. Und wenn Ihre Freunde hier –«, ich deutete auf Bill und seine beiden sonderbaren Begleiter, »–nicht aufgetaucht wären, hätte ich vielleicht mehr verloren als zehntausend Dollar.«
»Möglicherweise Ihr Leben, Robert«, sagte der jüngere Cowboy ruhig. »Teagarden ist ein eiskalter Killer.« Er maß Bill mit einem vorwurfsvollen Blick. »Ich war von Anfang an dagegen, zu ihm zu gehen.«
»Quatsch«, fauchte Bill. »Wir brauchen Annie, das weißt du genau. Wenn wir ohne sie in Europa auftauchen, ist die ganze Show nur noch die Hälfte wert!«
Europa?, dachte ich verwirrt. Show?
Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mit einem Male wusste ich, wieso mir Bill und sein rothaariger Begleiter so bekannt vorgekommen waren, obwohl ich sicher war, ihnen niemals zuvor im Leben begegnet zu sein. Ich kannte ihre Gesichter trotzdem. Jedermann in Amerika kannte sie, denn sie prangten von Hunderten von Plakaten herunter.
»Bill … Cody?«, murmelte ich verstört. »Sie … Sie sind … Buffalo Bill Cody! Aber dann ist das … das …«
»Häuptling Sitting Bull«, bestätigte Cody stolz. »Ich dachte schon, Sie würden uns gar nicht mehr erkennen.« Er schlug mir freundschaftlich auf die Schulter, lachte und deutete auf seinen Begleiter, dann auf Annie.
»Und diese beiden hier sind One-Shot Bodine und Annie Oakley. Ich nehme an, Sie haben schon von ihnen gehört.«
Instinktiv nickte ich, obgleich mir der Name One-Shot Bodine rein gar nichts sagte. Aber Annie Oakley? Wer hatte nicht von ihr gehört, der berühmtesten Kunstschützin im ganzen Westen.
Ich muss wohl reichlich dumm ausgesehen haben mit meiner vor Erstaunen herunterhängenden Kinnlade und ungläubig aufgerissenen Augen, denn Cody lachte erneut, schlug mir noch einmal auf die Schultern und wurde übergangslos wieder ernst.
»Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen«, sagte er. »Unser Zug fährt in einer Stunde, wissen Sie? Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, Mister Craven – meiden Sie diese Gegend hier in Zukunft. Teagarden ist ein verdammt nachtragender Mensch. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie sich plötzlich mit einem Dolch im Rücken wiederfinden.«
»Ich … bleibe ohnehin nur noch bis morgen in der Stadt«, antwortete ich stockend.
Cody nickte deutlich erleichtert. »Gut«, sagte er. »Aber trotzdem – sehen Sie sich vor. Teagarden vergisst so leicht nichts. Und er weiß jetzt, dass Sie kein armer Mann sind.« Er seufzte. »Eigentlich wären wir es Ihnen schuldig, bis zu Ihrer Abreise auf Sie Acht zu geben. Aber leider wird unser Zug nicht so lange auf uns warten. Und wenn wir den Anschluss in Salt Lake City verpassen, müssen wir nach Europa schwimmen, fürchte ich. Also …« Er lächelte breit, streckte mir die Hand entgegen und wartete ganz offensichtlich darauf, dass ich sie ergriff.
Stattdessen drehte ich mich herum, winkte eine Droschke herbei und machte meinerseits eine einladende Geste, als das Fuhrwerk neben uns am Straßenrand hielt.
»Was soll das?«, murmelte Cody.
Ich lachte leise. »Sie glauben doch nicht, dass Sie mir so leicht davonkommen, Buffalo Bill«, sagte ich. »Sie haben noch eine ganze Stunde Zeit, mir von sich und Ihrer Show zu erzählen, oder? Also werde ich Sie zum Bahnhof begleiten.«
»Begleiten?«, murmelte Cody. »Aber Sie –«
»Warum nicht?«, unterbrach ich ihn. »Nun kommen Sie schon. Wir fahren zum Bahnhof, trinken ein Bier zusammen, und Sie erzählen mir für jeden einzelnen Dollar, den ich für Sie hingeblättert habe, eine spannende Geschichte.«
Cody starrte mich an, als zweifelte er ernsthaft an meinem Verstand. Aber dann lachte er dröhnend, griff nach der Hand, die ich hilfreich ausgestreckt hatte, um Annie Oakley in den Wagen zu helfen, und drückte sie so kräftig, dass ich um ein Haar vor Schmerz aufgeschrien hätte.
Midwailer schlug die Tür hinter sich zu, durchquerte die Halle mit raschen Schritten und setzte mit einer für einen Mann seines Alters erstaunlich sportlichen Bewegung über die Barriere hinweg, die ihn noch vom Bahnsteig trennte. Zwei seiner Kollegen, die im Schatten des Bahnhofsgebäudes standen und miteinander redeten, sahen überrascht auf, aber Midwailer schenkte ihnen nur ein rasches Kopfnicken und eilte weiter.
Er war spät dran, wenn die große Uhr, die über dem Bahnsteig an zwei gewaltigen Ketten baumelte, richtig ging–und das tat sie meistens –, sogar schon zu spät; eine Minute über der Zeit; zwei, bis er den Zug erreichte. Eine Minute war eine lächerliche Zeit, zumal der Bahnhof von Frisco den Tag, an dem ein Zug pünktlich abgefahren oder eingetroffen wäre, noch nicht erlebt hatte. Aber Kennon hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er dafür sorgen würde, dass Midwailer dreikantig flog, wenn er noch ein einziges Mal zu spät kam.
Midwailer lief noch schneller, sprang – die in grell roten Buchstaben gemalten Verbotsschilder ignorierend – auf die Geleise hinab und turnte mit komisch anmutenden Storchenschritten zu der schwarzen Lok auf dem gegenüberliegenden Trail hinüber. Kennons Gesicht war als heller Fleck in dem ungleichmäßigen Rechteck des Fensters zu erkennen, und Midwailer glaubte das boshafte Grinsen auf seinen Zügen zu sehen.
Midwailer hatte keine Ahnung, ob Kennon seine Drohung wahrmachte und ihn bei der Direktion anschwärzen würde, aber Kennon war ein Schwein und Midwailer hatte den Fehler begangen, ihm irgendwann einmal ziemlich deutlich zu sagen, was er von ihm hielt. Er war betrunken gewesen damals.
Und – und das war sein eigentlicher Fehler – er hatte nicht gewusst, dass Kennon der Schwager des San Franciscoer Direktors der Union Pacific war.
Midwailer verscheuchte den Gedanken, lief schneller und umrundete die Lok, so rasch er konnte. Kennon blickte aus dem Führerstand kühl auf ihn herab. Nur in seinen Augen lag ein böses Glitzern. Die Lokführermütze saß keck auf seinem Kopf; in der Stellung, in die Kennon sie immer sorgfältig brachte, weil er der Meinung war, dass dies zu seinem Gesicht passte.
Neben seiner unerträglichen Widerwärtigkeit war Kennon auch noch einer der eitelsten Burschen, die Midwailer kannte; einer von diesen schneidigen jungen Typen Mitte zwanzig, die durch Beziehungen Karriere gemacht hatten und zu allem Überfluss auch noch so aussahen, dass die Frauen nur so auf sie flogen.
Nun, dachte Midwailer grimmig, was das anging, würde sich zeigen, was die Frauen von einem zwanzigjährigen Lokomotivführer ohne Zähne hielten, wenn Kennon seine Drohung wirklich wahr machte und ihn bei seinem Schwager verpfiff.
Endlich erreichte er die Eisenleiter, die zum Fahrerstand der Lok hinaufführte, griff danach – und wäre um ein Haar der Länge nach hingefallen, denn sein Fuß trat auf etwas Schlüpfriges; er glitt aus, kämpfte einen Moment mit wild rudernden Armen um seine Balance und fand im letzten Moment Halt.
Kennon lachte schadenfroh, und Midwailer schluckte die wütende Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, im letzten Moment herunter. Zornig sah er an sich herab und verzog angewidert das Gesicht, als er sah, worauf er ausgeglitten war.
Dicht neben den Gleisen befand sich eine gut metergroße Pfütze einer schwarzen, zähen Masse. Sein rechter Fuß war bis über die Knöchel in dem Zeug eingesunken. Etwas davon sickerte in seinen Schuh und drang durch den Strumpf. Das Gefühl, als es seine Haut berührte, war unbeschreiblich widerwärtig: warm und schleimig. Angeekelt zog Midwailer den Fuß vollends aus der Lache, balancierte fluchend auf einem Bein und klaubte einen der Putzlappen aus der Jackentasche, von denen er immer einen Vorrat bei sich trug; für einen Heizer eine Selbstverständlichkeit.
Noch immer leise vor sich hinfluchend, wischte er das Zeug von seinem Schuh, dem Hosenbund und dem Strumpf, so gut er konnte. Ein Spritzer davon geriet auf seine Hand, und abermals spürte Midwailer, wie unangenehm es sich anfühlte. Warm und irgendwie zuckend, als wäre es etwas Lebendiges. Außerdem stank es.
Midwailer schleuderte den Lappen im hohen Bogen davon und beeilte sich, endlich auf die Lok hinaufzuklettern.
Kennon erwartete ihn mit einem höhnischen Grinsen. »Bist in die Scheiße getreten, wie?«, fragte er gehässig. Midwailer starrte ihn wütend an, zog es aber vor, zu schweigen.
Weder das eine noch das andere schien Kennon zu stören. Im Gegenteil; sein Grinsen wurde noch unverschämter. Er trat auf Midwailer zu, schnüffelte übertrieben und nickte. »Tatsächlich. Man riecht es sogar.« Er kicherte. »Aber man sagt ja, in die Scheiße zu treten bringt Glück. Dann will ich mal nicht so sein und die zwei Minuten vergessen, die du zu spät gekommen bist.«
Midwailer schluckte, wandte sich mit einem wütenden Ruck um und ballte die Faust in der Tasche. Eines Tages, dachte er, eines Tages …
Aber das dachte er seit zwei Jahren – seit er Kennon kannte. »Worauf wartest du?«, fragte Kennon. »Wir fahren in einer Stunde. Setz den Kessel unter Druck.«
Wütend riss Midwailer die Kohleklappe auf, packte seine Schaufel und begann Kohle in das nimmersatte Maul der Dampflok zu werfen. Eines Tages, dachte er. Den winzigen schwarzen Spritzer, der auf seinem rechten Daumen zurückgeblieben war, bemerkte er in seiner Wut gar nicht. Und wenige Augenblicke später war er auch schon unter Kohlestaub und Schweiß verschwunden und unsichtbar geworden …
Aus den zehntausendvierhundert Geschichten, die mir Cody und Sitting Bull erzählen sollten, wurde vorerst nichts. Wir verbrachten die knapp zehn Minuten Fahrt bis zum Bahnhof und die anschließende Dreiviertelstunde, in der ich die vier noch auf einen Drink einlud, mit nichts anderem als Reden, aber die allermeiste Zeit war ich es, der auf Codys neugierige Fragen antwortete, und nicht umgekehrt.
Es schien nichts zu geben, was Cody nicht interessierte, denn immerhin befand er sich mit seiner gesamten Truppe auf dem Weg nach Europa – woher ich gerade kam, den kleinen Umweg über Krakatau außer Acht lassend – und für einen waschechten Cowboy musste die alte Welt mindestens ebenso fremdartig und bizarr sein wie für einen Europäer Amerika. Oder das, was man sich gemeinhin darunter vorstellte.
Auch Bodine und Annie Oakley schienen vor Neugier schier aus den Nähten zu platzen. Der Einzige, der bis auf ein gelegentliches Kopfnicken oder Stirnrunzeln nichts zu dem Verhör beitrug, dem mich die drei unterzogen, war Sitting Bull.
Schließlich zog Buffalo Bill Cody eine goldene Klappuhr aus der Tasche, blickte demonstrativ darauf und sah mich bedauernd an. »Wir müssen los«, sagte er. »Der Zug wartet nicht. Und es wäre einigermaßen peinlich, wenn unsere Truppe samt unserem Gepäck in Salt Lake City eintreffen sollte, während wir noch hier herumstehen, nicht?«
Sitting Bull nickte bekräftigend, während Bodine nur stumm in sich hineingrinste.
Bedauernd sah auch ich auf die Uhr und gestand mir insgeheim ein, dass er Recht hatte. Ich war enttäuscht, weit mehr, als ich zuzugeben bereit war. Genauso wenig, wie ich in diesem Moment zugegeben hätte, dass ich mich ziemlich albern benahm. Buffalo Bill Cody und One-Shot Bodine waren wahrhaftig nicht das, was der sogenannte Wilde Westen war. Sie kamen nur dem Bild nahe, das man sich davon machte. Und trotzdem übten sie auf mich die gleiche Faszination aus wie auf die Tausende und Abertausende, die ihre Wildwest-Show besucht hatten.
Ich setzte zu einer Antwort an, aber ich sprach die Worte nie aus. Denn im gleichen Moment, in dem ich die Uhr wegsteckte und aufsah, begegnete ich Sitting Bulls Blick.
Es war das erste Mal, dass ich ihm direkt in die Augen sah. Und es war wie ein Stromschlag.
Die Stehkneipe, das halbe Dutzend Gäste um uns herum, ja selbst Cody, Bodine und Annie waren verschwunden. Es war wie eine Woge, eine brüllende Sturmflut übersinnlicher Eindrücke, durcheinanderwirbelnder Bilder und Dinge, die ich nicht in Worte zu fassen vermochte:
Da war so etwas wie ein Wolfsrudel. Wild um sich schießende Soldaten. Schnee. Beißende Kälte und ein weißes, wirbelndes Chaos. Dann das Gesicht einer jungen Frau – eine Indianerin? Eine vage, noch nicht formulierte Bedrohung … Wieder Schüsse.
Dann war es vorbei, so schnell, wie es gekommen war. Zurück blieb ein unheimliches, bedrückendes Gefühl, eine Angst, die noch nicht vollends erwacht war, aber wie ein schlechter Geschmack am Grunde meiner Seele lauerte.
Ich versuchte den Schrecken abzuschütteln, der von meinen Gedanken Besitz ergriffen hatte, aber ganz gelang es mir nicht. Ich fühlte mich wie ein Mann, der unvermittelt aus einem Traum gerissen worden war und noch nicht vollends in die Wirklichkeit zurückgefunden hatte. Ich war wach; gleichzeitig schien mir etwas von den düsteren Visionen, die ich – auf welchem Wege auch immer – über den Geist des alten Indianerhäuptlings empfangen hatte, gefolgt zu sein.
»Was ist mit Ihnen?«, fragte Bodine besorgt.
»Was … was soll sein?«, fragte ich stockend. Plötzlich wurde mir klar, dass ich für Augenblicke die Kontrolle über mich verloren haben musste. Der Schrecken, den ich empfunden hatte, musste ziemlich deutlich auf meinem Gesicht zu lesen sein; zumindest den besorgten Blicken nach zu schließen, mit denen mich Bodine, Annie und Cody plötzlich musterten. Der Einzige, der mich weiterhin vollkommen ausdruckslos anstarrte, war Sitting Bull. Aber das mochte täuschen. Es war sehr schwer, in dem faltenzerfurchten Gesicht des Indianers überhaupt irgendeine Regung zu erkennen.
»Sie sehen aus, als hätten Sie gerade ein leibhaftiges Gespenst gesehen, Robert«, sagte Bodine ernst.
Ich lächelte. »Unsinn«, sagte ich. »Ich hätte mich nur gerne noch ein wenig mit Ihnen unterhalten, das ist alles.«
»Vielleicht sehen wir uns ja in Europa wieder«, sagte Cody. »Wir werden sicher ein Jahr drüben bleiben. Wenn nicht zwei. Kommt ganz auf den Erfolg unserer Tournee an.«
Er leerte sein Glas, stellte es mit einem übertrieben heftigen Ruck auf den Tisch zurück und wandte sich demonstrativ zur Tür.
»Ich begleite Sie noch zum Zug«, sagte ich hastig.
Cody sah mich an, und für einen ganz kurzen Moment runzelte er beinahe verärgert die Stirn. Dann nickte er. »Gut«, sagte er. »Warum nicht?«
Beinahe verzweifelt suchte ich Sitting Bulls Blick. Aber wenn der alte Indianer überhaupt bemerkt hatte, was sich gerade abgespielt hatte, so beherrschte er sich meisterhaft.
Ebenso meisterhaft, wie er es fertigbrachte, mich anzulächeln, ohne mir dabei in die Augen zu sehen.
Wir überquerten die Straße, betraten den Bahnhof und eilten zum Zug. Cody und seine Begleiter hatten natürlich schon ihre Karten, sodass wir keine Zeit am Schalter verloren, und ebenso natürlich stand der Zug schon unter Dampf, aber er war in einem Zustand, der alles andere als abfahrbereit war. Die meisten Türen standen offen, und vor dem Gepäckwagen stapelten sich wahre Berge von Koffern und Kisten.
»Die Eile war überflüssig«, sagte ich scherzhaft. »Sie haben mindestens noch eine halbe Stunde Zeit.«
Cody seufzte. »Ich fürchte«, sagte er. »Aber was machts? Europa läuft uns nicht davon.« Er lächelte, blickte erst auf sein Billett, verglich die Wagennummer mit den in goldenen Lettern gemalten Zahlen auf den Waggons und deutete auf eines der letzten Abteile. »Dort«, sagte er.
»Ich … begleite Sie noch ein Stück«, sagte ich hastig und fügte mit einem nicht einmal geschauspielerten, verlegenen Lächeln hinzu: »Wenn ich darf, heißt das.«
Codys Stirnrunzeln vertiefte sich, aber er nickte auch diesmal, wenngleich auch nicht mehr ganz so herzlich wie zuvor. Aber wahrscheinlich war er lästige Fans, die wie Teer an seinen Fersen klebten, gewohnt.
Meine Gedanken überschlugen sich schier, während ich Cody und den anderen folgte und in den Zug stieg. Ich musste mit Sitting Bull sprechen, allein! Die blitzartige Vision, die ich gehabt hatte, konnte kein Zufall gewesen sein!
Aber Sitting Bull gab mir nicht einmal die Spur einer Chance. Mit einer Geschicklichkeit, für die ich ihn unter anderen Umständen sicherlich bewundert hätte, wich er mir aus und brachte es stets fertig, entweder Annie, Bodine oder Cody zwischen sich und mir zu haben. Als wir das Abteil erreichten, das Cody gemietet hatte, setzte er sich an einen Platz am Fenster und blickte starr hinaus.
Beinahe verzweifelt versuchte ich, seinen Blick im verzerrten Spiegelbild seines Gesichtes auf der Scheibe zu erhaschen. Wenn es mir wenigstens gelang, ihn einmal anzusehen, konnte ich vielleicht auf geistiger Ebene in Kontakt mit ihm treten.
Mit ihm oder dem Ding, das sich in seinem Bewusstsein eingenistet hatte …
Aber es gelang mir nicht. Länger als eine halbe Stunde lungerte ich in Codys Abteil herum und erfand immer neue Ausreden, nicht gehen zu müssen. Buffalo Bills Geduld neigte sich sichtlich dem Ende zu, und auch das beständige Grinsen auf Bodines Gesicht wurde immer eisiger, aber es gelang mir einfach nicht, an Sitting Bull heranzukommen.
Ich war nahe daran, ihn schlichtweg vor aller Ohren auf mein Erlebnis anzusprechen; und sei es nur, um irgendeine Reaktion zu provozieren, als von draußen ein schriller Pfiff in den Wagen scholl.
Buffalo Bill Cody atmete eindeutig erleichtert auf. »Das war das Signal, Craven«, sagte er. Dass er mich plötzlich nicht mehr mit meinem Vornamen ansprach, entging mir keineswegs, aber ich tat so, als hätte ich es nicht bemerkt.
»Welches Signal?«, fragte ich dümmlich.
Cody lächelte. »Das Signal, dass alle, die nicht mitfahren wollen, den Zug verlassen müssen«, erklärte er geduldig.





























