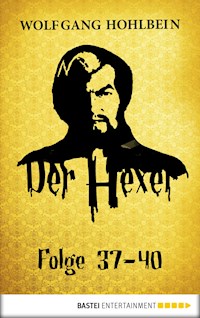
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Brücke am Ende der Welt" - Folge 37 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Kopf und Schultern des Mannes waren nach vorne gesunken. Sein Gesicht lag auf dem rauen Holz der Tischplatte, das sich von seinem eigenen, schon vor Stunden eingetrockneten Blut dunkelbraun verfärbt hatte. Sein Kopf war zur Seite gefallen, so dass man den entsetzten Ausdruck in den gebrochenen Augen noch deutlich erkennen konnte; der Ausdruck eines Entsetzten, das die Grenzen des Vorstellbaren überschritten haben musste. Sein Mund war wie zu einem stummen Schrei geöffnet, und in seiner erstarrten rechten Hand lag noch immer das Messer, mit dem er sich selbst die Kehle durchgeschnitten hatte...
"Necron - Legende des Bösen" - Folge 38 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Er lebte noch. Bruder Lecierc verstand nicht, warum das so war. Er war auch nicht in der Lage, mehr als einen Gedanken an dieses Wunder zu verschwenden. Er blutete aus zahllosen Wunden, seine Hände waren gefühllos und taub, und wo er entlangkroch, blieb eine glitzernde rote Spur auf dem Fels zurück. Er spürte nicht einmal mehr den Schmerz, der ihn nach seinem Erwachen schier in den Wahnsinn hatte treiben wollen. Jedes bisschen Kraft, das er noch hatte, galt der Aufgabe, weiter zu kriechen, seinen geschundenen Leib Stück für Stück über den schwarzen Granit zu ziehen, immer weiter auf das Ziel zu, das irgendwo vor ihm lag. Das Tor...
"Buch der tausend" - Folge 39 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Die Kammer war fensterlos und gerade groß genug für einen Tisch, einen Stuhl und ein durchbrochenes Gitterbecken, in dem glühende Kohlen düsterrotes Licht und stickige Hitze verbreiteten. Seit Tagen, vielleicht Wochen schon hatte niemand mehr diesen Raum betreten. Trotzdem brannte das Feuer nicht herunter, wurde die Glut nicht schwächer- und trotzdem war Bewegung in der winzigen Zelle. Es waren die Seiten des gewaltigen Buches auf dem Tisch, die sich bewegten, die sich langsam, aber beständig umblätterten, als lebe es.
"Die Macht des NECRONOMICON" - Folge 40 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Hier oben lebte nichts mehr. Eine Laune des Schicksals hatte die eiserne Toreinfassung stehen lassen, während die schwarzen Basaltmauern zu beiden Seiten niedergebrochen und die Torflügel selbst - fünfmal so groß wie ein Mann und jeder einzelne sicherlich mehrere Tonnen schwer- aus ihren Angeln gerissen und davongeschleudert worden waren, fast eine Meile weit, wo sie nun wie Stücke aus verbogenem Kupferblech im heißen Sand der Mojave lagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Brücke am Ende der Welt
Der Hexer – Necron – Legende des Bösen
Der Hexer – Buch der tausend Tode
Der Hexer – Die Macht des NECRONOMICON
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 37-40:
Der Hexer – Brücke am Ende der Welt
Der Hexer – Necron – Legende des Bösen
Der Hexer – Buch der tausend Tode
Der Hexer – Die Macht des NECRONOMICON
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 37–40
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1577-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 37-39
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Hier das Vorwort zu Band 37 bis 39.
Mit diesem Band erreicht ein weiterer Unterzyklus in Robert Cravens Ringen um die SIEBEN SIEGEL DER MACHT, das die gesamte Heftserie hindurch bis zu ihrem Ende währt, sein furioses Ende. Man könnte ihn den Necron-Zyklus nennen, und wenn man den damaligen Leserbriefen glauben darf, handelt es sich bei diesen E-Books um einen besonderen Höhepunkt der Saga um den Hexer. Endlich erreicht Robert nach langer Suche die Drachenburg und trifft erneut mit seinem Erzfeind Necron zusammen – ein Kampf, bei dem auch der Orden der Tempelritter eine zentrale Rolle spielt und der größere Opfer auf allen Seiten fordert, als irgendjemand zuvor ahnen mag. Wie im vorigen Buch versprochen, nun aber einige Informationen zu Buffalo Bill und Sitting Bull, die Robert bei der Suche nach der Drachenburg aktiv unterstützen.
Dass sich der Sioux-Häuptling und William Frederic Cody (wie Buffalo Bills bürgerlicher Name lautete) tatsächlich trafen und Freunde wurden, ist eine historische Tatsache. 1885 schloss Sitting Bull sich sogar Codys berühmter Wildwest-Show an, zu der auch Annie Oakley gehörte, mit der Robert ebenfalls Freundschaft schloss. Wenig später trennten die beiden sich jedoch wieder. Offenbar konnte Sitting Bull das Showgeschäft nicht mit seiner Häuptlingswürde vereinen, doch blieben sie Freunde und hielten auch lange danach noch Kontakt zueinander.
General George Armstrong Custer traf ebenfalls einmal mit Cody zusammen, allerdings schon im Jahre 1868, als dieser als Meldereiter unter General Sheridan diente und Custer eine Depesche überbrachte.
Authentisch sind auch verschiedene andere Ereignisse, die im Hexer eine Rolle spielen. Sitting Bulls Sonnentanz und seine Vision der Weißen Soldaten, die Liebe General Custers zu seiner »Dolmetscherin« Monahseetah, ihr gemeinsamer Sohn Yellow Swallow, der alte Magier Mazakootemane, ja sogar das einsame Pferd auf dem Schlachtfeld von Little Bighorn – all dies ist in den Geschichtsbüchern nachzulesen.
Eines der großen Rätsel der Indianerkriege ist bis heute, warum Custer bei seinem Feldzug gegen Sitting Bull plötzlich und scheinbar aus einer Laune heraus seine ursprünglichen Pläne änderte, sich von einem Teil seiner Truppe trennte und den Häuptling mit nur 250 Mann am Little Bighorn angriff – was zu einem der größten Debakel der amerikanischen Kriegsgeschichte führte. Nun, für dieses Geheimnis bietet der Hexer eine überraschende Lösung.
Auch ist belegt, dass Sitting Bull sich mit Magie beschäftigte. Er war einer der größten Medizinmänner der Sioux und holte sich oft den Ratschlag der Götter, bevor er eine große und entscheidende Tat vollbrachte. Seine magischen Utensilien trug er stets in einem Medizinbeutel bei sich; auch ein heiliger Bisonschädel diente ihm als »heißer Draht« zu Wakan Tanka, dem Gott der Sonne.
Leider konnten weder Sitting Bulls Magie noch der triumphale Sieg über Custers Siebente Kavallerie verhindern, dass die Indianer immer weiter zurückgedrängt und schließlich in kargen Reservaten eingepfercht wurden. Am 14. Dezember 1890 starb Häuptling Sitting Bull, niedergestreckt von der Kugel eines Indianerpolizisten. Der Mörder war ein Sioux – ein Mann aus seinem eigenen Volk.
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 37Brücke am Ende der Welt
Kopf und Schultern des Mannes waren nach vorne gesunken. Sein Gesicht lag auf dem rauen Holz der Tischplatte, das sich von seinem eigenen, schon vor Stunden eingetrockneten Blut dunkelbraun verfärbt hatte. Sein Kopf war zur Seite gefallen, sodass man den entsetzten Ausdruck in den gebrochenen Augen noch deutlich erkennen konnte; den Ausdruck eines Entsetzens, das die Grenzen des Vorstellbaren überschritten haben musste.
Sein Mund war wie zu einem stummen Schrei geöffnet und in seiner Hand lag noch immer das Messer, mit dem er sich selbst die Kehle durchgeschnitten hatte …
Reynaud de Maizieres wandte sich mit einem Ruck ab, verzog angewidert das Gesicht und schlug mit der linken Hand das Kreuzzeichen. Die Geste war nicht echt, nur ein Reflex, und das Gefühl, das sie begleiten sollte, blieb aus. Seine Augen waren kalt. Alles, was Jean Balestrano darin las, war ein mühsam unterdrückter Zorn.
»Du musst ihm vergeben, Bruder«, sagte er.
»Vergeben?« Reynaud de Maizieres runzelte die Stirn. Der Blick, mit dem er Balestrano maß, war beinahe feindselig und seine Lippen zuckten, als hielte er mit Mühe Worte zurück, die ihm als Antwort richtig schienen. Aber sein Respekt vor dem Ordensleiter war größer als sein Zorn. Wenn auch nicht viel.
»Sein Geist war verwirrt«, fuhr Balestrano nach einer Pause fort. »Bruder Henri wusste nicht mehr, was er tat.«
»Er hat gesündigt!«, beharrte Reynaud de Maizieres. »Das weißt du so gut wie ich, Bruder.« Seine Stimme wurde scharf; vielleicht eine Spur schärfer, als er sich dem Ordensmeister Jean Balestrano gegenüber erlauben konnte. »Das Leben ist heilig. Auch das eigene! Muss ich dich daran erinnern, dass der Herr ausdrücklich verboten hat, Hand an sich selbst zu legen?«
»Nein«, antwortete Balestrano, auch er in einem hörbar schärferen Ton als zuvor. »Das musst du nicht, Bruder. So wenig, wie ich dich daran erinnern muss, warum ich dich rufen ließ.«
Reynaud de Maizieres verstand den Tadel sehr wohl. Demütig senkte er den Blick, aber das harte Glitzern in seinen Augen blieb. Balestrano konnte sich nicht erinnern, Reynaud de Maizieres jemals anders als ernst und verbissen erlebt zu haben. Er war ein Mann, dessen Gesicht unfähig schien zu lachen. Aber er war auch einer der tapfersten und besten Männer, denen Balestrano jemals das Treuegelöbnis abgenommen hatte, auch wenn er niemals den Schritt zum Master des Templerordens tun würde.
Balestrano hatte stets bedauert, dass Reynaud de Maizieres jegliche magische Begabung so gänzlich abging. Einen Mann seiner Gradlinigkeit und Treue hätte er im inneren Zirkel des Ordens bitter nötig brauchen können, vor allem jetzt, wo ihre Zahl in so kurzer Zeit so drastisch geschrumpft war. Und gleichzeitig war er beinahe froh, dass es so war. Reynaud de Maizieres als Master, mit Mächten, die die Schöpfung selbst erschüttern mochten – das war ein Gedanke, der ihm einen eisigen Schauer über den Rücken jagte.
Er verscheuchte die Vorstellung. Es fruchtete nichts, über Dinge nachzudenken, die hätten sein können.
»Sein Platz muss besetzt werden«, sagte er mit einer Geste auf den Toten. »Du weißt, warum ich dich rufen ließ.«
Reynaud de Maizieres nickte. Ein sanfter Zorn glomm in seinem Blick auf. »Ja«, antwortete er. »Und es gefällt mir nicht.«
Balestrano antwortete nicht, aber sein Blick sprach Bände. Es kam selten vor, dass es jemand wagte, ihm in solcher Offenheit zu widersprechen. Trotzdem war seine Stimme sanft und freundlich wie immer, als er fragte: »Warum nicht?«
»Das weißt du genau, Bruder Jean«, fauchte Reynaud de Maizieres. »Es war Bruder Henris Aufgabe, Bruder de Laurec zu bewachen. Einen Verräter. Einen Mann, der sich Satan verschrieben und die Hand gegen seine eigenen Brüder erhoben hat. Einen Mann, der –«
»Der deiner Meinung nach hätte getötet werden müssen, ich weiß«, unterbrach ihn Balestrano. »Du hast es oft genug gesagt!«
»Das habe ich«, bestätigte de Maizieres wütend. »Und ich bleibe dabei!«
»Und das aus dem Munde eines Mannes, der noch vor Augenblicken sagte, das Leben sei heilig?«, erwiderte Balestrano mit sanftem Spott.
Reynaud de Maizieres wischte seine Worte mit einer zornigen Bewegung zur Seite. »Leben im Geiste des Herrn, ja!«, sagte er wütend. »Sarim de Laurec hat sich von uns losgesagt und damit von Gott. Er hat versucht, dich zu töten. Er hat sich selbst zum Heiden gemacht! Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich eine Kreatur bewache, die sich selbst und aus freien Stücken in Satans Fänge begeben hat!«
Balestranos Züge verdüsterten sich, als er das Wort Kreatur aus Reynaud de Maizieres’ Mund hörte. Es war nicht das Wort allein, das ihn schaudern ließ, sondern die Art, in der Reynaud de Maizieres es aussprach. Vielleicht war es doch gut, dass de Maizieres niemals die Macht eines Masters erringen würde, dachte der weißhaarige Führer des Templerordens.
Aber er sprach nichts von alledem aus, sondern wandte sich mit einem verzeihenden Lächeln zur Tür, öffnete sie und winkte Reynaud de Maizieres, ihm zu folgen. »Komm mit mir, Bruder«, sagte er. »Ich werde dir etwas zeigen, von dem nur sehr wenige Menschen wissen. Nicht einmal alle meine engsten Vertrauten.«
Reynaud de Maizieres runzelte die Stirn, beeilte sich aber gehorsam, Balestrano zu folgen und die Kammer zu verlassen – wenn auch nicht, ohne dem toten Templer hinter sich noch einen fast angeekelten Blick zuzuwerfen. Balestrano bemerkte ihn sehr wohl, tat aber auch diesmal so, als sehe er nichts. Wenn dies alles hier vorüber ist, dachte er, werden wir über Bruder Reynaud de Maizieres reden müssen. Sein Fanatismus ist gefährlich.
Schweigend gingen sie nebeneinander her durch einen schier endlosen, nur schwach erhellten Gang; einen von zahllosen, gleichförmigen Gängen, die das Pariser Templerkapitel – das gleichzeitig auch das Hauptquartier dieses geheimen Ordens darstellte – durchzogen. Wer das Gebäude von außen gesehen hätte, dem wäre nichts Außergewöhnliches daran aufgefallen; abgesehen von seiner Größe vielleicht. Es war ein riesiger Bau, reich verziert mit Stuckarbeiten und steinernen Skulpturen. Er nahm einen ganzen Häuserblock ein und war an seiner höchsten Stelle neun Stockwerke hoch.
In seinem Innern war das Hauptquartier, ein Labyrinth aus buchstäblich Tausenden von Räumen und Sälen, zahllosen Gängen und Korridoren und Treppenfluchten. Und dieses Labyrinth setzte sich tief in den Erdboden hinein fort. Selbst Reynaud de Maizieres, der nicht das erste Mal hier weilte, war erstaunt, wie endlos tief sich die eng gewundene steinerne Treppe in die Erde bohrte, die Jean Balestrano ihn hinabführte. Längst hatten sie das dreifache Kellerstockwerk über sich zurückgelassen, aber noch immer folgte eine Stufe der anderen, ein Absatz dem nächsten, bis sie sich endlich in einem winzigen, halbrunden Raum mit kuppelförmiger Decke befanden, der von einer einzelnen blakenden Fackel erhellt wurde.
Die einzige Tür, die es in der winzigen Kammer gab, wurde geöffnet, kaum dass sie die letzte Stufe hinter sich gebracht hatten, und ein schweigender Mann in der weißen Uniform der Tempelherren lud sie mit einer Handbewegung ein, näher zu treten.
Reynaud de Maizieres sah sich verwirrt um. Natürlich hatte er geahnt, dass er längst nicht alle Geheimnisse des Templerordens kannte, auch wenn er sich zu den engsten Vertrauten Jean Balestranos zählen konnte. Aber diese finsteren Gewölbe, die von Schatten und drückender Schwüle und dem Geruch nach faulendem Wasser erfüllt waren und deren schimmelbewachsene Wände das rote Licht der Fackeln aufzusaugen schienen, erfüllten ihn mit Furcht.
Sie mussten eine halbe Meile durch den niedrigen Stollen gelaufen sein, bis Balestrano abermals stehen blieb und auf eine Tür deutete, die sein vorderes Ende abschloss. Reynaud de Maizieres fiel auf, wie überaus massiv sie war: aus oberschenkelstarken Bohlen gefertigt und mit gewaltigen Nägeln zusammengehalten, erschien sie ihm stabil genug, selbst einem Kanonenschuss zu widerstehen. Was mochte sich hinter dieser Tür verbergen?
»Ich muss dich noch einmal bitten, mit niemandem über das zu reden, was du jetzt sehen wirst, Bruder Reynaud«, sagte Balestrano ernst. In seinen Augen stand ein Ausdruck, der Reynaud de Maizieres schaudern ließ. Ohne ein Wort nickte er.
»Das, was ich dir zeigen werde, wird dich erschrecken«, fuhr Balestrano fort. »Und vielleicht wirst du an der Richtigkeit dessen zweifeln, was du erleben wirst. Doch du musst gehorchen. Glaube mir, ich habe es mir gut überlegt, ausgerechnet dir diese Aufgabe zu übertragen, doch nach dem unerklärlichen Selbstmord Bruder Henris bist du der Einzige, der die Kraft hat, sie zu bewältigen.« Er lächelte, wandte sich um und hob die Hand, und wieder wurde die Tür geöffnet, als sie darauf zutraten.
Sie wurden von einer ganzen Abteilung weiß gekleideter Tempelritter erwartet. Balestrano nickte den Männern flüchtig zu, sagte jedoch kein Wort, sondern wartete nur, bis die Wächter die Tür hinter ihm und Reynaud de Maizieres wieder sorgsam verschlossen hatten, ehe er weiterging und schließlich vor einer weiteren, sehr niedrigen Tür stehen blieb. Mit einer Handbewegung bedeutete er Reynaud de Maizieres, an seine Seite zu treten.
Der Templer gehorchte.
Die Tür war nur eine von vielen, die die Wände des nach Moder und Fäulnis riechenden Ganges durchbrachen, aber im Gegensatz zu den meisten anderen stand sie nicht offen, sondern war mit einem übergroß erscheinenden Riegel verschlossen und aus den gleichen massiven Bohlen gefertigt wie die am Anfang des Ganges. In Kopfhöhe war ein schmales, zusätzlich vergittertes Fensterchen in das steinharte Holz geschnitten worden, durch das Reynaud de Maizieres jetzt blickte.
Was er sah, ließ ihn zornig die Luft einsaugen. Der Raum auf der anderen Seite der Tür war eine Zelle; ein Kerker, gerade drei mal drei Schritte groß und leer bis auf einen dreibeinigen Tisch und ein schmales, mit Stroh bedecktes Bett. In einer Ecke standen eine Wasserkanne und ein Eimer für Exkremente. Eine halb heruntergebrannte Kerze verbreitete trübes, gelbes Licht.
Auf dem Bett saß Sarim de Laurec. Obwohl er den Blick abgewandt hatte und die rückwärtige Wand der Zelle anstarrte, erkannte Reynaud de Maizieres ihn sofort. Aber er schluckte die scharfe Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, hinunter. Balestrano hatte ihn wohl kaum hierher geführt, nur um ihn wütend zu machen. Aufmerksam musterte er die Gestalt des ehemaligen Tempelritters. Er stand lange so da, sicher fünf Minuten, aber Sarim de Laurec rührte sich kein einziges Mal in dieser Zeit. Man musste sogar sehr genau hinsehen, um überhaupt festzustellen, dass er atmete.
»So sitzt er immer da«, sagte Balestrano leise. »Er bewegt sich nie. Man muss ihn füttern und sauber halten wie ein kleines Kind.«
Reynaud de Maizieres verzog angeekelt das Gesicht. Dann fiel ihm etwas auf. »Was ist das da an seinem Kopf?«, fragte er. An de Laurecs linker Schläfe war eine kleine, kaum daumennagelgroße Wunde. Ein einzelner Blutstropfen glitzerte auf seiner Haut.
»Etwas, das niemand von uns versteht, Bruder«, antwortete Balestrano. »Er hat diese Wunde, seit er hierher gebracht wurde.«
»Seit er …« Reynaud de Maizieres brach erstaunt ab. »Aber das ist Monate her!«, rief er ungläubig.
Balestrano nickte. »Und sie blutet noch immer. Die besten Ärzte konnten sie nicht schließen.« Er seufzte, machte eine Handbewegung, als wolle er das Thema beiseiteschieben, und deutete den Gang hinab. »Aber das ist es nicht, was ich dir zeigen wollte. Komm!«
Sie gingen weiter. Der Gang zog sich gut dreißig Schritte dahin und endete vor einer niedrigen, mit einem kompliziert aussehenden Schloss verschlossenen Tür, die Jean Balestrano mittels eines Schlüssels in der Form eines Kreuzes öffnete, den er an einer dünnen, silbernen Kette um seinen Hals trug.
Reynaud de Maizieres wollte eintreten, aber der Tempelherr hielt ihn mit einer raschen Geste zurück, richtete sich auf und winkte einem der Wächter, eine Fackel zu bringen. Erst dann bückte er sich unter dem niedrigen Eingang hindurch und winkte Reynaud de Maizieres, ihm zu folgen.
Ein sonderbarer Geruch schlug dem Tempelritter entgegen, als er Balestrano folgte und sich auf der anderen Seite des niedrigen Durchganges wieder aufrichtete. Was er sah, ließ ihn erstarren.
Der Raum war groß, aber vollkommen leer.
Das hieß – er hatte keine Einrichtung, wie Reynaud de Maizieres sie gewohnt war …
Auf dem steinernen Boden, der so sorgsam geglättet worden war, dass er wie ein matt gewordener Spiegel das Licht der Fackel zurückwarf, war mit blutroter Kreide ein gewaltiger, fünfzackiger Stern aufgemalt – ein Pentagramm, dachte Reynaud de Maizieres entsetzt, das Zeichen schwarzer Magie, das Symbol des Satans! Ohne dass er sich der Bewegung überhaupt bewusst geworden wäre, glitt seine Hand an die rechte Seite seines Gürtels, dorthin, wo das Schwert hing, wenn er sein Templergewand trug.
»Warte!«, sagte Balestrano rasch. »Urteile nicht vorschnell! Ich habe dir gesagt, dass dich Schlimmes erwartet. Sieh!« Er deutete mit der Fackel auf das Pentagramm.
Mühsam kämpfte Reynaud de Maizieres den Sturm einander widerstrebender Gefühle nieder, der in seinem Innern tobte, und beugte sich vor, wobei er allerdings peinlich darauf achtete, den roten Kreidestrichen des Drudenfußes nicht zu nahe zu kommen.
Das Pentagramm war nicht leer.
In seinem Zentrum lag ein grün flimmerndes, sonderbares Etwas, das wie unter einem unheimlichen inneren Licht zu glühen schien. Im ersten Moment erkannte Reynaud de Maizieres kaum etwas, aber seine Augen gewöhnten sich rasch an das flackernde Licht von Balestranos Fackel.
Das grüne Etwas war ein Kristall. Ein kinderkopfgroßer Kristall von der genauen Form eines menschlichen Gehirns!
»Großer Gott!«, keuchte Reynaud de Maizieres. »Was ist das?!« Es war nicht einmal das bizarre Äußere des kristallenen Gehirns, auch nicht das unheimlich pulsierende Licht, das aus seinem Innern drang, was ihn so über die Maßen erschreckte.
Vielmehr war es das, was er fühlte …
Das grüne Kristallgehirn atmete das Böse aus.
Es war Reynaud de Maizieres unmöglich, es anders als mit diesen Worten zu beschreiben. Er spürte den Atem der Hölle, als er das Kristallgehirn anblickte. Er sah jetzt, dass es beschädigt war: Ein gezackter Riss spaltete es nahezu in zwei Hälften, und dünne Sprünge liefen wie ein Spinnennetz durch den Kristall. Aber das änderte nichts an seiner furchtbaren, höllischen Ausstrahlung.
»Was ist das?«, flüsterte Maizieres noch einmal. Er starrte Balestrano an. Seine Augen waren weit und dunkel vor Schrecken.
»Wir wissen es nicht«, antwortete Jean Balestrano leise. »Etwas Böses, Bruder Reynaud, etwas unendlich Böses. Es wurde von Wesen erschaffen, die uns so fremd sind, dass wir sie uns nicht einmal vorzustellen vermögen. Wesen, die schlimmer sind als Satan.«
»Aber was tut es hier?«, keuchte Reynaud de Maizieres.
Balestrano lächelte milde, aber sein Blick blieb ernst. »Es fiel dem Orden in die Hände«, erklärte er – wobei Reynaud de Maizieres ganz genau spürte, dass dies eine höchst freie Interpretation dessen war, was wirklich geschehen sein musste. »Wir haben lange beraten, was damit zu geschehen hat. Wir wussten die Antwort nicht. Deshalb ist es hier. Bewacht von den treuesten und tapfersten unserer Brüder. Ich meine es ernst, Bruder Reynaud, wenn ich sage, dass dieses Gebilde vielleicht die Macht in sich trägt, die Welt zu vernichten.«
»Dann müsst ihr es zerstören!«, rief Reynaud de Maizieres erregt.
»Das geht nicht«, antwortete Balestrano leise. »Wir haben es versucht. Bruder Shadow hat es versucht. Du kennst das Ergebnis.«
Reynaud de Maizieres keuchte. »Du willst sagen, dass … dass dieses Ding ihn verändert hat?«
»Ich fürchte«, sagte Balestrano. »Und wenn es so ist, dann trifft mich ein Teil Schuld an seinem Schicksal. Doch dieses Rätsel werden wir wohl niemals lösen.« Er seufzte. »Bruder Henri nahm ein schweres Los auf sich, als ich ihm die Verantwortung für dieses Werk des Teufels übertrug«, fuhr er in verändertem – aber womöglich noch ernsterem – Ton fort. »Nun wirst du es sein, der sie tragen muss. Wenn du es willst.« Er sah Reynaud de Maizieres ernst an. »Willst du das tun? Ich werde es dir nicht ankreiden, wenn du es ablehnst.«
»Ich werde gehorchen«, antwortete Reynaud de Maizieres.
Balestrano lächelte. Er wollte etwas sagen, aber er kam nicht mehr dazu.
Denn in diesem Moment drang vom Gang her ein unmenschlicher Schrei an ihre Ohren!
Der Sturm hatte eine Stunde vor Sonnenaufgang begonnen. Und ich war ziemlich sicher, dass er innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht mehr aufhören würde.
Wenn mein Zeitgefühl nicht ebenso kaputt war wie meine Taschenuhr, die ich mir beim Sturz auf den Felsen zerschlagen hatte, musste es fast Mittag sein, aber rings um uns herum herrschte tiefste Nacht. Der Himmel war schwarz, nur ab und zu zuckte ein greller Blitz auf und tauchte die felsige Landschaft in unheimliches, flackerndes Licht. Der Sturm erfüllte die Luft mit einem ungeheuerlichen Heulen und Brüllen, als wären sämtliche Dämonen der Hölle auf einmal auf uns losgelassen worden. Staubfein zermahlener Sand prasselte auf den Felsen, hinter dem ich Deckung gesucht hatte, war in meinem Haar, in meiner Kleidung, in meinem Mund und meinen Augen, in meinen Ohren und meiner Nase.
Der Sturm hatte unser Lager innerhalb einer einzigen Minute so gründlich zerstört, dass selbst Dschingis Khan vor Neid erblasst wäre, und die Überreste in einer weiteren Minute auf tausend Quadratmeilen verteilt. Und er hatte unsere Pferde samt einem Gutteil der Ausrüstung auf Nimmerwiedersehen verschluckt und die fast mannstiefe Senke, in der wir unser Lager aufgeschlagen hatten, derart mit Sand zugeschaufelt, dass wir bis an die Hälse darin versunken wären, hätten wir den Fehler begangen, uns auf den Schutz des felsigen Randes zu verlassen.
Wieder wetterleuchtete es über uns, und wahrscheinlich erfolgte auch gleich darauf ein Donnerschlag, der aber im Heulen und Brüllen des Sturmes unterging. Immerhin sah ich in dem kurzen, weißblauen Flackern die verschwommenen Umrisse eines Menschen, der sich nur wenige Schritte neben mir in den Schutz eines Felsens duckte.
Vorsichtig erhob ich mich hinter meiner Deckung, wartete ab, bis der Sturm für einen Moment innehielt – freilich nur, um danach mit doppelter Wut wieder losheulen zu können –, und sprintete los.
Es waren nur wenige Schritte; nicht einmal zehn Yards. Trotzdem hätte ich es fast nicht geschafft. Der Sturm packte mich, als ich drei Viertel der Strecke hinter mich gebracht hatte, hob mich wie ein Blatt vom Boden hoch und schleuderte mich drei, vier Yards weit durch die Luft. Wäre ich auf Felsen statt auf weichen Sand gestürzt, hätte ich mir zweifellos sämtliche Knochen im Leibe gebrochen. Aber auch so kostete es mich meine letzte Kraft, mich auf Hände und Knie hochzustemmen und in den Schutz des nächsten Felsens zu kriechen.
Der Umriss, den ich im Licht des Blitzes bemerkt hatte, war Shadow. Ihre Hand streckte sich mir entgegen, als ich auf den Felsen zurobbte, packte die meine und zog mich mit erstaunlicher Kraft in die Deckung des Steines. Ich nickte dankbar. Zum Sprechen fehlte mir der Atem. Außerdem hätte das Heulen des Sturmes ohnehin jeden Laut verschluckt.
Wir müssen hier weg, wisperte Shadows Stimme in meine Gedanken. Der Sturm wird schlimmer.
Erschrocken sah ich auf, weniger alarmiert durch die Worte, die die El-o-hym mir telepathisch übermittelt hatte, als vielmehr durch die Tatsache, dass sie es tat. Natürlich wusste ich, dass Shadow jederzeit in der Lage war, ihre Gedanken ins Bewusstsein eines anderen Menschen zu projizieren – und unter gewissen Umständen auch die Gedanken anderer zu lesen. Aber es war eine unausgesprochene Übereinkunft zwischen uns, dass sie diese Fähigkeiten nicht benutzte, und ich glaube sogar, sie hatte ein wenig Angst davor, so, wie ich stets Hemmungen hatte, meine eigenen magischen Kräfte anzuwenden. Wenn sie es jetzt doch tat, dann nur aus dem Grund, weil wir wirklich in Gefahr waren.
Shadow sah mich an, und als ich ihrem Blick begegnete, wusste ich, dass sie auch diesen Gedanken gelesen hatte. Sie nickte.
Was wird passieren?, dachte ich.
Statt einer Antwort hob Shadow die Hand und deutete nach Osten, direkt in den heulenden Sandsturm hinaus. Ich folgte der Geste, aber so sehr ich mich auch anstrengte, alles was ich sah, war eine brüllende Wand aus Schwärze und apokalyptischer Bewegung.
Plötzlich griff Shadow abermals nach meiner Hand. Ihr Griff war so fest, dass ich vor Schmerz die Zähne zusammenbiss.
Dann fluteten Bilder in mein Bewusstsein …
Im ersten Moment sah ich nichts außer wirbelnder Schemen. Dann erkannte ich unser Lager, die schmale, von rund geschliffenen Findlingen gesäumte Senke an der Ostflanke des Berges, begraben unter Tonnen und Tonnen und Tonnen von Sand. Der Sturm hatte seine Kraft verzehnfacht. Felsen regneten vom Himmel, und wo der Sand gegen den Stein gepeitscht wurde, schlugen Funken aus dem Fels. Ein totes Pferd flog wie ein Geschoss heran und prallte gegen die Flanke des Berges.
Wann?, dachte ich entsetzt.
In wenigen Minuten, antwortete Shadow. Was wir bisher erlebt haben, war nur das Vorspiel. Der wirkliche Sturm beginnt erst. Sie ließ meine Hand los, und die schrecklichen Bilder verblassten und machten einer kaum weniger erschreckenden Wirklichkeit Platz. Die schwarze Wand war näher gekommen. An ihrem Fuß war eine vage, mahlende Bewegung, als würde der Wüstenboden selbst dort in die Höhe gerissen und zu Staub zermahlen. Wahrscheinlich war es so.
Wo sind die anderen?
Shadow hob die Hand und deutete auf den Berg hinter uns. Seine Flanke ragte annähernd lotrecht über uns in die Höhe, aber alles, was mehr als acht oder zehn Yards entfernt war, verlor sich in tobender Bewegung und irrsinnig tanzenden Sandschwaden.
Ixmal hat eine Höhle entdeckt, antwortete Shadow. Sie sind alle auf dem Weg dorthin.
Ist sie sicher?, fragte ich. Die Bilder, die ich durch Shadows Augen gesehen hatte, drohten mich wieder einzuholen. Mühsam schüttelte ich sie ab.
Das wird sich herausstellen, antwortete Shadow lakonisch. Komm jetzt. Ohne meine Antwort abzuwarten, sprang sie auf die Füße, fuhr herum und zerrte mich einfach hinter sich her.
Während der ersten paar Dutzend Schritte war es beinahe einfach, denn der Sturm schob uns geradewegs vor sich her, sodass wir nicht einmal hätten stehen bleiben können, wenn wir es gewollt hätten.
Die zweite Hälfte des Weges wurde zu einem Spießrutenlaufen durch die Hölle. Der schwarze Granit des Berges tauchte so unvermittelt vor uns auf, dass selbst Shadows übermenschlich schnelle Reaktionen nicht mehr ausreichten, das Unglück zu verhindern. Sie versuchte stehen zu bleiben, aber als hätte der Sturm nur auf diesen Augenblick gewartet, fauchte in diesem Moment eine brüllende Bö heran, riss sie von den Füßen und nach vorne und schmetterte sie gegen den Berg.
Wäre sie ein Mensch gewesen, hätte der Aufprall sie getötet. Aber auch so verzerrte sich ihr Gesicht vor Schmerz. Mit haltlos rudernden Armen brach sie zusammen, hob schützend die Hände vor das Gesicht und keuchte gleich darauf ein zweites Mal vor Schmerz, als die nächste Bö auch mich ergriff und gegen sie schleuderte.
Benommen stemmte ich mich in die Höhe, sah ein braunschwarzes Etwas auf mich zurasen und drehte hastig den Kopf, ehe der Sand, den die Sturmbö heranschleuderte, mir das Gesicht wegschmirgeln konnte. Mit aller Kraft stemmte ich mich in den Boden und versuchte irgendwo Halt zu finden.
Trotzdem wurde ich in die Höhe und gegen den Fels geschleudert, dass mir die Luft wegblieb. Ich fiel, rollte instinktiv herum und barg den Kopf zwischen den Armen. Sand war in meinem Mund und meiner Nase. Meine Kehle brannte, als hätte ich gemahlenes Glas eingeatmet. Ich konnte nichts mehr sehen. Das Heulen des Sturmes steigerte sich zu einem unbeschreiblichen Crescendo. Blutige Kreise tanzten vor meinen Augen. Mein Herz raste zum Zerspringen.
Plötzlich fühlte ich mich gepackt und in die Höhe gerissen, diesmal aber nicht vom Sturm, sondern von harten, menschlichen Händen. Mühsam öffnete ich die Augen und erkannte ein verschwommenes, auf und ab hüpfendes Oval, das erst nach Sekunden zu einem scharf geschnittenen Indianergesicht wurde.
Mit einem Ruck zerrte mich Ixmal vollends auf die Füße, stieß mich grob herum und gestikulierte wild in die Richtung des Berges. Seine Lippen formten Worte, die vom Sturm davongerissen wurden, ehe sie mein Ohr erreichten. Aber ich begriff auch so, was er meinte, und nickte.
Der Sturm steigerte sich zu unbeschreiblicher Wut, während ich hinter Ixmal um den Berg herumtaumelte. Funken stoben aus dem Fels. Kopfgroße Steine regneten auf uns herab und zerbrachen rings um uns, und plötzlich hob sich dicht vor meinen Füßen der Boden und zerriss zu einem halbmeterbreiten, gezackten Schlund.
Ixmal setzte mit einer eleganten Bewegung über den Spalt hinweg und stürmte weiter. Ich musste ihm folgen, ob ich wollte oder nicht.
Kurz bevor wir die Höhle erreichten, drehte ich mich im Laufen um und blickte in den Sturm zurück. Wo war Shadow? Aber ich sah weder die El-o-hym noch die Felsen, hinter denen wir Deckung gesucht hatten.
Unser Lager, Shadow, die Mojave-Wüste, der Himmel – alles war verschwunden. Stattdessen brodelte dort etwas Gigantisches, Schwarzes, das rasend schnell herankam, Sand und Steine und mannsgroße Felsen wie dürres Laub in die Höhe reißend und zermalmend.
Ich ließ Ixmals Hand los und rannte so schnell ich konnte. Hinter uns heulte der Urgroßvater aller Stürme heran.
Reynaud de Maizieres sah die Schwertklinge heransausen, duckte sich instinktiv darunter hinweg und schlug dem Mann die geballten Fäuste in den Leib, ohne auch nur zu denken. Der Templer krümmte sich mit einem keuchenden Laut, taumelte zurück und fiel mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Knie, aber sofort war ein zweiter Mann zur Stelle, drosch mit dem Schwert nach Reynauds Kopf und versuchte gleichzeitig, ihm die Beine unter dem Leib wegzutreten.
De Maizieres fing den Schwertarm des Mannes mit dem Unterarm ab, packte blitzschnell sein Handgelenk und verdrehte es mit einem kurzen, harten Ruck. Der Krieger ließ seine Klinge fahren und fiel schreiend zu Boden, aber Reynaud de Maizieres beachtete ihn gar nicht mehr. Blitzschnell hob er das Schwert auf, packte die Klinge mit beiden Händen und führte einen gewaltigen Rundschlag.
Er traf niemanden, aber die drei Templer, die ihren beiden Kameraden zur Hilfe hatten eilen wollen, brachten sich mit schnellen Sprüngen in Sicherheit, und für einen Moment hatte de Maizieres Luft. Hastig wich er zurück, hob auch die Waffe des zweiten Tempelritters auf und warf sie Jean Balestrano zu, der das Schwert geschickt auffing und mit gespreizten Beinen festen Stand suchte.
Erst jetzt kam Reynaud de Maizieres der furchtbare Anblick richtig zu Bewusstsein, den der Gang vor ihm bot. Von den anderthalb Dutzend Kriegern, die sie bei ihrer Ankunft hier unten erwartet hatten, lebte noch gut die Hälfte – und diese Krieger waren dabei, sich gegenseitig umzubringen!
Aber Reynaud de Maizieres blieb nicht einmal Zeit, sich nach dem Warum dieses schrecklichen Geschehens zu fragen, denn schon wurden er und Balestrano erneut angegriffen, diesmal von gleich vier Männern, die offensichtlich aus dem Schicksal ihrer beiden Vorgänger gelernt hatten, denn sie versuchten nicht mehr, den Tempelherrn im ersten Ansturm zu überwältigen, sondern umkreisten ihn in respektvollem Abstand und suchten nach einer Lücke in seiner Deckung.
Reynaud de Maizieres musterte die Angreifer kalt. Er hatte keine Angst; die hatte er niemals, wenn er kämpfte, selbst gegen so einen so übermächtigen Gegner wie jetzt. Außerdem war er ziemlich sicher, es selbst mit diesen vier Männern zugleich aufnehmen zu können. Nicht umsonst galt er als einer der gefährlichsten Männer, die jemals das weiße Gewand der Tempelherren angezogen hatten.
Was ihn vielmehr entsetzte, war die Tatsache, dass die Männer ihn und Balestrano angriffen. Jean Balestrano war das Oberhaupt des Templerordens, und diese Krieger waren einzeln und sorgsam ausgewählt worden. Ein Verrat auch nur eines Einzigen dieser Elitemänner war undenkbar! Und jetzt war gleich die Hälfte von ihnen zu Verrätern geworden. »Brüder!«, rief Balestrano. »Besinnt euch! Ihr wisst nicht, was ihr tut!«
Die Antwort eines der Angreifer bestand aus einem irren Lachen und einem Schwerthieb nach Balestranos Hals, der den alten Mann mit Sicherheit getötet hätte, hätte sich Reynaud de Maizieres nicht gedankenschnell dazwischengeworfen und den Hieb mit seiner eigenen Klinge aufgefangen.
Auf diesen Moment hatten die drei anderen nur gewartet. Gleichzeitig rissen sie ihre Schwerter hoch und drangen auf Reynaud de Maizieres ein. Reynaud fing einen der Hiebe mit seiner eigenen Klinge auf, blockte den Waffenarm eines zweiten Mannes mit der bloßen Hand ab und spürte einen furchtbaren Schmerz an der Seite, als die Klinge des dritten über seine Rippen schrammte und eine blutige Furche in seine Haut grub.
Das schien die letzte Barriere zu brechen. Reynaud de Maizieres wurde zum Berserker. Seine Klinge zischte wie ein silberner Blitz durch die Luft und fällte die drei Männer mit einem einzigen, unglaublich kraftvollen Hieb. Den vierten Angreifer richtete Jean Balestrano selbst.
Aber es war nur eine kurze Atempause, die den beiden Tempelherren vergönnt war. Der Kampf vor ihnen näherte sich rasch seinem Ende. Die wenigen Templer, die nicht dem Wahnsinn verfallen waren, wurden einer nach dem anderen niedergemacht und schon nach Augenblicken sahen sich Balestrano und Reynaud de Maizieres abermals einer erdrückenden Übermacht von Gegnern gegenüber.
»Ich flehe euch an, Brüder, besinnt euch!«, rief Balestrano. Seine Stimme zitterte, und seine Augen waren weit vor Furcht. Aber Reynaud de Maizieres begriff rasch, dass es nicht die Angst vor dem Tode war; die kannte Jean Balestrano so wenig wie er, wussten sie doch beide, dass nach dem Ende ihrer körperlichen Existenz nur der Übergang in eine andere, weit bessere Welt folgen würde.
Nein, das, was das Oberhaupt des Templerordens schier zur Verzweiflung trieb, war das unglaubliche Geschehen selbst. Noch vor Minuten hätte jeder dieser Männer mit Freuden sein Leben gegeben, um Jean Balestrano zu schützen. Jetzt hatten sie sich in gnadenlose Killer verwandelt!
Die sieben übrig gebliebenen Männer – drei von ihnen waren schwer verwundet, wie Reynaud mit einem raschen Blick feststellte – rückten nun in breiter Front gegen ihn und Balestrano vor. Reynaud de Maizieres fuhr sich nervös mit der Zungenspitze über die Lippen. In der Enge des Stollens war ein Ausweichen so gut wie unmöglich. Seine Beweglichkeit, die einen Gutteil seiner Überlegenheit im Kampf ausmachte, würde ihm hier nicht mehr viel nutzen.
Noch einmal versuchte Balestrano die wahnsinnig gewordenen Templer zur Vernunft zu bringen. »Beruhigt euch, Brüder!«, rief er. »Was immer geschehen sein mag, wir können darüber reden!«
Einer der Männer lachte hässlich und täuschte einen Angriff vor, zog sich aber hastig zurück, als Reynaud de Maizieres mit dem Schwert nach ihm schlug.
Ganz langsam rückte die Reihe der sieben Angreifer vor. Und im gleichen Maße wichen Reynaud de Maizieres und Jean Balestrano zurück. De Mazieres machte sich keine Illusionen mehr. Sie waren in die Enge getrieben, und sie standen Männern gegenüber, denen es offensichtlich vollkommen gleichgültig war, was mit ihnen geschah. Selbst wenn es ihm gelang, die meisten oder gar alle der Angreifer zu töten, würden sie gemeinsam sterben. Ein Mann, der keine Rücksicht mehr auf sein eigenes Leben nimmt, ist ein unschlagbarer Gegner.
Schließlich waren sie bis an die rückwärtige Wand zurückgetrieben. Reynaud de Maizieres hieß Balestrano mit einer Kopfbewegung hinter ihn zu treten, nahm mit gespreizten Beinen vor dem greisen Tempelherren Aufstellung und packte sein Schwert mit beiden Händen.
Aber der Angriff, auf den er wartete, kam nicht.
Die Reihe der sieben Tempelritter rückte weiter vor, blieb dann aber plötzlich wie auf ein geheimes Kommando hin stehen, wenngleich mit stoßbereit erhobenen Klingen, sodass Reynaud es nicht wagte, auch nur einen Schritt zu tun.
Und dann, wie aus dem Nichts, erschien eine weitere Gestalt hinter den Tempelrittern.
Der Mann war groß, relativ schlank und hatte dunkles Haar, dazu einen dunklen, sehr sorgfältig ausrasierten Bart, der ihn älter erscheinen ließ, als er sein mochte. Er war eine Spur zu elegant gekleidet, um auf einer normal belebten Straße nicht aufzufallen. In der rechten Hand trug er einen Spazierstock mit einem übergroßen, leicht gelblich schimmernden Knauf aus einem sonderbaren Kristall, in den ein dunkles Etwas eingeschlossen war. Das Sonderbarste aber war sein Haar, denn über seinem linken Auge beginnend zog sich eine schlohweiße, blitzförmig gezackte Strähne bis weit über seinen Scheitel hin.
Der Mann war Reynaud de Maizieres vollkommen unbekannt, aber Jean Balestrano stöhnte bei seinem Anblick erschrocken auf. »Sie?«, keuchte er.
Der Mann mit der gezackten Haarsträhne lachte leise, machte eine Bewegung mit der Linken und scheuchte die Templer beiseite, die Balestrano und Reynaud de Maizieres noch immer in Schach hielten. Er kam näher. Dass er dabei in die Reichweite von Reynaud de Mazieres’ Schwert geriet, schien ihn nicht zu stören. Ein böses, heimtückisches Funkeln erschien in seinen dunklen Augen.
Reynaud de Maizieres drehte sich halb herum und sah Balestrano an. »Du kennst diesen Mann, Bruder Jean?«, fragte er.
Balestrano antwortete nicht. Stattdessen lachte der unheimliche Fremde erneut, hob seinen Spazierstock und tippte Reynaud de Maizieres mit seinem Ende vor die Brust. Reynaud musste sich zurückhalten, um nicht mit dem Schwert zuzuschlagen.
»Sie!«, keuchte Balestrano noch einmal. »So … halten Sie also Ihr Wort.«
»Mein Wort?« Der Mann mit der Strähne lachte böse. »Aber, aber, Bruder Jean. Welches Wort? Als wir uns das letzte Mal sahen, habe ich Ihnen das Versprechen abgenommen, mich und meine Freunde in Ruhe zu lassen, nicht wahr? Davon, dass es auch umgekehrt so ist, war niemals die Rede.«
Balestrano sog zornig die Luft ein. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte er mit einer Geste in den Gang. »Warum bringen Sie meine Leute dazu, sich gegenseitig zu töten?«
»Nur die, die sich meinem geistigen Einfluss widersetzen«, sagte der Fremde lakonisch.
Balestranos Gesicht verhärtete sich. »Sie beginnen einen Krieg, Craven«, sagte er. »Das ist Ihnen klar. Sie können mich töten; und Bruder Reynaud hier auch, aber wir sind ersetzbar. Nach uns werden andere kommen, die den Kampf fortsetzen. Sie werden für das bezahlen, was hier geschehen ist.«
Craven lachte. »Aber nicht doch. Ich habe nicht vor, Ihnen oder Ihrem Begleiter ein Haar zu krümmen. Geben Sie mir, was ich haben will, und Sie werden mich niemals wiedersehen.« Er hob den Spazierstock und deutete damit auf die niedrige Tür, vor der Balestrano und Reynaud de Maizieres Aufstellung genommen hatte.
Balestrano erbleichte. »Das Gehirn?«, keuchte er.
Craven nickte. »Das Gehirn«, bestätigte er. »Sie haben die Wahl, Bruder Jean. Sie können es mir freiwillig ausliefern und leben, oder ich töte Sie und nehme es mir.«
»Niemals!«, keuchte Balestrano.
»Wie du willst, alter Narr«, sagte Craven. Mit einem Male klang seine Stimme hart, kaum mehr menschlich, sondern fast wie die einer Maschine. »Dann eben anders.«
Reynaud de Maizieres spannte sich, auf einen Angriff der sieben Templer gefasst. Aber stattdessen traten die Männer auf einen Wink Cravens hin einen Schritt zurück. Der Mann mit der weißen Haarsträhne hob seinen Spazierstock. Etwas klickte und plötzlich glitt eine dünne, rasiermesserscharf geschliffene Klinge aus dem hölzernen Schaft, der in Wahrheit nichts anderes als ein Stockdegen war.
Reynaud de Maizieres blickte fast verblüfft auf die zerbrechliche Klinge, dann auf das wuchtige Breitschwert in seinen Händen. War dieser Craven verrückt geworden? Ein einziger Hieb seines Breitschwertes musste seine Spielzeugwaffe wie einen Zahnstocher zerspringen lassen.
Der Tempelherr knurrte siegesgewiss, ließ seine Klinge pfeifen und drang mit einem gellenden Kampfschrei auf Craven ein. Aber der Mann mit der weißen Haarsträhne sprang mit einem behänden Satz zur Seite, stieß mit einer unglaublich raschen Bewegung nach Reynaud de Maizieres’ Waffenhand und fügte ihm einen zwar ungefährlichen, aber heftig blutenden Stich im Handgelenk zu.
»Gib Acht, Bruder Reynaud«, sagte Balestrano. »Er ist ein Magier!«
Craven lachte schrill, als er diese Worte hörte. Ein hässliches, unbeschreiblich höhnisches Lächeln verzerrte seine Lippen, und in seinen Augen loderte ein fast wahnsinniges Feuer. Immer schneller und schneller zuckte seine Klinge nach Reynaud de Maizieres’ Gesicht und immer schwerer fiel es dem Templer, dem tödlichen Stahl auszuweichen. Er schwang sein eigenes Schwert mit beiden Händen und versuchte, die zerbrechliche Klinge Cravens zu treffen, aber der Fremde kämpfte mit einer Schnelligkeit und Eleganz, wie sie Reynaud de Maizieres noch niemals zuvor im Leben gesehen hatte.
Ohne dass er es selbst bemerkt hatte, musste er Craven doch getroffen haben, denn auf seinem Gesicht war plötzlich Blut und Reynaud sah, dass er eine winzige, aber sehr tiefe Wunde an der linken Schläfe hatte. Der Anblick erinnerte ihn an irgendetwas, aber Craven gab ihm keine Zeit, seine Gedanken zu ordnen.
Abermals griff er an und diesmal so schnell, dass Reynaud de Maizieres’ Reaktion nicht mehr rasch genug kam. Seine Klinge kreiselte in einer eigentlich unmöglichen Bewegung um die de Mazieres’ herum und traf seine Waffenhand. Mit einem Schmerzensschrei ließ Reynaud de Maizieres seine Klinge fallen, fiel auf die Knie und presste die verwundete Hand gegen den Leib. Das ist also das Ende, dachte er, matt und ohne jede Furcht oder Bitterkeit.
Aber Craven tötete ihn nicht. Stattdessen lachte er abermals sein schrilles, höhnisches Lachen, stieß die Klinge in ihre hölzerne Hülle zurück – und schlug Jean Balestrano den kristallenen Knauf des Stockes gegen den Schädel.
Ohne einen Laut ging der Oberherr des Templerordens zu Boden.
Craven fuhr herum, hob seinen Stock und ließ den Knauf auf Reynaud de Maizieres’ Schläfe niederkrachen.
Das Letzte, was der französische Tempelherr sah, war das Gesicht Robert Cravens, zu einem hämischen Lachen verzerrt. Und dann, eine halbe Sekunde, ehe ihn die barmherzige Dunkelheit umfing, die weit offen stehende Tür von Sarim de Laurecs Zelle.
Sie war leer.
Die Höhle war im Grunde keine Höhle, sondern ein Riss im Fels, so schmal, dass wir hintereinander stehen mussten, aber durch eine Laune der Natur war der Berg so geborsten, dass wenige Schritte hinter dem Eingang des Hohlraumes ein Knick von neunzig Grad entstanden war. Die Wut des Sturmes reichte nicht aus, diese Biegung mitzumachen, und so standen wir zwar wie die Ölsardinen hintereinander, waren aber wenigstens aus dem tosenden Weltuntergang heraus. Ich konnte sogar atmen, ohne jedes Mal ein Pfund Sand zu schlucken.
Eine Unterhaltung hingegen war nicht möglich. Der Sturm steigerte sich zu dem apokalyptischen Inferno, das mir Shadow gezeigt hatte, und sein Brüllen wuchs derart an, dass wir uns selbst hier drinnen die Ohren zuhalten mussten.
Länger als eine Stunde standen wir so da, in einer äußerst unbequemen, aber sicheren Stellung, bis das Lärmen und Tosen allmählich abnahm und schließlich ganz verstummte. Ixmal, der als letzter die Höhle betreten hatte, erbot sich, hinauszugehen und nach dem Rechten zu sehen – was blieb ihm auch anderes übrig? Er musste ohnehin zuerst aus dem Berg kriechen, denn der Spalt war zu schmal, als dass ich oder einer der anderen uns an ihm hätten vorbeischieben können.
Ixmal blieb länger weg, als mir lieb war. Wahrscheinlich war es nicht sehr viel mehr als eine Minute, aber ich litt Höllenqualen während dieser Zeit. Schließlich kam der junge Indianer zurück und verkündete, dass der Sturm vorbei und alles in Ordnung sei. Sein Gesicht war sonderbar ausdruckslos bei diesen Worten.
Als ich auf Händen und Knien aus dem Berg kroch, verstand ich auch, warum.
So warnungslos, wie er aufgekommen war, war der Sturm weitergezogen, um anderswo weiterzutoben; vielleicht hatte er sich in seiner Wut auch selbst aufgezehrt. Aber der felsige Hang, an dem wir am Abend zuvor unsere Lager aufgeschlagen hatten, hatte sich vollkommen verändert.
Um mit dem Schlimmsten zu beginnen – unser Lager war fort.
Nicht etwa zerstört oder verwüstet oder vom Sand zugeschüttet, sondern weg.
Wo der flache Felskrater gewesen war, erstreckte sich eine ebene, leicht geriffelte Sandmasse. Unsere Zelte waren verschwunden, genauso wie die Pferde.
Aber auch die Landschaft, die sich dahinter erstreckte, hatte sich auf erschreckende Weise verändert. Am Abend zuvor, als wir im letzten Licht der brennenden Wüstensonne unsere Lager aufgeschlagen hatten, hatte sich das Schatten- und Felslabyrinth einer Steinwüste dort erstreckt, bis es am Horizont mit dem Abendhimmel verschmolz. Jetzt sah ich nur noch Sand. Sand, so viel ich wollte.
»Gütiger Gott!«, flüsterte Postlethwaite neben mir. »Was ist da passiert?«
Ich sah ihn an. Sein Gesicht war totenbleich. Er sah aus wie ein Mann, der gerade den Beweis dafür bekommen hatte, dass es den Weihnachtsmann noch gibt.
»Nichts Außergewöhnliches, Lance«, sagte Buffalo Bill, der in diesem Moment hinter uns aus dem Felsspalt gekrochen kam, sich schnaubend in die Höhe stemmte und ebenso zornig wie vergeblich versuchte, den Sand aus seinen Kleidern und dem Haar zu bekommen.
»Nichts Außergewöhnliches!«, wiederholte Postlethwaite mit überschnappender Stimme. »Wir verlieren unsere gesamte Ausrüstung, unser Wasser, die Tiere und unsere Karten, und das ist nichts Außergewöhnliches?!«
»Hier nicht«, bestätigte Cody, in einem Ton, der beinahe gelangweilt klang. In seinen Augen blitzte es auf, als er sich von Postlethwaite abwandte und mich ansah. »Ich habe dich gewarnt, hierherzukommen«, sagte er. »Das war nur ein Vorgeschmack. Solche Sandstürme kommen hier alle naselang vor.«
»Nun«, wandte Annie ein, »solche Sandstürme vielleicht nicht, aber –«
»Papperlapapp«, unterbrach sie Buffalo Bill verärgert. »Ob so einer oder nur halb so schlimm, spielt ja wohl keine Rolle. Auf jeden Fall ist das das Ende unserer kleinen Expedition.«
»Aber –«
Cody schnitt mir mit einer bestimmten Geste das Wort ab, als ich widersprechen wollte. »Zum Teufel, ich weiß, was du sagen willst. Aber so, wie die Sache im Moment aussieht, ist es Selbstmord, auch nur einen Schritt weiterzugehen. Lance hat Recht – wir haben keine Ausrüstung mehr, keine Pferde, keinen einzigen Schluck Wasser. Und diese Drachenburg kann hundert Meilen entfernt sein. Oder tausend.«
Einen Moment lang starrte ich ihn wütend an. Aber dann schluckte ich die scharfe Antwort, die mir auf den Lippen lag, herunter, wandte mich mit einem Ruck ab und starrte nach Westen.
Das Schlimme war ja, dass Cody Recht hatte. Und dass mir kein einziges auch noch so dünnes Argument einfiel, mit dem ich widersprechen konnte. Die auf so bizarre Weise veränderte Wüste erstreckte sich vor mir so weit ich blicken konnte – und wahrscheinlich noch ein gehöriges Stück darüber hinaus. Selbst wenn ich die genaue Lage der Drachenburg gekannt hätte, wäre es aussichtslos gewesen, weitergehen zu wollen.
»Okay«, sagte Cody, als klar wurde, dass ich nicht mehr antworten würde. »Sehen wir, ob wir noch ein paar klägliche Überreste unserer Sachen finden. Und danach machen wir uns auf den Rückweg. Dreißig Meilen zu Fuß und ohne Wasser sind alles andere als ein Spaziergang.«
Ich schenkte ihm einen wütenden Blick, fuhr herum und stapfte durch den lockeren Sand zu einem Felsen, auf den ich mich setzten konnte.
Es war zum Verzweifeln! Alles hatte so gut begonnen, trotz aller Schwierigkeiten! Nachdem es gelungen war, Monahseetahs Fluch von Sitting Bull zu nehmen, hatte die Drachenburg meines Lieblingsfeindes Necron scheinbar zum Greifen nahe vor uns gelegen!
Dreißig Meilen tief waren wir in diese verdammte Wüste vorgedrungen, geführt von Shadow, die mit ihren magischen Sinnen die genaue Position der Drachenburg zwar nicht erspüren, uns aber immerhin die Richtung weisen konnte, in der wir zu suchen hatten. Noch einen Tag, vielleicht zwei, und ich hätte Necron einen Überraschungsbesuch abstatten können, den er niemals vergessen würde.
Für wenige Stunden hatte ich sogar echte Hoffnung geschöpft. Eine El-o-hym, ich selbst und ein Sitting Bull, von dem ich jetzt wusste, dass er ein Magier wie ich war, nur ungleich mächtiger – wir zusammen hätten vielleicht sogar eine realistische Chance gehabt, Necron zu überwinden. Oder ihn wenigstens so lange hinzuhalten, bis ich Priscylla befreit hatte. Zum ersten Mal, seit ich diesen fast aussichtslosen Kampf aufgenommen hatte, waren die Karten zu meinen Gunsten verteilt gewesen.
Und dies alles war zunichte gemacht worden von etwas so Banalem wie einem Sandsturm! Ich hätte schreien können vor Wut.
Ich hörte Schritte, sah auf und erkannte Shadow, die es wie ich vorgezogen hatte, sich nicht an der aussichtslosen Sandbuddelei der anderen zu beteiligen, sondern die Kräfte lieber für den Rückweg aufzusparen. Sie lächelte, aber es wirkte sehr traurig. Ohne ein Wort ging sie vor mir in die Hocke, streckte die Hand aus und ergriff meine Finger. Die Berührung tat gut, und nach einem Moment des Zögerns griff ich zu und erwiderte ihren Händedruck.
»Du tust dir keinen Gefallen damit, wenn du jetzt verzweifelst«, sagte sie.
»Liest du schon wieder meine Gedanken?«, schnappte ich zornig. Mein gereizter Ton tat mir fast augenblicklich wieder leid, aber Shadow nahm meine Worte nicht übel.
»Nein«, sagte sie. »Aber das ist auch nicht nötig. Du siehst nicht gerade fröhlich aus.«
»Glaubst du, ich hätte Grund dazu?«, murmelte ich.
Shadow seufzte. »Natürlich nicht«, sagte sie. »Verzeih. Aber noch ist nichts verloren. Necron läuft dir nicht davon.«
»Wie beruhigend.«
Shadows schmale, wie mit feinen, weißen Strichen gezeichneten Brauen zogen sich zu einem unwilligen »V« zusammen. Mit einer fast groben Bewegung löste sie ihre Hand aus der meinen und stand auf.
»Es gibt zwei Möglichkeiten, Robert«, sagte sie. »Die eine ist, wir machen kehrt und versuchen die nächste Stadt zu erreichen, ehe uns die Sonne oder der Durst umbringen. Danach können wir in aller Ruhe einen Plan ausarbeiten, wie Necrons Rattenloch zu finden und zu nehmen ist. Du kannst natürlich auch hier bleiben und dir selbst leid tun, wenn du willst.«
Das wirkte. Shadow hatte ja Recht. Die Burg des Zauberers existierte seit Tausenden von Jahren, und Pri, meine geliebte Pri, die zu befreien ich hierhergekommen war, befand sich nun schon seit annähernd einem Jahr in Necrons Klauen. Ein paar Tage mehr oder weniger – was machte das schon?
Das jedenfalls war es, was mein Verstand mir sagte.
Mein Gefühl behauptete etwas anderes.
Jede Sekunde, die ich länger von Priscylla getrennt sein musste, bedeutete eine Ewigkeit der Qual für mich.
»Du liebst sie immer noch, nicht wahr?«, flüsterte Shadow.
Ich antwortete nicht, und auch Shadow schwieg eine ganze Weile. Schließlich ergriff sie abermals meine Hand, und diesmal war ihre Berührung viel sanfter und irgendwie tröstend.
»Ihr seid sonderbare Wesen, ihr Menschen«, murmelte sie. »Ihr vollbringt Dinge, die eigentlich unmöglich sind, wenn ihr um euer Leben kämpft. Und dann seid ihr bereit, das gleiche Leben eines Gefühles wegen zu opfern.«
Ich sah sie an. Ihre Worte klangen sonderbar. Ich wusste zwar, dass sich hinter der menschlichen Gestalt, die die El-o-hym angenommen hatte, ein Wesen verbarg, das auf seine Art vielleicht ebenso fremd und unverständlich war wie die GROSSEN ALTEN selbst. Und trotzdem spürte ich irgendwie, dass diese Worte nicht aufrichtig waren. Nicht, dass sie log. Aber es kam mir so vor, als versuchte Shadow sich mit ihren eigenen Worten über etwas hinwegzutäuschen. Etwas, vor dem sie panische Angst zu haben schien.
»Was ist das?«, fuhr sie fort. »Liebe?«
»Weißt du das wirklich nicht?«, antwortete ich, ebenso leise wie sie und ohne den Blick von ihren Augen zu nehmen. Der Ausdruck von Schrecken darin wurde größer. »Oder willst du es nur nicht wissen, Shadow?«
»Unsinn«, behauptete Shadow, aber das Wort kam viel zu schnell und eine Spur zu heftig, um noch überzeugend zu wirken, so wenig wie das, was sie danach sagte: »Liebe ist durch und durch ein menschliches Gefühl, Robert, und eure Gefühle sind mir fremd. Ich bin hier, weil ich eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen habe, aus keinem anderen Grund.«
»Und weil Hastur es dir befohlen hat, nicht wahr?«, fügte ich spöttisch hinzu. »Du belügst dich selbst, Shadow. Du bist viel zu lange Mensch gewesen, um nicht längst zu wissen, was menschliche Gefühle sind. Ihr El-o-hym mögt unglaublich mächtige Wesen sein, aber auch eure Seelen sind nicht unverwundbar.«
Shadow senkte den Blick. Sie schwieg. Hätte ich in diesem Moment auch nur geahnt, wie nahe ich mit meinen Worten der Wahrheit gekommen war, hätte ich den Mund gehalten. Aber so plapperte ich lustig weiter und drehte das Messer noch einmal genüsslich in der Wunde herum.
»Du kannst mich nicht täuschen, Shadow«, sagte ich. »Du hast längst Gefallen an dem Körper gefunden, in den du geschlüpft bist, und an dem Leben, das wir führen. Es ist verdammt kurz, verglichen mit dem, was dein Volk –«
»Hör auf!«, schrie Shadow. Plötzlich sprang sie in die Höhe, fuhr einen Schritt zurück, als hätte sie einen Schlag erhalten, und starrte mich beinahe hasserfüllt an. »Hör sofort auf, Robert«, sagte sie noch einmal, zwar nicht mehr so laut, aber in scharfem, unerklärlich aggressivem Ton.
»Warum?«, fragte ich beleidigt. »Bin ich der Wahrheit zu nahe gekommen?«
»Ja«, antwortete Shadow zornig. »Und ich danke dir dafür. Du hast mich vor einem schweren Fehler bewahrt, Robert Craven.«
Betroffen starrte ich sie an. Es war die Tatsache, dass sie meinen Namen in voller Länge aussprach, die mich begreifen ließ, wie sehr ich sie verletzt haben musste. Dieses so harmlos klingende Robert Craven riss in diesem Moment eine Kluft zwischen uns auf, die ich vielleicht nie wieder völlig würde schließen können.
»Ich … Es tut mir leid, Shadow«, sagte ich.
»Das braucht es nicht«, antwortete Shadow kalt. »Ich sagte es bereits – du hast mir einen Gefallen erwiesen. Ich danke dir.« Und damit wandte sie sich um und eilte mit weit ausgreifenden Schritten zu Buffalo Bill und den anderen hinüber.
Aber es vergingen selbst jetzt noch Augenblicke, bis mir klar wurde, dass ich es wieder einmal fertig gebracht hatte, einen der wenigen Menschen, die wirklich meine Freunde waren, gründlich zu verletzen.
Es wurde sehr still in dem großen, abgedunkelten Raum, nachdem Balestrano aufgehört hatte, mit seiner leisen, angenehmen Stimme zu erzählen. Sie waren allein. Balestrano hatte die Diener hinausgeschickt, sobald das Essen und der Wein aufgetragen worden waren, und sich anschließend noch einmal davon überzeugt, dass auch wirklich niemand vor der Tür stand und lauschte – etwas, das noch vor Tagesfrist schier unmöglich gewesen wäre, denn bis zu diesem schicksalsschweren Abend hatte der Begriff Misstrauen ebenso wenig zum Wortschatz der Tempelherren gehört wie die Worte Verrat und Brudermord. Jetzt, schlagartig, hatte sich alles geändert.
Reynaud de Maizieres war nicht sicher, ob er die wahre Tragweite des unglaublichen Geschehens bisher wirklich begriffen hatte. Dort unten, in den geheimen Kellern des Templerkapitels, war weit mehr geschehen, als das Aufbegehren einiger abtrünniger Brüder gegen ihn und Bruder Jean. Was er erlebt hatte, war das Ende eines Mythos; Häresie, wie sie schlimmer nicht vorstellbar war.
Zum ersten Mal seit Bestehen dieses Hauses, ja, seit Gründung des Ordens der Tempelherren hatten Brüder gegen Brüder gekämpft, hatte ein Templer die Hand und das Schwert gegen einen anderen Templer erhoben. Er selbst, Reynaud de Maizieres, hatte Träger der weißen Kutte erschlagen, und obwohl er keine Schuld daran trug und Bruder Balestrano ihm auf sein Bitten hin zwei Mal die Beichte abgenommen und ihn gesegnet hatte, fühlte er sich beschmutzt; besudelt auf eine Weise, die er nicht wieder würde gänzlich abwaschen können.
Aber schlimmer noch als dies alles war die vergangene Stunde gewesen. Balestrano und er waren nahezu gleichzeitig aus der Bewusstlosigkeit erwacht. Sie hatten den Stollen leer gefunden, de Laurecs Zelle verwaist, die Katakombe des Kristallgehirns beraubt. Die Verräter hatten selbst ihre Verwundeten mitgenommen. Mit letzter Kraft hatte de Maizieres sich und Bruder Balestrano nach oben geschleppt, die zahllosen Stufen der geheimen Treppe hinauf in den Teil des Kellers, in dem sie auf Hilfe hoffen konnten.
Was danach kam, verschwamm in Reynauds Erinnerungen. Sie waren gefunden und nach oben gebracht worden, wo sich Ärzte und gleich ein Dutzend Offiziere der Wachmannschaft um ihn und Balestrano gekümmert hatten. Ein paar Mal war er ohnmächtig geworden und das Nächste, woran er eine klare Erinnerung hatte, war der darauf folgende Morgen, als er in seinem Gelass im Westflügel des Kapitels erwacht war.
Jetzt war es beinahe Abend.
Natürlich hatte Reynaud de Maizieres sofort versucht, Kontakt mit Balestrano aufzunehmen, aber er war nicht einmal bis ins Vorzimmer des Tempelherren gekommen. Irgendetwas ging in dem riesigen Gebäudekomplex vor, etwas, das ihn über die Maße beunruhigte.
Männer kamen und gingen in großer Zahl, die meisten von ihnen hohe Würdenträger des Ordens, und obgleich Reynaud de Maizieres trotz hartnäckigen Fragens nicht einmal eine Andeutung zu hören bekam, fiel ihm doch eines auf: Manche von den Tempelrittern, die er sah, waren Männer, die Dienst in weit entfernten Ländern taten – in Amerika, Australien, Indien, Neukaledonien …
Und es war durch und durch unmöglich, dass sie innerhalb eines einzigen Tages den Weg nach Paris bewältigt haben sollten, nicht einmal mit dem schnellsten Schiff!
Aber er hatte sich gedulden müssen, bis es abermals dunkelte, ehe Balestrano ihn endlich zu sich rufen ließ. Der alte Mann trug einen Turban aus weißem Verbandsstoff, und seine Augen glänzten krank. Vielleicht war es auch Angst, die Reynaud in seinem Blick las.
Und dann, endlich, hatte Balestrano zu erzählen begonnen, und Reynaud de Maizieres hatte zugehört, über eine Stunde lang und mit ständig wachsendem Schrecken und Unglauben. Er erfuhr Dinge, von denen er niemals zu träumen gewagt hätte – Balestrano erzählte ihm die Geschichte Sarim de Laurecs und seines Zusammentreffens mit Robert Craven. Er erfuhr von Necron, dem Herrn der Drachenburg, und der unseligen Allianz, die der Templerorden mit ihm eingegangen war, von den GROSSEN ALTEN und ihren schrecklichen Dienern, die hundert Mal schlimmer waren als Satan und seine höllischen Heerscharen, vom Fluch des Labyrinths von Amsterdam und dem Kristallgehirn, das es beherrschte. Dies und noch viel mehr, sehr viel mehr.
Als Jean Balestrano mit seinem Bericht zu Ende gekommen war, wusste Reynaud de Maizieres, dass der Ausdruck in seinen Augen Angst war. Und er verstand ihn. Denn auch er spürte das gleiche, ungläubige Entsetzen, das er im Blick des alten Mannes gelesen hatte.
»Nun weißt du alles, Bruder Reynaud«, schloss Balestrano. »Du bist einer der Wenigen, die die ganze Wahrheit erfahren haben.« Er lächelte bitter. »Unser finsteres Geheimnis. Ich muss dir den Schwur abverlangen, es niemandem anzuvertrauen; und sollte dein Leben davon abhängen.«
Reynaud de Maizieres nickte. »Meine Lippen werden versiegelt sein«, sagte er und schlug das Kreuzzeichen.
Balestrano beugte sich vor und hob mit zitternden Fingern das Weinglas, um seine vom langen Sprechen trocken gewordenen Lippen zu befeuchten. »Aber ich habe dich nicht nur zu mir gebeten, um dir all dies zu erzählen«, fuhr er fort.
»Auch das ist mir klar, Bruder Jean«, sagte er. »Ich habe Augen. Ich sehe.«
Balestrano lächelte milde. Dann wurde er wieder ernst. »Du kennst nun die Macht des Kristallgehirns«, fuhr er fort. »Und die Gefahr ist jetzt weit größer als damals, als es in unsere Hände fiel. Dieses unselige Gebilde des Teufels, zusammen mit der Macht Robert Cravens und dem Wissen von Bruder de Laurec, das ist kaum vorstellbar. Wir müssen alles in unseren Kräften Stehende tun, es wieder in unsere Hände zu bekommen.«
»Und Sarim de Laurec und Robert Craven zu töten«, fügte Reynaud de Maizieres hinzu.
Balestrano schwieg einen Moment. Das Nicken, mit dem er Reynaud schließlich zustimmte, wirkte sehr mühsam. »Ja«, sagte er. »Ich fürchte, es gibt keine andere Wahl mehr. Was gestern geschehen ist, beweist, dass nicht einmal die Mauern unserer Kerker fest genug sind, dem Ansturm übler Magie zu trotzen. Diese beiden müssen sterben und das Kristallhirn muss wieder hierher gebracht werden. Diesmal wird niemand erfahren, wo ich es hinbringe. Und ich werde dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen.« Seine Augen wurden dunkel vor Sorge. »Ich habe gefehlt, Bruder Reynaud«, sagte er leise. »Was gestern hier geschehen ist, ist auch meine Schuld.«
»Unsinn«, protestierte Reynaud de Maizieres, aber Balestrano brachte ihn mit einer abrupten Geste zum Verstummen und sagte noch einmal:
»Ich bin schuld, Bruder Reynaud. Ich hätte das Kristallhirn zerstören sollen, gleich, wie hoch der Preis dafür gewesen wäre. Aber ich habe geglaubt, dass wir oder einer unserer Nachfolger sein Geheimnis ergründen und uns seine Kräfte nutzbar machen könnten. Ich wollte das Böse mit Kräften des Bösen bekämpfen und habe Böses dabei bewirkt.« Er schüttelte heftig den Kopf. »Nein«, sagte er. »Dieses unselige Ding muss vernichtet werden, ganz gleich, was es kostet.«
»Ich werde dir helfen, Bruder Jean«, sagte Reynaud de Maizieres impulsiv, aber wieder winkte Balestrano ab.
»Dir habe ich eine ganz andere Aufgabe zugedacht«, sagte er. »Du hast gesehen, dass ich die meisten unserer Brüder zu mir habe rufen lassen, sie von der Gefahr zu unterrichten, doch damit allein ist es nicht getan. Es müssen Boten in die Welt geschickt werden, um auch alle unsere Verbündeten zu warnen. Du wirst einer dieser Boten sein.«
Reynaud de Maizieres nickte. Er hatte halbwegs mit diesen Worten gerechnet, nach Balestranos komplizierter Einleitung. »Und wohin soll ich gehen?«, fragte er.
Balestrano zögerte einen winzigen Moment. »Ich … habe dich auserwählt, einen der schwersten Gänge zu tun«, sagte er stockend. »Du wirst zusammen mit einigen unserer Brüder nach Amerika gehen, um dort Necron, den Herrn der Drachenburg, zu unterrichten.«
»Den –« Reynaud de Maizieres fuhr auf, aber Balestrano brachte ihn zum dritten Mal mit einer befehlenden Geste zum Schweigen.
»Ich weiß, dass es dir widerstrebt, dorthin zu gehen und mit einem Mann zu sprechen, der sich Mächten und Wesenheiten bedient, die unsere Feinde sind«, sagte er streng. »Und auch ich habe lange gezögert, den unseligen Pakt zu erneuern. Doch wie es scheint, bleibt uns keine andere Wahl. Craven und de Laurec werden das Kristallhirn erwecken, und wenn es ihnen gelingt, werden wir jede Hilfe brauchen, die wir bekommen können.«
»Auch die des Teufels?«, entfuhr es Reynaud de Maizieres.
Balestrano starrte ihn erschrocken an, und auch Reynaud kam erst jetzt wirklich zu Bewusstsein, was er gerade gesagt hatte. Aber dann nickte Bruder Jean nur; der erwartete strenge Verweis blieb aus.





























