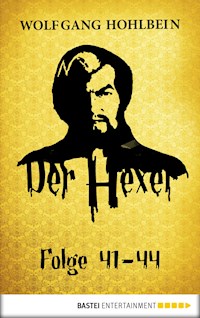
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Der Koloss von New York" - Folge 41 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Das Ding war fast hundert Yards hoch - ein Gigant aus Stahl und Kupfer und Stein. Es symbolisierte die Freiheit. Und es brachte den Tod. Denn mit der gewaltigen Statue war noch etwas anderes, unglaublich Fremdes nach New York gekommen; etwas, das sich nun zu regen begann, das seine unsichtbaren Klauen nach der Stadt ausstreckte. Und das auf der Suche war: nach einem Mann, den es töten musste. Nach einem jungen, zierlichen Mädchen, dessen Geist das Böse in sich trug. Nach einem Buch, dem es dienen konnte. Der Mann war Robert Craven. Das Mädchen war Priscylla. Und das Buch das NECRONOMICON...
"Wer die Götter erzürnt" - Folge 42 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Das Mysterium des Lebens. Wer es ergründet, der hat die macht über den Tod, über die Zeit. Vergangene Materie wird er erwecken und das Fleisch dem Verfall entreißen. Doch hüte dich, Menschengeschlecht! Es ist verboten seit ewigen Zeiten, sich an Schöpfung zu versuchen. Triumph wird sich wandeln in unendliche Pein, und das Weltengefüge wird erbeben zum Jüngsten Gericht. Ist das eherne Gesetzt der Götter gebrochen, werden die Pforten Nirwanas sich öffnen, und die Toten werden Rache nehmen an den Lebenden...
"»Stirb, Hexer!«" - Folge 43 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Das Gesicht war in der Mitte gespalten. Ein klaffender Riss zog sich von seiner Kinnspitze bis zum Mund, spaltete Unter- und Oberlippe, zerteilte die Nase in zwei säuberlich getrennte Hälften und erweitere sich über der Stirn zu einem fast handbreiten Dreieck, durch das man geradewegs in den Schädel des Mannes hineinblicken konnte. Aber darin war kein Gehirn. Keine mit Blut gefüllten Arterien und Venen, kein lebendes Fleisch. Im Kopf des Mannes war nichts als ein kompliziertes Sammelsurium aus Drähten, kleinen, vielfach durchbrochenen Scheiben und sich surrend drehenden Zahnrädchen.
"Die seelenlosen Killer" - Folge 44 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
"Er ist tot, Howard. Sie haben ihn umgebracht!" Die Augen des großen, rothaarigen Mannes waren verquollen von Tränen, sein Gesicht war rot und verzerrt und zu einer Grimasse geworden, über die er längst jede Kontrolle verloren hatte. "Er ist tot." Immer und immer wieder stammelte er diese Worte, begleitet von einem ruckhaften, schmerzerfüllten Schluchzen, dass seinen Körper wie eine Folge schrecklicher Krämpfe schüttelte. "Robert ist tot!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Der Koloss von New York
Der Hexer – Wer die Götter erzürnt
Der Hexer – »Stirb, Hexer!«
Der Hexer – Die seelenlosen KillerVorschau
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 41-44:
Der Hexer – Der Koloss von New York
Der Hexer – Wer die Götter erzürnt
Der Hexer – »Stirb, Hexer!«
Der Hexer – Die seelenlosen Killer
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 41–44
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1578-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 41-42
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 41 bis 42.
Viele von Ihnen werden erst durch die Hexer-E-Books Bekanntschaft mit den Abenteuern Robert Cravens geschlossen haben; andere kennen vielleicht die dicken Hexer-Taschenbücher aus dem Bastei-Verlag, in denen jedoch nur ein Teil der Hefte enthalten ist, wieder andere mögen noch die (in Sammlerkreisen mittlerweile recht wertvollen) Originalhefte besitzen oder die Sammelausgabe, weil Bücher nun mal viel besser im Schrank aussehen. Diese E-Book-Sammelausgabe hat es sich zum Ziel gesetzt, den Hexer in möglichst originalgetreuem Zustand zu präsentieren. Das bedeutet, dass – so weit irgendwie möglich – auf die noch nicht lektorierten Originalmanuskripte zurückgegriffen wird. Leider geht das nicht immer, viele sind mittlerweile längst verschollen.
Bereits sehr frühzeitig hat Wolfgang Hohlbein begonnen, seine Romane auf einem Computer zu schreiben, doch als die ersten Hexer-Bände entstanden, steckte dieser Markt noch in den Kinderschuhen. Gespeichert wurde damals noch auf 5¼-Zoll-Disketten, die ungefähr das Format einer CD hatten, aber lediglich 360 KB an Daten aufnehmen konnten und extrem empfindlich waren. Die Prozessoren waren so langsam, dass man bequem einen Spaziergang machen konnte, bis ein Text von Romanlänge neu formatiert war. Seither hat sich viel verändert. Betriebssysteme, die damals als das Nonplusultra galten, sind längst in Vergessenheit geraten, und immer neue Texterfassungsprogramme kamen und gingen – und waren leider nur bedingt kompatibel zu ihren Vorgängern, sodass man die Texte nicht einfach ins neue Format übernehmen konnte. Zusammen mit vielen im Laufe der Jahre einfach kaputt gegangenen Disketten einer der Hauptgründe, weshalb manche Manuskripte heute nicht mehr im Original existieren.
Allzu umfangreich aber waren die damals im Lektorat vorgenommenen Änderungen ohnehin nicht. Manche Beschreibungen mussten aus Gründen des zu dieser Zeit gerade bei Heftromanen sehr strengen Jugendschutzes entfernt werden, einige Scherze, mit denen der Autor sich und seinen Helden auf die Schippe nahm, wurden gestrichen, und manche Passagen gefielen einfach dem kritischen Auge des Redakteurs nicht.
Wenn sich jemand die Mühe macht, die Originalhefte mit den Buchtexten zu vergleichen, wird er jedoch feststellen, dass manchmal die Hefte sogar geringfügig länger waren. Vereinzelt wurden nämlich auch Passagen beim Lektorat hinzugefügt, die für diese Edition wieder gestrichen wurden. So drängte einer der drei Michaels beim Start der eigenen Serie darauf, dass Robert häufiger seine Magie einsetzen sollte, schließlich wäre er ein Hexer. Das führte dazu, dass einer der anderen Michaels, nämlich Michael Schönenbröcher, der Redakteur der Serie, eine Szene im ersten Band so ausschmückte, dass der in einem sich immer mehr erhitzenden Fluss treibende Robert in bester Superhelden-Manier mit magischer Kraft eine Art Schutzschirm um sich herum errichtete und schließlich sogar über dem Fluss zu schweben begann.
Als der Roman erschien und Wolfgang die entsprechende Stelle las, war er nicht weit von einem Tobsuchtsanfall entfernt, bei dem vermutlich selbst Rowlf Schwierigkeiten gehabt hätte, ihn zu bändigen. Wenn jemandem aufgefallen sein sollte, dass diese Edition von der im Heftroman abweicht, dies ist die Erklärung dafür.
Auch in diesem Buch gibt es eine Passage, für die Ähnliches gilt. Nach Kritik des Jugendschutzprüfers, der Hexer wäre zu brutal und es würden zu viele unschuldige Menschen sterben, hatte Michael die undankbare Aufgabe, daran etwas zu ändern. Als durch einen dämonischen Angriff Priscyllas Krankenschwester starb, fügte er eine Szene ein, in der Robert sie mit seiner Magie im Moment ihres Todes ins Leben zurückholt. Wenn die gute Frau in diesem Buch nun dennoch ihren verdienten Frieden findet, liegt das nicht an der Blutrünstigkeit des Bearbeiters, sondern daran, dass die »Rettung« im Originalmanuskript von Wolfgang nicht vorkam und zudem äußerst fragwürdig war. Würde Robert diese Fähigkeit besitzen, müsste man sich nämlich fragen, warum er sie nicht viel häufiger anwendet, vor allem, wenn ihm nahe stehende Menschen sterben. Warum hat er Shannon nicht auf diese Art gerettet? Warum nicht diesen und jenen? Wolfgang wusste schon, warum er Robert keine solche Macht verlieh. Die Streichung dieser Passage und einiger anderer dient also lediglich dazu, den weitaus sinnvolleren Originalzustand wiederherzustellen.
Auch in diesem E-Book begegnet Robert erneut einer Person der Zeitgeschichte, nämlich dem Schriftsteller Herman Melville. Wenn dieser Howard gegenüber flachst, sein Roman »Moby Dick« würde eines Tages ja vielleicht mal zu den Klassikern der Weltliteratur gehören, so wissen wir heute, dass dies tatsächlich geschehen ist. Zu Melvilles Lebenszeiten sah das jedoch anders aus. Er wurde am 1. 8. 1819 in New York geboren. Viele Jahre fuhr er zur See, unter anderem auf Walfangschiffen. 1844 kehrte er in die USA zurück und versuchte sein Glück als freier Schriftsteller. Nach einigen anfänglichen Erfolgen ließ sein Ruhm jedoch schnell nach. Gerade sein heute so berühmtes Buch um Kapitän Ahab und dessen Jagd nach dem weißen Wal erregte kaum Aufmerksamkeit, als es 1851 erschien. Erst lange nach Melvilles Tod am 28. 9. 1891 wurde es populär. Da die Schriftstellerei nicht ausreichte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, musste er sich mit anderen Jobs über Wasser halten. So arbeitete er, wie in diesem Buch beschrieben, von 1866 bis 1885 als Zollinspektor im Hafen von New York.
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 41Der Koloss von New York
Es war sehr dunkel. O’Connellys Karbidlampe warf einen schwankenden Kreis blasser Helligkeit auf das Kopfsteinpflaster, aber alles, was jenseits der flackernden Grenze lag, die im gleichen Tempo vorrückte wie der fast siebzigjährige Ire, schien dafür doppelt dunkel. Dabei, dachte O’Connelly missmutig, hätte es eigentlich recht hell sein müssen, denn wenn er dem Kalender – und dem Nörgeln seiner Frau, die in Vollmondnächten noch empfindlicher und grantiger wurde, als sie ohnehin schon war – glauben konnte, dann war Vollmond; und O’Connelly hatte keinen einzigen vernünftigen Grund, an einem von beiden zu zweifeln.
Was nichts daran änderte, dass es stockfinster war. Und das, obgleich sich am Himmel nicht die kleinste Wolke zeigte.
O’Connelly blieb stehen, setzte die Karbidlampe vorsichtig auf einen Mauervorsprung, rieb die Hände dicht vor dem Gesicht aneinander und blies hinein. Es war kalt, der Jahreszeit zum Trotz, und seine Finger waren klamm und taten ein wenig weh; aber das taten sie in letzter Zeit eigentlich immer. Die Gicht hatte ihn nach siebzig Jahren nun doch eingeholt und gönnte ihm schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was er in den letzten Jahren seines Lebens zu erwarten hatte.
Irgendwo auf der anderen Seite der massigen Reihe geduckter schwarzer Schatten, zu denen die Lagerschuppen in der Nacht zusammengeschmolzen waren, erscholl der klagende Ruf eines Nebelhorns, kurz darauf antwortete ein gleichartiger, aber sehr viel leiserer Laut vom offenen Meer her auf das Geräusch, und noch bevor es verklang, begann irgendwo in der Stadt eine Glocke zu schlagen. Eins … zwei … drei … O’Connelly zählte die Schläge aufmerksam mit, obwohl er erst vor einer halben Stunde auf seine Taschenuhr geblickt hatte und auch ohne sie ziemlich genau gewusst hätte, wie spät es war. Zwölf. Mitternacht. Der beinahe kahlköpfige Ire lächelte flüchtig in sich hinein und fügte in Gedanken das Wort Geisterstunde hinzu. Gleichzeitig huschte der Blick seiner trübe gewordenen Augen über die finsteren Silhouetten der Lagerschuppen, die sich auf der anderen Seite der Straße erhoben wie die Wehrmauer einer bizarren mittelalterlichen Burg.
Dahinter, nur noch als Schemen vor der Farbe der Nacht zu erahnen, reckten sich die Skelette der modernen Krananlagen in den Himmel, die die Docks in den letzten Jahren zu überwuchern begonnen hatten und unaufhörlich weiterwuchsen. Manche von ihnen sahen aus wie drohend erhobene Knochenhände. Ja, dachte O’Connelly spöttisch. Für jemanden, der romantisch – oder ängstlich – veranlagt war, mochte dieses Wort gerade in einer Umgebung wie dieser alles andere als beruhigend wirken. Und dazu kamen noch die Gerüchte, die sich in den letzten Monaten hartnäckig hielten und ihren Ursprung irgendwo in diesem Viertel hatten. Ja, man konnte schon anfangen, an Geister und ähnlichen Humbug zu glauben, hier an den Docks, wenn man das Mitternachtsschlagen hörte.
Was O’Connelly anging, hielt er nicht sehr viel von solcherlei Gerede – genau genommen gar nichts. Ganz genau genommen hielt er alle, die auch nur einen Furz auf Gerede von Geistern und sonderbaren Lauten gaben, für leicht bescheuert. Sicher – in den letzten Wochen hatten sich sonderbare Dinge hier getan, und auch O’Connelly hatte die Laute gehört, manchmal sogar eine Bewegung gesehen, ein Huschen in der Nacht, das immer gerade dann verschwand, wenn er genauer hinzusehen versuchte. Aber die sieben Jahrzehnte, die er jetzt auf dem Buckel hatte, hatten vielleicht seine Augen trübe und seine Schultern krumm werden lassen, und ihm die Gicht und Hämorrhoiden und noch einige andere Zipperlein beschert – sein gewohnt logisches Denken hatten sie nicht beeinträchtigt. O’Connelly maßte sich nicht an, eine Erklärung für all die sonderbaren Dinge zu finden, die in letzter Zeit hier vor sich gingen – aber das bedeutete nicht, dass es nicht eine gab. Ratten, zum Beispiel, oder eine der zahllosen Banden, die sich seit Bestehen des Hafens schon fast traditionell hier herumtrieben … es gab tausend mögliche Erklärungen, und jede einzelne davon war logischer als Geister.
Im Grunde war O’Connelly sogar ein wenig froh über diese Gerüchte, denn sie hatten es ihm ermöglicht, seinen Job zu behalten. Melville hatte ihn noch nie leiden können, und sie waren erst vor knapp drei Monaten derart aneinandergerasselt, dass Melville zum Schluss wutschnaubend gedroht hatte, ihn zu feuern und einen Jüngeren auf seinen Platz zu setzen. Aber dann waren die Gerüchte aufgekommen, und plötzlich waren keine jüngeren Männer mehr da gewesen, die sich für den Job als Nachtwächter interessierten. Für O’Connellys Dafürhalten waren sie alle beknackt – gottlob. Er hätte nicht gewusst, was er ohne die paar Dollars anfangen sollte, die er sich auf diese Weise dazuverdiente.
Nein, die einzigen Geister, vor denen sich O’Connelly fürchtete, waren verwahrloste Jugendliche und Strauchdiebe, die nachts in die Docks kamen, um zu schlafen oder ahnungslose Fremde auszurauben. Und für solcherlei Fälle trug er einen mit Sand gefüllten Lederbeutel in der Rocktasche. Der Letzte, der sich von seiner gebeugten Gestalt und seinem schütter gewordenen Haar hatte täuschen lassen, hatte seine Zähne vom Straßenpflaster aufgehoben, ehe er davongekrochen war. O’Connelly war eindeutig alt, aber er gehörte zu jener kleinen Gruppe von Alten, zu denen zum Beispiel gereizte alte Elefantenbullen gehörten; oder übellaunige Grizzlybären.
Er nahm seine Lampe wieder an sich, vergrub die linke Hand in der Tasche seiner groben, schwarzen Arbeitsjacke und schlurfte los. Genau drei Schritte weit. Dann blieb er wieder stehen, hob die Lampe ein wenig höher und lenkte den zittrigen Schein in die Schatten auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das kalkweiße Licht brannte einen Halbkreis in die Nacht, aber er sah nichts als schmutzigen, feucht glänzenden Stein, Unrat, der sich in Ecken und Winkeln angesammelt hatte, ein wenig Schimmel, Schatten, die hastig vor dem Licht flohen und kleine, zornige Pfiffe hören ließen …
Trotzdem blieb O’Connelly weiter reglos stehen, gebannt lauschend und die Augen zu schmalen Schlitzen zusammengepresst. Verdammt, er war sicher, etwas gehört zu haben; ein Geräusch, das nicht der Wind und nicht die Ratten verursacht haben konnten.
Aber sonderbarerweise war er auch sicher, dass es kein Mensch gewesen war …
O’Connelly wollte die Lampe gerade wieder senken und seinen Rundgang fortsetzen, als er den Laut erneut hörte. Und diesmal so deutlich, dass er erstens sicher war, sich nicht getäuscht zu haben, und zweitens auch die Richtung identifizieren konnte, aus der er kam. Seine freie Hand kroch in die Tasche und schloss sich um den improvisierten Totschläger darin.
Als er die Straße zur Hälfte überquert hatte, sah er die offen stehende Tür. Es war nur ein schmaler Spalt und jedem anderen wäre er wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Aber O’Connelly kannte jeden Fußbreit Boden, jeden Schatten und jeden Schmutzfleck auf diesen Wänden seit zwanzig Jahren. Für ihn war die angelehnte Tür wie ein Hinweisschild aus Leuchtfarbe.
Einen Moment lang zögerte der greise Nachtwächter doch, seinen Weg fortzusetzen. Er verspürte nicht direkt Angst, aber die offen stehende Tür – und vor allem das Wissen, dass sie bei seiner letzten Runde verschlossen gewesen war – ließ auch den letzten Gedanken an Gespenster und ähnlichen Firlefanz erlöschen. Gespenster pflegen keine Türen aufzubrechen, um in einen Lagerschuppen einzudringen.
Aber was sollte er tun? Zurückgehen und die Polizei rufen?
O’Connelly verwarf den Gedanken fast so schnell, wie er ihm gekommen war. Er würde eine halbe Stunde brauchen, das Büro der Hafenmeisterei zu erreichen, und noch einmal die gleiche Zeit, um zurückzukommen. Bis dahin waren die Vögel garantiert fort – und wahrscheinlich der Inhalt des Lagerhauses auch. Melville würde ihm mit Freuden die Hölle heiß machen, wenn während seiner Schicht auch nur das Geringste geschah. Und andererseits, dachte O’Connelly listig – er musste sich ja nicht mit den Burschen anlegen, die dort drinnen gerade ihre langen und vermutlich schmutzigen Finger ausstreckten. Es reichte, wenn er sie beobachtete und einem frustriert dreinblickenden Melville am nächsten Morgen eine genaue Beschreibung oder gleich die Täter präsentierte. In seiner Zeit als Nachtwächter hatte O’Connelly so ziemlich jeden Galgenvogel kennen gelernt, den es in diesem Teil New Yorks gab.
Behutsam setzte er seine Lampe auf den Boden, drehte das Licht herunter, bis nur noch ein blasser Schimmer übrig war, den drinnen im Schuppen garantiert niemand mehr sehen würde, und näherte sich auf Zehenspitzen der Tür. Wieder blieb er einen Moment stehen und lauschte gebannt, aber er hörte nichts, und so schob er die Tür vorsichtig auf, huschte in den Schuppen und mit einer für einen Mann seines Alters erstaunlichen Behändigkeit in die Deckung eines Kistenstapels.
Der Stapel war nicht der einzige. Der Schuppen hatte von außen klein ausgesehen, aber sein Inneres offenbarte sich als gigantischer Dom aus Holz, der schier bis zum Bersten mit Kisten und Ballen und Fässern vollgestopft war; in zwanzig Jahren war es O’Connelly nicht gelungen, eine zufrieden stellende Erklärung dafür zu finden, wie um alles in der Welt die Männer, die hier arbeiteten, die Übersicht in diesem Chaos behielten. Im Moment interessierte ihn diese Frage aber auch nicht sonderlich.
Seine ganze Aufmerksamkeit galt der Gestalt, die sich als verwaschener Schemen vor dem Hintergrund eines gewaltigen Segeltuchballens abzeichnete. Sie war nicht einmal sehr weit entfernt – zwanzig, fünfundzwanzig Schritte vielleicht, der halbe Durchmesser des Schuppens –, aber es war so dunkel hier drinnen, dass er sie eigentlich nur an ihren Bewegungen erkannte.
Und etwas an diesen Bewegungen war falsch.
O’Connelly konnte das Gefühl nicht in Worte kleiden, aber ganz plötzlich spürte er eine sonderbare Art von Beunruhigung, beinahe schon Furcht, die er noch nie zuvor im Leben kennen gelernt hatte. Einfach, weil die Bewegungen der Gestalt nicht stimmten. Sie waren sehr schnell, dabei aber unglaublich ruckhaft und auf schwer zu bestimmende Weise hart; fast … ja, dachte O’Connelly schaudernd, fast wie die eines menschengroßen Insektes.
Er verscheuchte den Gedanken, richtete sich vorsichtig hinter seiner improvisierten Deckung auf und versuchte die Dunkelheit mit Blicken zu durchdringen. Seine Augen gewöhnten sich langsam an das sehr schwache Licht, das nur durch ein paar Ritzen im Dach und zwei staubverkrustete Fenster in der gegenüberliegenden Wand hereinfiel. Soweit er erkennen konnte, war die Gestalt dort vorne allein.
Sie bewegte sich, wie sich ein Mensch – oder eben kein Mensch – bewegen mochte, der unruhig auf der Stelle trat und vielleicht auf jemanden wartete. Möglicherweise, flüsterte eine leise, böse Stimme in O’Connellys Gedanken, auf jemanden, der gleich durch die Tür kommen musste und ihm eins überbriet. Oder auf eine ganze Menge Jemander …
Auch diesen Gedanken dachte O’Connelly vorsichtshalber nicht zu Ende. Aber er begriff immerhin, dass er nicht mehr viel Zeit hatte, irgendetwas zu unternehmen.
O’Connelly zog seinen Totschläger aus der Tasche, versuchte sich die Stelle einzuprägen, an der die sonderbare Nicht-Gestalt stand, und huschte in seitlicher Richtung davon. Das Chaos, das in dem Lagerhaus herrschte, war nur ein scheinbares. Zwischen den Warenstapeln gab es zahllose Gänge und Wege, die tagsüber die Arbeiter hier benutzten. Jetzt dienten sie O’Connelly dazu, den Eindringling in weitem Bogen zu umgehen und sich ihm aus einer Richtung zu nähern, aus der er sicherlich keinen Besuch erwartete.
O’Connelly pirschte sich nahezu lautlos an die Gestalt heran. Sein Herz begann vor Aufregung zu rasen, als er den Schatten wieder vor sich sah, sehr viel näher diesmal, aber sonderbarerweise noch immer so undeutlich wie bisher, obwohl ihn nur noch wenige Schritte von ihm trennten. Aber er war jetzt eindeutig zu weit gegangen, um noch einen Rückzieher machen zu können. So tat er so ziemlich das Dümmste, was ein siebzigjähriger Mann mit Gicht und einem schwachen Herzen in dieser Situation überhaupt tun konnte – er hob seinen Lederbeutel, sprang mit einem Satz aus seiner Deckung und rief ein lautschallendes: »Halt!«
Die Gestalt reagierte ganz anders, als er erwartet hatte. Sie schrak nicht zusammen, fuhr nicht herum oder zauberte gar eine Waffe hervor – mit alledem hätte O’Connelly gerechnet, und auf all dies hätte er ausgezeichnet reagiert, wenn auch immer auf die gleiche Art: mit einem deftigen Hieb seines Totschlägers. Aber statt zu erschrecken, drehte sich die Gestalt ganz gemächlich herum, blickte einen Moment aus unsichtbaren Augen in O’Connellys Richtung und trat dann auf ihn zu; allerdings sehr langsam.
»Stehen bleiben!«, befahl O’Connelly noch einmal. »Zum Teufel, Bursche, wenn du noch einen Schritt machst, schlag ich dir die Nase bis an den Hinterkopf!«
Tatsächlich blieb die Gestalt stehen, und ihr Zögern gab O’Connelly ein bisschen von seinem verlorenen Mut zurück. Er streckte kampflustig das Kinn vor, wedelte drohend mit seinem Sandsack und trat seinerseits einen Schritt auf den Einbrecher zu.
Eine Sekunde später entrang sich ein keuchender, halb erstickter Laut seiner Brust, und eine weitere Sekunde später begann O’Connelly ernsthaft an seinem Verstand zu zweifeln.
Es war kein Einbrecher, sondern allerhöchstens eine Einbrecherin, denn die Gestalt war eine Frau. Eine zwei Meter große, in eine Art hellgrüne Toga gekleidete Frau, auf deren Kopf der lächerlichste Hut saß, den O’Connelly jemals gesehen hatte – ein Kranz aus dreieckigen Spitzen, wie ein höchst albern symbolisierter Strahlenkranz. In der rechten Hand trug sie etwas, das eine Fackel darstellen mochte – einen kurzen Stiel, darüber gewundene Flammen, die aber bestimmt nicht brannten, denn sie waren aus Kupfer.
Genau wie das Kleid der Frau.
Oder ihr seltsamer Hut.
Und sie selbst.
O’Connelly keuchte. In das lähmende Entsetzen, das sich in ihm breit gemacht hatte, mischte sich Angst, dann alles verdrängende Panik, als er begriff, was er da sah. Er stand einer Frau aus Metall gegenüber!
Und die bewegte sich …
O’Connelly erwachte endgültig aus seiner Erstarrung, mit einem gellenden, in der Kehle schmerzenden Schrei. Er fuhr herum, hieb noch in der Drehung mit seinem Sandsack nach der kupfernen Frau und registrierte mit dem kleinen, klar gebliebenen Teil seines Denkens, dass der Sack platzte und sein Inhalt in alle Richtungen davonspritzte. Gleichzeitig versuchte er mit einem verzweifelten Satz von der Schreckensgestalt davonzuspringen.
Es blieb bei dem Versuch.
Eine unmenschlich starke Hand aus hellgrün angelaufenem Kupfer griff nach seiner Schulter und hielt sie fest. O’Connelly kreischte, viel mehr vor Schrecken und Angst als vor Schmerz, obwohl er spürte, dass der Griff der Metallhand sein Schlüsselbein brach. Er wurde herumgewirbelt, prallte gegen einen Kistenstapel und stürzte schwer zu Boden. Seine rechte Schulter war gelähmt, der Arm taub und nutzlos. Verzweifelt versuchte er vor dem entsetzlichen Ding davonzukriechen, aber selbst wenn die Kisten nicht hinter ihm gewesen wären, wäre er nicht schnell genug gewesen.
Die Metallfrau beugte sich über ihn, zog ihn ohne spürbare Anstrengung auf die Füße. O’Connelly begann mit seiner unverletzten Hand auf das Gesicht der unmöglichen Gestalt einzuschlagen, erreichte aber damit nur, dass seine Knöchel aufplatzten. Das Blut auf dem bleichen Gesicht der Frau war sein eigenes. Und sie reagierte auch nicht auf seine Hiebe, sondern starrte ihn aus ihren kalten, kupfernen Augen an. O’Connelly sah keine Spur von Bosheit oder Hass in ihrem Blick, aber er sah auch kein anderes Gefühl darin. Die Metallfrau betrachtete ihn mit einer Art kühlem, wissenschaftlichem Interesse. So wie ein Mensch einen interessanten Käfer betrachten mochte.
Und in ihrem Blick war auch nicht die mindeste Regung zu erkennen, als sie die Fackel hob, die sie in der anderen Hand trug, und sie O’Connellys Gesicht näherte.
Und plötzlich begriff O’Connelly, dass er sich zumindest in einem Punkt geirrt hatte: als er glaubte, die Flamme aus Kupfer könne nicht brennen …
Zurück in der Wirklichkeit, kam sie mir beinahe unwirklicher vor als der Albtraum, der die letzten Wochen und Monate meines Lebens bestimmt hatte. Ich fühlte mich verloren, wie ein hilfloser Gefangener in einer Welt, die zu bunt und zu laut, zu hektisch und zu schillernd war, um wirklich real sein zu können, zwischen Menschen gepfercht, die das rechte Maß der Dinge verloren hatten und dabei waren, sich in einem pulsierenden, überschäumenden Leben selbst aufzuzehren.
Vom Fenster meiner Hotelsuite aus konnte ich die Straße aus großer Höhe überblicken: Die Menschen waren nicht mehr als winzige Ameisen, die mit ruckhaften Bewegungen auf den Gehsteigen und zwischen den Droschken und Fuhrwerken hin und her eilten. Was unten auf der Straße den Anschein von geregeltem Verkehr erwecken mochte, war aus der Höhe des fünfzehnten Stockwerkes betrachtet ein einziges Chaos. Die Hochhäuser, die das Stadtbild New Yorks in diesem Viertel bestimmten, erschienen mir wie finstere, ins Absurde vergrößerte Grabsteine, in denen das Leben erstarren musste.
Nein, dachte ich, ich befand mich nicht unbedingt in einer sonderlich frohen Gemütsverfassung – was auch nicht unbedingt verwunderlich war. Nach allem, was ich erlebt und durchgemacht hatte, hatte sich mein Bewusstsein eine kleine Depression verdient. Auch der Geist braucht manchmal Phasen, in denen er ausspannen kann. Vielleicht war die Mischung aus Niedergeschlagenheit und Aggressivität, mit der ich meine Umwelt seit gut anderthalb Wochen ungewollt terrorisierte, nichts anderes als ein seelischer Muskelkater.
Wir schrieben den 24. Juni 1886 und ich hielt mich somit schon annähernd zwei Wochen in New York auf, aber ich war mir, als ich vor dreizehn Tagen aus dem Zug stieg, nicht unbedingt wie der Sieger vorgekommen, der ich war. Sicher – ich hatte eine Schlacht gewonnen und meinen Erzfeind vernichtet – einen meiner Erzfeinde, um genau zu sein, denn an Menschen, die mir die Pest an den Hals wünschten, hatte ich wahrlich keinen Mangel –, aber der Preis, den ich dafür bezahlt hatte, war einfach zu hoch. Nein, ich hatte wahrlich keinen Grund zu triumphieren.
Der einzige Lichtblick in der finsteren Nacht aus Beinahe Katastrophen und Soeben-noch-mal-gut-gegangen-Seufzern war die kleine Karte, die mir der Page vor Stundenfrist auf einem Silbertablett gebracht hatte. Sie enthielt nur vier Worte: Erwarte mich um drei!, und eine Unterschrift, die noch unleserlicher war als gewohnt – aber ich wusste trotzdem sofort, wer der Absender war. Der Gestank von verbranntem Virginia-Tabak, der der Karte angehaftet hatte, war einfach unverkennbar. Der Schreiber konnte kein anderer sein als Howard.
Nicht, dass mich die Karte überrascht hätte – letztendlich war ich hierhergekommen, um ihn zu treffen. Aber ich hatte in den letzten vierzehn Tagen vergeblich nach ihm gesucht, und die Hoffnung, ihn und seinen poltrigen Leibdienerfreundkochkutscherrausschmeißer Rowlf noch einmal wiederzusehen, war mit jedem Tag, der verging, weiter gesunken. Genau genommen hätte es mich nicht einmal mehr sonderlich überrascht, wenn ich Howard niemals wiedergesehen hätte. Trotz meines scheinbaren Sieges hatte ich in den letzten Wochen und Monaten das Pech gepachtet. Und jeder, der irgendwie mit mir zu tun hatte, auch.
Ich schüttelte die finsteren Gedanken mit Macht ab, trat endlich vom Fenster zurück und blickte noch einmal auf die Standuhr, die eine Ecke meiner Suite zierte. Ich hatte noch Zeit, eine gute halbe Stunde, aber wenn ich noch länger hier in diesem Zimmer blieb, würde mir die Decke auf den Kopf fallen. So beschloss ich, hinunter in die Halle zu gehen und dort auf Howard und Rowlf zu warten; jedoch nicht, ohne vorher noch einmal einen Blick ins Nebenzimmer zu werfen.
Was ich sah, war dasselbe, was ich immer gesehen hatte, wenn ich in den letzten dreizehn Tagen diese Tür geöffnet und in den abgedunkelten Raum geblickt hatte – den schwachen Schimmer einer abgedeckten Gaslampe, ein sehr breites, mit kostbaren Seidendecken bezogenes Bett und darin ein sehr schmales, grau und krank aussehendes Mädchengesicht.
Priscylla schlief. Sie schlief jetzt fast immer. Mit unserem Eintreffen in New York schienen ihre Kräfte endgültig erschöpft zu sein. Sie lag da und schlief, öffnete nur manchmal die Augen – ohne jedoch irgendetwas von ihrer Umgebung wahrzunehmen oder wenigstens darauf zu reagieren – und das war alles. Das Buch lag neben ihr. Trotz aller Anstrengung war es mir nicht gelungen, das unheilige Band zu durchtrennen, das ihren Geist mit den Mächten dieses verfluchten Buches verband. Aber zumindest war sie nicht mehr gefährlich.
Wenigstens redete ich mir das ein …
Mrs. Peddigrew, die Krankenschwester, die ich engagiert hatte, blickte kurz von der Lektüre ihres Buches auf und lächelte pflichtschuldig, als sie mich erkannte. »Alles in Ordnung, Mr. Craven«, sagte sie im Flüsterton. »Sie schläft.«
Welch originelle Feststellung, dachte ich ärgerlich. Trotzdem rang ich mir ein flüchtiges Nicken ab. »Gut. Ich … bin für ein paar Stunden unten in der Halle zu erreichen. Schicken Sie einen Pagen, wenn sich irgendetwas verändert.«
Mrs. Peddigrews Gesichtsausdruck sagte mir sehr deutlich, was um alles in der Welt sich wohl bei einer vollkommen Geistesgestörten ändern sollte, die seit zwei Wochen in ihrem Bett lag und gefüttert und sauber gehalten werden musste wie ein kleines Kind. Aber sie sagte trotzdem: »Selbstverständlich, Mr. Craven. Ich werde aufpassen.« Bei dem Gehalt, das ich ihr für ihre Dienste zahlte, hatte ich ihr das auch geraten. Und bei dem kleinen Vermögen, das ich noch draufgelegt hatte, um auch ihr Stillschweigen zu erkaufen, erst recht.
Leise schloss ich die Tür, durchquerte mein Zimmer und trat auf den Flur hinaus. Die vornehme Ruhe teurer Hotels nahm mich in Empfang, als ich mich der Treppe näherte, und ein livrierter Diener huschte in eine Wandnische und versuchte, unsichtbar zu werden. Ich nickte ihm freundlich zu und bekam ein verlegenes Grinsen zur Antwort. Der Mann stand wie Mrs. Peddigrew weitaus mehr in meinen Diensten als in denen des Hotels. Wenn man es genau bedachte, hatte ich ohnehin so ungefähr das halbe Hotel gekauft. Die Summe, die ich ausgegeben hatte, um Leute zu bestechen und mir ihr Stillschweigen zu erkaufen, war schon nicht mehr lustig. Aber ich wollte verhindern, dass man anfing, sich in der Stadt Gedanken über einen sonderbaren jungen Mann mit einer noch sonderbareren weißen Haarsträhne zu machen, der zusammen mit einem geistesgestörten Mädchen in einem der teuersten Hotels der Stadt wohnte. So hatte ich kurzerhand die ganze Etage gemietet und jedem, der mich auch nur fragend ansah, das Maul gestopft. Mit Geld. Wenigstens bemühte ich mich, mir einzureden, dass es mir gelungen war.
Ich versuchte an erfreulichere Dinge zu denken und lief die Treppe hinunter, so schnell es gerade noch ging, ohne Aufsehen zu erregen. Ich war halbwegs außer Atem, als ich im Foyer anlangte; trotzdem fuhr ich, nachdem ich mich einen Moment lang vergeblich umgesehen hatte, noch einmal herum, lief ein paar Schritte die Treppe hinauf und hielt von dieser erhöhten Position aus Ausschau nach Howard und Rowlf.
Keine Spur – natürlich nicht. Es waren noch gute zwanzig Minuten bis zum vereinbarten Zeitpunkt und H.P. war einer der pünktlichsten Menschen, die ich kannte. Wenigstens war er es bis zu diesem Zeitpunkt gewesen. Denn ich hatte den Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, da wurde die Eingangstür unsanft aufgestoßen und ein als Mensch verkleideter Grizzlybär mit rotem Haar polterte herein, einen völlig konsternierten Türsteher am Kragen gepackt und vor sich hertragend. »Watt heiß hier, so kommsste nich rein, Freundchn?«, grölte eine mir wohl bekannte Stimme. »Wir sind verabredet mit einem von euren piekfeinen Gästen, wa! Und du wirst mir nich erzählen, dasse –«
»Rowlf!« Mein Schrei war so laut, dass für eine Sekunde jedermann in der Halle die Luft anzuhalten schien. Dutzende von Augen richteten sich auf mich, und mehr als eine Stirn legte sich missbilligend in Falten, dass ich es gewagt hatte, die heilige Ruhe dieser Hallen zu stören. Soviel zum Thema Unauffälligkeit.
Aber das war mir egal, im Moment zumindest, und eine Sekunde später richtete sich die allgemeine Aufmerksamkeit auch wieder auf Rowlf, der meinen Schrei mit einem mindestens drei Mal so lauten »Bob! Ich werd nich mehr!« beantwortete und mit Riesenschritten auf mich zuzulaufen begann.
Den unglückseligen Portier schien er dabei völlig vergessen zu haben, denn er schleifte ihn einfach mit sich, seine keuchenden Protestlaute ignorierend. Erst als er den Fuß der Treppe erreicht hatte, ließ er ihn los – er landete prompt auf dem Hinterteil und blieb vollkommen verwirrt sitzen. Eine Sekunde später lagen Rowlf und ich uns in den Armen, drückten und quetschten uns und schlugen uns lachend vor Freude auf die Schultern. Rowlf war gnädig genug, mir dabei nicht mehr als drei Rippen zu prellen.
»Mein Gott Rowlf, dass du da bist«, keuchte ich atemlos vor Freude, als er mich endlich wieder losließ. »Ich … ich hatte schon kaum mehr damit gerechnet, dich noch einmal zu sehen!«
Rowlf brabbelte eine Antwort, die ich in meiner Aufregung gar nicht verstand. Aber er schien mindestens ebenso erfreut zu sein wie ich, denn er schlug mir abermals auf die Schultern, dass ich in die Knie ging, und machte schon wieder Anstalten, mich zu umarmen. Diesmal wich ich seinem Griff aus. »Wo ist Howard?«, fragte ich aufgeregt. »Warum kommt er nicht herein? Wo …«
Ich sprach nicht weiter. Plötzlich war etwas in Rowlfs Blick, das meine Freude so abrupt abkühlte wie ein Eimer Eiswasser. Er lächelte noch immer, aber in seinen Augen stand ein dumpfer Schmerz, den er nicht vollends unterdrücken konnte.
»Was … ist geschehen?«, murmelte ich. »Wo ist Howard, Rowlf? Ist er hier? Lebt er? Ist er gesund?« Und plötzlich fiel mir noch mehr auf – ich hatte Rowlf eigentlich niemals gut oder gar elegant gekleidet erlebt, sodass es mir im ersten Moment nicht einmal aufgefallen war, aber jetzt konnte ich den Portier beinahe verstehen, der ihm den Eintritt verwehrt hatte.
Zu sagen, dass er in Lumpen gekleidet war, wäre geschmeichelt gewesen. Die Kleider, die er trug, waren nur noch Fetzen, und sie starrten vor Schmutz. Sein Gesicht war noch immer das breite, gutmütige Bulldoggengesicht Rowlfs, aber er schien um zehn Jahre gealtert, und unter seinen Augen lagen schwarze Tränensäcke. Seine Hände waren rissig geworden. Ein schmuddeliger Verband zog sich um sein linkes Handgelenk.
»Was ist passiert?«, fragte ich noch einmal.
Rowlf versuchte zu grinsen. »Siehste doch«, antwortete er. »’s geht uns nich besonders gut im Moment.« Er lachte, aber jetzt wirkte es eindeutig bitter. »Deine feinen Pinkel wollten uns ja nich’ma in ihr sauberes Hotel lassen.«
Ich wollte antworten, aber ich kam nicht dazu, denn in diesem Moment zupfte mich jemand sanft am Ärmel, und hinter mir erscholl jenes unnachahmliche Räuspern, zu dem nur Oberkellner in besonders teuren Restaurants oder Hotelangestellte der höheren Preisklasse fähig waren.
Im Moment war es der Direktor des Hilton-Hotels selbst, der hinter mir Aufstellung genommen hatte und mich eindeutig missbilligend ansah. Die Blicke, mit denen er Rowlf maß, wollte ich zu seinen Gunsten lieber nicht deuten.
»Sir«, sagte er. »Gehört dieses –« Er blickte zu Rowlf hoch und sträubte kampflustig seinen Schnauzbart, »– dieses Individuum zu Ihren Bekannten?«
»Äh?«, fragte Rowlf.
»Er ist ein Freund von mir, ja«, sagte ich hastig, um mein Budget nicht auch noch mit den Kosten für einen Schönheitschirurgen belasten zu müssen. »Ich bitte Sie, stören Sie sich nicht an seinem etwas sonderbaren Aussehen. Er –«
»Mister Craven«, unterbrach mich der Hoteldirektor. »Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber es gibt Grenzen.«
»Ach?«, fragte ich böse. »Wie hoch sind sie?«
Ich hatte einen Fehler begangen, aber das bemerkte ich erst, als es in den Augen des schnauzbärtigen Zwerges wütend aufblitzte. »Zu hoch«, sagte er zornig. »Selbst für Sie, fürchte ich.« Er stieß einen dürren Zeigefinger wie einen Dolch in Rowlfs Richtung. »Dieser Mensch wird mein Hotel nicht betreten. Nicht, solange ich hier die Direktion vertrete.«
Für einen Moment hatte ich allen Ernstes Lust, das Hotel zu kaufen, nur um den Kerl rausschmeißen zu können. Aber nur für einen Moment. Dann sah ich ein, dass ich nur noch mehr Aufsehen erregen würde, wenn ich den Streit fortsetzte, und nickte mit gespielter Zerknirschung. »Natürlich«, sagte ich. »Es … tut mir leid. Verzeihen Sie.« Dann wandte ich mich an Rowlf. »Bring mich zu Howard. Wir können draußen reden.«
Rowlf nickte. Auch er war sichtlich erleichtert, den Streit nicht fortsetzen zu müssen – etwas, das so gar nicht zu dem Rowlf passte, den ich kannte.
So schnell wir konnten, verließen wir das Hotel und traten auf die Straße hinaus. Ich hatte erwartet, Howard irgendwo auf dem Trottoir vor dem Eingang anzutreffen, aber Rowlf deutete auf eine schmale Gasse auf der anderen Seite der Straße und eilte vor mir her, ohne auf den dichten Verkehr zu achten. Ich folgte ihm – wobei ich fast von einem Pferdefuhrwerk überrollt wurde – und hetzte hinter Rowlf in die Gasse.
Im ersten Moment erkannte ich nur einen Schatten. Dann trat er auf mich zu, und sein Gesicht kam ins Sonnenlicht, und ich erkannte Howard. Und mein erfreuter Ausruf blieb mir im wahrsten Sinne des Wortes im Halse stecken.
Es war Howard, obgleich ich im allerersten Moment selbst daran zweifelte – aber wie hatte er sich verändert!
Howard war schon immer sehr schlank gewesen, ein asketisch wirkender Mann, der jedoch pedantisch auf sein Äußeres achtgab. Jetzt wirkte er wie eine um zweihundert Pfund leichtere Version Rowlfs.
Sein Gesicht war so eingefallen, dass es einem Totenschädel glich. Die Augen darin blickten mich mit müdem Schmerz an, und seine Haut hatte einen krankhaften, wächsernen Schimmer. Er hatte Fieber, das war unübersehbar. Seine Hände, auf die er immer besonders geachtet hatte, waren blutig von schwerer Arbeit und dunkel von Schmutz, der sich zu tief hineingegraben hatte, um sich noch herunterwaschen zu lassen. Seine Kleider bestanden aus Fetzen.
»Mein Gott, Howard, was … was ist geschehen?«, stammelte ich.
Howard lächelte. »Hat Rowlf dir das nicht erzählt?«
Ich schüttelte den Kopf und blickte hilflos von Rowlf zu Howard und wieder zurück.
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte Howard mit einem traurigen, sehr schwach klingenden Seufzer. »Ich erzähle sie dir gerne. Aber vorher …« Er stockte. Plötzlich wirkte sein Lächeln verlegen. »Ich hätte eine Bitte.«
»Welche?«
»Wäre es dir möglich, Rowlf und mich zu einer heißen Suppe einzuladen?«, fragte er. Und noch während ich ihn mit offenem Mund anstarrte, klaubte er einen zerknautschten Zigarrenstummel aus dem Hemd, der seinem Aussehen nach mindestens schon ein dutzend Mal angeraucht und immer wieder säuberlich gelöscht worden war, und lächelte noch ein wenig breiter. »Und vielleicht zu einer Zigarre?«, fügte er schüchtern hinzu.
Nebel war aufgekommen, obwohl gar nicht für die Jahreszeit üblich, und es war viel zu kalt. Die beiden Sturmlaternen, die Straub vorsichtshalber an Bug und Heck des kleinen Hafenkutters aufgehängt hatte, waren nur noch als verschwommenes gelbes Blinzeln in unbestimmbarer Entfernung zu erkennen, und die grauen Schwaden, die sich beharrlich über das niedrige Deck des Bootes wälzten, tränkten alles mit kalter, klammer Feuchtigkeit.
Straub schauderte, zog den Kragen seiner Jacke enger zusammen und nippte an seinem Tee. Nicht einmal das beinahe noch kochende Getränk vermochte die Kälte wirklich aus seinem Inneren zu vertreiben. Und die Nervosität schon gar nicht.
Das Schlimme war, dass Straub nicht einmal wusste, warum er nervös war. Es gab keinen Grund dazu. Solange der Nebel nicht aufriss, lag das Boot sicher vertäut am Kai, und die beiden Lampen dienten nur seiner eigenen Beruhigung – keines der großen Schiffe würde sich bei derartig schlechten Sichtverhältnissen auch nur einen Inch von der Stelle rühren. Eigentlich hätte er allen Grund gehabt, sich auf eine zwar langweilige, aber nichtsdestotrotz geruhsame und vor allem bezahlte Freischicht zu freuen.
Aber irgendetwas beunruhigte ihn; ein sonderbares Kribbeln, wie die Ahnung von etwas Kommendem.
Straub runzelte die Stirn, verwirrt und gleichzeitig ein bisschen erschrocken über seine eigenen, abwegigen Gedanken, nippte abermals an seinem Tee und kippte nach kurzem Zögern einen kräftigen Schuss geschmuggelten Whisky in die Tasse. Danach schmeckte das Getränk schon weitaus besser. Wenn es auch seine Nervosität nicht merklich dämpfte.
Draußen auf dem Schiff polterte etwas.
Straub blickte misstrauisch auf, stellte sich auf die Zehenspitzen, um das Vorderdeck von seiner Position hinter dem festgestellten Ruder besser übersehen zu können, und versuchte die grauen Schwaden mit Blicken zu durchdringen. Aber er sah nichts außer Nebel und dem Licht der Lampe und noch mehr Nebel, der ihm Bewegung vorgaukelte, wo keine war.
Das Poltern wiederholte sich.
Behutsam stellte Straub die Tasse mit dem brühheißen Getränk ab, zog die Schultern zusammen und trat schaudernd in die Kälte hinaus, die auf dem ungeschützten Vorderdeck des kleinen Schiffes herrschte. Nebel hüllte ihn ein wie Millionen körperloser grauer Hände, und die Kälte begann sofort durch seine Kleider zu kriechen. Er spürte erst jetzt, wie warm es trotz allem noch im Ruderhaus gewesen und wie kalt es hier war.
Und das Geräusch wiederholte sich nicht. Eigentlich mehr als Grund genug, überlegte Straub, in sein Ruderhaus zurückzukehren und dort den Rest der Nacht dem Nebel und einigen Tassen heißem Whisky mit Tee zu überlassen – in genau diesem Verhältnis.
So wandte er sich wieder um und ging zum Ruderhaus zurück, blieb aber noch einmal stehen, als eine Windböe das brackige Wasser des New Yorker Hafens kräuselte und die Nebelfetzen auseinandertrieb. Für einen Moment konnte er einen gigantischen, in der Nacht schwarz erscheinenden Umriss vor dem Meer erkennen, einen Koloss von so ungeheuerlicher Größe, dass selbst Straub, der jede Phase seiner Errichtung in allen Einzelheiten mitverfolgt hatte und sogar ein paar Mal drüben auf Liberty Island gewesen war, von seinen Dimensionen noch immer beeindruckt war. Die Freiheitsstatue … Ja, dachte er, dieser Name war passend. Irgendwie erschien ihm die titanische kupferne Frau als das passendste Symbol für das Wort Freiheit, was man sich nur denken konnte.
Hinter ihm polterte etwas auf das Deck, und es war ein Geräusch, das so laut und hart und sonderbar metallisch war, dass Straub trotz des eisigen Schreckens, der ihn durchfuhr, eine Sekunde lang wie gelähmt stehen blieb, ehe er überhaupt den Mut aufbrachte, sich herumzudrehen.
Und als er es dann tat, wünschte er sich sehnlichst es nicht getan zu haben.
Hinter ihm stand die Freiheitsstatue.
Es war völlig unmöglich, und wahrscheinlich träumte er oder hatte zu viel Whisky getrunken oder eins über den Schädel gekriegt und lag im Hospital oder im Irrenhaus und phantasierte vor sich hin, dachte er mit mehr als nur beginnender Hysterie – aber hinter ihm stand die Freiheitsstatue!
Sie war nur zwei Meter groß, und ihr Körper glänzte in einem unheimlichen, mattgrünen Licht, aber es war eine perfekte Kopie der gigantischen Metallfrau auf Liberty Island.
Und sie bewegte sich!!!
Straub wich mit einem krächzenden Schrei zurück, als die Gestalt einen Arm ausstreckte und auf ihn zutrat. Die Planken ächzten unter ihrem Gewicht, und in den bisher ausdruckslosen Augen der kupfernen Lady glomm ein düsteres, böses Feuer auf. Straub spürte die Berührung eiskalter, metallener Finger, sprang instinktiv erneut zurück und fiel rücklings auf die kurze Treppe, die zum Ruderhaus hinaufführte.
Der Sturz rettete ihm das Leben.
Wenigstens für einen Moment.
Die Pranke des eisernen Monsters schloss sich mit einem hörbaren Knirschen dort, wo sein Kopf gewesen wäre, wäre er nicht gestürzt. Straub kreischte, kroch blind vor Angst rückwärts die Treppe hinauf und trat nach der Gestalt.
Ebenso gut hätte er versuchen können, die wirkliche Freiheitsstatue mit einem Tritt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein dumpfer, hallender Schlag erklang, und eine Sekunde später schoss ein entsetzlicher Schmerz durch seinen Knöchel. Straub wimmerte vor Angst, kroch weiter und kam irgendwie ins Ruderhaus und auf die Füße. Die Angst lähmte sein Denken, aber er handelte rein instinktiv, warf die Tür zu und stemmte sich mit der Schulter dagegen.
Einen Augenblick später zerbarst die Tür dicht neben seinem Kopf. Eine grün leuchtende Klaue griff herein und suchte blind nach ihrem Opfer. Straub torkelte zurück, prallte gegen das Ruder und sah aus ungläubig aufgerissenen Augen, wie die Tür von einer fast spielerischen Bewegung des Metallarmes vollends zermalmt und aus den Angeln gerissen wurde. Ein grotesker, mattgrüner Umriss erschien unter der Öffnung. Grausame Augen starrten auf Straub herab. Langsam trat die entsetzliche Gestalt in das Ruderhaus, streckte die Hand nach ihm aus und zögerte noch einmal, ihn zu packen, so als wüsste sie noch nicht so recht, was sie mit ihm anfangen sollte. Dann senkte sich die geöffnete Klaue wieder und stattdessen hob die lebende Statue die andere Hand, in der sie eine metallene Fackel hielt; ganz wie ihr großes Vorbild. Aber mit einem Male war sie nicht mehr aus Kupfer, sondern ganz real. Und sie brannte auch ganz real. Die feuchte Kälte wich von einer Sekunde auf die andere stickiger Wärme und dem Zucken blutig roter Lichtreflexe. Ein Teil des Ruders, neben dem die Kupferfrau stand, begann zu brennen. Kleine, weiß glühende Funken sprühten von der Fackel auf den Boden und setzten auch ihn in Brand.
Straub wich vor der entsetzlichen Gestalt zurück, so weit er konnte. Seine Hände tasteten blind umher und bekamen die Whiskyflasche zu fassen. Eine Sekunde lang überlegte er, sie der Gestalt über den Schädel zu schmettern, dann fuhr er herum und schleuderte sie stattdessen durch das Fenster. Die Scheibe zerbarst klirrend. Kälte und Nebel und Feuchtigkeit fauchten herein, bliesen die Flammen zu höherer Glut an und ließen die Fackel in der Hand der Statue zischen.
Straub sprang. Glassplitter schnitten schmerzhaft durch seine Jacke und in die Hände, die er schützend vor das Gesicht gehoben hatte, und seine Rippen prallten unsanft gegen den Fensterrahmen. Er fiel, rollte ungeschickt auf dem Deck ab und prallte so heftig mit dem Schädel auf, dass er für einen Moment benommen liegen blieb.
Aber der Schrecken hatte noch kein Ende. Wie durch einen seidenen Vorhang hindurch beobachtete Straub, wie das Ruderhaus hinter ihm zu brennen begann, viel schneller, als normal gewesen wäre, dann wurde das zerborstene Fenster mit einem schmetternden Schlag vollends nach außen gedrückt; ein Teil des brennenden Ruders krachte dicht neben Straub zu Boden und rollte wie ein Feuerrad davon, brennende Holztrümmer regneten auf die Planken, und eine entsetzliche, grün leuchtende Gestalt trat aus dem Chaos hervor, ihre Fackel schwenkend und die andere Hand gierig nach ihm ausgestreckt.
Straub sprang kreischend hoch, stolperte abermals und hechtete noch im Fallen nach der Reling. Der Sturz war zu kurz; er prallte mit Brust und Oberkörper gegen das harte Holz, sank halb betäubt zurück und rollte rein instinktiv herum. Eine metallene, zur Faust geballte Hand fuhr krachend neben ihm durch die Planken, dann stieß etwas Glühendes, unglaublich Heißes nach seinem Gesicht, verfehlte es und hinterließ eine brennende Spur aus Schmerz auf seiner Wange. Straub sprang, wie von Sinnen schreiend und um sich schlagend, auf die Füße, taumelte rücklings gegen die Reling und spürte, wie sich eine kalte Hand um seine Schulter schloss.
Das Entsetzen gab ihm übermenschliche Kräfte. Blindlings hieb er mit den Fäusten auf das Eisengesicht vor sich ein, warf sich abermals zurück und kam tatsächlich frei.
Aber sein eigener Schwung hatte ihn zu weit nach hinten getragen. Die Reling traf ihn mit der Wucht eines Hammerschlages in die Nieren; Straub keuchte vor Schmerz, kippte mit rudernden Armen nach hinten und fiel über Bord. Aber noch bevor er auf dem Wasser aufschlug und versank, sah er, wie auch seine unheimliche Verfolgerin, durch die abrupte Bewegung offenbar ebenso aus dem Gleichgewicht gebracht, nach vorne kippte, gegen die Reling fiel und sie mit ihrem Körpergewicht zerschmetterte.
Die lebende Doppelgängerin der Freiheitsstatue klatschte wie ein vom Himmel stürzender Felsen dicht neben Straub ins Wasser.
Und sank auch ebenso rasch.
»Das hat gutgetan!« Rowlf schlug sich mit beiden Händen auf den Magen, grinste zufrieden und ließ einen Rülpser hören, der einem Grizzly die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte. Den Ober, der steif wie ein Brett drei Schritte hinter unserem Tisch stand und seit mehr als zwei Stunden vergeblich versuchte, seine Fassung zu bewahren, trieb er etwas ganz anderes in die Augen – nämlich die Tränen –, und ich warf Rowlf einen mahnenden Blick zu, den er allerdings nur mit einem neuerlichen Grinsen quittierte.
Unter normalen Umständen hätte es mir wahrscheinlich sogar Spaß gemacht, dem Spielchen zuzusehen, aber wir erregten auch so schon mehr als genug Aufsehen – das Lokal, in das ich Howard und Rowlf geführt hatte, gehörte entschieden nicht zu der Preisklasse meines Hotels, aber auch ebenso entschieden nicht zu der, in der Männer von Rowlfs und Howards gegenwärtigem Aussehen zu speisen pflegten. Die missbilligenden Blicke, mit denen uns das Personal und ein kleines, schnauzbärtiges Wiesel, das wohl der Geschäftsführer sein musste, maßen, sprachen Bände.
Ich entschuldigte mich bei dem geplagten Oberkellner mit einem Lächeln, das das Versprechen auf ein großes Trinkgeld enthielt, wandte mich wieder an Howard und Rowlf und griff nach meinem Glas, trank aber nicht. Wir saßen seit gut zwei Stunden hier, und der Sherry, der in dem Glas in meiner Hand glitzerte, war der siebente oder achte. Ich war nicht betrunken, aber meine Zunge begann bereits schwer zu werden und meine Gedanken liefen nicht mehr ganz so schnell wie gewohnt. Ich musste vorsichtig sein. So stellte ich den Sherry zurück und beauftragte den Ober stattdessen, mir ein Glas Orangeade zu bringen. Howard und Rowlf hatten die Zeit größtenteils damit zugebracht, einen Gang nach dem anderen in sich hineinzustopfen, und ich hatte währenddessen beinahe ununterbrochen geredet, denn Howard hatte sehr deutlich gemacht, dass zuerst ich über meine Abenteuer zu berichten hätte. Und so hatte ich ihm alles erzählt, was in den vergangenen zehn Bänden geschehen war, bis hin zu unserem Abschied von Sitting Bull, der sich entschlossen hatte, Cody doch nicht auf der Europatour zu begleiten, sondern zu seinem Stamm zurückzukehren und mit seinen Göttern eins zu werden – was immer er darunter verstand –, und Buffalo Bills, Annies, Priscyllas und meiner Rückreise mit der Bahn hierher.
Bei der Erwähnung des Namens Cody sah Howard neugierig auf. »Bill Cody?«, vergewisserte er sich. »Der berühmte Buffalo Bill ist hier in New York?«
Ich nickte voller Entdeckerstolz. »Willst du ihn kennen lernen?«, fragte ich. »Ich bringe dich zu ihm. Aber erst«, fügte ich mit einem missbilligenden Blick auf seine und Rowlfs Kleidung hinzu, »besuchen wir einen anständigen Schneider.«
Howard lächelte gequält, sog tief an seiner Zigarre und blickte an sich herab. »Unsere Kleidung entspricht in der Tat nicht unbedingt dem Standard, den ich gewohnt bin und schätze«, erklärte er umständlich. Und damit waren wir beim Thema. Howard hatte es bisher geschafft, alle meine diesbezüglichen Fragen mit fast unglaublichem Geschick abzublocken, aber jetzt würde ich mich nicht mehr mit Ausflüchten zufriedengeben.
»Was ist passiert, Howard?«, fragte ich. »Wo wart ihr die ganzen Wochen und wieso … seht ihr so aus?«
Howard lächelte unglücklich, tauschte einen raschen Blick mit Rowlf und blies eine Wolke blaugrauen Qualms in meine Richtung. Ich hustete demonstrativ, was er ebenso demonstrativ überhörte. »Ich musste mich für eine Welle zurückziehen, um meine … Kräfte zu regenerieren«, erklärte er geheimnisvoll. »Und jetzt frag mich bitte nicht, wohin und wozu – ich dürfte es dir nicht einmal sagen, wenn ich es wollte.«
»Aber du willst es auch nicht.«
Howard lächelte. »Nein«, erklärte er. »Ganz davon abgesehen, dass ich es nicht kann. Aber es war nötig. Ich wäre gestorben, hätte ich es nicht getan«, fügte er mit großem Ernst hinzu und dann, noch leiser: »Und auch so beinahe.«
»Und dann?«, fragte ich nach einer Weile. »Was ist geschehen?«
Howard druckste herum, sog wieder an seiner Zigarre und versteckte sich hinter Qualmwolken. »Wir hatten … Pech«, erklärte er zögernd. »Nach unserer Rückkehr von jenem Ort, über den ich zu schweigen geschworen habe, hat etwas nicht so geklappt, wie ich hoffte.«
»Das sieht man«, sagte ich. »Was?«
»Wir sind pleite«, erklärte Rowlf gerade heraus.
Howard lächelte. »Ich hätte es etwas anders ausgedrückt«, sagte er, »aber es trifft den Kern der Sache ziemlich gut, fürchte ich. Wir erreichten New York, wie ich es geplant habe, aber wir fanden uns leider vollkommen mittellos.«
»Wenn das alles ist«, sagte ich, beinahe erleichtert. »Ich helfe dir gerne mit ein paar Pfund aus.«
Howard seufzte. »Das ist leider nicht alles«, gestand er. »Geld wäre das kleinere Problem, mein Junge. Wir können arbeiten und Rowlf mit seinen Bärenkräften und ich mit meiner nicht unbedingt geringen Intelligenz hätten wohl innerhalb weniger Wochen die nötige Barschaft zusammengehabt, die nötigen Schritte zu unternehmen. Aber das größere Problem sind unsere Papiere.«
Diesmal verstand ich nicht ganz.
»Wir kamen nicht nur ohne Geld hier an«, erklärte Howard, »sondern gewissermaßen ohne alles. Unter anderem sind wir auch unserer gesamten persönlichen Papiere verlustig gegangen.«
»Seid ihr unter die Straßenräuber gefallen?«, fragte ich in einem schwachen Versuch, einen Scherz zu machen.
»Man könnte es wohl eher eine temporal-materiell differierende Materialisations-Dissonanz nennen«, antwortete Howard. »Aber … gut, es waren eine Art Räuber.«
Ich starrte ihn an.
»Auf jeen Fall simmer pleite«, grummelte Rowlf. »Un Arbeit is nich ohne Papiere, Jungchen. Außer als Tagelöhner Kohle schaufeln un so’n Kram. Un immer auffer Flucht vor’n Cops.«
»Papiere«, murmelte ich, noch immer darum bemüht, den Knoten aus meinen Gehirnwindungen zu bekommen, den ich mir eingehandelt hatte, als ich versuchte, Howards Erklärung zu verstehen. »Das ist ein Problem«, gestand ich schließlich. »Aber kein unlösbares. Gebt mir ein paar Tage Zeit, und ich besorge euch Pässe.«
Howard blieb skeptisch. »Hast du Verbindungen zu den hiesigen Behörden?«, fragte er zweifelnd.
»Eher im Gegenteil«, erwiderte ich feixend. »Aber ich beschaffe euch Papiere, die so falsch sind, dass sie schon wieder echt sind.«
Rowlf kicherte, aber Howards Stirnrunzeln vertiefte sich eher noch. »Das gefällt mir nicht«, sagte er. »Ich habe selbst mit dem Gedanken gespielt, aber es ist riskant, mit Kriminellen Geschäfte zu machen.«
»Vor allm, wemma se nich bezahln kann«, stimmte Rowlf zu.
»Für mich nicht«, behauptete ich. »Hast du vergessen, wo ich aufgewachsen bin, Howard? Eine ganze Menge meiner alten Freunde müssen noch hier sein. Gib mir ein paar Tage. In der Zwischenzeit wohnt ihr bei mir im Hotel.«
»Wenn du Platz hast …«
»Ich habe eine ganze Etage gemietet«, erklärte ich und fügte, durch Howards vorwurfsvollen Blick sofort wieder in die Defensive gedrängt, hinzu: »Nicht aus Angeberei, Howard: Priscylla ist bei mir. Ich wollte neugierige Fragen vermeiden.«
»Indem du mit Geld um dich wirfst?« Howard schüttelte den Kopf. »Damit erreichst du eher das Gegenteil.«
»Und wenn«, sagte ich gereizt. »Unser Schiff geht in einer Woche. Danach können sie sich das Maul zerreißen, so viel sie wollen. Wenn Priscylla und ich erst einmal in England sind, stört es mich herzlich wenig, was man in New York von mir denkt.«
»Wie geht es ihr überhaupt?«, fragte Howard.
»Priscylla?« Ich seufzte, zuckte mit den Achseln und gewann einige weitere kostbare Sekunden damit, meine Orangeade zu leeren und nach der Rechnung zu verlangen. »Nicht besonders gut, fürchte ich«, gestand ich schließlich … »Eigentlich unverändert.«
»Aber du willst sie trotzdem mit dir nehmen.« Der leise Vorwurf in Howards Stimme war nicht zu überhören. Er schüttelte den Kopf.
»Warum nicht?«, fragte ich zornig. »Necron ist tot, und mit diesem verdammten Buch werde ich auch noch fertig. Wenn ich Zeit und Ruhe habe, wird es mir schon irgendwie gelingen, Priscyllas Geist von dem des NECRONOMICON zu trennen.«
Howard sog hörbar die Luft ein, starrte mich aus hervorquellenden Augen an und wurde hinter seiner Rauchwolke bleich. »Sag … sag das noch einmal«, keuchte er.
»Was?« Ich verstand nicht gleich, was er meinte.
»Du … du willst doch nicht etwa sagen, dass es hier ist?«, stammelte Howard. »Das ist doch ein Irrtum. Sag mir, dass ich dich falsch verstanden habe! Du hast es nicht wirklich hierher gebracht?!« Die letzten Worte schrie er fast.
»Das habe ich dir doch erzählt.«
»Du hast mir gar nichts erzählt!«, brüllte Howard, fuhr schuldbewusst zusammen, als sich dieses Mal nicht nur der Ober, sondern das halbe Lokal zu uns herumdrehte und strafende Blicke auf uns abschoss, und fuhr, etwas leiser, aber noch immer in sehr erregtem Tonfall fort: »Du hast mir erzählt, was mit Balestrano geschah und dass dieses Mädchen seither harmlos ist, aber mehr nicht. Zum Teufel, ich dachte natürlich, dass du das Buch verbrannt hättest oder wenigstens zwanzig Yards tief vergraben!«
»Verbrannt? Aber das hätte Priscyllas Tod bedeutet!«
»Du hast es hierher gebracht?«, keuchte Howard. »Du hast dieses Buch hierher gebracht, Robert? Hierher nach New York? Wo ist es jetzt?« Seine Augen wurden weit vor … vor Furcht?, dachte ich verwirrt. »Wo ist es?«, wiederholte er.
»Im Hotel«, antwortete ich automatisch. »Bei Priscylla. Wo denn sonst?«
Howard starrte mich noch eine Sekunde lang entgeistert an, dann sprang er auf, stampfte seine erst halb gerauchte Zigarre so heftig in den Aschenbecher, dass die Glut über den halben Tisch spritzte, und fuhr herum. »Bring mich dorthin«, befahl er. »Sofort!«
Ich wagte es nicht, ihm zu widersprechen.
Diesmal war ich es, der den Türsteher des Hilton so grob beiseitestieß, dass er um ein Haar zum zweiten Male an diesem Tag unsanft zu Boden gegangen wäre. Im Sturmschritt lief ich durch die Halle, gefolgt von einem mehr als nur nervösen Howard und von Rowlf, der sich bemühte, ein möglichst finsteres Gesicht zu machen, um jeden Versuch, uns aufzuhalten, gleich im Keime zu ersticken. Wir erreichten auch tatsächlich unbehelligt die Treppe und die erste Etage, ehe hinter uns ein erboster, halb erstickter Schrei aufklang und der Hotelmanager erschien, drei Stufen auf einmal nehmend und mit kampflustig gesträubtem Schnauzbart.
»Mister Craven!«, kreischte er. »Ich muss doch bitten! Das geht entschieden zu weit. Sie können nicht –«
Er sprach nicht weiter, denn Rowlf war blitzschnell herumgefahren, hatte ihn am Kragen in die Höhe gelupft und schüttelte eine Faust vor seinem Gesicht, die nur wenig kleiner als sein ganzer Kopf war. »Wat kömma nich?«, fauchte er.
»Rowlf!« In Howards Stimme war eine ungewohnte Schärfe. »Lass den Unsinn.« Er wartete, bis Rowlf den blass gewordenen Manager behutsam wieder auf die Füße gestellt hatte, trat auf ihn zu und lächelte entschuldigend.
»Ich bitte Sie, verzeihen Sie meinem unglückseligen Faktotum diesen Ausrutscher«, sagte er freundlich. »Manchmal ist er wie ein Kind, wissen Sie? Es wird nicht wieder vorkommen.« Dann drehte er sich wieder zu mir um. »Du bringst das in Ordnung, ja?«
Ich nickte, und wir stürmten weiter. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass sich der Manager meiner bisherigen Großzügigkeit erinnern und nicht etwa die Polizei rufen würde.
Völlig außer Atem erreichten wir den fünfzehnten Stock und steuerten meine Suite an. Nach dem Chaos unten in der Halle kam mir die Stille hier oben doppelt tief vor. Nicht einmal der Page war zu sehen, der sonst Tag und Nacht in seiner Wandnische stand und darauf wartete, dass ich irgendeinen Wunsch hatte.
Und die Tür zu meiner Suite stand offen.
Das allein hätte vielleicht nicht ausgereicht, mich mitten im Schritt stocken zu lassen. Auch das Personal eines so sündhaft teuren Hotels konnte schließlich einmal etwas vergessen.
Es war vielmehr der Umstand, dass das Schloss fehlte. Zusammen mit einem halben Quadratmeter des zollstarken Türholzes, in das es eingelassen gewesen war.
Ich wollte weitergehen, aber Rowlf legte mir eine seiner gewaltigen Pranken auf die Schulter, schob mich kurzerhand beiseite und stieß die Tür mit dem Fuß auf.
Was wir sahen, war ein Bild vollkommener Zerstörung. Die Suite war zertrümmert, so gründlich, als wären Dschingis Khans Horden hindurchgeritten; mindestens fünfundzwanzigmal. Kein einziges Möbelstück war heil geblieben, die meisten so zertrümmert, dass sie nicht einmal mehr zu identifizieren waren. Die kostbaren Kristalllüster waren von der Decke gerissen und die Splitter wie glitzerndes Eis über das ganze Zimmer verteilt, die Teppiche waren zerrissen, und in den Fußböden gähnten gewaltige, ausgefranste Löcher.
»Großer Gott«, stammelte Howard. »Was ist hier passiert?«
Aber ich hörte seine Worte kaum. Mein Blick hing wie gebannt an der Tür zu Priscyllas Schlafzimmer.
Genauer gesagt, an dem gezackten Loch darin, das ungefähr die Größe und Umrisse eines menschlichen Körpers hatte. Wer immer hier eingedrungen war, hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht die Tür zu öffnen, sondern war einfach hindurchgelaufen.
Zitternd, wie gegen einen inneren Widerstand ankämpfend, näherte ich mich der Tür, duckte mich durch das gewaltige Loch hindurch und unterdrückte nur noch mit letzter Kraft einen Schrei, als ich sah, dass der Raum ebenso verwüstet war wie das Nebenzimmer. Schlimmer noch – hier war sogar die Wand eingerissen. Der unbekannte Eindringling war nicht auf dem gleichen Wege zurückgegangen, auf dem er gekommen war, sondern in gerader Linie weiter – durch die Wand hindurch.
Und Priscylla war verschwunden.
Neben dem, was von ihrem Bett übrig geblieben war, lag eine verkrümmte Gestalt, in die Fetzen einer ehemals weißen Schwesterntracht gehüllt. Ihre Haube war nach vorne gerutscht und verbarg gnädig den Anblick ihres Gesichtes.
Behutsam kniete ich neben der Toten nieder, streckte die Hand nach ihr aus und fuhr wie elektrisiert zurück, als ein leises, gequältes Stöhnen aus ihrer Brust drang. »Sie lebt!«, entfuhr es mir.
»Ja«, antwortete Howard leise. »Aber sie wird sterben.«
Ich fürchtete, dass er Recht hatte. Der Teppich unter dem Körper der Krankenschwester war dunkel von Blut. Niemand konnte die Verletzungen überstehen, die sie davongetragen hatte. Es war ein Wunder, dass sie überhaupt noch am Leben war.
»Mein Gott«, flüsterte ich. »Was ist hier geschehen?«
Howard kniete neben mir nieder, drehte die Sterbende wenig sanft auf den Rücken und berührte ihr Gesicht. In seinen Augen stand eine Frage geschrieben, die den Schrecken in mir noch vertiefte.
»Nein!«, sagte ich.
»Du musst«, erwiderte Howard sehr leise, aber auch sehr ernst. »Wir müssen wissen, was hier passiert ist. Und zwar schnell.«
Einen Moment lang sträubte ich mich noch dagegen, aber in Wahrheit hatte ich längst eingesehen, dass er Recht hatte. Mrs. Peddigrew war die einzige Zeugin, die uns sagen konnte, wer für diese Verwüstung verantwortlich war; und – was noch wichtiger war! – was mit Priscylla geschehen war. So nickte ich schließlich widerstrebend, streckte die Hand nach ihr aus und berührte mit gespreizten Fingern ihre Augen und ihre Stirn. Dann konzentrierte ich mich.
Es war leichter, als ich erwartet hatte, denn ihr Geist glitt bereits hinüber in die dunklen Sphären des Nichts und wehrte sich nicht mehr gegen meine Beeinflussung, wie es das Bewusstsein eines gesunden Menschen ganz instinktiv getan hätte.
Und es war schlimmer, als ich gefürchtet hatte.
Zuerst fühlte ich nichts als einen tiefen, kalten Schmerz, eine Pein sonderbar körperloser Art, dann einen fast unwiderstehlichen Sog. Etwas Schwarzes, ungeheuer Starkes wollte sich meines Bewusstseins bemächtigen. Eine grässliche Kälte machte sich in mir breit.
Hastig zog ich mich zurück, blockte den Einfluss des finsteren Strudels ab und griff noch einmal nach dem Geist der Sterbenden. Diesmal sah ich Bilder, aber es war wie in einem wahnsinnigen, sich unglaublich rasch drehenden Kaleidoskop: Momentaufnahmen aus ihrer Jugend, banale Augenblicke ihres Lebens, ihr erster Schultag, ihre erste Liebesnacht, eine Enttäuschung, die so groß gewesen war, dass sie ihr ganzes nachfolgendes Leben veränderte. Binnen weniger Augenblicke raste das ganze Leben der sterbenden Frau an mir vorüber, nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern als irrer Veitstanz auf unbeschreibliche Weise gleichzeitig auf mich einstürmender Eindrücke. Es war das Entsetzlichste, was ich bis zu diesem Moment erlebt hatte – ich nahm am Sterben eines Menschen teil.





























