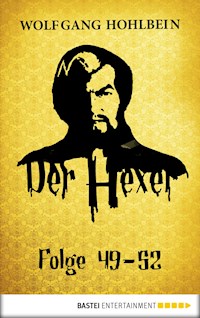
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Das unheimliche Luftschiff" - Folge 49 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Die Luft war kühl und feucht an diesem 14. Oktober des Jahres 1886. Dichter Nebel zog vom Ufer herauf und kroch in die schmalen Gassen zwischen den Lagerschuppen. Immer höher und höher stieg er an, und die Menschen beeilten sich, in ihre warmen und schützenden Häuser und Katen zu kommen. Es roch nach Fäulnis an diesem Abend, und Fäulnis war der Vorbote der Pest. In den Hafenspelunken munkelten es die Seeleute, und sie berichteten über Jahre, in denen der Herbst ähnlich gewesen war. Jedes Mal hatte es im darauffolgenden Winter eine Epidemie gegeben, und die Bewohner der Stadt waren hinauf nach Norden geflohen, in die Wälder von St. Albans und Harlow, weg von diesem todbringenden Wasser.
"Die fantastische Reise" - Folge 50 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Die Luft schmeckte nach Schnee und Frost. Kleine weiße Flocken wirbelten durch die zerbrochene Glastür ins Zimmer und ließen sich, einem hauchzarten Teppich gleich, auf den hölzernen Dielen nieder. Der junge, hochgewachsene Mann blieb einen Augenblick stehen und blickte hinaus in den Garten. Der Mond hatte die graue Wolkendecke für einen kurzen Moment durchbrochen und verwandelte die sorgsam angelegten Kaskaden und die knorrigen Obstbäume im fahlen Zwielicht dieser Neujahrsnacht zu drohenden, schemenhaften Riesen, die ihre dürren Geisterfinger nach im ausstreckten.
"Die vergessene Welt" - Folge 51 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Das leise Summen mit dem der Kreis die Beschwörung begonnen hatte, steigerte sich zu einem tiefen, unangenehm dröhnenden Ton, der nach und nach den ganzen Saal zum Beben brachte und schließlich in die Körper der Knieenden kroch. Er nistete sich als dumpfer Schmerz ein, ließ ihre Zähne vibrieren, die Finger- und Zehenspitzen prickeln und jeden einzelnen Nerv in ihrem Körper erzittern. Die Mitglieder des magischen Kreises schlossen ihre Hände fester zusammen, um den Kontakt zueinander nicht zu verlieren.
"Revolte der Echsen" - Folge 52 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Der Platz bot einen Anblick des Schreckens. Wo vor Tagesfrist noch eine Stadt gewesen war, erstreckte sich nun ein Ruinenfeld, übersät mit Trümmern, Unrat, Asche und Toten. Die Meisten waren nicht menschlich- große, grün schimmernde Geschöpfe, die an Echsen erinnerten, in einfache Kleidung gehüllt: Sree. Aber viele der reglos ausgestreckten Gestalten hatten auch die Gesichter von Menschen. Zu viele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Das unheimliche Luftschiff
Der Hexer – Die fantastische Reise
Der Hexer – Die vergessene Welt
Der Hexer – Revolte der Echsen
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 49-52:
Der Hexer – Das unheimliche Luftschiff
Der Hexer – Die fantastische Reise
Der Hexer – Die vergessene Welt
Der Hexer – Revolte der Echsen
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 49–52
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1580-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 49-50
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 49, 50 und 53 (Folge 53 finden Sie in Sammelband Nr. 14, Folge 53-56).
Dieses Vorwort bezieht sich auf die E-Book-Hexer-Folgen 49, 50 und 53, da es dem Taschenbuch-Sammelband entspringt und dort erstmals von der Regel abgewichen wurde, alle Hexer-Hefte chronologisch in der Reihenfolge ihres damaligen Erscheinens neu zu präsentieren, und zwar aus folgendem Grund: Bei den ursprünglichen Bänden 40 »Das unheimliche Luftschiff« und 44 »Endstation Hölle« handelt es sich um zwei Gastromane, die Perry-Rhodan-Autor Arndt Ellmer verfasst hat. Es ist ein Soloabenteuer um Howard und Rowlf, in dem Robert Craven selbst gar nicht mitspielt. Da es sich um einen Zweiteiler handelt, erschien es allen Beteiligten sinnvoll, beide Hefte für die Taschenbuch-Sammeledition hintereinander zu bringen, statt sie durch ein Festhalten an der ursprünglichen Reihenfolge auf zwei Bücher zu verteilen. Gleiches gilt für die Bände 42 »Die vergessene Welt« und 43 »Revolte der Echsen«. Auch hierbei handelt es sich um einen Zweiteiler.
Eine weitere Hauptrolle bei den Abenteuern Howards spielt ein gewisser Phileas Fogg. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um den durch den Roman »In achtzig Tagen um die Welt« von Jules Verne berühmt gewordenen Weltreisenden, der seine Wette nun unter verschärften Bedingungen wiederholt. Herausgefordert dazu wird er von einem gewissen Professor Moriarty, auf den ich bereits im Vorwort zu den E-Books 43 bis 45 kurz eingegangen bin. Moriarty war der Intimfeind des Meisterdetektivs Sherlock Holmes.
Jules-Gabriel Verne, der auch schon den für die Hexer-Saga nicht ganz unwichtigen Kapitän Nemo und seine NAUTILUS erfunden hat, wurde am 8. Februar 1828 als Sohn eines Rechtsanwaltes in Nantes geboren. Auf Wunsch seines Vaters studierte er Jura, zunächst in Nantes, ab 1848 in Paris, wo er Kontakt zu literarischen Zirkeln fand und u. a. die Bekanntschaft von Alexandre Dumas machte. Er begann Dramen zu schreiben.
Sein erstes Stück wurde am 12. Juni 1850 im Pariser Théatre Historique uraufgeführt. Von 1852 bis 1855 arbeitete Jules Verne als Sekretär am Théatre Lyrique und war ab 1856 auch als Börsenmakler tätig.
Neben der mit wachsendem Erfolg andauernden Arbeit als Romancier unternahm Verne große Reisen, auf denen er Anregungen für seine Arbeit fand. Neben reinen Abenteuerromanen verfasste er zahlreiche Bücher mit fantastischem Einschlag, die ihm den Titel als Vater des Science Fiction einbrachten. Viele seiner Werke wurden mehrfach verfilmt und sind noch heute Welterfolge.
Jules Verne starb am 24. März 1905 in Amiens.
Ähnlich große Berühmtheit errang Herbert George Wells, dem der Hexer in diesem Buch begegnet. Geboren wurde er am 21. September 1866 in Kent; er starb am 13. August 1946 in London. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören die Romane »Die Zeitmaschine« (erschienen 1895) und »Der Krieg der Welten« (1898). Letzterer wurde von dem damals dreiundzwanzigjährigen Orson Welles in ein Hörspiel umgewandelt, das am 30. Oktober 1938 ausgestrahlt wurde und angeblich wegen seines pseudodokumentarischen Charakters in halb Amerika eine Panik ausgelöst haben soll. Eine Legende, die sich bis heute hartnäckig hält, obwohl längst erwiesen wurde, dass es sich bei dieser Hysterie nur um Einzelfälle handelte.
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 49Das unheimliche Luftschiff
Die Luft war kühl und feucht an diesem 14. Oktober des Jahres 1886. Dichter Nebel zog vom Ufer herauf und kroch in die schmalen Gassen zwischen den Lagerschuppen. Immer höher und höher stieg er an, und die Menschen beeilten sich, in ihre warmen und schützenden Häuser und Katen zu kommen. Es roch nach Fäulnis an diesem Abend, und Fäulnis war der Vorbote der Pest.
In den Hafenspelunken munkelten es die Seeleute, und sie berichteten über Jahre, in denen der Herbst ähnlich gewesen war. Jedes Mal hatte es im darauf folgenden Winter eine Epidemie gegeben, und die Bewohner der Stadt waren hinauf nach Norden geflohen, in die Wälder von St. Albans und Harlow, weg von diesem tödlichen Wasser.
Schmierige Wellen leckten an den Holzbohlen der Docks. Die Flut brachte Treibgut von der Themsemündung mit sich, und in den Kuhlen und Nischen der Bassins östlich der erst halb vollendeten Tower Bridge sammelte sich der Unrat, den die Schiffer über Bord gekippt hatten: faules Fleisch und stinkende Kartoffeln, zerbrochene Kisten und alte Lumpen, mit denen die Seemänner ihre wunden Handballen bedeckten, wenn sie sich in den Stürmen der Nordsee gegen den Wind stemmten und versuchten, die Segel straff und doch nicht überspannt zu halten.
Irgendwo brannte eine einzelne Gaslaterne und markierte den Hofeingang von Benny’s Inn. Der Rest der Docks war in tiefe Finsternis getaucht.
Die Themse schmatzte. Während der Flut stieg ihr Wasserspiegel um dreieinhalb Meter an. Dann lagen selbst die steinernen Treppen an den Anlegestellen unter Wasser. Bei Ebbe waren sie glitschig; kleine, algenüberzogene Kerben in den Kaimauern, auf deren Stufen sich so mancher betrunkene Seemann schon den Hals gebrochen hatte, bevor ihn die Fluten aufnahmen und hinaustrugen, an den Docks und an Greenwich vorbei bis zu den Leuchttürmen und dann hinaus ins offene Meer.
Und es ging die Sage, dass so mancher von ihnen zurückgekehrt war – längst tot und doch lebendig …
Der Nebel verdichtete sich weiter, bildete eine undurchdringliche Mauer aus Schweigen und Angst und eisiger Kälte. Wen er verschluckte, der war gefangen in einer fremden, unheimlichen Welt. Wen er wieder entließ, dem kam es vor, als sei ihm das Leben neu geschenkt worden. Der Nebel war finster in dieser Nacht. Es gab keinen Himmel über London, und die Gebete der Frauen und Kinder hinter den windschiefen Fensterläden oder den zerbrochenen, notdürftig geflickten Scheiben wurden erbarmungslos von dem feuchten Dunst verschluckt, noch ehe sie den Allmächtigen erreichen konnten.
Der Nebel nahm alles in sich auf. Er war wie ein Grab, und er schwieg über alles, was in seinem feuchten Mantel vor sich ging. Der Nebel war der engste Verbündete des Todes.
Besonders in dieser Nacht.
Niemand bemerkte das Brodeln unterhalb der Tower Bridge. Nicht einmal die Matrosen der Handelsschiffe, die sich zaghaft durch den Nebel tasteten oder an den Kaimauern vertäut lagen, wurden aus ihrer Schläfrigkeit gerissen, in der sie die Zeit der Wache auf dem Vor- und Achterdeck verbrachten. Sie saßen oder standen in klamme Decken eingehüllt, und das einzige Geräusch, das sie vernahmen, war das Klappern ihrer eigenen Zähne.
An den steinernen Säulen der Brücke, umrahmt von stählernen Baugerüsten, begann es, heftiger zu brodeln. Die dampfende Oberfläche des Wassers geriet in Wallung. Blasen stiegen auf, groß und stinkend. Sie verteilten sich und bildeten dunkle Flecken in der Nebelwand. Die Themse kochte, kochte in einem Umkreis von zwölf Yards, und die Erscheinung bewegte sich langsam von der Brücke weg und auf die Docks zu.
Etwas glitt durch das Wasser, eine schwarze, nicht fassbare Erscheinung, ein entsetzliches Ding, das die Dunkelheit und den Nebel benutzte, um ungesehen an sein Ziel zu gelangen. Es bewegte sich südostwärts an der Pier entlang und schwenkte dann in den engen Kanal ein, der in das St. Katharina Marina Dock führte. Es driftete in das Westbassin hinein, auf die schmalen Treppen unterhalb des Main Trade Center zu. In Ufernähe angelangt, kam es zur Ruhe. Das Brodeln verschwand, nur die stinkenden Blasen stiegen weiterhin auf.
Dann, plötzlich, breiteten sich nach allen Seiten hin hektische Wellen aus. Sie schlugen verlangend gegen die Stufen und erzeugten klatschende Geräusche.
Der Nebel über dem Wasser riss für ein paar Augenblicke auseinander. Doch niemand sah, was in diesen Sekunden aus dem brackigen Wasser stieg.
In einer solchen Nacht sagte der Volksmund, waren nur Bösewichte unterwegs und Betrunkene. Oder der Tod …
In der East Smithfield waren drei der fünf Gaslaternen erloschen. Der Nebel hatte sie mit seiner Feuchtigkeit heimtückisch erstickt. Die beiden restlichen befanden sich etwa dreihundert Yards voneinander entfernt, und ihr trübes Licht reichte nicht aus, um die Hand vor Augen erkennen zu lassen.
Professor James Moriarty ließ ein ungnädiges Brummen hören. Er ging leicht nach vorn gebeugt, um einem zufällig mit einer Handlaterne entgegenkommenden Passanten keine Möglichkeit zu geben, sein Gesicht zu erkennen. Er trug einen dunklen Anzug und einen schwarzen Capemantel, den er mit der linken Hand vorn zusammengerafft hielt. Seine Rechte umklammerte den Stock, den ein Mann seines Standes stets bei sich trug.
Irgendwo schlug eine Tür. Das Geräusch klang dumpf in der alles verschluckenden Feuchtigkeit. Die lauten Stimmen, die aufklangen, hörten sich wie das Gewinsel geprügelter Hunde an. Dann herrschte wieder Ruhe. Nur das leise Glucksen des Wassers an den Holzbohlen der Stege war jetzt noch zu hören.
Professor Moriarty beachtete beides kaum. Er eilte weiter, ein dunkler Schatten in der Nacht. Seine Stiefelsohlen markierten seinen Weg: ein leises und regelmäßiges Klacken auf dem groben Kopfsteinpflaster.
Die erste der beiden brennenden Laternen kam näher. Ihr Licht flackerte, die Flamme rußte – ein deutliches Zeichen, dass die Düse lange nicht gereinigt worden war. Die Feuchtigkeit tat ein Übriges.
In der Ferne schlug eine Uhr. Die Glocken dröhnten verhalten durch den dichten Nebel. Fast schien es, als wollten die Töne in ihm stecken bleiben.
Moriarty blieb unter dem Gaslicht stehen und zog seine Taschenuhr hervor. Die goldene Uhrkette blitzte verführerisch im armseligen Licht.
Noch eine Stunde bis Mitternacht.
»’n richtiges Novemberwetter. Und dabei ha’m wir erst Oktober«, sagte eine dumpfe Stimme aus der Dunkelheit. Moriarty zuckte zusammen, ließ die Uhr verschwinden und fuhr herum. Sein Mantel klaffte auf, der Stock zeigte nach vorn. Er versuchte zu erkennen, mit wem und wie vielen er es zu tun hatte.
Aus der finsteren Nebelwand schälte sich eine einzelne Gestalt. Sie schwankte leicht. Ihre Augen glänzten stumpf, flammten dann in jähem Erkennen auf. Die Alkoholfahne des Mannes ließ Übelkeit in Moriarty aufsteigen.
»Ah, sieh an. Der Pro … Professor persön … lich.« Eine Hand schnellte nach vorn und streckte sich Moriarty verlangend entgegen. »Nur … ’n paar Shilling für ’nen Schnaps, Professor. Ich schweige … auch wie’n Grab. Ich … habe Sie hier … nicht gesehen. Bestimmt nicht!«
James Moriarty spuckte verächtlich aus. Er war nicht in der Laune, sich mit diesem Säufer abzugeben. Barnley gehörte zu jener Art von heruntergekommenem Gesindel, das seine Großmutter verkaufte, wenn der Erlös für einen Rausch reichte.
»Du stinkst«, zischte er. »Verschwinde!«
Der Betrunkene wich ein wenig zurück, aber seine Augen leuchteten heimtückisch auf.
»Bei … bei Benny’s ha’m sie mich raus … geschmissen. Aber du wirstmi … mich nicht … so schnell … los!«
Er richtete sich ein wenig auf.
»Was willst du?«, fragte Moriarty scharf. Die Gaslaterne flammte unter einem Lufthauch ein wenig heller auf und beleuchtete seine Gestalt. Moriarty war groß und hager. Sein Gesicht wirkte eingefallen, die Nase besaß die Form eines Habichtschnabels, und der breite Mund mit den schmalen Lippen und das spitz zulaufende Kinn standen in keinerlei Harmonie zueinander. Die kleinen, stechenden Augen gaben dem Gesicht des Professors einen irgendwie bösartigen Zug.
Die schwarzen Haare trug er glatt nach hinten gekämmt, und die Brauen auf den stark ausgeprägten Augenknochen sahen aus wie dünne Drähte.
»Geld«, lallte der Betrunkene. »Nur ’n wenig Geld!«
»Ich gebe dir nichts! Ich habe nichts dabei!«
Er wandte sich ab und ging weiter. Der Betrunkene brach in verhaltenes, ordinäres Lachen aus. Moriarty stutzte bei diesem Klang. Das Lachen alarmierte ihn. Barnley folgte ihm und holte auf. Im Abstand von drei Yards wankte er neben Moriarty her.
»Damals, im Mai, da hab ich dich … ich meine Sie … erkannt, Professor. Drunten an … der Carron Wharf. Die Sache mi … mit dem Sack, der in der Themse ver … sank. Ja, ja … unsere gute alte Themse. Sie schweigt wie ’n … Grab. Wie ich … Nur, ich hab meinen … Preis!«
James Moriarty blieb so abrupt stehen, dass Barnley zusammenzuckte. Der Stock fuhr zur Seite und deutete auf den Betrunkenen. Moriarty drehte an dem Messingknauf und zog den elfenbeinfarbenen Griff zurück. Eine rasiermesserscharfe Klinge fuhr aus dem Stock; das feine Sirren in der Dunkelheit musste selbst für einen unter Alkohol stehenden Menschen ein Alarmsignal sein.
»Alles hat seinen Preis!«, sagte er gefährlich leise. »Du sollst den bekommen, der dir zusteht. Aber heute bin ich ausgesprochen gnädig, du Hund. Da!«
Die Klinge des Stockdegens durchschnitt den Nebel. Die Bewegung war so schnell, dass Barnley nicht reagieren konnte. Er mochte vielleicht ahnen, was Moriarty vorhatte, aber es war bereits zu spät. Die Klinge schlitzte das Wams des Betrunkenen auf und drang ein kleines Stück in seine Brust ein. Barnley schrie auf und warf sich zurück. Er stürzte, fiel hart auf das grobe Pflaster und blieb stöhnend liegen. Sein Hemd färbte sich rot.
»Mörder!«, ächzte der Mann. »Du Mörder! Ich … werde dich …«
»Nichts wirst du«, unterbrach Moriarty ihn barsch. Die Spitze der Waffe zielte auf Barnleys Kehle. »Noch ein Wort, und ich steche dir die Gurgel durch. Mit Gesindel wie dir mache ich kurzen Prozess. Hast du verstanden?«
»J … ja!«
James Moriarty wandte sich ab und ließ die Klinge mit einem metallischen Geräusch verschwinden. Es klickte, und das Gesicht des Professors erschien über dem Verletzten. »Danke mir auf den Knien, dass die Waffe nicht mit Curare behandelt ist, sonst wärst du bereits ein toter Mann!«, zischte er.
Dann ließ er den Betrunkenen einfach liegen und setzte seinen Weg fort. Der Nebel verschluckte seine hagere Gestalt, und nach einer Weile erstarb auch das Gewimmer des Verwundeten. Moriarty geriet endgültig aus dem Lichtkreis der Gaslaterne und mäßigte seinen Gang.
Nach einer Weile hörte er in einigem Abstand schleichende Schritte hinter sich. Er grinste. Er hatte damit gerechnet. Barnley folgte ihm; der Betrunkene sann auf Rache. Moriarty verzog geringschätzig das Gesicht. Er orientierte sich wie jemand, der sich selbst mit geschlossenen Augen in diesem düsteren Viertel auskannte. Nach dreißig Schritten bog er nach rechts ab und schlich auf Zehenspitzen an der Wand eines Lagerhauses entlang auf die Kaimauer zu. Einmal hustete er unterdrückt, gerade laut genug, dass sein Verfolger seine Spur nicht verlor. Barnley konnte ein kühles Bad gut vertragen, um seinen Mut etwas abzukühlen.
Einen Atemzug lang blieb der Professor stehen und lauschte. Barnley folgte ihm. Er kam ebenfalls die Hauswand entlang.
Moriarty huschte weiter. Er ahnte die Kaimauer und die Treppe, ohne sie zu sehen. Das Gebäude war zu Ende, und Moriarty verharrte hinter der Ecke und wartete.
Vom Bassin her kam ein Geräusch. Es war anders als das übliche Schmatzen des Wassers an den Holzbohlen. Es war fremdartig.
Und dann roch James Moriarty den Gestank. Es war nicht der Odem der Fäulnis, der immer über dem Hafenbecken lag. Es stank geradezu bestialisch, und der Nebel trug den Geruch in dichten Wolken heran. Moriarty hielt den Atem an.
Barnley kam. Er schlich an ihm vorbei, und für einen Augenblick konnte der Professor einen vagen Schatten erkennen, der den Nebel zerteilte. Der Betrunkene bemerkte ihn nicht. Er hielt auf eine der Treppen zu, die hinab zu den Planken führten, wo einige kleinere Schiffe vertäut lagen. Der Schatten verschwand, und auch die Schritte Barnleys verklangen.
Und dann zerschnitt ein scharfes Zischen die Stille. Etwas klatschte auf die feuchten Pflastersteine unmittelbar an der Kaimauer. Ein überraschter Ausruf Barnleys folgte, ein Keuchen, das in einen Entsetzensschrei überging. Der Schrei währte nur wenige Sekunden, aber er ging Moriarty durch Mark und Bein. Unwillkürlich wich der Professor bis zur Seitenmauer des Gebäudes zurück, jederzeit bereit, die Flucht anzutreten. Er kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, tastete nach seinem Feuerzeug. Augenblicke später leuchtete die kleine Flamme auf und erhellte die Umgebung notdürftig.
Doch James Moriarty konnte nichts erkennen. Der Nebel verbarg die unheimlichen Vorgänge an der Kaimauer vor seinen Blicken. Im Schein des Feuerzeugs leuchtete er grauweiß und blendete ihn.
Und dann sah er doch etwas. Aus dem Wall undurchdringlicher Nebelschwaden rann eine winzige rote Spur. Sie vergrößerte sich rasch zu einem Rinnsal und bildete eine Pfütze auf dem feuchten Pflaster. Wieder klang das Zischen auf, lauter und härter diesmal. Die Pfütze verwandelte sich in eine dampfende Lache.
Jetzt wurde es selbst James Moriarty unheimlich. Er wandte sich zur Flucht. Seine Stiefelabsätze knirschten verräterisch laut auf dem Boden. Mit der linken Hand tastete er nach der Gebäudewand, die Rechte umklammerte seine Waffe, als er sich vorsichtig Schritt um Schritt zurückzog. Er kam nicht weit.
Etwas Kaltes, Feuchtes schlang sich mit einem peitschenden Geräusch um seinen rechten Fußknöchel und jagte eine Welle des Schmerzes durch seinen Körper. Moriarty verlor das Gleichgewicht und fiel der Länge nach hin. Er schlug sich die Ellbogen und die Knie blutig. Der Stockdegen wurde ihm aus der Hand geprellt und schlitterte davon, unerreichbar für ihn. Das Feuerzeug fiel zwischen ihn und die Blutlache und brannte flackernd weiter. In seinem Licht sah Moriarty, was sich da aus dem Nebel auf ihn zubewegte.
Es war ein unheimliches schwarzes Etwas, ein pulsierender nasser Sack mit schleimiger Haut, tentakelbewehrt wie die Riesenkraken in den Seemannsgeschichten, die er nie geglaubt hatte. Es kroch langsam auf ihn zu, schmatzend und glucksend. Der widerliche Gestank, den es vor sich herschob, raubte dem Professor fast den Atem. Er glaubte, daran ersticken zu müssen, und warf seinen Körper herum. Wieder flammte der Schmerz auf, und sein rechtes Bein fühlte sich dick und leblos an wie ein aufgequollenes Stück Holz.
»Lass mich!«, stöhnte Moriarty. Schmerz und Panik verzerrten seine Stimme. »Ich kann dir behilflich sein!«
Es war absurd. Als ob dieses … Meeresungeheuer sein Flehen hätte verstehen können! Ein halbes Dutzend weiterer Tentakel, dick wie menschliche Oberarme, krochen heran und griffen nach ihm.
Moriarty warf den Kopf zurück und begann mit dem freien Bein wie von Sinnen um sich zu treten. Es half ihm nichts. Das Ungeheuer kam über ihn und schnürte ihm die Luft ab. Es rollte ihn in seine Tentakel ein und zog ihn näher an sich heran. Der Ekel erregende Gestank nach Seetang und Moder schlug wie eine feuchte Woge über ihm zusammen. Er schnappte erneut nach Luft – es ging nicht mehr! Doch die Panik währte nur kurz. Übergangslos versank Moriarty in einen Zustand der Trance, erlebte wie im Halbschlaf, was mit ihm geschah.
Es konnte nicht sein. Es war unmöglich! Er war sich plötzlich sicher, das alles nur zu träumen.
Die Tentakel des Wesens verschmolzen mit seinem Körper! Sie lösten sich vom eigentlichen Leib, der halb im Nebel, halb im Licht des Feuerzeugs lag, begannen sich wie weiche, nachgiebige Gallertmasse an seine Kleidung und seine Haut zu schmiegen und durchdrangen Mantel und Anzug mühelos. Sie wurden eins mit Professor Moriarty und er eins mit ihnen. Ein grelles Feuer begann in seinem Körper zu brennen, aber es verzehrte ihn nicht; im Gegenteil, es wärmte ihn wohlig. Langsam löste sich die Beklemmung von seiner Brust, und er konnte wieder frei atmen. Für Sekunden verspürte er noch einen sanften Druck in seinem Kopf, nicht schmerzhaft, nicht einmal unangenehm, dann war es vorbei. Er konnte wieder klar denken. Vorsichtig richtete er sich auf.
Es war wie das Erwachen aus tiefem Schlaf. Das Ungeheuer war verschwunden! Er selbst war unversehrt; nicht einmal sein Fußknöchel tat noch weh. Weit entfernt schlug Big Ben die Mitternachtsstunde.
Moriarty stand auf und griff nach dem Feuerzeug. Er fand den Stockdegen und nahm ihn an sich.
»Ich bin von Barnley überrascht und zusammengeschlagen worden«, flüsterte er heiser und wusste gleichzeitig, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Er starrte auf die Blutlache am Boden und folgte ihr in den Nebel hinein.
Seine Füße stießen an helle, schmale Gebilde, im Nebel kaum zu erkennen. Menschenknochen. Und ein bleicher, hohler Schädel.
Moriarty trat mit den Stiefeln danach und schleuderte Barnleys Gebeine über die Kante der Kaimauer in das brackige Wasser hinab. Eine Weile blieb er sinnend stehen und sah zu, wie der Schädel auf und ab hüpfte und schließlich versank.
Moriarty machte auf dem Absatz kehrt und schritt mit traumwandlerischer Sicherheit in die Dunkelheit hinein. Er löschte sein Feuerzeug und steckte es ein. Er brauchte es nicht mehr. Er sah jetzt alles so klar und deutlich, als sei es heller Tag.
In seinen Gedanken war ein Wissen, das er vorher nicht besessen hatte. Er wusste jetzt, dass etwas zu ihm gekommen war. Barnley hatte es nicht brauchen können, deshalb hatte er sterben müssen.
James Moriarty vergeudete keinen weiteren Gedanken an den Betrunkenen.
»Savile Row sieben Burlington Gardens«; murmelte er vor sich hin. »Morgen, pünktlich um die Mittagszeit!«
Der Nebel verschlang ihn endgültig. Professor James Moriarty machte sich auf den Weg, seinen Auftrag auszuführen.
Harvey Davidson, der Hausdiener, hatte das Frühstück auf dem Kamintisch im hinteren Teil der Halle serviert. Es roch im ganzen Haus nach Tee und frischem Gebäck, und Howard überzeugte sich durch einen Blick auf die Wanduhr, dass es tatsächlich schon kurz vor zehn war. Er griff nach der Klingel auf dem Kaminsims und läutete. Sein Blick ruhte auf der Tür, die den Korridor von der Halle abschloss.
Nichts rührte sich. Harvey hörte das Klingeln nicht.
Howard seufzte leise. Er ließ sich in einen der Ledersessel sinken, die vor dem Kamin standen, und blickte versonnen auf die frisch gewichsten Spitzen seiner Lederstiefel. Er klingelte kein zweites Mal. Harvey hätte es wieder nicht gehört, und Howard wollte den Alten nicht unnötig hetzen.
Seit Priscylla in dieses Sanatorium außerhalb Londons geschafft worden war und Mary sie dorthin begleitet hatte, war Harvey der einzige dienstbare Geist, den das Haus Nummer 9 am Ashton Place aufzuweisen hatte. Harvey putzte die Schuhe, machte die Betten, bereitete die – immerhin seltenen – Mahlzeiten, bestellte den Kräutergarten hinter dem Haus und reparierte alles, was mit eigenen Händen repariert werden konnte. Dass sein Alter ihn dabei manchmal behinderte und sein Körper nicht immer machte, was der Geist wollte, sah man ihm großzügig nach.
Howard starrte in den dunklen Kamin und verschränkte die Arme. Ein feines Lächeln erschien in dem scharf geschnittenen Gesicht des Amerikaners. Von irgendwoher hörte er die schweren Schritte Rowlfs. Sein Leibdiener und Kampfgefährte bewegte sich irgendwo in den oberen Stockwerken. Wenigstens Rowlf war noch da und verhinderte mit seinem gutmütigen Humor, dass das Haus endgültig vereinsamte.
Es war schon leer genug. Robert war reichlich überstürzt, wie Howard fand, nach Dartmoor gereist, und eigentlich hätte er längst zurück sein müssen. In solchen Fällen war Howard es jedoch gewohnt, dass es keinen eigentlichen Zeitplan gab. Robert würde zurückkehren, sobald er das wusste, was er hatte wissen wollen, oder sobald er ausgeführt hatte, was zu tun war. Zwar hatte Harvey vor einigen Tagen behauptet, ihn hier gesehen zu haben, doch das schien Howard wenig glaubhaft. Robert hätte sich bei seiner Rückkehr doch zumindest bei ihm gemeldet.
Dennoch, eine unterschwellige Sorge blieb. Sie ließ Howard nicht völlig zur Ruhe kommen. Er hatte eine unruhige Nacht verbracht, und sein Versuch, sich vor dem erloschenen Kamin zu entspannen, schlug kläglich fehl. Schließlich gab er sich einen Ruck und erhob sich. Er öffnete die Tür und hörte Harvey in der Küche mit Töpfen klappern.
Der alte Diener blickte auf, als Howard den Raum betrat.
»Harvey, haben Sie gestern im Laufe des Tages etwas Ungewöhnliches bemerkt?«, erkundigte er sich. »Ist jemand gekommen? Hat Robert eine Nachricht geschickt?«
»Nein, Mr. Lovecraft. Es kam keine Nachricht und auch kein Bote. Während Sie mit Mr.Rowlf in der City weilten, war lediglich der Milchmann hier. Aber wie ich schon sagte, vor einigen Tagen –«
»Danke, Harvey!« Howard seufzte übertrieben laut. Er hatte die Geschichte mehr als zehn Mal über sich ergehen lassen und war zu dem Schluss gekommen, dass Harvey offensichtlich einen Fremden an der Haustür mit Robert verwechselt hatte.
Nachdenklich kehrte er zum Kamin zurück. Minutenlang war Howard versucht, den nächsten Zug nach Dartmoor zu nehmen. Dann aber wischte er den Gedanken wieder beiseite. Langsam war es wirklich an der Zeit, dass er Robert nicht mehr als den jungen, unerfahrenen Sohn Roderick Andaras betrachtete, sondern als einen eigenständig handelnden Mann, der schwer genug an seinem Erbe trug.
In London nannten sie ihn den Hexer, und die GROSSEN ALTEN allein mochten wissen, wie weit sein Ruf bereits um die Welt gegangen war. Robert handelte verantwortungsbewusst, und er brauchte Freunde und Gefährten, keine Vormunde.
Howard setzte sich an den Frühstückstisch und griff nach einem der Brötchen. Sein Blick wanderte zu den Fenstern an der vorderen Front des Hauses. Für ein paar Augenblicke wurde es draußen hell, als die Sonne durch die Wolken brach. Die Scheiben ließen ihre Strahlen herein, die ein wirres Spiel aus Lichtreflexen auf den glänzenden Steinfußboden zeichneten. Sie bildeten einen Kreis mit zwölf Strahlen, und in der Mitte des Kreises schwamm ein milchiger, ovaler Fleck mit einem dunklen Punkt. Howard sah den Reflexen mehr verträumt als aufmerksam zu. Dann weiteten sich seine Augen plötzlich, und in sein Gesicht trat ein Ausdruck von Überraschung, ja Erschrecken. Mit einem Schrei sprang Howard auf. Der Stuhl polterte zu Boden, und Howard rammte sich den rechten Oberschenkel an der Tischkante, doch er bemerkte es gar nicht. Seine Füße trugen ihn hinüber zu dem Lichtspiel, das gerade zu verblassen begann. Er starrte noch einen Moment ungläubig darauf, dann wandte er sich um, stürmte auf die Eingangstür zu und riss sie auf.
Feuchte Luft schlug ihm entgegen. Draußen hing noch immer dichter Nebel und erlaubte eine Sicht von höchstens fünfzig Yards. Von Sonne war keine Spur zu entdecken.
Howard blieb wie angewurzelt unter der Tür stehen, starrte hinüber zu dem Fenster, in dessen Scheiben sich der graue Nebel spiegelte. Dann eilte er wieder hinein in die Halle und betrachtete die bleigefassten Scheiben von innen.
Da war nichts. Nicht der leiseste Hinweis darauf, dass durch dieses Fenster soeben die Sonne geschienen hatte. Was bei dem Nebel auch absolut unmöglich war.
Noch einmal ging Howard hinaus und wieder zurück. Dann verschloss er kopfschüttelnd die Tür. Er suchte jene Stelle am Boden auf, an der er das Lichtspiel gesehen hatte, ging in die Hocke und strich mit den Handflächen über den Steinboden. Es knisterte leicht, und die Härchen auf seinen Handrücken richteten sich auf.
»Elektrizität«, flüsterte er überrascht. »Eine elektrostatische Aufladung!«
Eilig untersuchte er die nähere Umgebung der Stelle. Die Aufladung war nur an diesem einen Teil des Bodens vorhanden, und sie verlor langsam an Intensität und verschwand schließlich.
Unter normalen Umständen hätte Howard der Erscheinung keine sonderliche Bedeutung beigemessen. Doch nicht so bei diesem Symbol. Howard war der ehemalige Time-Master des Ordens der Tempelritter, und er kannte sich mit den magischen Zeichen des Ordens und denen der weißen Magie aus.
Der Kranz aus zwölf Strahlen mit dem ovalen Fleck in der Mitte war das Zeichen für Gott, wobei der Fleck als Symbol für Gottes Auge galt. Die zwölf Strahlen stellten die zwölf Apostel oder die zwölf Stämme Israels dar. Doch darüber gab es noch ein paar andere Auslegungen.
Die zwölf Master des Templerordens wurden ebenfalls durch zwölf Lichtstrahlen symbolisiert. Ihr Zentrum war der Großmeister.
Und die Manifestation des Zeichens konnte nur eines bedeuten! Howard stellte sich breitbeinig in die Mitte der Halle und fixierte jenen Bereich, der im Dunkeln unter der steinernen Treppe lag. Wenn sich jemand in der Halle verborgen hielt, dann nur dort.
»Komm heraus, ich bin hier!«, rief er mit fester Stimme. Irgendwo erklang ein Poltern als Antwort – ein ganz und gar nicht magischer Laut –, und dann tönte von oben eine grollende Stimme herab:
»Komm ja schon. Was is ’n das für’n Lärm, den du machst?«
Rowlf erschien am oberen Ende der Treppe und kam langsam herunter.
»Vorsichtig!«, warnte Howard. »Bleib stehen!«
Er schloss für ein paar Augenblicke die Augen, um sich zu konzentrieren. Er lauschte auf irgendetwas, ohne genau beschreiben zu können, was es war. Doch er rechnete insgeheim damit, dass einer seiner ehemaligen Ordensbrüder ins Haus eingedrungen war und sich dort versteckt hatte. Es hätte ihn allerdings gewundert, wenn einer der Templer nochmals seinen Fuß über die Schwelle von Andara-House gesetzt hätte. Deutlich waren ihm noch die Ereignisse der letzten Wochen in Erinnerung.
»Is ’n los?«, fragte Rowlf nach einer Weile und setzte sich wieder in Bewegung. Er kam vollends die Treppe herunter und baute sich vor Howard auf. »Haste Probleme mit irgendwas?«
»Nein, nein«, machte Howard. Er war verwirrt. Irgendetwas hier war … falsch. Doch was? Gedankenverloren deutete er zum Tisch hinüber. »Lass uns frühstücken. Robert wird bald zurück sein. Jedenfalls hoffe ich es.«
Rowlf machte keine Anstalten, ihm zu folgen. Er starrte an Howard vorbei in den Living-room und runzelte die Stirn. »Was ’n jez los?«, brummte er. »Wo kommt denn die Sonne her, bei dem Nebel?«
Howard war herumgefahren, bekam jedoch nur noch das zweite Verblassen der Leuchterscheinung mit. Sie hatte nicht direkt mit den Templern zu tun, davon war er jetzt überzeugt. Dennoch musste sie eine Bedeutung besitzen.
»Wir müssen uns vorsehen«, sagte er zu Rowlf. »Etwas ist hier im Gange!«
»Wir könn’ ja den Kleenen fragen, wenn er zurückkommt«, schlug der Hüne vor.
Howard schüttelte missbilligend den Kopf.
»Glaubst du, dass wir nicht allein damit zurechtkommen?«, fragte er. »Und ich glaube …« Er ging noch einmal zu der Stelle, an der das Zeichen erschienen war, und sah zum Fenster hoch. »Ja«, fuhr er fort. »Es ist das Haus, Rowlf! Es versucht, uns auf etwas aufmerksam zu machen.«
»Auf ’ne Gefahr doch nich’, oder?«
»Egal. Irgendetwas. Das Haus will uns warnen, und es bedient sich magischer Zeichen, die den Mitgliedern des Ordens geläufig sind. Das ist kein Wunder; Erfahrungen mit den Templern hat dieses Haus inzwischen genug!«
Er steuerte auf den Frühstückstisch zu.
Die Teetassen begannen auf ihren Untersetzern zu klirren, und der Korb mit dem Gebäck neigte sich langsam zur Seite und stürzte um. Die Brötchen kullerten zu Boden. Ein Zittern durchlief das Haus.
»Es geht los!«, zischte Howard. Er vergaß den Gedanken an eine erste Zigarre nach dem Frühstück. »Jemand greift das Haus an!«
Plötzlich lag ein Singen über der Halle. Es legte sich wie ein Netz unsichtbarer Spinnweben über den Raum und schien Howard und Rowlf einzuweben in einen Kokon aus Tönen und Visionen. Mit einem Male fühlten sie sich in eine endlose Ebene versetzt, deren einziger Bezugspunkt ein ferner Berg war. Auf der Spitze dieses Berges stand ein Engel und sang ein Lied. Der Wind wehte die Klänge heran und formte sie zu einer Zauberballade aus dem Jenseits, dem Echo einer anderen, paradiesischen Welt.
Rowlf stieß einen dumpfen Schrei aus und taumelte in Richtung der Eingangstür davon.
Der Gesang wurde leiser und leiser, verstummte schließlich und machte einem Laut Platz, der wie das gleichmäßige Weinen eines Säuglings klang.
»Komm endlich!«, schrie Rowlf von der Tür her. »Wir müssen raus hier! Ich hol Harvey!« Er wandte sich in Richtung der Küche, kam aber nicht weit. Eines der wertvollen Gemälde aus dem Besitz Roderick Andaras rutschte von der Wand herab und verkantete sich genau vor der Tür.
Ein Kreischen klang auf und übertönte das Weinen des Neugeborenen. Das Haus ächzte und knirschte in allen Fugen. Ein Albdruck, den Howard nur zu gut kannte, legte sich über das Haus. Der Odem des Bösen!
Von der Decke begann Kalk zu rieseln. Der Tisch, an den sie sich hatten setzen wollen, stürzte um und zerbrach mit einem scharfen Knall in zwei Teile.
Howard eilte Rowlf nach. Er hatte schon einiges in diesem Haus erlebt, aber diesmal erschien ihm das Abwehrverhalten von Andara-House als besonders konzentriert und auf ein bestimmtes Ziel gerichtet.
Irgendwo war das Böse; er spürte es jetzt ganz deutlich. Es war nicht hier unten in der Halle. Es musste draußen sein oder in einem der oberen Stockwerke.
Eine plötzlich aufflammende, grelle Lichtflut blendete Howard. Er kniff die Augen zusammen. Sein scharf geschnittenes Gesicht spannte sich unter der Konzentration so stark an, dass die Wangenknochen überdeutlich hervortraten. Seine Lippen wurden zu schmalen Strichen, und wer Howard jetzt erblickt hätte, hätte den Eindruck eines durch und durch bösen und hinterhältigen Menschen gewonnen. Die Konzentration und der Versuch einer Abwehr nötigten ihm all seine Kräfte ab.
Die Lichtflut kam von dem Fenster her. Das Muster aus zwölf flammenden Strahlen breitete sich ein drittes Mal auf dem Fußboden aus. Der schwarze Punkt in dem ovalen Fleck in der Mitte breitete sich zuckend aus, pulsierte wie ein lebendes Herz und schwoll weiter und weiter an, bis er das Oval überdeckte. Er verschlang die Strahlen, und das Licht wurde immer dünner und schwächer. Dann hatte er die Ausmaße des Strahlenkranzes erreicht und waberte unruhig auf und ab, ein diffuses Gebilde voll düsterer Magie, das die beiden Menschen in diesem Raum bannte. Howard konnte sich nicht mehr rühren, war sogar unfähig, auch nur einen Warnruf auszustoßen.
Er hätte Rowlf ohnehin nicht helfen können. Der Hüne stand mit nach vorn gekrümmtem Oberkörper da, die Arme steif wie Hölzer. Seine Brust hob und senkte sich, sein Gesicht war in Schweiß gebadet, der rasch winzige Rinnsale bildete, die den Hals hinab zum Hemdkragen rannen und darin versickerten.
Das wabernde Gebilde pulsierte jetzt stärker, wuchs noch einmal an, bis es fast den halben Raum ausfüllte – und explodierte mit einem Knall, der die Fenster klirren ließ und Howard schmerzhaft in den Ohren dröhnte. Dann war es vorbei. Nur das Licht aus den Lüstern hing noch zitternd über der Halle, und nach der grellen Explosion wirkte es fast dunkel.
Ein Schrei ließ Howard zusammenzucken. Der Bann, der ihn zur Bewegungslosigkeit verdammt hatte, verschwand mit einem Schlag. Er sah, wie Rowlf vornüber zu Boden stürzte, und wollte zu ihm eilen, als der Boden wieder zu beben begann, sich hob und senkte wie der Pfropfen auf einem kurz vor der Eruption stehenden Vulkan.
Rowlf war bewusstlos. Doch Howard war sicher, dass der Schrei nicht von ihm gekommen war.
Harvey!, durchfuhr es ihn. Harvey war in Gefahr!
Der Schrei wiederholte sich. Schrill und hoch hörte er sich an, höher fast, als das menschliche Ohr zu hören vermag, dabei von solcher Lautstärke, dass er Howard für kurze Zeit taub werden ließ. Keuchend hielt Howard inne und lauschte. Das war nicht Harvey! Das war nicht einmal ein Mensch!
Und dann klang die Stimme auf. Sie war überall – in jedem Raum des Hauses und auch tief in ihm selbst. Sie sprach nicht direkt zu Howard, sondern zu allen, die in der Lage waren, sie zu hören.
»Andara!«, schrie die Stimme. Sie klang irgendwie menschlich und doch so anders. Sie erinnerte ihn – ja, woran? Der Gedanke wollte Howard wieder entgleiten, doch er hielt ihn mit aller Macht fest. Und dann erkannte er die Stimme.
Es war das Haus selbst! Es rief nach seinem früheren Herrn! Howard fragte sich, was vorgefallen sein konnte. Panische Angst befiel ihn plötzlich, Angst um Robert.
»Howard!« Rowlf war erwacht. Seine Lippen bebten, die Augenlider zuckten nervös. Mühsam bewegte er einen Arm nach oben. »Es ist dort!«
Gleichzeitig drang das Bersten von Holz und Glas in die Halle herab. Es kam von oben, aus dem ersten Stockwerk, dort, wo sie ihre Zimmer hatten, wo Roberts Bibliothek mit der Uhr lag, dem Tor der GROSSEN ALTEN.
Mit zwei, drei Sätzen stand Howard am unteren Ende der Treppe. Er streckte sich, riss den Zierdegen von der Wand am Aufgang und stürmte die Treppe empor, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Oben angelangt, sah er sich hastig um.
Der Korridor lag ruhig da. Der eine Teil zur Treppe hin bot das gewohnte Bild. Der andere bis zur Balkontür wurde von dickem, schwarzem Nebel verhüllt, in dem sich irgendetwas bewegte. Ein Schmatzen drang an Howards Ohren, und ein fürchterlicher Gestank stach in seine Nase. Howard kannte diesen Geruch, und er wich instinktiv einen Schritt zurück.
»Es ist ein Shoggote!«, rief er nach unten.
Ein Knurren kam als Antwort. Rowlf wuchtete das Gemälde vor der Korridortür zur Seite und ließ es achtlos fallen, als die Treppe sich aufbäumte. Eine Staubwolke stieg auf, ein Teil des Geländers löste sich aus der Verankerung und krachte unter ohrenbetäubendem Lärm in die Halle hinab.
Es war nicht das erste Mal, dass das Haus sich auf diese Weise zur Wehr setzte, aber zum ersten Mal geschah es zu einem Zeitpunkt, zu dem Robert sich nicht in der Nähe aufhielt.
Howard näherte sich wieder dem Nebel, den Degen angriffsbereit vorgestreckt. Erneut krachte es. Holz splitterte, etwas durchbrach den Nebel und krachte vor Howards Füßen auf den Teppich. Es war ein Teil der Wandverkleidung. Sie zerbrach vor seinen Augen in Tausende winziger Splitter, die sich teilweise auflösten. Der Gestank verdichtete sich.
Und dann tauchte eine der widerwärtigen plumpen Schlangen auf, einer der Tentakel des Ungetüms, das sich über den Balkon Eintritt ins Haus verschafft hatte. Mehr im Reflex denn aus logischem Denken heraus führte Howard einen blitzschnellen Streich mit dem Degen gegen den Shoggoten. Er wusste genau, dass er ihm mit dieser Waffe nichts anhaben konnte. Er machte ihn höchstens auf sich aufmerksam, und die Reaktion folgte auf dem Fuße.
Gleich drei Tentakel auf einmal schnellten aus der schwarzen Wolke hervor. Sie zuckten dicht an Howards Gesicht vorbei, schlangen sich um seine Schultern und rissen ihn von den Füßen. Der Degen entglitt seiner Hand und polterte auf den Teppich. Howard wurde in die Wolke hineingerissen. Der Gestank raubte ihm augenblicklich den Atem, sein Körper prallte gegen etwas Weiches, Nachgiebiges. Es war glitschig und kalt, und es verströmte diesen bestialischen Geruch. Für eine schreckliche, endlose Sekunde presste ihn der Shoggote fest an sich, um ihn dann, mit einem gewaltigen Ruck, von sich zu werfen.
Howard schoss durch die Luft. Er streckte die Arme instinktiv von sich, registrierte mit einem kleinen Teil seines Bewusstseins, dass kein Tentakel ihn mehr umklammerte. Er flog aus dem Nebel hinaus, sah die Brüstung des Treppenhauses unter sich, griff mit einer geistesgegenwärtigen Bewegung nach dem steinernen Geländer und suchte nach einem Halt. Seine Hand rutschte ab, aber sein linker Fuß blieb zwischen zwei der Säulen hängen, die ihren Führungssims verloren hatten. Ein furchtbarer, reißender Ruck ging durch seinen Körper. Er krümmte sich, seine Hände schwangen zurück, bekamen eine der benachbarten Steinsäulen des Geländers zu fassen und umklammerten sie. Gleichzeitig rutschten seine Beine ab und rissen den Körper nach unten.
Howard fand nicht einmal Gelegenheit, nach Luft zu schnappen. Tief unter ihm schwang der Boden der Halle hin und her, gut sechs, sieben Yards entfernt. Ein Sprung aus dieser Höhe konnte ihm sämtliche Knochen im Leibe brechen.
»Rowlf!«, schrie er, aber der Hüne hörte ihn nicht. Im Lärm des Shoggoten ging selbst sein Schreien unter.
Die Steinsäule, an die er sich klammerte, zitterte plötzlich und brach ab. Howard schrie abermals, als er endgültig den Halt verlor, über die Brüstung kippte und in die Tiefe fiel. Die Welt drehte sich vor seinen Augen. Er ruderte mit den Armen, wirbelte herum, sah die steinernen Fliesen der Halle in rasender Geschwindigkeit näher kommen. Und wusste im gleichen Moment mit schrecklicher Gewissheit, dass er sich das Genick brechen würde.
Ein Schatten wuchs unter ihm auf. Rowlfs zupackende Pranken schnellten empor, fingen ihn auf. Wie ein Geschoss traf Howard auf den Hünen, riss ihn zu Boden und zurück. Das rettete ihnen das Leben. Reste des Geländers stürzten hinter ihnen auf die Fliesen herab und zerbarsten in einem feurigen Funkenregen. Howard und Rowlf rollten noch ein Stück weit und blieben dann ineinander verschlungen liegen.
»Tut mir leid«, knurrte Rowlf. »Aber ich hab’s zu spät gesehn!«
»Schon gut«, stöhnte Howard und kam wieder auf die Beine. »Wo steckt Harvey?«
»Weiß nich.«
Von dem alten Diener war nichts zu hören oder zu sehen. Er musste sich in seiner Küche verkrochen haben.
Holzteile krachten in die Halle hinab. Der Shoggote tobte sich in der Galerie aus, doch er machte keine Anstalten, sich der Treppe oder gar der Bibliothek zu nähern. Howard betastete kopfschüttelnd seine Glieder. Er hatte sich nichts gebrochen, sich aber etliche blaue Flecken und Prellungen zugezogen. Noch spürte er nicht viel. Alles wäre halb so schlimm gewesen, hätte das Haus, wenn es sich gegen das Eindringen negativer Kräfte zur Wehr setzte, wenigstens Rücksicht auf die wirklich Leidtragenden genommen. Doch es schützte nur sich selbst – Robert hatte es damals bei seinem ersten Aufenthalt in Andara-House am eigenen Leibe erlebt.
Zusammen mit Hank van der Groot, dem falschen Lovecraft, dem Agenten der Templer.
Howard schüttelte den Kopf. Diese Gedanken waren jetzt völlig unwesentlich. Sie mussten sehen, dass sie das Ungetüm im ersten Stock wieder los wurden.
Der Lärm dort oben nahm jetzt ein wenig ab. Erneut splitterte Holz, der Rahmen der Balkontür stürzte in die Halle und zerbarst in alle Einzelteile.
Draußen im Vorgarten gab es ein paar dumpfe Schläge, dann trat Ruhe ein. Die beiden Männer in der Halle lauschten aufmerksam. Nichts war mehr zu hören außer ihren schweren, hastigen Atemzügen. Der Nebel und der Gestank lösten sich langsam auf und verteilten sich in den Korridor und die große Halle. Dünne Schwaden trieben aus der offenen Balkontüre ins Freie.
Howard trat entschlossen zur Eingangstür und öffnete sie. Er warf einen Blick hinaus. Nichts. Aber was hatte er erwartet – das Ungeheuer musste längst im dichten Nebel verschwunden sein, der wie ein graues Leinentuch über der Stadt lag.
Vorsichtig trat Howard ins Freie und warf einen Blick an der Fassade empor. Das steinerne Balkongeländer war abgebrochen und in den Garten gestürzt. An der Außenfassade zog sich eine feuchte, schleimige Spur entlang, und unten, am Fundament des Gebäudes, hatte sich eine Pfütze gebildet. Sie dampfte ein wenig und löste sich rasch auf.
Howard kehrte ins Haus zurück. Das dreieinhalb Stockwerke hohe Gebäude mit seiner annähernd hundert Schritt breiten Fassade hatte sich beruhigt. Nichts bewegte sich mehr, und auch die düstere Ausstrahlung hatte sich verflüchtigt. Nur ein seltsames Wispern und Flüstern echote noch zwischen den Mauern, aber es ebbte rasch ab.
Howard trat zu der Stelle, an der der Strahlenkranz entstanden war. Er bückte sich und tastete vorsichtig mit den Handflächen darüber – oder – besser gesagt – er wollte es. Die elektrostatische Aufladung war abgeklungen, aber der Boden glühte in einem Bereich von etwa eineinhalb Yards Durchmesser. Fast hätte man sagen können, dass er kochte, doch das war übertrieben. Er bildete keine Blasen, strahlte nur Hitze aus wie eine Metallplatte über einem Herdfeuer.
»Er ist fort«, sagte Howard leise und mehr zu sich selbst als an Rowlf gewandt. »Was hat er dort oben gewollt?«
Er legte sich alle die Eindrücke zurecht, die er aufgenommen hatte, seit das Haus erwacht war. Was hatte es mit dieser Vision des singenden Engels und dem Schrei des Neugeborenen auf sich, die er und Rowlf erlebt hatten? Und was war das Ziel des Shoggoten gewesen? Fragen, auf die er keine Antwort fand – jedenfalls noch nicht.
Howard erhob sich wieder.
»Nimm du die Küche!«, wandte er sich an Rowlf und deutete auf die Tür. »Kümmere dich um Harvey!«
Er selbst kehrte zur Treppe zurück und begann sie zu erklimmen, jederzeit darauf gefasst, dass die Stufen unter seinem Gewicht nachgaben, sofern sie noch vorhanden waren.
Nichts geschah. Unbeschadet erreichte Howard die Galerie, die sich an drei Seiten um die Halle zog, und wandte sich in Richtung Bibliothek. Er öffnete die Tür und warf einen Blick hinein.
Der Raum wies keine Spuren einer Zerstörung auf und auch keine anderen Hinweise auf eine Benutzung. Hier war der Shoggote nicht gewesen. Nichts war verändert. Die hohe Standuhr stand an ihrem Platz.
Die Uhr! Howard trat hastig ein und ging auf den monströsen Kasten zu. Sie war alt, so alt, dass das Holz an gewissen Stellen anfing, hart und grau zu werden wie Stein. Sie besaß drei zusätzliche kleine Zifferblätter, die ein ungleichmäßiges Dreieck unter der großen, normalen Anzeige bildeten. Was diese Zifferblätter anzeigten, wusste niemand. Auf keinen Fall die Uhrzeit. Sie waren so geheimnisvoll wie das Tor, das sich in der Uhr verbarg und nur von magisch begabten Menschen wie Robert aktiviert werden konnte. Eines der Zifferblätter besaß drei Zeiger, das zweite überhaupt keine, und auf dem dritten drehten sich drei kleine spiralige Scheiben immerwährend, sodass es einem schwindlig wurde, wenn man zu lange hinsah. Aber wenigstens das große Uhrwerk hinter seinem Zifferblatt war normal und zeigte – halbwegs pünktlich – die Uhrzeit an.
Halb elf vormittags.
Howard kam nicht einmal auf die Idee, darüber nachzudenken, in welch kurzer Zeit sich alles abgespielt hatte. Er hatte nur Augen für eines.
Für die Tür.
Der Uhrkasten stand offen, aber das Schloss war unbeschädigt; die Tür war von außen geöffnet worden.
Sollte Harvey die Uhr abgestaubt und dabei vergessen haben, die Tür wieder zu schließen? Unwahrscheinlich, gestand Howard sich ein. Nachdenklich schloss er die Tür und verriegelte sie. Dann verließ er die Bibliothek und suchte jenen Teil des Korridors auf, in dem der Shoggote gewütet hatte. Das Verhalten des Protoplasmageschöpfes war widersinnig. Es war gekommen und wieder gegangen, ohne sich direkt um die Bewohner des Hauses zu kümmern.
Was hatte es gewollt? Oder vielmehr wen?
Robert?
Oder Priscylla?
Der Nebel hatte sich endgültig verzogen und gab nun den Blick auf den vorderen Teil des Korridors frei. Die Trümmer der Balkontür lagen weit verstreut umher, vermischt mit den Holzsplittern der Wandverkleidung, die der Shoggote entfernt hatte. Der blanke Putz lag frei, und die Wand wies deutliche Spuren von Tentakeln auf, die mit titanischer Kraft darübergeglitten waren.
»Haben Necrons Erben dich geschickt?«, zischte Howard. »Bereuen sie es, dass er Pri aus seinen Händen gegeben hat?«
Er stieg über die Trümmer, näherte sich der nackten Wand und wandte ein wenig den Kopf, um die Spuren besser erkennen zu können, die der Shoggote darauf hinterlassen hatte.
Im nächsten Augenblick war es Howard, als würde sein Schädel platzen. Der Anblick löste etwas in ihm aus, wogegen er sich eigentlich gewappnet fühlte. Seine Augen traten aus ihren Höhlen, feurige Ringe begannen vor ihnen zu kreisen. Er verlor sein Gleichgewichtsgefühl und versuchte die Hände vor das Gesicht zu schlagen. Es ging nicht. Sie klebten an den Hüften und waren schwer wie Blei.
Howard Lovecraft stieß einen Schrei aus, so lang anhaltend und schrill, wie ihn nur ein Mensch in höchster Lebensgefahr oder im Angesicht des Todes ausstoßen konnte; in der schrecklichen Erkenntnis, dass es kein Zurück und keine Rettung mehr für ihn gab …
Auch vierzehn Jahre nach Erfüllung seiner weltweit Aufmerksamkeit erregenden Wette, in achtzig Tagen um die Welt zu reisen, hatte sich in der Lebensweise von Phileas Fogg nichts geändert; oder zumindest nicht viel im Vergleich zu vorher. Er hatte Aouda mit nach London gebracht und sie geheiratet. Zwei Söhne hatte er mit ihr, inzwischen zwölf und elf Jahre alt. Sie eiferten deutlich ihrem Vater nach und besaßen in ihrer Mutter eine Frau, die aufgrund ihrer Herkunft all jene Eigenschaften mitbrachte, die in der industrialisierten Gesellschaft doch manchmal ein wenig zu kurz kommen: Bescheidenheit, Sparsamkeit und Sinn für Häuslichkeit, verbunden mit einer meist nur Frauen eigenen, glühenden Liebe und Aufopferungsbereitschaft, die ein Mensch wie Phileas Fogg so dringend benötigte, da sie seinen eigenbrötlerischen Lebensstil ein wenig verschluckte und überdeckte.
Aouda war ganz Dame, elegant und doch einfach, und wenn sie an langen Kaminabenden die Märchen und Sagen aus ihrer Heimat Indien erzählte, dann saßen nicht nur die beiden Knaben mit geröteten Wangen vor dem knisternden Feuer, nein, auch Phileas Foggs Augen leuchteten, und dann und wann ergänzte er die Erzählungen durch die eine oder andere Einzelheit, die er auf seiner langen Weltreise erfahren hatte.
Es war schon erstaunlich, dass Mr. Fogg die Abende zu Hause bei seiner Familie und nicht in seinem über alles geliebten Club verbrachte. Dort ging er nur hin, um sein Mittagsmahl einzunehmen; das aber tat er nach wie vor mit der ihm eigenen Pünktlichkeit. Seit er seine Wette gewonnen hatte, war er noch angesehener und beliebter, und die Mitglieder des Reform Club behandelten ihn wie den Ersten unter seinesgleichen.
Es gab Fälle, wo einflussreiche und mächtige Vertreter der Gesellschaft versucht hatten, Mitglied im Reform Club zu werden, allein um die Bekanntschaft von Phileas Fogg zu machen. Der Club suchte sich seine Mitglieder jedoch selbst aus, und er überschritt eine bestimmte Anzahl nicht, sodass Phileas Fogg davon verschont blieb, von Gunsthaschern auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden.
Zudem hatte er im Verlauf dieser vierzehn Jahre eine eigentümliche Erfahrung gemacht, die sein Weltbild ein wenig ins Wanken brachte: Die Welt wurde immer schnelllebiger. Ein Rekord brach den anderen, eine Pioniertat hetzte die nächste. So kam es, dass nach relativ kurzer Zeit niemand mehr von seiner Ruhmestat sprach. Die Gesellschaft ließ ihn in Ruhe und lud ihn nicht mehr zu den Empfängen und Veranstaltungen, die er ohnehin nur selten besucht hatte, und sei es nur, um seiner Frau einen kleinen Beweis seiner Liebe zu geben. Mit der Liebe war es bei Mr. Fogg wie mit allem. Sie gedieh tief im Innern, nicht so sehr nach außen hin. In dieser wichtigen Lebenseinstellung war er seiner Aouda so ähnlich, wie es ähnlicher nicht ging, offenbarte sie doch den seelischen Tiefgang des Naturmenschen, nicht das oberflächliche Gebaren des neuzeitlichen Menschen.
Dies jedoch nur am Rande, denn ein wenig mochte diese seine Verinnerlichung den Ausschlag gegeben haben, warum Mr. Phileas Fogg von einem unnahbaren Schicksal (oder einem launischen Gott) dazu ausersehen worden war, eine Rolle in einem düsteren Spiel zu spielen.
Punkt 11 Uhr 30 also verließ Mr. Fogg sein Haus in der Savile Row. 575 Mal setzte er den rechten Fuß vor den linken und 576 Mal den linken vor den rechten, dann stand er vor dem Eingang des Reform Club, dessen imposante Heimstätte in der Pall Mall nicht weniger als drei Millionen Pfund gekostet hatte.
Phileas Fogg schaute nicht nach rechts und nicht nach links; deshalb hatte er auch den Schatten nicht bemerken können, der ihm gefolgt war, seit die Haustür hinter ihm ins Schloss gefallen war. Er suchte unverzüglich den Speisesaal auf. Der Raum besaß neun Fenster, die auf den hübschen Garten hinausgingen, in dem sich die herbstlich bunten Blätter gerade in einem leichten Wind bewegten. An seinem immer für ihn reservierten Tisch war das Gedeck bereits aufgelegt. Die Speisekarte lag geometrisch exakt neben der Serviette, so wie sie es immer tat. Phileas Fogg nahm Platz und studierte sie eingehend.
Er wartete, bis einer der dienstbaren Geister sein Nicken bemerkte und herankam. Er wählte eine Vorspeise, dann als ersten Gang gedünsteten Fisch in erstklassiger Reading-Sauce, als zweiten Gang leicht gegrilltes Roastbeef mit Pilzbeilage und als Nachtisch ein Stück Pastete mit Rhabarber- und Stachelbeerfüllung sowie etwas Chester-Käse. Dann lehnte er sich gemütlich zurück und wartete darauf, dass serviert würde.
Heute war der Jahrestag. Der vierzehnte Jahrestag, dass er jene Wette abgeschlossen hatte. Von seinen Wettkameraden hielt sich keiner im Club auf; zwei waren zwischenzeitlich verstorben, die anderen geschäftlich unterwegs.
Nun denn, Phileas Fogg hätte es für vulgär gehalten, mit den Schultern zu zucken. Er musterte seine Hände, die sorgfältig auf der Tischfläche links und rechts neben seinem Gedeck lagen, die Handgelenke auf der Höhe der Tischkante.
Er wartete, als einer der Kellner lautlos neben ihn trat und ihn fragte, ob er eine Mitteilung machen dürfe.
Fogg nickte. Das Ansinnen war außergewöhnlich, und es weckte sein Interesse.
»Am Eingang zum Club ist ein Herr. Er lässt sich nicht abweisen. Er behauptet fest, eine Verabredung mit Ihnen zu haben, Sir!«
Fogg hatte keine Verabredung. Nie hatte er sich mit jemandem im Club verabredet außer mit anderen Clubmitgliedern. Dass der Fremde am Eingang warten musste, bedeutete, dass er nicht Mitglied war.
»Die Karte!«, seufzte Mr. Fogg.
Der Kellner reichte ihm die Visitenkarte. Fogg studierte sie flüchtig.
Prof. James Moriarty, stand darauf. Mehr nicht. Keine Adresse, keine genaue Berufsbezeichnung. Ein Professor? Seltsam … Der Name kam ihm irgendwie bekannt vor, und doch wusste er ihn nicht einzuordnen.
»Führen Sie ihn herein«, sagte er knapp.
Der Kellner entfernte sich, und eine Minute später betrat ein Mann den Speisesaal, der Mr. Fogg sofort unsympathisch war. Es lag nicht allein an dem Äußeren dieses Mannes, an seinem Gesicht und seinem Habitus. Fogg beobachtete seine Bewegungen, die eckig wirkten und etwas Lauerndes an sich hatten. Die Beine bewegten sich in zwei verschiedenen Rhythmen. Alles in allem war dieser Moriarty ein äußerst unausgeglichener Mensch.
»Mr. Fogg?«, fragte er und verbeugte sich höflich.
»Bitte, nehmen Sie Platz.« Phileas Fogg machte eine einladende Handbewegung zu dem Stuhl gegenüber. Der Fremde gab seinen Hut und seinen Stock ab und setzte sich.
Phileas Fogg musterte die kleinen, glitzernden Augen seines Gegenübers. Ein Schauer rann seinen Rücken hinunter, aber er ließ sich nichts anmerken. Er rückte seine Hände auf dem Tisch zurecht, nahm sie wieder hoch und verschränkte die Arme vor der Brust. Er lehnte sich zurück. Deutlicher konnte er seine Zurückhaltung nicht zum Ausdruck bringen.
»Was verschafft mir die Ehre?«, fragte er mit verhaltener Stimme.
Sein Gegenüber lächelte verbindlich. »Ein alter Glaube«, erwiderte er. »Ich glaube, dass Sie damals vor vierzehn Jahren nicht aufrichtig waren. Zwar ist der Verlauf Ihrer Reise damals genau analysiert und beobachtet worden, aber es muss einen Haken geben. Achtzig Tage für damalige Verhältnisse?«
»Alle Welt hat es bestätigt«, erwiderte Mr. Fogg noch leiser. »Was wollen Sie?«
»Fünfzigtausend Pfund, wenn Sie es in sechzig Tagen schaffen! Bedenken Sie, die Verkehrsmittel sind schneller und die Verbindungen besser geworden. Lassen Sie sich Zeit mit Ihrer Entscheidung. Ich kann warten. Wenn Sie wünschen, tue ich es draußen auf der Straße!«
»Nein, nein. Bleiben Sie sitzen«, hauchte Fogg. Alles, was recht war, aber Aufsehen erregen wollte er nicht. Und das Angebot des Fremden … Es klang verlockend, in der Tat. Er musste gestehen, dass Moriarty dabei war, ihn bei seiner Ehre als Gentleman zu packen. Er tat es ohne Umschweife und dennoch geschickt.
Wenn da nur nicht dieser Eindruck gewesen wäre. Moriartys Augen waren seltsam starr, seine Lippen zuckten unaufhörlich im linken Mundwinkel. Die Habichtsnase sonderte stark Feuchtigkeit ab, und der Professor wischte sich in raschen Abständen mit einem Tuch darüber.
»Abgesehen davon, dass damals nicht der Hauch eines Betruges im Spiel war«, erklärte Mr. Fogg schließlich, »und das kann ich mit meiner Ehre bezeugen, werden Sie kaum ernsthaft das Gegenteil behaupten wollen. Ich bin ein guter Fechter und präziser Schütze.«
»Das ist ein Missverständnis«, bellte Moriarty lauter als nötig. »Nie würde ich Ihre Ehrenhaftigkeit anzweifeln. Es geht mir darum, Sie auf friedliche Weise herauszufordern. Schlagen Sie ein?«
Nie hätte Phileas Fogg es fertig gebracht, diese skelettartig dürre Hand zu ergreifen und damit sein Wort zu besiegeln. Wider seinen Gewohnheiten erhob er sich und schritt hinüber in das Raucherzimmer. Er bat mehrere Herren zu sich heraus und eröffnete ihnen sein Anliegen.
»Ich benötige einige Zeugen, meine Herren«, meinte er lächelnd. »Dieser Mann ist Professor James Moriarty, und er fordert mich heraus, meine Leistung von damals zu wiederholen. Diesmal soll ich die Welt in sechzig Tagen umfahren!«
»Unmöglich!«, rief jemand spontan.
»Nicht unmöglich«, widersprach Fogg. »Damals hieß es auch, es sei unmöglich. Dennoch habe ich es geschafft. Ich war sogar einen Tag zu früh, haben Sie das vergessen?«
Natürlich wussten sie es noch, und nun wurden sie Zeuge, wie Mr. Fogg sich leicht vor Professor Moriarty verbeugte.
»Ich willige ein. Fünfundzwanzigtausend Pfund vorher, der Rest danach. Sind Sie einverstanden?«
James Moriarty schien fest damit gerechnet zu haben, dass er Erfolg haben würde. Er holte ein Bündel Scheine aus seinem Mantel und zählte fünfundzwanzigtausend Pfund auf den Tisch. Hobbs, einer der Diener des Clubs, nahm sie auf und verwahrte sie am Körper.
»Damit ist der Akt vollzogen«, stellte Fogg fest. »Ich danke Ihnen, meine Herren!«
Er wartete, bis die Zeugen sich in das Raucherzimmer zurückgezogen hatten, und setzte sich wieder auf seinen Stuhl.
»Zufrieden?«, fragte er den Professor.
»Beinahe!« Moriarty lächelte ein viel sagendes, unheimliches Lächeln. »Sie werden mir eine Bitte nicht abschlagen. Hier!« Er zog einen kleinen schwarzen Lederbeutel hervor und setzte ihn Phileas Fogg vor die rechte Hand. »Der Beutel ist versiegelt. Sie dürfen ihn nicht öffnen. Aber Sie werden ihn mit auf die Reise nehmen. Er enthält etwas, womit ich Ihren Weg genau verfolgen kann. Dadurch erspare ich mir Beobachter und weiß dennoch, ob Sie ehrlich sind oder nicht!«
»Wenn Sie noch im Zweifel sind, bin ich nicht Ihr Mann«, sagte Fogg eisig. Er bereute es bereits, sich mit Moriarty eingelassen zu haben. »Was ist da im Spiel? Magie?« Sein Lächeln zeigte Moriarty, dass Fogg in allen Wissenschaften bewandert war und die Hintergründe vieler magischer Kunststücke besser kannte als mancher Schamane.
»Magie«, bestätigte Moriarty. »Überlassen Sie es mir, ob sie wirkt oder nicht. Aber Sie müssen den Beutel wieder mit zurückbringen. Es gibt vielleicht Menschen, die seine Kräfte erkennen und Sie unterwegs belästigen, weil sie an ihm interessiert sind. Lassen Sie sich von ihnen nicht beeinflussen.«
Er erhob sich und machte eine Verbeugung. »Und brechen Sie innerhalb der nächsten drei Tage auf. Auf Wiedersehen!«
Er wandte sich um und ging hinaus, und mit jedem Schritt, den er sich entfernte, wurde Phileas Fogg nachdenklicher. Er winkte Hobbs herbei und trug ihm auf, das Geld mit einem Boten zu sich nach Hause bringen zu lassen. Dann begann er mit der Vorspeise und nahm seine Mahlzeit zu sich. Er hatte sich auf sie gefreut, doch sie schmeckte ihm nicht mehr.
Etwas war in ihm, ein bohrender Zweifel und der vergebliche Versuch seines Bewusstseins, sich gegen irgendeinen hypnotischen Zwang zur Wehr setzen zu müssen. Es gelang ihm nicht, seine innere Unruhe abzuschütteln, und die Angestellten des Clubs beobachteten verwundert, dass Phileas Fogg diesmal auf die Lektüre der wichtigsten Tageszeitungen verzichtete, den Lederbeutel einsteckte und den Club verließ, kurz nachdem er mit dem Nachtisch fertig geworden war.
Mr. Fogg trug eine nachdenkliche Miene zur Schau. Er wusste, dass er mit Aouda ein besonders ernstes und liebevolles Gespräch würde führen müssen. Und er durfte es nicht unterlassen, seinen Diener Passepartout mit den nötigen Reisevorbereitungen zu beauftragen.
Roter, wallender Nebel hüllte sein Bewusstsein ein. Er peinigte ihn, aber sein Mund war unfähig zu schreien, seine Ohren unfähig zu hören. Seine Augen sahen nicht, und sein Hals war wie zugeschnürt.
Howard Lovecraft merkte nicht, wie er stürzte und der Länge nach zu Boden schlug. Er verstauchte sich das linke Handgelenk dabei und stieß sich die Ellbogen wund, doch er spürte es nicht einmal. Er war gefangen in einem Bann, gegen den er nur mit äußerster Konzentration hätte ankommen können.
Und die besaß er im Augenblick nicht. Der Angriff hatte ihn überrumpelt, noch ehe er das Ding an der Wand genau hatte erkennen können.
Der Shoggote hatte ihm eine Falle gestellt, das begriff Howard mit dem letzten Rest seines Bewusstseins. Und er hatte sich darin gefangen wie die Fliege im Netz der Spinne. Die Falle umklammerte ihn mit fast körperlicher Gewalt und zog ihre Fessel immer enger.
Lovecraft nahm nicht wahr, wie Rowlf mit stampfenden Schritten die Treppe heraufstürmte und sich über ihn warf. Er begann sich am Boden zu wälzen und entwickelte schier übermenschliche Kräfte. Er schüttelte den Hünen ab, erkannte für einen winzigen Sekundenbruchteil dessen breitflächiges Gesicht mit den besorgten Augen über dem seinen, dann war da nur noch der rote Nebel.
Dennoch gab Howard nicht auf. Er hatte einst eine intensive und lange Ausbildung genossen, hatte als Master des Templerordens in alle Geheimnisse der weißen Magie Einblick erhalten und sich in ihrer Anwendung geübt – ein paar Dinge ausgenommen, deren Geheimnisse nur dem Großmeister des Ordens vorbehalten waren.
Jean! Jean Balestrano!
Er begann innerlich zu lachen, als er daran dachte, was inzwischen aus dem mächtigen Orden geworden war. Seine Gedanken waren von einer Klarheit, die ihn alarmierte. Er dachte an die Ordensburgen, die er besucht hatte, und an jenen Weg, der für ihn der schwerste gewesen war: als er Sarim de Laurec aufgesucht hatte, den Puppet-Master, um sich dem Todesurteil der Templer zu stellen.
Robert hatte ihn gerettet, aber Robert war jetzt nicht da. Also musste er sich selbst helfen.
Ein weißer Punkt glühte in seinem Bewusstsein auf, erweckt durch den Gedanken an den Freund. Der weiße Punkt wurde zu dem Strahlenkranz, mit dem das Haus ihn und Rowlf vor dem Shoggoten hatte warnen wollen.





























