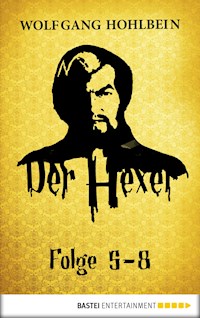
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Das Haus am Ende der Zeit" - Folge 5 - gehörte zu den ursprünglich als Gespensterkrimi erschienenen Episoden des HEXERS.
Von außen hatte das Haus nur groß und finster ausgesehen; vielleicht ein ganz kleines bisschen düster, wie es die Art alter, einsam stehender Herrenhäuser nun einmal ist; mit einer Spur von Bedrohung und dem leichten Hauch des Unheimlichen, der von seinen von den Jahrzehnten geschwärzten Mauern ausging. Aber trotz allem nicht mehr, als eben ein Haus, das seit einem Menschenalter vergessen und seit zweien verlassen hier mitten im Wald stand. Das war das Äußere gewesen. Innen war es unheimlich. Unheimlich und - gefährlich.
"Im Schatten der Bestie" - Folge 6 - gehörte zu den ursprünglich als Gespensterkrimi erschienenen Episoden des HEXERS.
Wie oft nach einem schweren Sturm lag das Meer ruhig und schon fast unnatürlich glatt da. Es war still, und selbst das Geräusch des Windes, der die ganze Nacht lang um die Kanten und Grate der turmhohen Steilküste geheult und die Wellen in weißer Gischt an ihrem Fuß hatte zerbersten lassen, war verstummt, als die Sonne aufgegangen war. Der einzige Laut, der die Stille durchbrach, waren die Schritte der drei Männer, die sich vorsichtig an dem Rand der grauweiß marmorierten Wand näherten und in die Tiefe blickten. Das gigantisch graue Etwas, das sich lautlos der Küste genähert hatte und lauernd zwischen den Riffen lag, bemerkte keiner von ihnen ...
"Bücher, die der Satan schrieb" - Folge 7 - gehörte zu den ursprünglich als Gespensterkrimi erschienenen Episoden des HEXERS.
Das Licht der Petroleumlampe warf flackernde Muster an die Wände und schuf Leben, wo keines war. Ein muffiger Geruch hing in der Luft, und unter den Schuhsohlen der beiden Männer knirschten Unrat und staubfein zermahlene Glassplitter. Ein Spinnennetz wehte wie ein grauer Vorhang im Wind, und aus der Tiefe des Gebäudes drangen unheimliche, rasselnde Geräusche. Laute, die in der überreizten Phantasie Tremayns zu einem mühsamen schweren Atmen wurden. Er blieb stehen. Die Lampe in seiner Hand zitterte, und für einen Moment musste er mit aller Gewalt gegen den immer stärker werdenden Zwang ankämpfen, einfach herumzufahren und zu laufen, so schnell und so weit er konnte, nichts wie weg; weg aus diesem verwunschenen, finsteren Haus, das ihm mit jedem Moment mehr wie ein gewaltiges feuchtes Grab vorkam ...
"Der Baumdämon" - Folge 8 - gehörte zu den ursprünglich als Gespensterkrimi erschienenen Episoden des HEXERS.
"Still!" Howard legte warnend den Zeigefinger über die Lippen, presste sich dichter gegen die Wand und wartete mit angehaltenem Atem, bis die Stimme und Schritte näher gekommen und wieder verklungen waren. Erst dann wagte er es, sich vorsichtig aus dem Schatten zu erheben und geduckt zu uns zurück zu huschen. Mit einer fahrigen, nervös wirkenden Bewegung, die seine Erschöpfung mehr als alles andere verriet, ließ er sich zwischen Rowlf und mir in die Hocke sinken, fuhr sich mit dem Handrücken über das Gesicht und deutete mit dem Daumen zurück. "Ich glaube wir können es riskieren" murmelte er. "Es sind nur noch ein paar Blocks. Es wird dunkel."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Das Haus am Ende der Zeit
Der Hexer – Im Schatten der Bestie
Der Hexer – Bücher, die der Satan schrieb
Der Hexer – Der Baumdämon
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 5-8:
Der Hexer – Das Haus am Ende der Zeit
Der Hexer – Im Schatten der Bestie
Der Hexer – Bücher, die der Satan schrieb
Der Hexer – Der Baumdämon
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 5–8
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1569-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 5–7
Wolfgang Hohlbein gibt in ebenso informativen wie amüsanten Vorworten Einblick in die heiße Schaffensphase der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel gleich auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 5 bis 7.
Das Wunder geschah: DER HEXER überstand nicht nur die ersten drei Bände, sondern kurz, nach dem die ersten Abenteuer Robert Cravens erschienen, passierte etwas sehr Sonderbares (und für mich durchaus Erfreuliches, um ehrlich zu sein): Schon die ersten Romane sorgten für ziemliches Furore im damaligen »Fandom.«
Was das ist?
Ja, ja, die Frage habe ich befürchtet …
Auch wenn sich diese E-Book-Sammleredition – wie der Name schon sagt, ha, ha – zu einem Gutteil an Sammler richtet, die sich schon per Definitionem vermutlich eher in der Historie des Heftromans auskennen, lassen Sie uns ein paar Augenblicke in Erinnerungen schwelgen; Erinnerungen an die goldenen Zeiten des Heftromans, in denen es noch ganze Heerscharen begeisterter Fans gab, die die regelmäßig erscheinenden Abenteuer ihrer Lieblingshelden nicht nur ebenso regelmäßig kauften (wichtig), sondern auch lasen (nicht ganz so wichtig) und darüber redeten, die Geschichten analysierten und besprachen (manchmal ziemlich lästig; vor allem, wenn sie anfangen, die Romane besser zu kennen als die Autoren …) und sich in Fanclubs zu organisieren. Es war schon eine tolle Zeit – auch wenn der Zenit des Fandoms im Grunde schon überschritten war, was gottlob damals aber noch niemand wusste: Man tauschte Briefe aus, organisierte sich in Hunderten von Fanclubs, brachte sein eigenes Fanmagazin heraus (auf einem Spiritusdrucker erstellt, Auflage zwischen 30 und 200) und veröffentlichte selbstgeschriebene Geschichten mit den Helden seiner Lieblingsserie – manchmal waren zwar die Seiten in der falschen Reihenfolge zusammengeheftet, oder die Geschichten waren so toll, dass der »echte« Autor schon mal das dringende Bedürfnis verspürte, zum Knüppel (oder doch wenigstens zum Telefon) zu greifen und dem bösen Spiel ein Ende zu bereiten (nicht wahr, Dennis?), aber es war dennoch eine sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Man traf sich am Wochenende zum regelmäßigen »Horror-Talk« in der Kneipe um die Ecke, und alle paar Wochen, vorzugsweise im Sommer, weil das Übernachten in Schlafsack und Zelt billiger war, wurden »Cons« abgehalten, zu denen die Fans zum Teil aus dem ganzen Land anreisten. Okay, ich weiß, das alles gibt es auch heute noch, aber irgendwie ist es anders geworden. Die wunderbare Naivität und (ja, ja, ich meine dieses große Wort durchaus ernst) Unschuld dieser Zeit ist irgendwie dahin.
Vielleicht werde ich aber auch einfach nur alt …
Also gut, stecken wir die Taschentücher wieder ein. Ich wollte erzählen, wie das »Fandom« auf den HEXER reagierte.
Heftig.
Ganz unerwartet heftig sogar.
Der Verlag erstickte geradezu in einer Flut von Briefen und Anrufen, die mehr über die neue Serie wissen wollten, mehr über die Hintergründe, mehr über die Entstehungsgeschichte und die Pläne für die Zukunft und vor allem: mehr über den Autor. Es waren vermutlich nicht Tausende (wie mir meine eitle Erinnerung vor gaukeln will), wohl aber Hunderte von Briefen, die binnen nur vier (!) Wochen auf den Schreibtischen der drei Michaels eintrudelten, und vermutlich war es einzig und allein dieser Umstand, der zu einer verlagsinternen Entscheidung führte, die es meines Wissens nach zuvor noch nicht gegeben hatte: nämlich dem HEXER nach nur vier Bänden in der damaligen Reihe »Gespensterkrimi« zu einer eigenständigen, 14-tägig erscheinenden Reihe zu machen. Da wir einen gewissen Vorlauf brauchten, wurden dann doch acht Bände daraus, aber das war nicht das Problem.
Das eigentliche Problem war, dass ich ganz offensichtlich der einzige war, der all diese Briefe gelesen hatte und ergo wusste, was darin stand …
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 05Das Haus am Ende der Zeit
Von außen hatte das Haus nur groß und finster ausgesehen, vielleicht ein ganz kleines bisschen düster, wie es die Art alter, einsam stehender Herrenhäuser nun einmal ist, mit einer Spur von Bedrohung und dem leichten Hauch des Unheimlichen, der von seinen von den Jahrzehnten geschwärzten Mauern ausging. Aber trotz allem nicht mehr, als eben ein Haus, das seit einem Menschenalter vergessen und seit zweien verlassen hier mitten im Wald stand.
Das war das Äußere gewesen.
Innen war es unheimlich. Unheimlich und gefährlich …
Jenny vermochte das Gefühl nicht in Worte zu kleiden. Sie waren stehen geblieben, nachdem Charles das morsche Türschloss aufgebrochen und einen Flügel des gewaltigen Portals mit der Schulter aufgedrückt hatte. Ein schmaler Streifen grauer, flackernder Helligkeit sickerte hinter ihnen in die Halle, vielleicht das erste Mal seit Jahren, dass Licht die ewige Nacht hier drinnen erhellte, und durch das dumpfe, rasche Hämmern seines eigenen Herzens glaubte Jenny das Huschen kleiner, krallenbewehrter Pfoten zu hören. Ratten, dachte sie entsetzt. Natürlich. Das Haus mochte von Menschen verlassen sein, aber die Ratten und Spinnen hatten es erobert und zu ihrem Domizil gemacht. Sie hasste Ratten.
Aber das war nicht alles. Irgend etwas Seltsames, körperlos Drohendes nistete in dem alten Gemäuer, etwas, das sie weder hören noch sehen oder riechen, dafür aber um so deutlicher spüren konnte.
»Lass … lass uns wieder gehen, Charles«, sagte sie stockend. »Ich … ich fürchte mich.« Sie flüsterte, als hätte sie Angst, mit dem Klang ihrer Stimme die Geister dieses Hauses aufzuwecken, aber ihre Worte füllten die hohe, in undurchdringliche Schwärze getauchte Halle trotzdem mit kichernden Echos aus. Ein rascher, unangenehmer Schauer huschte auf eisigen Spinnenfüßen über ihren Rücken.
Charles schüttelte stumm den Kopf, berührte sie flüchtig am Arm und versuchte zu lächeln. »Unsinn«, sagte er. »Es gibt hier nichts, wovor du Angst zu haben brauchst. Das Haus steht seit fast fünfzig Jahren leer. Als Kind habe ich oft hier gespielt. Wir haben es als Versteck benutzt, aber das ist lange her.«
Jenny schauderte. Ohne dass sie sagen konnte, warum, verstärkten Charles Worte ihre Furcht noch. Ihr Herz schlug schneller. Speichel sammelte sich hinter ihrer Zunge. Sie hatte das Gefühl, dass ihr gleich übel werden würde. Ihre Handflächen wurden feucht.
»Ich will nicht hierbleiben«, sagte sie noch einmal. »Bitte, Charles!«
Charles seufzte. Sein Blick glitt zurück durch die Tür und heftete sich für einen Augenblick auf den nahen Waldrand, der rasch im dunkler werdenden Grau der Dämmerung versank. »Wir können nicht weiter«, sagte er nach einer Weile. Seine Stimme hörte sich gleichzeitig entschlossen wie bedauernd an. »Sie suchen garantiert die Hauptstraße ab, und ich gebe dir Brief und Siegel, dass sie jedes Gasthaus im Umkreis von fünfzig Meilen kontrollieren werden.« Er lächelte. »Wir können nicht draußen im Wald übernachten, das weißt du genau. Und es ist nur für eine Nacht.« Er schüttelte den Kopf, atmete hörbar ein und sah sich suchend um. »Irgendwo hier muss es eine Kerze geben«, murmelte er. »Früher lagen Dutzende davon hier herum.«
»Charles, ich …«
»Bitte, Jenny«, unterbrach sie Charles. »Morgen Abend um diese Zeit sind wir Mann und Frau und keine Macht der Welt kann uns noch trennen. Aber solange wir noch nicht offiziell verheiratet sind, müssen wir vorsichtig sein;« Er trat auf sie zu, legte die Hände auf ihre Schultern und küsste sie flüchtig auf die Stirn. »Du weißt doch genau, was geschieht, wenn deine Eltern uns erwischen, Schatz«, flüsterte er.
Jenny nickte zögernd. Natürlich wusste sie es. Dass sie es wusste, war ja gerade der Grund, aus dem sie sich entschlossen hatten, wie eine moderne Ausgabe von Romeo und Julia miteinander durchzubrennen und in Gretna Green zu heiraten. Sie war erst achtzehn und sie wusste, dass ihre Eltern alles in ihrer Macht Stehende tun würden, sie von Charles fernzuhalten. Sie hatten mehr als einmal damit gedroht, sie in ein Internat auf dem Kontinent zu schicken, wenn sie sich weiter mit Charles traf. Und ihr Vater war kein Mensch, der leere Drohungen ausstieß.
Sicher, Charles hatte recht mit jedem Wort. Und trotzdem bedauerte sie ihren Entschluss fast, seit sie dieses unheimliche Haus betreten hatten.
Charles löste sich behutsam von ihr, drehte sich herum und ging mit vorsichtigen Schritten tiefer in das Haus hinein. Jenny blieb neben der Tür stehen, achtsam darauf bedacht, den winzigen Bereich von Helligkeit hinter dem Eingang nicht zu verlassen. Charles hantierte eine Weile im Dunkeln herum, fluchte gedämpft und kam – nach Sekunden, die ihr wie Ewigkeiten erschienen – zurück. Seine Kleider waren verdreckt und staubig, und auf seiner linken Wange glänzte ein dünner, blutiger Kratzer. Aber er trug eine Kerze in der Hand. Mit einem triumphierenden Grinsen ließ er sich neben Jenny in die Hocke sinken, stellte die Kerze zu Boden und kramte eine Schachtel Streichhölzer aus der Tasche. Nach wenigen Augenblicken schlug ein gelbes, flackerndes Flämmchen aus dem Docht und trieb die Dunkelheit um ein paar Schritte zurück.
Charles richtete sich auf, gab Jenny die Kerze und schob die Tür wieder zu. Das schwere, annähernd drei Meter hohe Türblatt bewegte sich nur widerwillig. Es war verzogen und verquollen, und Charles keuchte vor Anstrengung, als es ihm endlich gelungen war, die Tür wieder zu schließen. Mit einem dumpfen, unheimlich widerhallenden Laut rastete das Schloss ein.
»Gehen wir nach oben«, schlug Charles vor. »Es gibt ein paar Zimmer, die noch ganz in Ordnung sind. Komm.« Er nahm Jenny die Kerze wieder ab, machte eine aufmunternde Kopfbewegung und ging auf die breite Freitreppe zu, die sich im hinteren Teil der Halle erhob.
Jenny folgte ihm mit klopfendem Herzen. Nachdem sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte sie im schwachen Schein der Kerze erstaunlich weit sehen. Die Halle war gefüllt mit zerbrochenen Möbelstücken, Staub und Unrat, der sich im Laufe der Jahrzehnte hier gesammelt hatte. Überall hingen Spinnweben wie graue Vorhänge und von der Decke fielen graue Staubfäden bis fast zum Boden herab. Auf den Treppenstufen lag Rattenkot, und aus einem finsteren Winkel schlug ihnen leichter Verwesungsgeruch entgegen. Dieses Haus ist kein Haus, dachte Jenny schaudernd, sondern ein Grab.
Hintereinander gingen sie die Treppe hinauf. Charles schritt schnell aus, und Jenny musste sich sputen, um mit ihm Schritt zu halten und nicht zurückzufallen. Sie erreichten das obere Ende der Treppe und traten auf eine breite, auf einer Seite offene Galerie hinaus, von der zahllose Türen abzweigten. Jenny glaubte Geräusche zu hören, das Wispern und Flüstern von Stimmen, das Schlurfen schwerer Schritte, Atmen, ein leises, unglaublich böses Lachen …
Für einen Moment stieg Panik in ihr hoch, aber sie drängte sie zurück und ballte die Fäuste, so fest, dass sich ihre Fingernägel schmerzhaft in ihre Handflächen gruben.
»Charles«, flüsterte sie. »Ich will hier raus.«
Charles blieb stehen, drehte sich langsam zu ihr herum und sah sie an. Sein Gesicht war ernst, und Jenny glaubte, das leise Flackern von Angst in seinen Augen zu erkennen.
»Ich will weg«, sagte sie noch einmal und etwas lauter als zuvor. »Bitte, Charles. Lieber übernachte ich im Wald als in diesem Haus.«
Das Wispern und Flüstern wurde lauter. Jemand lachte, ganz leise und voller boshafter Vorfreude. Charles’ Mundwinkel zuckten. Die Kerze in seiner Hand begann zu zittern, und die Flamme warf zuckende Lichtreflexe und huschende Schatten auf die Wände. Schatten, die sich auf sie zu bewegten, sie einzukreisen begannen …
»Bitte«, sagte sie noch einmal. »Ich … bleibe nicht hier.«
Charles nickte. Die Bewegung wirkte abgehackt, und auf seiner Stirn glänzte plötzlich Schweiß, obwohl es hier drinnen eher zu kalt war. Und plötzlich begriff Jenny, dass er es auch hörte. Die Stimmen und Schritte waren keine Einbildung.
»Du … hast recht«, sagte er gepresst. »Vielleicht finden wir eine andere Stelle, an der wir übernachten …«
Er sprach den Satz nicht zu Ende. Die wispernden Stimmen verstummten. Das Lachen hörte auf, und die Schatten zogen sich zurück, hörten auf, hierhin und dorthin zu huschen, sondern bildeten einen massigen, undurchdringlichen Kreis rings um sie herum. Plötzlich war es still, unheimlich still.
Aber nur für einen Augenblick. Ein helles, wimmerndes Geräusch durchdrang die Stille, ein Laut, als würde eine Tür in uralten Angeln bewegt …
Jenny fuhr mit einer abrupten Bewegung herum. Ihre Augen weiteten sich entsetzt, als sie sah, wie die Türen hinter ihr eine nach der anderen aufgingen.
Im ersten Moment sah sie nichts außer schwarzen Schatten und körperlosen, finsteren Dingen, die sich dahinter zu verbergen schienen. Dann kamen sie näher, lautlos, schleichend und unaufhaltsam.
Erst als Jenny sah, was da mit lautlosen Bewegungen auf die Galerie hinausglitt, begann sie zu schreien …
»Sagtest du: Salem?«
Es dauerte einen Moment, bis Howard auf meine Worte reagierte. Die letzten zweieinhalb Stunden hatte er mit halb geschlossenen Augen auf seinem Platz neben dem Fenster gesessen, außer einem gelegentlichen Seufzer keinen Laut von sich gegeben und – genau wie ich und Rowlf – ergeben darauf gewartet, dass die Fahrgäste, die in Carlisle zugestiegen waren, endlich wieder gingen. Howard hatte Platzkarten und Billets für das ganze Abteil gekauft, sodass wir eigentlich ungestört hätten fahren und reden können, aber der Zug war überfüllt und der Schaffner hatte Howard mit einem gleichmütigen Achselzucken geantwortet, dass er die Passagiere schließlich nicht auf den Kohletender verfrachten könne – womit er recht hatte. Es waren ein Mann und zwei Frauen (wie aus ihren Gesprächen hervorging, ein Ehepaar in Begleitung der Schwiegermutter) gewesen, eigentlich drei nicht einmal unnette Personen, denen anzumerken war, wie unangenehm ihnen die ganze Situation war. Eigentlich hatte ich sie ganz sympathisch gefunden. Aber es redete sich schlecht über Hexen, Magier und GROSSE ALTE, wenn fremde Ohren mithörten …
»Was?«, fragte Howard.
Ich wiederholte meine Frage: »Salem«, sagte ich. »Als wir gestern Abend mit … Priscylla sprachen, erwähntest du Salem.« Das unmerkliche Stocken in meinen Worten musste ihm auffallen. Obwohl ich mir alle Mühe gab, hatte ich die Ereignisse längst nicht verwunden, geschweige denn vergessen. Wie konnte ich auch? Ich liebte Priscylla noch immer. Jetzt vielleicht mehr als zuvor. Aber Howard ging nicht auf den warnenden Ton in meiner Stimme ein.
»Ich sagte Salem«, antwortete er und lehnte sich wieder zurück, als wolle er schlafen. Es war nicht das erste Mal, dass ich ihn auf seine Worte ansprach.
Und es war nicht das erste Mal, dass er nicht oder nur ausweichend antwortete. Aber dieses Mal würde ich mich nicht mit einer Ausflucht abspeisen lassen. Seine Worte ergaben keinen Sinn, außer …
Ich schüttelte den Gedanken ab und sah ihm scharf in die Augen. Howard lächelte, unterdrückte mit Mühe ein Gähnen und blickte auf die Landschaft, die vor dem Fenster vorüberhuschte. Der Zug fuhr jetzt, auf dem letzten, beinahe schnurgerade verlaufenden Stück der Strecke, mit voller Geschwindigkeit und unsere Umgebung flog nur so an uns vorüber. In weniger als zwei Stunden würden wir Glasgow erreichen. Von dort aus sollte die Reise – wenigstens hatte Howard mir dies erklärt – mit einer Kutsche weitergehen, die er telegrafisch zum Bahnhof bestellt hatte. Wenn wir erst einmal in der Stadt waren, würde er sicher genug Gelegenheiten finden, mir nicht antworten zu müssen.
»Und?«, fragte ich.
Howard blickte mit unverhohlenem Missmut auf. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er die Penetranz, mit der ich auf einer Antwort beharrte, als äußerst lästig empfand. »Was und?«, fragte er.
»Ich möchte wissen, wie du deine Worte gemeint hast«, sagte ich, nicht sehr laut, aber mit großem Nachdruck. Etwas hatte sich zwischen uns geändert. Während der letzten beiden Tage war er wie ein väterlicher Freund zu mir gewesen, und jetzt …
Ich konnte das Gefühl selbst nicht in Worte fassen. Es war keine Feindschaft, nicht einmal Misstrauen. Aber es gab eine fühlbare Spannung zwischen uns. Er verschwieg mir etwas, und ich spürte es.
Howard seufzte, schüttelte den Kopf und rutschte auf dem unbequemen Sitz hin und her. »Du machst dir Sorgen um Priscylla«, sagte er. »Das verstehe ich, Junge. Aber sie ist bei Dr. Grays Freunden in den besten Händen. Sie haben Erfahrung in solchen Dingen, glaube mir. Wenn es jemanden gibt, der aus ihr wieder einen normalen Menschen machen kann, dann sie.«
»Einen normalen Menschen?« Ich hatte Mühe, den Zorn in meiner Stimme zu unterdrücken. »Du sprichst von ihr, als wäre sie geistesgestört.«
Howard sah mich ernst an. »Das ist sie auch, Robert«, sagte er leise. »Nicht so, wie man das Wort normalerweise benutzt – sie ist nicht verrückt oder gar schwachsinnig. Aber ihr Geist ist verwirrt.« Er machte eine entsprechende Bewegung zur Stirn. »Sie hat sich mit Mächten eingelassen, denen sie nicht gewachsen ist, Robert. Sie ist nicht böse; nicht wirklich. Früher war sie sogar ein ausgesprochen liebenswerter Mensch. Und es wird sehr viel Zeit und Geduld nötig sein, sie wieder zu dem Menschen zu machen, der sie war.«
»In Salem«, fügte ich hinzu.
Howards Blick verfinsterte sich. »Bitte, Robert«, sagte er leise. »Fang nicht …«
»Du verschweigst mir etwas«, unterbrach ich ihn. Rowlf, der die ganze Zeit schweigend und mit geschlossenen Augen neben Howard gehockt und so getan hatte, als schliefe er – ohne dass ich darauf hereingefallen wäre –, hob träge das linke Augenlid und blinzelte mich an.
»Du verschweigst mir sogar eine ganze Menge«, fuhr ich in scharfem, beinahe aggressivem Ton fort. »Du hast mir weder gesagt wohin ihr Priscylla bringt, noch was dort mit ihr geschieht.«
»Weil ich es nicht weiß«, behauptete Howard. »Auch Dr. Gray weiß es nicht, und das ist auch gut so. Es geschieht zu unserer und ihrer Sicherheit. Die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind sehr vorsichtig. Aber sie wissen nicht, wer wir sind. Wir haben mächtige Feinde, weißt du, und wir müssen damit rechnen, dass einer von uns in ihre Hände fällt. Was er nicht weiß, kann er nicht preisgeben.« Er lachte. »Das ist ein uralter Trick, den zum Beispiel Spionageringe verwenden, um …«
»Du weichst mir schon wieder aus«, unterbrach ich ihn. »Was hatten deine Worte zu bedeuten? Salem ist seit über hundert Jahren zerstört, und Priscylla …«
»Lyssa«, sagte Howard ruhig. »Ihr wirklicher Name ist Lyssa.«
»Das ändert nichts daran, dass Salem vor mehr als einem Jahrhundert vernichtet worden ist.«
»Isses nich«, nuschelte Rowlf. Ich hielt verstört inne und sah ihn an. Rowlf gähnte, ohne sich die Mühe zu machen, dabei etwa die Hand vor den Mund zu nehmen, kratzte sich mit den Fingern an seinem Stoppelbart und blickte mich triefäugig an. Sein Bulldoggengesicht wirkte verschlafen.
»Rowlf hat recht«, sprang Howard hilfreich – und eine Spur zu schnell – ein. »Salem wurde nicht vernichtet, wie die meisten glauben. Es gab ein Pogrom, bei dem Dutzende von Menschen getötet wurden, aber der Ort selbst existiert noch heute. Ich war dort, vor ein paar Jahren. Damals habe ich Lyssa – Priscylla getroffen.«
Ich glaubte ihm kein Wort. Es hätte nicht einmal meines Talentes, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden, bedurft, um zu erkennen, dass er log. Aber warum? Welchen Grund sollte er haben, mich zu belügen? Außer dem, dass er glaubte, mich vor irgendetwas schützen zu müssen.
»Lyssa«, murmelte ich. »Das ist ihr richtiger Name?«
Howard nickte.
»Und weiter?«
»Weiter?«
»Kein Nachname, keine Familie, nichts?«
Howard druckste herum. »Ich weiß es nicht«, sagte er schließlich. Eine weitere Lüge. »Und es spielt auch keine Rolle.« Er seufzte, blickte wieder aus dem Fenster und fuhr, ohne mich anzusehen, fort: »Es ist nicht mehr weit bis Glasgow, Robert. Wenn der Wagen pünktlich am Bahnhof ist, dann können wir gleich weiterfahren. Wir sollten noch etwas essen, solange Zeit ist. Später werden wir keine Gelegenheit mehr dazu haben.« Er stand auf. »Lass uns in den Speisewagen gehen.«
Ich starrte ihn finster an, aber diesmal ignorierte er meinen Blick, lächelte sogar und wandte sich mit einer abrupten Bewegung zum Gehen.
Matthew Carradine hielt die Laterne so, dass der Lichtschein durch die halb offenstehende Tür des Hauses fiel. Im Zentrum des flackernden, weißgelben Kegels erschienen Staub und Unrat, Bruchstücke von vermoderten Möbeln und dunkle, unidentifizierbare Klumpen – und die halb verwischten Spuren menschlicher Füße.
»Sie waren hier«, sagte Carradine. »Vor nicht allzu langer Zeit.«
Boldwinn trat mit einem raschen Schritt neben ihn, beugte sich vor und starrte einen Moment auf die durcheinander laufenden Fußspuren. Seinem Gesichtsausdruck nach zu schließen, sagten ihm die Abdrücke im Staub nicht sehr viel. »Sind Sie sicher, Carradine?«, fragte er. Seine Stimme klang eisig; der einzige Ausdruck, der überhaupt darin mitschwang, war Verachtung.
Carradine sah wütend auf. »Hören Sie, Boldwinn«, schnappte er. »Ich …«
Boldwinn brachte ihn mit einer zornigen Bewegung zum Verstummen. Als er Carradine ansah, huschte ein Ausdruck über seine Züge, als betrachte er ein vielleicht interessantes, aber nichtsdestotrotz lästiges Insekt, das er am Schluss doch zerquetschen würde, so oder so. »Mister Boldwinn«, sagte er betont.
Carradine sog hörbar die Luft ein. Die Laterne in seiner Hand zitterte. Der Lichtstrahl huschte wie ein bleicher Finger über Boldwinns Gesicht und tastete unstet an den zerbröckelnden Außenmauern des Hauses entlang. »Wie Sie wollen, Mister Boldwinn«, sagte er. »Aber ich bin sicher, dass sie hier waren. Ich wäre es auch, wenn ich diese Spuren nicht gesehen hätte. Charles ist als Kind immer hierhergekommen, wenn er ein Versteck brauchte. Er hat wohl geglaubt, wir wüssten nichts von diesem Haus, und wir haben ihn in diesem Glauben gelassen.«
Boldwinn lächelte kalt. »Sie scheinen mir überhaupt sehr seltsame Erziehungsmethoden zu haben«, sagte er eisig. »Das Benehmen Ihres Sohnes …«
»Steht hier nicht zur Debatte«, fiel ihm Carradine ins Wort.
Boldwinns linke Augenbraue rutschte ein Stück weit seine Stirn empor. »Nicht?«, wiederholte er mit gespielter Verwunderung. »Sie werden sich wundern, was alles zur Debatte steht, wenn Ihr feiner Sohn meine Tochter auch nur angerührt hat. Sie ist noch ein Kind, vergessen Sie das nicht.«
»Ein Kind?« Carradine lachte, aber seiner Stimme fehlte die nötige Selbstsicherheit. Boldwinn war ein mächtiger Mann, das wusste er. Wenn Charles die Kleine auch nur falsch angesehen hatte, würde Boldwinn ihn vernichten, das war ihm klar. Und es war auch der einzige Grund, aus dem er hier war. Charles würde ihn hassen, wenn ausgerechnet er, sein eigener Vater, ihn verriet. Und vermutlich würde er es zu Recht tun. Aber er hatte keine Wahl.
»Lassen wir das«, sagte er, ohne Boldwinn dabei anzusehen. »Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo sind. Das Schloss ist aufgebrochen worden, sehen Sie? Und die Spuren führen nur hinein, nicht wieder hinaus. Kommen Sie.« Er machte eine einladende Bewegung mit der Laterne, schob die Tür ein Stück weiter auf und trat in die dahinterliegende Halle. Boldwinn folgte ihm nach kurzem Zögern. Auf seinem bleichen Stutzergesicht erschien ein angewiderter Ausdruck, als er den Staub und den Unrat sah, die die Jahrzehnte in der Halle abgeladen hatten.
Carradine hielt seine Laterne höher, beugte sich ein wenig vor und folgte der Fußspur, die sich deutlich im knöcheltiefen Staub abzeichnete. Sie führte in gerader Linie zur Treppe und brach dann ab. Aber es war nicht schwer zu erraten, wohin sie führte. Carradine deutete mit einer Kopfbewegung nach oben, wartete, bis Boldwinn aufgeholt hatte und neben ihm stehen geblieben war, und ging dann ohne ein Wort weiter. Auf der obersten Stufe blieb er stehen, hob seine Laterne höher über den Kopf und versuchte im Staub zu seinen Füßen die Spuren wiederzufinden. Es gelang ihm, aber sie verschwanden schon nach wenigen Metern erneut.
So abrupt, als hätten sich die beiden Menschen, von denen sie stammten, in Luft aufgelöst …
Carradine blinzelte verwirrt. Boldwinn bemerkte sein Zögern, runzelte die Stirn und wollte an ihm vorbeitreten, aber Carradine hielt ihn mit einer raschen Handbewegung zurück. »Nicht«, sagte er. »Sie verwischen nur die Spur. Sehen Sie.«
Boldwinn blickte gehorsam in die Richtung, in die sein ausgestreckter Arm wies, aber der fragende Ausdruck auf seinen Zügen änderte sich nicht. »Was meinen Sie?«, fragte er.
»Die Spuren«, murmelte Carradine verstört. »Sehen Sie sich die Spuren an, Boldwinn.«
Boldwinn gehorchte. »Und?«, fragte er.
»Verdammt, sind Sie blind?«, schnappte Carradine. »Fällt Ihnen nichts auf? Sie beginnen hier – und wo enden sie, bitteschön?«
»Sie …« Boldwinn verstummte verwirrt, blickte ein paar Mal von seinem Gesicht auf die Fußspur, die so abrupt abbrach, und wieder zurück, und sog hörbar die Luft ein. Sein Gesicht verfinsterte sich.
»Hören Sie, Carradine«, sagte er leise. »Wenn das ein Trick ist, mit dem Sie Ihren Herrn Sohn schützen wollen …«
»Aber natürlich«, unterbrach ihn Carradine wütend. »Ich habe genau gewusst, was die beiden vorhaben, wissen Sie? Ich bin gestern schon hierhergekommen und habe diese falsche Spur gelegt, um Sie zu täuschen, Boldwinn. Ich habe meine Schuhe an den Füßen und die Ihrer Tochter an den Händen getragen und bin hier herauf gekrochen, damit alles ganz echt aussieht. Und dann, als ich hier war, habe ich meine Flügel ausgeklappt und bin weggeflogen.«
Boldwinn schluckte und starrte ihn mit einer Mischung aus Zorn und Verwirrung an. »Aber das ist doch unmöglich«, sagte er, noch immer laut, aber jetzt in einem Tonfall, der eher hilflos als aggressiv klang. »Eine Spur kann doch nicht einfach im Nichts enden.«
»Diese hier tut es aber«, schnappte Carradine.
»Und was … was tun wir jetzt?«
Carradine zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung«, brummte er. »Aber es wird uns wohl nicht viel anderes übrig bleiben, als das Haus Zimmer für Zimmer zu durchsuchen.«
»Allein?«, entfuhr es Boldwinn »Dieses Haus muss Dutzende von Zimmern haben, Carradine!«
»Wir können natürlich auch zurückgehen und Hilfe holen«, erwiderte Carradine gelassen. »Aber machen Sie mich nicht verantwortlich, wenn dann niemand mehr hier ist.«
Boldwinn zögerte. Sein Blick wanderte den Weg zurück, den sie gekommen waren, und saugte sich einen Herzschlag lang an der offen stehenden Tür fest. Sein Gesicht wirkte im grellen Schein der Laterne noch bleicher, als es ohnehin war. Seine Nasenflügel bebten. Wenn Carradine jemals einem Menschen gegenübergestanden hatte, der Angst hatte, dann ihm.
Aber trotzdem nickte er nach einer Weile. »Sie haben recht«, murmelte er. »Durchsuchen wir das Haus. Wo fangen wir an?«
Carradine deutete mit der Hand nach rechts und mit dem Kopf nach links. »Sie dort und ich auf der anderen Seite«, sagte er. »Dann geht es schneller.«
»Allein?« Boldwinn schluckte. »Sie meinen, wir sollen uns trennen?«
»Sie haben es selbst gesagt«, antwortete Carradine. »Das Haus hat Dutzende von Zimmern. Wir brauchen bis Sonnenaufgang, wenn wir sie alle durchsuchen wollen. Wenn wir uns teilen, sind wir schneller.«
»Aber ich – wir haben nur eine Laterne«, stammelte Boldwinn.
Carradine unterdrückte ein triumphierendes Grinsen. Es bereitete ihm ein geradezu sadistisches Vergnügen zu sehen, wie Boldwinn vor Angst zitterte. »Fürchten Sie sich im Dunkeln?«, fragte er hämisch.
Für einen Moment blitzte in Boldwinns Augen Zorn auf. Aber die Furcht war größer und gewann rasch wieder die Oberhand. »Das spielt keine Rolle«, antwortete er. »Aber wir haben nichts davon, wenn einer von uns im Dunkeln herumstolpert.«
»Es gibt genug Kerzen hier«, entgegnete Carradine ruhig. »Und unten in der Halle war ein Wandhalter mit einer Fackel. Warum holen Sie sie nicht?«
Boldwinn blickte ihn unsicher an. »Ich warte hier«, fügte Carradine nach einigen Sekunden hinzu. »Aber Sie sollten sich beeilen. Wahrscheinlich hört man unsere Stimmen durch das ganze Haus. Es würde mich nicht wundern, wenn Charles und Jenny schon wissen, dass wir hier sind.«
Boldwinn nickte verkrampft, drehte sich herum und begann vorsichtig die Treppe wieder herabzugehen. Carradine überlegte einen Moment, ob er die Sache auf die Spitze treiben sollte, entschied sich aber dann dagegen und hielt seine Laterne so, dass ihr Schein Boldwinn den Weg wenigstens notdürftig erhellte. Im Moment war er zweifellos in der stärkeren Position, aber er kannte Boldwinn gut genug, um zu wissen, dass er ihm jede Sekunde, die sie in diesem Haus verbrachten, doppelt und dreifach zurückzahlen würde – ganz gleich, ob sie seine Tochter fanden oder nicht.
Boldwinn klapperte und rumorte eine Weile unten herum und kam dann mit weit ausgreifenden Schritten zurück. Sein teurer Maßanzug war verdreckt, und in seinem Haar klebten graue Spinnweben. Ein gehetzter Ausdruck lag auf seinen Zügen. Sein Blick glitt an Carradine vorbei und huschte unstet über die geschlossenen Türen, die die Galerie säumten. Carradine ließ sich zu einem schadenfrohen Lächeln hinreißen – aber er musste sich auch gleichzeitig eingestehen, dass er selbst nicht halb so ruhig war, wie er sich gab. Das Haus übte einen seltsamen, unheimlichen Einfluss auf ihn aus. Wenn er ganz ehrlich war, dann hatte auch er Angst.
Er entzündete die Fackel, reichte Carradine seine Laterne und hielt das brennende Holz hoch über den Kopf. Es war besser, wenn Boldwinn die Laterne hatte – mit der brennenden Fackel in der Hand würde dieser Trottel am Ende noch das ganze Haus anstecken. Boldwinn schien etwas sagen zu wollen, aber Carradine winkte rasch ab, deutete noch einmal mit einer Kopfbewegung nach rechts und machte sich in die entgegengesetzte Richtung auf den Weg. Sein Blick tastete über den knöcheltiefen Staub auf dem Boden. Die flockige graue Schicht war unbeschädigt und höchstens da und dort von den Spuren winziger Rattenfüßchen durchbrochen. Wenn Charles und Jenny in eines dieser Zimmer gegangen wären, hätte er es gesehen. Aber andererseits: Wenn sie es fertiggebracht hatten, ihre Spuren einfach so abbrechen zu lassen, dann …
Er verscheuchte den Gedanken, ging bis zum Ende des Korridors und öffnete die letzte Tür. Weit hinter sich, am anderen Ende der Galerie, hörte er Boldwinn eine andere Tür öffnen.
Knarrend schwang die Tür auf. Die zuckenden Flammen seiner Fackel warfen irrlichternde rote Blitze gegen die Decke und die Wände, und die Bewegung und der plötzliche Luftzug – vielleicht der erste seit einem Menschenalter – ließen Staub in dichten, brodelnden Schwaden vom Boden hochsteigen. Carradine trat zögernd durch die Tür, hob seine Fackel ein wenig höher und sah sich mit einer Mischung aus Neugier und Unbehagen um.
Das Zimmer bot einen Anblick der Zerstörung. Früher musste seine Einrichtung einmal kostbar und von großem Geschmack gewesen sein. Jetzt war sie zerstört. Nicht zerfallen und vermodert, wie Carradine auffiel, sondern gründlich zerschlagen, als hätte jemand in einem Anfall von Raserei jedes einzelne Möbelstück zertrümmert. Überall lag Staub und Schmutz. Das Fenster war vernagelt, die Scheiben zerborsten, ohne auseinandergebrochen zu sein, und das hintere Drittel des Raumes war hinter einem massiven grauen Vorhang aus ineinander verflochtenen Spinnweben verborgen.
Hinter dem Vorhang bewegte sich etwas.
Carradines Herz begann rasend und schmerzhaft zu schlagen. Instinktiv machte er einen Schritt, blieb aber abrupt wieder stehen und starrte aus schreckgeweiteten Augen auf den verzerrten Schatten, der sich hinter dem grauen Vorhang abzeichnete.
»Charles?«, fragte er halblaut. Seine Stimme klang unsicher. Der Schatten hinter den Spinnweben bewegte sich wieder, aber Carradine konnte immer noch nicht erkennen, was es war.
Eine faustgroße Spinne fiel mit einem hörbaren Geräusch aus dem Netz und begann langsam auf ihn zuzukriechen. Ekel stieg in Carradine hoch, aber gleichzeitig auch Erstaunen. Er hatte niemals eine Spinne von dieser Größe gesehen. Einen Moment lang beobachtete er das sinnverwirrende Spiel ihrer Beine, dann senkte er seine Fackel und verbrannte sie.
Langsam ging er weiter. Der Schatten hinter dem Vorhang bewegte sich erneut und als Carradine näherkam, erkannte er weitere, kleinere, dunkle Punkte …
Dann, mit einem Ruck, stand die Gestalt auf und zerriss den grauen Vorhang.
Carradine schrie gellend auf. Für die Dauer von zwei, drei Herzschlägen stand er gelähmt vor Schrecken da und starrte auf das Grauen erregende Bild, das ihm die zuckenden roten Flammen der Fackel enthüllten.
Es waren nicht eine, sondern zwei Gestalten, die Gestalten zweier Menschen, die nur so eng ineinander verschlungen gewesen waren, dass sie durch den grauen Schleier hindurch wie eine einzige gewirkt hatten.
Es waren Jenny und Charles.
Sie waren nackt, beide. Ihre Kleider lagen in Fetzen und vermodert auf dem Boden und dem verrotteten Bett, auf dem sie gesessen hatten. Und über das Bett, über den Boden, die zerrissenen Kleider und vermoderten Decken und ihre Körper krochen Dutzende von faustgroßen, mit drahtigem, schwarzem Haar bedeckte Spinnen …
Carradine erwachte mit einem gurgelnden Schrei aus seiner Erstarrung, als die beiden jungen Menschen auf ihn zutraten und ihnen die Spinnen wie eine quirlende schwarze Woge folgten. Halb wahnsinnig vor Furcht wirbelte er herum und rannte los. Fünf, sechs der ekelhaften haarigen Tiere fielen wie kleine pelzige Bälle von der Decke, prallten auf seine Schulter und seinen Rücken und krallten sich in seinen Kleidern fest. Haarige Beine tasteten über sein Gesicht. Carradine schrie, fegte die Tiere angeekelt zur Seite und schwang seine Fackel. Die Flammen zeichneten einen feurigen Halbkreis in die Luft, und die Hitze vertrieb die Tiere, wenn auch nur für einen Augenblick. Carradine taumelte weiter, prallte mit dem Gesicht schmerzhaft gegen den Türrahmen und torkelte auf die Galerie hinaus. Er hörte Boldwinns Stimme, verstand aber die Worte nicht, sondern lief weiter, noch immer schreiend und dem Wahnsinn nahe. Hinter ihm quoll ein schwarzer, vierbeiniger Teppich aus winzigen Körpern aus der Tür.
»Carradine?« Boldwinns Stimme drang nur wie durch einen dämpfenden Schleier in sein Bewusstsein. Der tanzende Schein einer Laterne tauchte vor ihm auf der Galerie auf, huschte über den staubbedeckten Boden und blendete ihn einen Moment. Er hörte, wie Boldwinn voller Entsetzen aufschrie, dann klirrte irgendetwas; die Laterne erlosch.
Carradine torkelte weiter, prallte gegen die steinerne Brüstung der Galerie und verlor um ein Haar das Gleichgewicht. Verzweifelt blickte er sich um. Die Spinnen kamen näher.
Für einen Moment – nur einen Moment – gewann sein klares Denken wieder die Oberhand. Carradine wechselte die Fackel von der Linken in die Rechte und schwang das brennende Holz wie eine Waffe. Die Hitze trieb die Spinnen zurück, aber aus der offen stehenden Tür drängten immer mehr und mehr nach, nicht mehr Dutzende jetzt, sondern Hunderte. Der Mosaikfußboden der Galerie verschwand unter einer schwarzen, kribbelnden, haarigen Masse, die wie eine zähe Woge näherschwappte.
»Boldwinn!«, keuchte er. »Zur Treppe! Laufen Sie!«
Er wusste nicht, ob Boldwinn auf seine Worte reagierte. Sein Angriff hatte den Vormarsch der Spinnen ins Stocken gebracht, aber von hinten drängten immer mehr und mehr der ekelhaften Tiere nach, und hinter ihnen …
Carradines Magen krampfte sich schmerzhaft zusammen, als er die beiden aneinandergeklammerten Schatten sah. Sein Sohn und Boldwinns Tochter torkelten mit mühsamen, abgehackt wirkenden Bewegungen aus der Tür. Ihre Gesichter waren leer, der Blick ihrer Augen erloschen, ihre Münder standen offen, was ihnen den Ausdruck von Schwachsinnigen verlieh. Die Armee der Spinnen teilte sich vor ihren Füßen, sodass eine schmale, quirlende Gasse entstand, die sich aber hinter ihnen sofort wieder schloss.
Carradine vergaß die Spinnen, als die beiden nackten Gestalten näherkamen. Langsam, Schritt für Schritt, wich er zurück, unfähig, den Blick von dem leeren Gesicht seines Sohnes zu wenden. Charles’ Augen waren erloschen. Er ist tot, dachte Carradine entsetzt. Tot – oder Schlimmeres. Aber der Gedanke erreichte sein Bewusstsein kaum, sondern verging in der Woge von Entsetzen und Wahnsinn, die sein Denken zu überschwemmen drohte. Er fühlte die harte Kante der Galeriebrüstung in seinem Rücken, spürte, wie er sich weiter und weiter zurückbog, als die Schreckensgestalt, die einmal sein eigener Sohn gewesen war, näherkam, und irgendwo tief in ihm begann eine Alarmglocke zu schlagen, aber auch diese Warnung verhallte ungehört.
Langsam hob Charles die Hand. Seine Finger deuteten fast anklagend auf Carradine, zitterten, kamen näher und verharrten wenige Zentimeter vor seinem Gesicht reglos in der Luft.
Eine Spinne krabbelte über seine Schulter, blickte Carradine aus ihren acht stecknadelkopfgroßen funkelnden Augen einen Sekundenbruchteil lang boshaft an und begann dann auf wirbelnden Beinchen über Charles’ Arm auf ihn zuzulaufen. Etwas berührte seine Beine, leicht, tastend, kroch an seinem Knöchel empor und schlüpfte in seine Hose. Carradine stieß einen gellenden, unglaublich schrillen Schrei aus, warf sich zurück und stürzte mit haltlos wirbelnden Armen über das Geländer in die Tiefe.
Seine Fackel erlosch, als er auf dem Steinboden aufprallte.
»Da is nix zu machen«, sagte Rowlf kopfschüttelnd. Mit einem resignierenden Seufzen ließ er den Vorderlauf des Pferdes los, tätschelte dem Tier mit einer unbewussten Geste den Hals und wandte sich zu uns um. »Der Gaul läuft keine Meile mehr. S’n Wunder, dass er noch nich zusammengebrochn’ is«, sagte er.
»Verdammt«, murmelte Howard. »Und das ausgerechnet hier.« Er atmete hörbar ein, biss sich einen Moment auf die Unterlippe und sah mit einem gleichermaßen gequälten wie resignierenden Blick die Straße hinab. Vor einer knappen halben Stunde waren die Häuser einer kleinen Ortschaft an den Fenstern des Wagens vorübergezogen; seitdem hatten wir nichts als Wald gesehen. Es war dunkel geworden, und die Bäume säumten die Straße zu beiden Seiten wie eine finstere, undurchdringliche Mauer. Es war kalt.
»Ich fürchte, wir werden umkehren müssen«, sagte er bedauernd. »Damit dürfte unser Zeitplan über den Haufen geworfen ein. Gründlich.«
»Umkehren?«, fragte ich. Wir waren praktisch ununterbrochen gefahren, seit wir Glasgow erreicht und den Zug verlassen hatten. Die Vorstellung, auch nur eine einzige der Meilen, die wir so mühsam gereist waren, wieder zurückzufahren, erfüllte mich mit einem instinktiven Widerwillen. Und Howard hatte recht – unser Zeitplan war ohnehin knapp bemessen. Wir konnten es uns nicht leisten, eine ganze Nacht zu verlieren.
Howard nickte. »Die Ortschaft, durch die wir gekommen sind«, erinnerte er. »Mit etwas Glück finden wir dort jemanden, der uns ein frisches Pferd verkauft oder leiht. Allerdings ist es schon spät«, fügte er achselzuckend hinzu.
»Und wenn wir das Pferd abschirren und nur mit einem Zugtier weiterfahren?«, fragte ich.
»Geht nich«, antwortete Rowlf an Howards Stelle. »Wir sin zu schwer für nur ein Tier. Der Gaul würde bloß schlappmachn’.«
Howard nickte. »Rowlf hat recht. Ich möchte nicht mitten auf der Straße liegen bleiben. Komm – helfen wir Rowlf.«
Diesmal widersprach ich nicht, sondern trat gehorsam neben ihn und seinen hünenhaften Diener und begann die Schirrriemen des Pferdes zu lösen. Die Vorstellung, auf dieser abgelegenen Straße übernachten zu müssen, behagte mir ganz und gar nicht. Ich habe niemals Angst vor der Dunkelheit gehabt oder etwas ähnlich Albernes – aber dieser schwarze Wald, dessen Bäume die Straße zu erdrücken und mit dürren, blattlosen Ästen wie mit schwarzen Armen auf uns herabzugreifen schienen, erfüllte mich mit Unbehagen, ohne dass ich sagen konnte, warum. Vielleicht hatte ich in den letzten Wochen einfach zu viel erlebt. Ich hatte die Vorstellung, dass ich der Sohn eines Hexers war und Dinge wie Zauberer und Dämonen real existierten und in die Welt der Menschen eingreifen konnten, akzeptiert, weil ich es musste. Aber das hieß nicht, dass ich sie schon verarbeitet hatte. Der Spruch, dass man sich an jeden Schrecken gewöhnt, wenn er nur lange genug andauert, ist nicht wahr, im Gegenteil. Nach einer Weile fängt man an, hinter jedem Schatten eine Gefahr und in jedem Geräusch eine Bedrohung zu vermuten.
»Jemand kommt«, murmelte Rowlf.
Ich sah auf, trat einen halben Schritt auf die Straße hinaus und blickte in die Richtung, in die er gewiesen hatte, zurück, dorthin, wo wir hergekommen waren. Im ersten Moment konnte ich weder etwas Außergewöhnliches sehen noch hören. Aber Rowlf schien über schärfere Sinne zu verfügen als ich, denn nach ein paar Augenblicken hörte ich Hufschlag, dann begann sich der Schatten eines einzelnen Reiters gegen das Schwarzgrau des Waldes abzuheben.
Der Mann kam in scharfem Tempo näher und zügelte sein Tier erst wenige Schritte vor unserer Kutsche. Das Pferd stampfte unruhig, und der Wind trug den scharfen Geruch seines Schweißes zu mir. Er musste sehr schnell geritten sein.
»Guten Abend, die Herren«, sagte er steif. »Sie haben Schwierigkeiten?«
Die Frage war rein rethorisch. Rowlf hatte das Pferd vollends abgeschirrt, während Howard und ich dem Fremden entgegengetreten waren, aber das Tier scheute noch immer und zog schmerzhaft das rechte Vorderbein an.
»Ich fürchte«, antwortete Howard. »Eines unserer Pferde hat sich einen Stein in den Huf getreten. Und das zweite allein wird die Kutsche nicht ziehen können.«
Der Mann hob den Kopf und blickte für die Dauer von zwei, drei Herzschlägen auf unser Fahrzeug. Obwohl ich sein Gesicht in der Dunkelheit nur als hellen Fleck erkennen konnte, entging mir der Blick, mit dem er unsere Kalesche musterte, keineswegs. Es war ein Blick, dem nicht die geringste Winzigkeit entging. Ein Blick, der mir nicht gefiel. Aber ich schwieg.
»Ein denkbar ungünstiger Platz für einen Halt«, sagte er, nachdem er seine Musterung beendet hatte. »Bis zur nächsten Stadt sind es fast fünf Meilen. Sie sind auf einer weiten Reise?«
Howard ignorierte seine Frage und rang sich sogar zu einem freundlichen – wenn auch spürbar kühlen – Lächeln durch. »Wir dachten an die Ortschaft, durch die wir gekommen sind«, sagte er. »Vielleicht gibt es dort …«
»Dort gibt es absolut niemanden, der Ihnen helfen wird«, unterbrach ihn der Reiter kopfschüttelnd. Howard runzelte die Stirn und der Fremde fuhr nach einer Sekunde fort: »Die einzigen Pferde, die es dort gibt, sind ein paar Ackergäule, die Ihre Kutsche zuschanden schlagen würden, wenn Sie versuchten, sie einzuspannen. Und die fünf Meilen bis nach Oban«, fügte er mit einer Handbewegung nach Norden hinzu, »schaffen Sie nicht mit nur einem Pferd.«
Howard seufzte. »Dann werden wir wohl zu Fuß gehen müssen«, murmelte er. »Jedenfalls können wir nicht hier übernachten.«
Der Fremde lachte, ein dunkler, unsympathisch klingender Laut. Sein Pferd scheute und scharrte unruhig mit den Vorderläufen, aber er brachte es mit einem brutalen Ruck zur Ruhe. »Das können Sie nicht«, bestätigte er. »Aber Sie müssen auch nicht zu Fuß gehen. Mein Haus ist keine halbe Meile von hier entfernt. Wenn Sie mit meinem Gästezimmer Vorlieb nehmen wollen, können Sie die Nacht dort verbringen. Morgen Früh kümmere ich mich darum, dass Sie ein frisches Pferd bekommen. Oder besser gleich zwei«, fügte er mit einem Seitenblick auf das zweite, noch angespannte Tier hinzu.
Howard zögerte. Ohne ihn anzusehen spürte ich, dass ihm der hochgewachsene Fremde mindestens ebenso suspekt vorkam wie mir. Aber wir hatten keine große Wahl.
»Das … wäre überaus freundlich von Ihnen Mister …«
»Boldwinn«, sagte der Fremde. »Lennon Boldwinn, Sir. Zu Ihren Diensten.«
Howard deutete eine Verbeugung an. »Phillips«, sagte er. »Howard Phillips. Mein Neffe Richard, und Rowlf unser Hausdiener und Kutscher.« Nacheinander deutete er auf mich und Rowlf, gleichzeitig warf er mir einen raschen, beschwörenden Blick zu. Ich widerstand im letzten Moment der Versuchung zu nicken. Sicher, es gab keinen Grund, Boldwinn zu misstrauen – aber es gab auch keinen Grund, ihm zu trauen. Und wir hatten schon in London verabredet, unter falschem Namen zu reisen.
»Dann kommen Sie, Mister Phillips«, sagte Boldwinn knapp. »Es ist spät, und ich habe einen weiten Weg hinter mir und bin müde. Steigen Sie in Ihre Kutsche. Ich reite voraus.« Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ er sein Pferd antraben und ritt an uns vorüber. Für einen ganz kurzen Moment konnte ich sein Gesicht im bleichen Licht des Mondes genauer erkennen. Es ähnelte auf schwer zu beschreibende Weise dem Howards: schmal, von scharfem, beinahe – aber eben nur beinahe – aristokratischem Schnitt, mit dunklen Augen und eingerahmt von einem pedantisch ausrasierten King-Arthur-Bart. Seine Haut schien mir unnatürlich bleich, aber ich war nur nicht sicher, ob dieser Eindruck nicht einfach am Licht lag. Und er hockte in unnatürlich verkrampfter Haltung im Sattel. Entweder hatte er wirklich einen sehr langen und anstrengenden Ritt hinter sich, oder er war – was mir wahrscheinlicher schien – kein sehr geübter Reiter.
Howard berührte mich am Arm und deutete auf die Kutsche. Rowlf hatte das überzählige Geschirr mittlerweile zu einem Bündel verschnürt und zwischen unser Gepäck auf das Dach der Kutsche geworfen. Das verletzte Tier stand ein Stück abseits, aber ich wusste, dass es uns folgen würde, sobald die Kutsche anfuhr.
Wir stiegen wieder in den Wagen. Howard schloss die Tür, schob jedoch den Vorhang zur Seite und setzte sich so, dass er aus dem Fenster blicken und Boldwinn unauffällig im Auge behalten konnte. Rowlf ließ seine Peitsche knallen, der Wagen setzte sich schaukelnd in Bewegung. Das Knarren der schweren, hölzernen Räder auf der staubigen Straße schien mir lauter als vorher.
»Was hältst du von ihm?«, fragte Howard nach einer Weile.
»Boldwinn?« Ich zuckte mit den Achseln. »Ich glaube nicht, dass ich ihn mag«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Aber zumindest bewahrt er uns davor, auf offener Straße übernachten zu müssen.«
Howard runzelte die Stirn. »Vielleicht wäre das besser«, murmelte er. Die Worte schienen mehr für ihn selbst als für mich bestimmt, aber ich antwortete trotzdem darauf.
»Du traust ihm nicht?«
»Trauen …« Howard seufzte. »Wahrscheinlich sehe ich Gespenster«, sagte er. »Aber es kommt mir seltsam vor, dass er ausgerechnet jetzt auftaucht. Immerhin sind wir seit fast zwei Stunden keiner Menschenseele begegnet. Sein Hilfsangebot kam ziemlich schnell.«
»Ich dachte immer, die Engländer sind besonders hilfsbereite Menschen.«
Howard lachte leise. »Jeder Mensch ist hilfsbereit, wenn er Gründe dafür hat«, antwortete er zweideutig. »Aber vermutlich hast du recht – wir sollten froh sein, dass wir nicht wirklich auf der Straße schlafen müssen.«
»Und wie geht es weiter?«
Howard schwieg einen Moment. »Dieses kleine Unglück ändert nichts an unserem Plan«, antwortete er schließlich. »Ich habe Freunden in Durness telegrafiert, dass wir kommen. Sie werden eine gewisse Verspätung einkalkulieren.«
Der Klang der Hufschläge änderte sich. Die Kutsche begann stärker zu schaukeln und legte sich schließlich wie ein Schiff auf hoher See auf die Seite. Ein harter Stoß traf die kaum gefederten Achsen und beutelte Howard und mich, als Rowlf den Wagen hinter unserem Führer auf einen schmalen, von tiefen Schlaglöchern und Gräben durchzogenen Waldweg lenkte.
Für den Rest des Weges wurde eine Unterhaltung unmöglich. Howard und ich hatten alle Hände voll zu tun, nicht von den Sitzen geworfen zu werden oder unentwegt mit dem Kopf gegen die Decke zu prallen, wenn ein neuer Stoß den Wagen traf, und ich rechnete ernsthaft damit, dass die Achse brechen oder die Kalesche schlichtweg umstürzen würde. Ich versuchte aus dem Fenster zu sehen, aber alles, was ich erkennen konnte, war Schwärze, in der nur ab und zu ein paar Schatten auftauchten und wieder verschwanden. Der Weg war so schmal, dass Unterholz und Geäst an beiden Seiten scharrend an der Kutsche entlangschrammten, und in einem Zustand, als wäre er jahrelang nicht mehr benutzt worden.
Ich schätzte, dass wir etwa eine halbe Meile tief in rechtem Winkel zu unserem vorherigen Kurs in den Wald eingedrungen waren, als das Schaukeln und Stoßen endlich aufhörte und die Kutsche mit einem letzten, magenumstülpenden Krachen zum Stehen kam. Howard rappelte sich Grimassen schneidend hoch und beugte sich zur Seite, um aus dem Fenster zu sehen, und ich tat es ihm auf der anderen Seite gleich.
Der Wagen hatte vor einem gewaltigen, schmiedeeisernen Tor gehalten. Boldwinn war aus dem Sattel gestiegen und machte sich am Schloss zu schaffen. Er öffnete nur einen Flügel, der jedoch mehr als breit genug war, die Kutsche durchzulassen. Die Scharniere quietschten, als wären sie seit einem Menschenalter nicht mehr geölt worden.
Wir fuhren weiter. Unter den Rädern der Kutsche knirschte jetzt Kies, und die buckeligen Schatten, die den Weg säumten, gehörten zu einem ausgedehnten, aber vollkommen verwilderten Park, der Boldwinns Haus umgab. Der Weg und das Tor schienen nicht das einzige zu sein, was verwahrlost war. Aber darüber stand mir kein Urteil zu. Ich ließ mich wieder zurücksinken.
Wir wurden nicht mehr ganz so arg durchgeschüttelt, während Rowlf die Kutsche den leicht ansteigenden Weg zum Haus hinauflenkte. Ich hörte, wie er ein paar Worte mit Boldwinn wechselte, dann kam der Wagen erneut zum Stehen. Ein gewaltiger, dunkler Schatten füllte das Fenster auf Howards Seite aus.
Kalter Wind schlug uns entgegen, als wir ausstiegen, und aus dem nahen Wald drang eine seltsame Mischung aus dem Geruch feuchten, frischen Grüns und … ja – und was eigentlich? Mir fiel kein passender Vergleich ein, aber es roch … seltsam. Die Luft schien abgestanden und verbraucht, obwohl das unmöglich war, ich kam mir vor wie in einem Raum, dessen Fenster zu lange nicht geöffnet worden waren.
Dann fiel mein Blick auf das Haus, und ich vergaß den Geruch.
Es war gewaltig. Gewaltig, düster und drohend wie eine Gewitterwolke, die den Horizont verdunkelte; ein Herrenhaus in spätviktorianischem Stil, das früher einmal grandios gewesen sein und einem Adeligen oder König gehört haben musste. Mächtige, polierte Säulen säumten die breite Freitreppe aus weißem Marmor und über den Fenstern, die ausnahmslos vergittert waren, prangten kostbare Stuckarbeiten. Zwei gewaltige steinerne Löwen flankierten die Haustür, und direkt über dem Eingang war eine Inschrift, die ich allerdings in der herrschenden Dunkelheit nicht entziffern konnte.
Aber das Haus war nicht nur gewaltig, es war auch alt. Die Gitter vor den Fenstern waren verrostet; der Regen hatte hässliche braune Streifen in das Mauerwerk darunter gewaschen. Die Wände waren rissig, da und dort war der Putz abgebröckelt und nicht oder nur laienhaft erneuert worden, und aus einer der Marmorsäulen war ein kopfgroßes Stück herausgebrochen und auf der Treppe zersplittert. Seine Bruchstücke lagen noch da auf den geborstenen Stufen, wo sie niedergestürzt waren.
»Mister Phillips?«
Boldwinns Stimme riss mich aus meinen Betrachtungen. Ich schrak hoch, sah ihn einen Moment fast schuldbewusst an und lächelte rasch, als ich seine einladende Handbewegung bemerkte.
»Wenn Sie mir ins Haus folgen wollen«, sagte er steif »Ich lasse einen kleinen Imbiss für Sie herrichten. Sie müssen hungrig sein.«
»Unser Gepäck …«, begann Howard, wurde aber sofort von Boldwinn unterbrochen.
»Darum wird sich mein Hausdiener kümmern«, sagte er.
»Ihr Kutscher muss ebenso müde sein wie Sie. Lassen Sie den Wagen getrost stehen. Ihrem Eigentum wird nichts geschehen.«
Seine Worte ärgerten mich, aber Howard machte eine rasche, warnende Geste mit der Hand, und ich schluckte die scharfe Entgegnung, die mir auf der Zunge lag, herunter. Schweigend folgten wir Boldwinn die Treppe hinauf.
Die Tür wurde geöffnet, kurz bevor wir sie erreicht hatten. Ein Streifen gelber, flackernder Helligkeit fiel auf die Treppe hinaus, dann erschien eine geduckte Gestalt unter der Öffnung und sah Boldwinn und uns entgegen. Boldwinn winkte ungeduldig mit der Hand; der Mann trat hastig zurück und öffnete die Tür gleichzeitig weiter, sodass wir eintreten konnten.
Der Anblick überraschte uns alle drei. Nach dem verwahrlosten Zustand des Parks und des Hauses hatte wohl nicht nur ich hier drinnen etwas Ähnliches erwartet, aber das Gegenteil war der Fall: Hinter dem Eingang erstreckte sich eine gewaltige, fast zur Gänze in schneeweißem Marmor gehaltene Halle. Ein mindestens fünf Yards messender Kronleuchter hing an einer armdicken Kette von der Decke und tauchte den Raum in mildes, gelbes Licht, und der Boden war so sauber, dass sich unsere Gestalten als verzerrte Schatten darauf spiegelten. Die Halle war fast leer; das einzige Möbelstück war ein gewaltiger, kostbarer Sekretär, über dem ein riesiger Kristallspiegel in einem goldenen Rahmen hing. Auf der gegenüberliegenden Seite der Halle führte eine geschwungene, mit kostbaren Teppichen belegte Treppe zu einer Galerie hinauf, von der zahlreiche Türen abzweigten. Es war angenehm warm, obwohl nirgends ein Feuer brannte.
»Nun, Mister Phillips?«, fragte Boldwinn. »Zufrieden?«
Es dauerte eine Sekunde, ehe ich begriff, dass seine Worte mir galten. Ich fuhr zusammen, drehte mich halb um und sah ihn verlegen an. Ein dünnes, spöttisches Lächeln spielte um seine Lippen. Er musste den Blick, mit dem ich mich umgesehen hatte, richtig gedeutet haben.
»Ich … verzeihen Sie«, stotterte ich. »Ich …«
Boldwinn winkte ab und schloss die Tür hinter sich. »Es muss Ihnen nicht unangenehm sein, Mister Phillips«, sagte er gleichmütig. »Ich bin das gewohnt, wissen Sie? Jeder, der mein Haus nur von außen kennt, ist überrascht, wenn er es betritt.« Sein Lächeln wurde ein wenig breiter, aber nicht sympathischer. »Ich habe weder die Mittel noch das Personal, den Park in Ordnung zu halten«, sagte er, »aber es verschafft mir immer wieder Genugtuung, die Gesichter meiner Besucher zu sehen, wenn sie hereinkommen.«
Ich fühlte mich mit jeder Sekunde unbehaglicher. Boldwinn war im Grunde nichts als ehrlich, aber es gibt eine Art der Ehrlichkeit, die schon wieder unhöflich ist.
»Ich sehe«, fuhr er fort, »ich bringe Sie in Verlegenheit, also wechseln wir das Thema. Carradine – bereiten Sie einen Imbiss für vier Personen vor. Und schnell, bitte.«
Die Worte galten dem Mann, der uns geöffnet hatte, einem verhutzelten kleinen Männchen, das die ganze Zeit schweigend und mit gesenktem Kopf dagestanden und Howard und mich verstohlen aus den Augenwinkeln gemustert hatte. Schon vorhin, als ich nur seinen Schatten gesehen hatte, war er mir sonderbar vorgekommen; jetzt, als ich ihn im hellen Licht sah, erschreckte mich seine Erscheinung fast.
Im ersten Moment hielt ich ihn für einen Buckeligen, aber das stimmte nicht. Seine linke Schulter hing tiefer und in anderem Winkel herab als die rechte, und sein Hals war auf sonderbare Weise auf die Seite geneigt, als könne er den Kopf nicht gerade halten. Seine linke Hand war einwärts geknickt, die Finger zu einer nutzlosen steifen Kralle verkrümmt, und sein rechtes Bein und der Fuß sahen aus, als wären die Knochen irgendwann einmal gebrochen und in falschem Winkel wieder zusammengeheilt. Sein Gesicht war ein Albtraum: eingedrückt und schief wie eine Maske aus Wachs, die jemand zusammengedrückt hatte; der Mund verzogen, sodass er ständig sabberte – ohne etwas dafür zu können –, das linke Auge blind und geschlossen. Ein Krüppel.
»Gefällt Ihnen Carradine?«, fragte Boldwinn leise. »Er ist mein Hausdiener, wissen Sie? Ein bedauernswertes Geschöpf. Eigentlich ist er nutzlos und richtet mehr Schaden als Nutzen an, aber irgendjemand musste sich seiner annehmen, nicht wahr?« Er lachte. »Eigentlich wollte ich ihn Quasimodo nennen, aber das wäre geschmacklos gewesen.«
Howard sog scharf die Luft ein, aber diesmal war ich es, der ihn mit einem warnenden Blick zurückhielt. Boldwinns Sinn für Humor schien eine sonderbare Entwicklung mitgemacht zu haben, aber das ging uns nichts an.
»Sie … leben allein hier?«, fragte ich, um auf ein anderes Thema zu kommen.
Boldwinn starrte mich an, als hätte ich ihn gefragt, ob er Syphilis habe. »Nein«, sagte er. »Außer Carradine wohnen noch meine Tochter und mein Neffe Charles hier. Aber die schlafen beide schon. Sie werden sie morgen beim Frühstück kennen lernen – wenn Sie Wert darauf legen.« Er wandte sich abrupt um und klatschte in die Hände. »Carradine!«, sagte er. »Hast du nicht gehört? Einen Imbiss für vier – husch, husch!«
Carradine grunzte, blickte uns der Reihe nach aus seinem einzigen verquollenen Auge an und humpelte dann davon. Er erinnerte mich tatsächlich ein bisschen an Quasimodo …
»Aber was stehen wir hier noch herum?«, fuhr Boldwinn fort, als der Krüppel gegangen war. »Es wird eine Weile dauern, ehe das Essen fertig ist. Gehen wir in die Bibliothek. Dort redet es sich besser.«
Er wartete unsere Antwort nicht ab, sondern drehte sich um und ging mit raschen Schritten auf eine Tür in der Seitenwand zu. Ich tauschte einen langen, fragenden Blick mit Howard. Er schwieg, aber das Gefühl in seinen Augen entsprach dem in meinem Inneren. Man musste kein Hellseher sein, um zu spüren, dass mit diesem Haus und seinen Bewohnern etwas nicht stimmte.
Aber ich war plötzlich gar nicht mehr begierig darauf herauszubekommen, was es war.
Die Bibliothek war ein gewaltiger, bis unter die Decke mit Regalen vollgestopfter Raum, dessen gesamte Einrichtung aus einem rechteckigen, polierten Tisch und vier Stühlen bestand. Dicke, sicherlich kostbare Teppiche bedeckten den Boden, und im Kamin – mit Ausnahme der Fenster und der Tür der einzige Fleck, der nicht mit Büchern vollgestopft war – brannte ein gewaltiges Feuer. Boldwinn deutete mit einer einladenden Geste auf den Tisch, wartete, bis wir an ihm vorübergegangen waren und schloss die Tür.
Erstaunt blieb ich stehen.
Der Tisch war nicht leer. Auf dem polierten Holz stand ein verzierter silberner Leuchter mit nahezu einem Dutzend brennender Kerzen und an seinen vier Kopfenden standen vier Teller, komplett mit Besteck, Gläsern und säuberlich gefalteten Servietten. Vier Teller … dachte ich verwirrt. Fast, als hätte er uns erwartet.
»Erwarten Sie Gäste?«, fragte Howard.
»Gäste?« Boldwinn blickte einen Moment lang irritiert von ihm zu mir und zurück, dann hellte sich sein Gesicht auf. »Ach, das Geschirr, meinen Sie?« Er lächelte. »Nein. Aber Carradine bereitet immer schon alles für das Frühstück vor, bevor er zu Bett geht. Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass ich das nicht will. Die Teller und Gläser stauben ein, wissen Sie? Aber es ist sinnlos. Er ist nun mal ein Krüppel, und leider nicht nur körperlich.« Er seufzte. »Aber setzen Sie sich doch, meine Herren.«
Howard starrte ihn eine endlose Sekunde lang durchdringend an, dann zuckte er mit den Achseln und gehorchte. Auch ich zog mir einen der Stühle heran und ließ mich darauf nieder, während Rowlf neben dem Kamin stehen blieb, sich unglücklich umsah und ganz offensichtlich nicht wusste, was er mit seinen Händen tun sollte. Boldwinn runzelte die Stirn und schenkte ihm einen langen, strafenden Blick, wandte sich dann aber wieder an Howard.
»Sie entschuldigen mich einen Moment«, sagte er. »Ich will sehen, wie weit Carradine ist. Ihre Zimmer müssen noch vorbereitet werden.«
»Machen Sie sich nur keine Umstände unseretwegen«, sagte Howard hastig. »Wir …«
»Aber ich bitte Sie«, unterbrach ihn Boldwinn, und er tat es in einem Ton, der keinen weiteren Widerspruch duldete. »Es sind keine Umstände. Das Haus steht praktisch leer, und ich habe genug Zimmer, mit denen ich sowieso nichts anfangen kann. Ich bin gleich zurück.« Damit wandte er sich um und verließ den Raum.
Howard starrte ihm stirnrunzelnd nach, auch als die Tür schon lange ins Schloss gefallen war. Es war nicht schwer, seine Gedanken zu erraten. Seine Finger spielten nervös mit dem kleinen Stöckchen, das er ständig mit sich herumschleppte. Aber er schwieg verbissen.
Schließlich hielt ich das Schweigen nicht mehr aus. »Also?«, sagte ich.
Howard sah auf. »Was – also?«
»Du weißt, was ich meine«, sagte ich verärgert. »Was hältst du von ihm? Und von diesem Haus?«
»Was ich von ihm halte?« Howard wandte den Blick und starrte in die prasselnden Flammen im Kamin, als könne er die Antwort auf meine Frage dort lesen. »Das ist nicht so leicht zu sagen, Robert. Boldwinn ist ein seltsamer Mann, aber es ist noch kein Verbrechen, ein Exzentriker zu sein.«
Ich spürte deutlich, dass er nicht aussprach, was er dachte. Er fühlte wie ich, dass mit Boldwinn, seinem sonderbaren Diener und diesem ganzen Haus etwas nicht stimmte; ganz und gar nicht stimmte. Und auch Rowlf schien die boshafte Aura, die dieses Haus ausstrahlte, zu fühlen. Und er hatte weniger Hemmungen als Howard, seine Gefühle in Worte zu fassen.
»Der Kerl is meschugge«, sagte er. »Plemplem. Und außerdem isser mir unheimlich.«
Howard lächelte flüchtig. Kopfschüttelnd kramte er eine flache silberne Dose aus der Tasche, entnahm ihr eine seiner dünnen schwarzen Zigarren und suchte nach Streichhölzern. Als er keine fand, stand er auf, ging zum Kamin hinüber und ließ sich davor in die Hocke sinken.
»Am liebsten würde ich wieder fahren«, murmelte ich. »Mir wäre beinahe wohler, draußen im Wagen zu schlafen als in diesem Haus.«
»Geht mir genauso«, murmelte Rowlf. Er sprach sehr leise, aber auf seinem Gesicht lag ein nervöser Zug, und sein Blick huschte unentwegt hierhin und dorthin. Er war nervös. Wie wir alle.
Howard hatte seine Zigarre mit einem brennenden Span entzündet, richtete sich auf und trat neugierig an die Bücherregale heran, die den Kamin flankierten. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, da er mir den Rücken zudrehte, aber ich sah, wie sich seine Haltung für einen winzigen Augenblick versteifte und sein Kopf mit einer ruckhaften Bewegung hochflog.
»Ist irgendetwas?«, fragte ich.
Howard antwortete nicht, sondern starrte einen Herzschlag lang die dicht gedrängt stehenden Bücher an, fuhr dann herum und eilte mit zwei, drei großen Schritten zu einem anderen Regal. Rowlf und ich beobachteten ihn verwirrt. Für mich waren die Bücher – nun, Bücher eben. Ich hatte mir nie viel aus Geschriebenem gemacht (außer aus gedruckten Zahlen auf gewissen grünen Scheinen) und konnte Howards Begeisterung für alte Schmöker nicht einmal in Ansätzen teilen. Aber ich glaubte zu spüren, dass seine Erregung einen Grund hatte.
Schließlich, nachdem er fast zehn Minuten von einem Regal zum anderen gelaufen und kopfschüttelnd und wie ein Sabbergreis vor sich hinbrummelnd die ledernen Rücken begutachtet hatte, wandte er sich um und kam zum Tisch zurück. »Das ist phantastisch«, murmelte er. »Unglaublich.«
»Aha«, sagte ich.





























