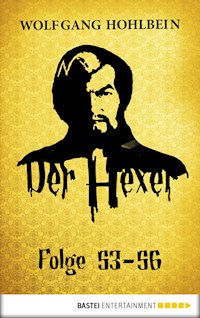
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Endstation Hölle" - Folge 53 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
"Talsah, gib mir deine Hand!" Die Stimme lag ruhig und ausgeglichen über der von weichem Moos bewachsenen Felsbalustrade, hoch über dem grünen Tal des Bhima. Ihr Klang trug die Weisheit des Alters in sich; eine Weisheit von solcher Eindringlichkeit, dass die Bewohner des Dorfes drunten am Fluss ihr nur mit Furcht gelauscht hatten. Bis sie den blinden Alten schließlich fortjagten und die fürchterlichsten Drohungen für den Fall ausstießen, dass er jemals zurückkehrte. Jetzt lebte er hier oben, nahe dem Himmel, weit weg von den Störenfrieden und ihren Nachkommen, und richtete seinen Geist auf das, was in ihm war. Manchmal erschrak er selbst vor diesen unbeschreiblichen Kräften, die ihn über die anderen Menschen erhaben machten. "Talsah, deine Hand!" wiederholte er. Talsah tat, wie ihm befohlen, und Rajniv Sundhales begann zu sehen.
"Der abtrünnige Engel" - Folge 54 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Es war eine Welt aus Nebel und Licht. Ein Land ohne Form, ohne Farben, ohne feste Körper. Noch!!! Die gleißenden Kugeln aus purer Energie, die über der Nebelwelt hingen, sanken langsam tiefer, formierten sich zu einem Kreis, in dem eine weitere Kugel schwebte, kleiner und schwächer als die übrigen. Sekundenlang verharrten die Geistergebilde in schweigender, fast andächtiger Ruhe. Dann eine Stimme: Im Namen des einen Herrn!" Die Welt versank. Die Zeremonie begann...
"Das Rätsel von Stonehenge" - Folge 55 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Sie blieb stehen. Ihr Herz jagte, und trotz der feuchten Kälte, die sie einhüllte, war sie in Schweiß gebadet. Aus angstvoll geweiteten Augen blickte sie um sich. Aber da war nichts. Nichts außer grauen Nebelschwaden, die die Welt gefressen hatten und alles mit trister Gleichförmigkeit überzogen, was weiter als zwei oder drei Schritte entfernt war. Aber was sie nicht sah, das hörte sie: das gedämpfte Tappen schwerer Pfoten, die Geräusche massiger Körper, die durch das Unterholz und Gestrüpp brachen- und das grässliche Bellen der Bluthunde, das unbarmherzig näher kam...
"Stadt der bösen Träume" - Folge 56 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Es war dunkel hier unten, fast hundert Fuß unter der Erdoberfläche, doch das Ding benötigte keine Augen, um sich zurechtzufinden. Gierig peitschten seine schleimglänzenden Tentakel über die nachtschwarzen Granitwände des Stollens. Es hatte seinen Ruf ausgesandt, und es wusste dass er gehört worden war. Die Gier nach frischem, pulsierendem Leben wurde beinahe übermächtig in ihm. Die Opfer waren unterwegs...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Endstation Hölle
Der Hexer – Der abtrünnige Engel
Der Hexer – Das Rätsel von Stonehenge
Der Hexer – Stadt der bösen Träume
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 53-56:
Der Hexer – Endstation Hölle
Der Hexer – Der abtrünnige Engel
Der Hexer – Das Rätsel von Stonehenge
Der Hexer – Stadt der bösen Träume
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 53–56
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1581-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 53
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 49, 50 und 53 (Folge 49 und 50 finden Sie in Sammelband Nr. 13, Folge 49-52).
Dieses Vorwort bezieht sich auf die E-Book-Hexer-Folgen 49, 50 und 53, da es dem Taschenbuch-Sammelband entspringt und dort erstmals von der Regel abgewichen wurde, alle Hexer-Hefte chronologisch in der Reihenfolge ihres damaligen Erscheinens neu zu präsentieren, und zwar aus folgendem Grund: Bei den ursprünglichen Bänden 40 »Das unheimliche Luftschiff« und 44 »Endstation Hölle« handelt es sich um zwei Gastromane, die Perry-Rhodan-Autor Arndt Ellmer verfasst hat. Es ist ein Soloabenteuer um Howard und Rowlf, in dem Robert Craven selbst gar nicht mitspielt. Da es sich um einen Zweiteiler handelt, erschien es allen Beteiligten sinnvoll, beide Hefte für die Taschenbuch-Sammeledition hintereinander zu bringen, statt sie durch ein Festhalten an der ursprünglichen Reihenfolge auf zwei Bücher zu verteilen. Gleiches gilt für die Bände 42 »Die vergessene Welt« und 43 »Revolte der Echsen«. Auch hierbei handelt es sich um einen Zweiteiler.Eine weitere Hauptrolle bei den Abenteuern Howards spielt ein gewisser Phileas Fogg. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um den durch den Roman »In achtzig Tagen um die Welt« von Jules Verne berühmt gewordenen Weltreisenden, der seine Wette nun unter verschärften Bedingungen wiederholt. Herausgefordert dazu wird er von einem gewissen Professor Moriarty, auf den ich bereits im Vorwort zu den E-Books 43 bis 45 kurz eingegangen bin. Moriarty war der Intimfeind des Meisterdetektivs Sherlock Holmes.
Jules-Gabriel Verne, der auch schon den für die Hexer-Saga nicht ganz unwichtigen Kapitän Nemo und seine NAUTILUS erfunden hat, wurde am 8. Februar 1828 als Sohn eines Rechtsanwaltes in Nantes geboren. Auf Wunsch seines Vaters studierte er Jura, zunächst in Nantes, ab 1848 in Paris, wo er Kontakt zu literarischen Zirkeln fand und u. a. die Bekanntschaft von Alexandre Dumas machte. Er begann Dramen zu schreiben.
Sein erstes Stück wurde am 12. Juni 1850 im Pariser Théatre Historique uraufgeführt. Von 1852 bis 1855 arbeitete Jules Verne als Sekretär am Théatre Lyrique und war ab 1856 auch als Börsenmakler tätig.
Neben der mit wachsendem Erfolg andauernden Arbeit als Romancier unternahm Verne große Reisen, auf denen er Anregungen für seine Arbeit fand. Neben reinen Abenteuerromanen verfasste er zahlreiche Bücher mit fantastischem Einschlag, die ihm den Titel als Vater des Science Fiction einbrachten. Viele seiner Werke wurden mehrfach verfilmt und sind noch heute Welterfolge.
Jules Verne starb am 24. März 1905 in Amiens.
Ähnlich große Berühmtheit errang Herbert George Wells, dem der Hexer in diesem Buch begegnet. Geboren wurde er am 21. September 1866 in Kent; er starb am 13. August 1946 in London. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören die Romane »Die Zeitmaschine« (erschienen 1895) und »Der Krieg der Welten« (1898). Letzterer wurde von dem damals dreiundzwanzigjährigen Orson Welles in ein Hörspiel umgewandelt, das am 30. Oktober 1938 ausgestrahlt wurde und angeblich wegen seines pseudodokumentarischen Charakters in halb Amerika eine Panik ausgelöst haben soll. Eine Legende, die sich bis heute hartnäckig hält, obwohl längst erwiesen wurde, dass es sich bei dieser Hysterie nur um Einzelfälle handelte.
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 53Endstation Hölle
Talsah, gib mir deine Hand!«
Die Stimme erklang ruhig und ausgeglichen über der von weichem Moos bewachsenen Felsbalustrade hoch über dem grünen Tal des Bhima. Sie trug die Weisheit des Alters in sich; eine Weisheit von solcher Eindringlichkeit, dass die Bewohner des Dorfes unten am Fluss ihr nur mit Furcht gelauscht hatten. Bis sie den blinden Alten schließlich fortjagten und die fürchterlichsten Drohungen für den Fall ausstießen, dass er jemals zurückkehrte. Jetzt lebte er hier oben, nahe dem Himmel, weit weg von den Störenfrieden und ihren Nachkommen, und richtete seinen Geist auf das, was in ihm war.
Manchmal erschrak er selbst vor diesen unbeschreiblichen Kräften, die ihn über andere Menschen erhaben machten.
»Talsah, deine Hand!«, wiederholte er. Talsah tat wie ihm befohlen, und Rajniv Sundhales begann zu sehen:
Die Berge spien weiße, feurige Glut über das gesamte Land zwischen den Abgründen, ließen die kleinen Meere verdunsten und füllten die entstandenen Täler mit Schlacke und Asche. Brodelnde Lava wälzte sich unaufhaltsam die Hänge hinab wie glühende Schlangen, um über die Fliehenden und die Bestraften hereinzubrechen und sie in den Bann ihres steinernen Kerkers zu ziehen. Sie warf sich über sie und erstarrte, erstarrte in Millionen kleiner und kleinster Brocken, porös und schwarz wie alles aus dieser alten Zeit. Was in ihnen eingesperrt wurde, war gefangen für alle Ewigkeit, und was so töricht gewesen war, seine Lungen mit dem giftigen Odem aus dem Erdinnern zu füllen, atmete ihn nun auf immer, ohne die Möglichkeit, ihm jemals zu entkommen.
Nein, zu diesen Zeiten war es eine andere Welt, ein Reich voller Düsternis, eine Welt, die noch kein eigenes Leben entwickelt hatte und sich die Opfer bei denen suchte, die von außen gekommen waren. Viele erwiesen sich als zu schwach und suchten ihr Heil in der Flucht, ohne entkommen zu können. In ihrem Bewusstsein dämmerte die Erkenntnis, dass ihr Unheil allein damit begonnen hatte, dass sie hergekommen waren, um ihre Macht zu festigen.
Die Erde fraß sie alle, dieser unheilvolle Planet mit seiner Entsetzen verbreitenden Natur.
Vor Äonen waren sie gekommen, gewaltige Wesen von unbeschreiblicher Bosheit und Kälte, einen Panzer aus Eis hinter sich herziehend und mit schrillen, spitzen Schreien an den Toren wachend, jederzeit bereit, diese beim geringsten Anzeichen von Verfolgern zu zerstören. Sie waren aus der Finsternis gekommen und schleppten den Schatten des Todes mit sich, den verderblichen Hauch, und die kahle und tote Welt begann sich gegen sie zu wehren, als hätte sie den Keim des Lebens bereits in sich und müsste ihn nur noch gebären. Ein Heulen und Jaulen lag über den Landmassen, und es nahm beständig an Lautstärke zu, bis es die Schreienden an den Toren übertönte. Die Tore erloschen, die Ankunft war abgeschlossen.
Und damit begann alles.
Sie machten sich die Erde untertan und begannen die Geheimnisse unter ihrer Oberfläche zu ergründen, in der Absicht, diese Welt für alle Ewigkeit zu ihrem Eigentum zu machen. Der maßlose Wille nach absoluter Macht beherrschte sie, und in ihrem Gefolge befanden sich Legionen Schwächerer, die ihnen dienten und die dennoch so gewaltig und unendlich stark waren, dass sich kein normales Lebewesen gegen sie behaupten konnte.
Die Herrscher besaßen Namen, die man nicht aussprechen soll, will man nicht Gefahr laufen, sie dadurch zu rufen und den Preis für ihr Kommen zu zahlen. Einen schrecklichen Preis, der aus Tod und Verderben besteht, aus Untergang und Vergessen, aus Finsternis und erloschenem Seelenfeuer. Wehe, sie kehren einst zurück und zerbrechen den Kerker, in den sie von den ÄLTEREN GÖTTERN einst gepfercht wurden!
Aber so weit war es noch nicht. Die GROSSEN ALTEN begannen erst, sich die Erde untertan zu machen. Und sie schickten ihn hinauf in die Kälte, dorthin, wo es keine speiende Lava gab, wo keine Bergketten einstürzten und die nimmermüden Helfer unter sich erschlugen und für die Ewigkeit mit sich in die Tiefen rissen. Dort, wo das ewige Eis lag, knirschte der Schnee, und die Kälte machte ihm mehr zu schaffen als alles andere. Eis hatte sich auf dieser kalten und kahlen Welt gebildet, lange bevor sie gekommen waren. Aber die GROSSEN ALTEN hatten selbst einen Panzer aus Eis mit eingeschleppt, und er überwachte dessen Ablagerung in den Polregionen.
Das Eis kämpfte gegen das Eis, wie sich ein Körper gegen eine Krankheit zur Wehr setzt. Es versuchte das andere zu fressen und zu zerstören; und die Wogen der Eismeere schlugen höher, bildeten Wände von großer Höhe und rollten über das Eis, um es wegzufegen vom eigenen, kalten Untergrund.
Das fremde Eis klammerte sich an. Es bildete Myriaden um Myriaden feiner und feinster Krallen, dünne Splitter, die sich in den Untergrund bohrten und festhielten. So trugen die Wogen nur einen Teil mit sich weg, und dieser fasste an anderen Orten Fuß, und so konnte er nach vielen langen Jahren melden, dass seine Aufgabe erfüllt war.
Das war der Anfang. Millionen Jahre vergingen, bis der Erste Krieg begann. Sie entschieden ihn für sich, aber durch ihren Sieg machten die GROSSEN ALTEN die ÄLTEREN GÖTTER auf sich und ihren Hunger nach Macht aufmerksam, und diese kamen und verbannten die GROSSEN ALTEN nach langem und entsetzlichem Kampf vom Antlitz des verwüsteten Sterns.
Nur einer fand Gnade.
Er.
Er war ein fürchterliches Wesen, doch in den Augen der ÄLTEREN GÖTTER war er schwach.
Und er war ein Kind, geboren lange vor der Flucht auf die Erde, getrennt von seinen Erzeugern, die irgendwo zwischen den Sternen weit draußen ihr feuriges Leben ausgehaucht hatten. Er war der Letzte seiner Art, ein gewaltiger Gott in den Augen urzeitlicher Völker. Doch es sollte ihm nicht gegeben sein, jemals diese Rolle zu spielen.
Die ÄLTEREN GÖTTER erlaubten ihm zu schlafen. Sie räumten ihm ein, dass er sein kindhaftes Leben unbeschadet behalten durfte, und sie wussten zu genau, dass er ihre Entscheidungen und Maßnahmen nachträglich nicht zu durchkreuzen vermochte. Dazu war er zu schwach, dazu wusste er viel zu wenig von der Welt der Erwachsenen, die eigentlich gar nicht seine Welt war. In ihm lebte der Spieltrieb wie in jedem Kind, und ihm fehlte das Urteilsvermögen, um zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können.
Er wählte sich den Bereich um den Nordpol für seine Ruhestatt. Längst war das fremde Eis mit dem vorhandenen verschmolzen, bildete eine friedliche Einheit und wehrte sich nicht gegen seine Annäherung. Die geflügelten Boten der ÄLTEREN GÖTTER schufen die Kaverne, und sie wiesen ihn an hinabzusteigen.
»Wann werde ich erwachen?«, fragte er immer wieder, doch erhielt er keine Antwort. Das Eis umschloss ihn, und es verhinderte, dass er jemals seine verderblichen Fähigkeiten gegen irgendein Lebewesen würde einsetzen können. Er legte sich zur Ruhe, und aus Cthugha, dem Flammenden, wurde Cthugha, der Eisige. Kälte und Finsternis umfingen ihn, während die Helfer der ÄLTEREN GÖTTER die Kaverne verschlossen.
»Schlafe, kleines Kind«, vernahm Cthugha endlich eine ihrer Stimmen. »Du hast den Schlaf bitter nötig. Du bist in eine falsche Welt geboren, denn du hast eine andere verdient. Doch merke dir: Was immer auch sein wird, es liegt an dir selbst, was aus dir wird, AUF WESSEN SEITE DU EINES TAGES STEHEN WIRST.«
»Wann werde ich erwachen?«
Sie blieben ihm die Antwort schuldig, und Cthugha wurde schläfrig und dachte nicht mehr an die Zukunft. Er besaß keine Vergleichsmöglichkeit, und so war in seinen Gedanken Zufriedenheit über sein bisheriges Leben, Zufriedenheit über die Handlungen der GROSSEN ALTEN und die Rebellion der Shoggoten und ihrer Helfer.
Cthugha nahm es hin, wie ein Kind etwas hinnahm, was es nicht ändern konnte. Er verdrängte die schlimmen Gedanken und wollte nur noch schlafen. Er fragte sich nicht, wie lange der Schlaf dauern würde.
Es spielte keine Rolle.
Nicht für ihn, den flammenden Cthugha.
Der Schlaf übermannte das Kind, und das Eis flüsterte ihm zu, dass er der Letzte seiner Familie war.
Cthugha schlief, und vielleicht war in ihm jene Art von wohliger Wärme, die bei Menschenkindern ein so stilles und sanftes Lächeln auf das Gesicht wirft, wenn sie träumen.
Sechs Tage lang führte ihr Weg durch unwegsames Gelände. Sie überquerten die Pässe der West-Ghats und ritten das Bhima-Tal hinab bis Gulbarga, an dem Flusslauf entlang, dessen grünblaues Wasser sie immer wieder zu einem Bad verlockte. Trotz der Jahreszeit war es in Indien sommerlich warm; die letzte Trockenperiode vor dem einsetzenden Winter hielt bereits seit Wochen an. Von Gulbarga gelangten sie hinauf nach Haiderabad, und von dort waren es nur ein paar Minuten bis zu der außerhalb der Stadt gelegenen Endstation der Bahn.
Eine halbe Meile hinter der Stadt zügelte Phileas Fogg sein Pferd. Er wandte sich zu seinem Diener um, und Passepartout erschrak ob des Aussehens seines Herrn. Foggs Gesicht war aschfahl und eingefallen, seine Augen lagen tief in den dunkel umrandeten Höhlen, und die Nase war gerötet und ein wenig geschwollen. Er machte den Eindruck, als litte er an Auszehrung, und dabei wusste der Diener genau, dass dies nicht der Fall war. Sie hatten sich in Bombay mit ausreichend Nahrungsmitteln für eine ganze Woche versorgt, und die Satteltaschen waren noch nicht vollständig leer geworden.
Viel schlimmer war der allgemeine Zustand seines Körpers. Hände und Unterarme von Mr. Fogg zitterten unablässig, und manchmal ging es wie ein Zucken durch seine Beine. Ab und zu, wenn er sich unbeobachtet fühlte, sank sein Oberkörper nach vorn, rang sich über seine Lippen ein kaum hörbares Stöhnen, schien der ganze Körper dieses Mannes nach Erlösung zu schreien.
Und Passepartout ritt hinterher wie ein Häuflein Elend, unfähig, etwas Sinnvolles zu sagen und seinem Herrn zu helfen. Und wenn er einmal den Versuch machte, dann erkannte Fogg ihn bereits im Ansatz. Er fuhr im Sattel herum und raunzte seinen Diener an, dass er gefälligst Abstand zu halten habe.
Jetzt, unter den Mauern von Haiderabad, winkte er ihn zum ersten Mal zu sich. Auf seinem Gesicht erschien ein leichtes, Verständnis heischendes Lächeln, als er abstieg und Passepartout die Zügel in die Hand drückte.
»Mache einen guten Preis, und lass dich von den Indern nicht übers Ohr hauen«, trug er Passepartout auf. Er sammelte den Inhalt der Satteltaschen ein und verstaute alles in der Reisetasche, die Passepartout vor sich auf dem Pferd trug. Er entfernte sich mit ihr in Richtung des kleinen Bahnhofes, und Passepartout machte sich daran, den Auftrag auszuführen und die Pferde zu verkaufen.
In der Zwischenzeit suchte Phileas Fogg die kleine Kaffeestube auf, die sich neben dem Bahnhof befand. Ein riesenhaftes Schild über dem Eingang wies darauf hin, dass es hier eine letzte Erfrischung vor der Bahnfahrt gab.
Für Weiße wohlgemerkt. Farbige jeder Herkunft hatten keinen Zutritt, und als Mr. Fogg langsam eintrat und sich umsah, stellte er fest, dass er der einzige Zivilist war. Alle anderen Gäste trugen die Uniform der englischen Kolonialtruppen, und das Eintreten eines in staubige Straßenkleidung gehüllten Mannes wurde mit einem lauten Hallo quittiert. Sofort eilte der Wirt herbei und erkundigte sich beflissen nach den Wünschen seines hohen Gastes.
Phileas Fogg orderte zwei Kaffee. Er stellte die Tasche in eine Ecke und ließ sich auf dem Stuhl eines Tisches nieder, an dem niemand saß. Er legte die Hände so auf die Tischplatte, dass diese exakt mit den Handgelenken abschloss, wie er es von seinem Mittagsmahl im Reform Club gewöhnt war. Er dachte an seine Bekannten und Freunde, die von seiner neuerlichen Wette erfahren haben mussten. Wie reagierten sie? Glaubten sie daran, dass er es zum zweiten Mal schaffte?
Der Weltreisende wurde etwas ruhiger. In den vergangenen Tagen und Nächten hatte er kein einziges Mal an die Daheimgebliebenen gedacht, an seine Frau und die Kinder. Jetzt tat er es, und er tat es hingebungsvoll und merkte nicht einmal, dass der Wirt die beiden Tassen duftenden Kaffees vor ihn hinstellte und sich mit einem freundlichen Nicken entfernte. Er hörte auch nicht die Frage nach dem Woher und Wohin, die halblaut an einem der Nebentische gestellt wurde. Er hatte die Augen geschlossen und dachte nach.
Er war zum dreifachen Mörder geworden, und die Erinnerung an jene grauenhaften Abendstunden auf der Lichtung vor der Hügelformation hatte den Ritt nach Haiderabad zum Albtraum für ihn werden lassen. Je größer der Abstand zu den Ereignissen wurde, desto schlimmer litt er, und am liebsten wäre er aufgesprungen und hätte es laut hinausgeschrien, dass er ein Mörder war.
Draußen entstand Unruhe, verbunden mit einem leichten Vibrieren des Fußbodens. Ein Pfeifsignal kündigte das Eintreffen des Zuges an, der in Stundenfrist wieder nach Bezwada zurückfahren sollte. Inder begannen laut zu schreien, und Phileas Fogg hob ein wenig den Kopf und öffnete die Augen, warf einen nachdenklichen Blick zu einem der glaslosen Fenster hinaus auf das dampfende Ungetüm und widmete sich dann dem gerade noch dampfenden Kaffee. Er schlürfte ein wenig, wie es sich gehörte, vernahm das leise Öffnen und Schließen der Eingangstür und sagte, ohne sich umzudrehen: »Wir werden den Zug so bald wie möglich besteigen, mein lieber Passepartout. Aber zunächst setze dich her, und trinke deinen Kaffee!«
Der Diener nahm schweigend Platz und beobachtete seinen Herrn. Das Flackern in dessen Augen war einem ruhigen, aber dennoch übertriebenen Glanz gewichen, die Blässe einer natürlichen Röte, und das Zittern der Hände war kaum noch merkbar, wenn Mr. Fogg die Kaffeetasse hielt.
»Dennoch liegen wir vier Tage im Rückstand«, meinte Passepartout nach einer Weile. »Aber das zählt natürlich nicht mehr. Die Wette war doch nur ein Vorwand!«
Der bedenkliche Unterton seiner Worte ließ Phileas Fogg zurückzucken. Seine Augen öffneten sich unnatürlich weit, er lehnte sich nach hinten und ging in Abwehrstellung. Foggs Gedanken begannen sich zu überschlagen. Die Hilflosigkeit, mit der er seinem Diener gegenübersaß, bewirkte, dass er sofort alle seine bisherigen Gedanken vergaß. Mit der Abwehr kehrte die Macht des Fremdartigen zurück. Er griff in die Rocktasche und holte den Beutel hervor. Er hielt ihn Passepartout vor die Nase, und der Diener wich mit einem leisen Aufschrei zurück.
»Der Stein von Kadath!«, zischte Mr. Fogg. »Ein Überbleibsel jener Realität gewordenen Traumwelt, zu der nur ganz wenigen Berufenen der Zugang möglich war. Kennst du Kadath?« Er lachte auf und stellte den Beutel vor sich hin. »Natürlich hast du noch nie davon gehört. Ich weiß es von dem Inhalt dieses Beutels. Willst du ihn fühlen? Er wird immer schwerer und ist doch so leicht wie Federn. Die drei, die uns verfolgt haben, haben einen kleinen Geschmack dessen bekommen, was Kadath ist!«
An einem der Tische in der hinteren Ecke hatte sich ein Colonel erhoben und näherte sich dem Tisch. In respektvollem Abstand blieb er stehen.
»Verzeihen Sie, ich hörte, wie Sie Ihren Begleiter mit dem Namen Passepartout anredeten, Sir. Sind Sie wohl gar der berühmte Phileas Fogg?«
Mr. Fogg hätte unter normalen Umständen auf eine solch höfliche Frage eine noch höflichere Antwort gegeben, doch was war auf dieser Reise schon normal? Er registrierte die wischende Bewegung über den Tisch, die seine Kaffeetasse streifte und zur Seite warf und gegen den Lederbeutel zielte. Passepartouts Angriff kam überraschend, und doch hatte der Diener nicht die geringste Chance, sein Vorhaben auszuführen. Foggs Hand knallte auf den Tisch, klemmte den Arm fest und riss mit der freien Hand den Beutel weg. Er verschwand in der Tasche, noch ehe sich Passepartout von seiner Überraschung erholt hatte.
»Ja«, sagte der Weltreisende nun mit einem kurzen Nicken zu dem Offizier. »Sie entschuldigen!«
Mit diesen Worten sprang er auf, warf sich auf Passepartout und riss ihn samt dessen Stuhl zu Boden. Der Diener gab einen erstickten Laut von sich und begann zu strampeln. Man hätte wohl über den Anblick der beiden auf dem Fußboden zappelnden Körper lachen können, wenn die Angelegenheit nicht so ernst gewesen wäre. Es fanden sich denn auch sofort mehrere Militärs, die die beiden trennten und derb auf ihre Stühle drückten. Der Wirt kam aus seiner Deckung hinter dem Tresen hervor und hob zu einem Klagelied auf seine noch unbeschädigten Möbel an.
Phileas Fogg warf ihm das Geld für den Kaffee vor die Füße, packte mit der Rechten die Reisetasche, mit der Linken Passepartout und stürmte hinaus auf den Bahnsteig, wo sich der Zug inzwischen geleert hatte. Die ersten Fahrgäste für die Rückfahrt fanden sich ein und suchten sich passende Abteils aus. Fogg ließ den Diener los und kaufte bei dem Beamten an der Lokomotive die Fahrkarten, kehrte zu Passepartout zurück und stieß ihn bis ans Ende des Zuges und in das einzige vorhandene Abteil erster Klasse hinein. Die Reisetasche folgte, dann stieg Phileas Fogg mit wuchtigen Bewegungen gleich einem Racheengel ein und ließ sich schwer in die Polster fallen. Er achtete nicht auf die ängstlichen Blicke, die der verschüchterte Diener ihm zuwarf.
»Was hast du für die Pferde bekommen?«, fragte Fogg, als sei nichts gewesen. Der Diener nannte die Summe und fügte hinzu, dass er sie zu der übrigen Barschaft in die Reisetasche gesteckt habe.
»Wohin fahren wir von Bandar aus?«, wagte er leise zu fragen.
Fogg blickte seinen Diener verhärmt und mutlos an.
»Ich weiß es nicht, treuer Passepartout«, seufzte er. »Ich glaube nicht, dass wir das Ziel unserer Reise überhaupt jemals erreichen werden. Willst du mir einen Gefallen tun?« Er wartete die mögliche Antwort gar nicht ab und fügte hinzu: »Pass ein wenig auf deinen Herrn auf, Passepartout. Wenn nötig, mit Gewalt!«
In einem Meer von Farben ging die Sonne unter. Der ovale Ball tauchte die Regenwälder in einen rötlichen Schimmer. Vereinzelt zogen Vögel ihre leichten Kreise am Himmel, und aus den Wäldern am gegenüberliegenden Hang des Bhima-Tales kräuselte sich an mehreren Stellen der Rauch der Schäfer, die kleine Feuer entzündeten, um sich die Nacht über zu wärmen und wilde Tiere von den Herden fernzuhalten.
Die Natur bot sich als ein einziges Gemälde voller Harmonie dar, ein Sinnbild vieler unausgesprochener und unsichtbarer Mysterien. Sie entrückte die Wirklichkeit des Alltags ein wenig und schuf ein Paradies, dessen eigentliche Seele nur jemand wie Rajniv Sundhales erkennen konnte. Nicht einmal Talsah war dazu in der Lage, obwohl er einen Teil dessen empfing, was in Rajniv vor sich ging.
Der alte Mann stand da wie ein Fels. Hoch aufgerichtet hielt er den Kopf leicht nach hinten gebeugt und lauschte. Er hielt Talsahs Hand, und er sah mit Talsahs Augen und empfand die Welt so, wie Talsah sie empfand.
Und doch ein wenig anders; eindringlicher und hinter die Dinge blickend, Vorgänge und Anzeichen erkennend. Er spürte die Schatten, die von Westen heraufzogen, langsam die Hänge der West-Ghats emporkrochen, in die Nähe des oberen Laufes des Bhima gerieten und dort verharrten. Rajniv wandte sich ruckartig um, zog seinen jugendlichen Schüler mit sich und machte ihm durch einen leichten Druck der Hand klar, in welche Richtung er zu blicken wünschte.
»Eine schwarze Wand kommt von Westen«, verkündete er mit leiser Stimme, aus der die Besorgnis klang. »Sie hat angehalten, aber sie wird ihren Weg fortsetzen. Sie wird auch zu uns kommen. Wir werden zusehen müssen, dass wir uns schützen!«
»Dein Schutz ist mir genug, Meister«, erwiderte Talsah. Der Junge mit den dunklen Augen verzog das Gesicht zu einem beruhigenden Lächeln. Rajniv sah es nicht, denn er sah durch Talsahs Augen und konnte ihm daher nicht ins Gesicht blicken. Aber Talsah wandte sich zu ihm um, und Rajniv sah sich selbst, den ausgemergelten Körper in dem Gewand, das früher einmal weiß gewesen war und längst ein schmutziges Grau angenommen hatte. Talsah wusch es regelmäßig, drüben an dem kleinen Wasserfall, doch es wurde immer ein wenig grauer und dunkler, mit jedem Jahr, das Rajniv Sundhales lebte.
»Mein Schutz ist nicht genug, Talsah«, sagte er leise. »Ich bin besorgt, und ich weiß, dass es zu meinen Aufgaben gehört, alles abzuwehren. Folge mir!«
Er löste seine Hand aus der des Jungen und schritt davon. Er hielt die pupillenlosen Augen zu Boden gerichtet und hatte den Kopf ein wenig geneigt, um besser hören zu können. Links fiel das Gelände steil in das Tal ab, rechts lag die Kuppe des Hügels, dicht an dicht von Bäumen und Büschen bewachsen, in denen unzählige Vogelarten ihr ewiges Lied trällerten.
Diesmal hatte Rajniv Sundhales kein Ohr dafür. Er lauschte auf seine Schritte und die Geräusche, die sie erzeugten. Er bewegte sich immer in der Mitte zwischen Hügel und Abhang entlang. Er ging nicht fehl, und er fand den schmalen Pfad, der hinab in das Tal führte, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, dass ein Blinder dahineilte wie ein junger Mann.
Er begann bergab zu schreiten, und Talsah folgte ihm, einen Arm nach vorn gestreckt, um ihn zu halten, falls er zu stürzen drohte. Als sie die ersten Weiden auf halber Höhe erreicht hatten, wurden die Schäfer auf Rajniv aufmerksam. Sie erhoben ein Geschrei und sammelten sich, um ihm entgegenzugehen.
»Verschwinde!«, riefen sie ihm zu. »Du verhext unser Vieh, und die Weiber werden irr, wenn sie dich sehen!«
»Ich will nicht in das Dorf!«, rief der alte Mann laut und hob die Arme. »Ich will in die Höhle. Ihr könnt es mir nicht verbieten!«
Erste Steine kamen geflogen, und einer traf ihn an der Schulter. Talsah stellte sich schützend vor ihn, und die Steinwürfe hörten auf. Die Schäfer begannen zu murren, aber schließlich räumten sie das Feld und verschwanden hinter den Bäumen. Talsah aber nahm seinen Lehrer und Meister bei der Hand und führte ihn hinab bis zur Abzweigung in die Schlucht. Der Wasserfall stürzte hier von hoch oben herab, ein kleines Rinnsal, das früher einmal mehr Wasser geführt haben musste und die Schlucht geschaffen hatte. Es war viele Generationen her, wie Rajniv sagte, und weil er es sagte, glaubte Talsah daran. Er hatte noch nie erlebt, dass der Weise vom Berg gesprochen hätte, ohne vorher gründlich zu überlegen.
Wieder sah Rajniv Sundhales durch die Augen seines Schülers, und er riss ihn mit sich, und aus seinem Mund kam ein beängstigendes Pfeifen von Luft, ein Geräusch, das Talsah noch nie von ihm vernommen hatte.
»Es eilt«, stieß der Alte hervor. »Etwas geschieht, und es ist entsetzlich!«
Er zog ihn davon und schwieg, bis sie die Höhle erreicht hatten. Ein Felsüberhang wies auf den Eingang hin. Sundhales zog Talsah darunter und deutete auf das Loch, das ihnen dunkel und unheimlich entgegengähnte.
»Führe mich hinein!«, verlangte er. »Verliere keine Zeit!«
Talsah wäre ein schlechter Schüler gewesen, wenn er widersprochen und ihn in lange Streitgespräche verwickelt hätte. Er tat wie geheißen und hielt erst an, als Sundhales von allein stehen blieb.
»Sie sind angekommen«, hauchte er. »Spürst du es nicht? Nein, du kannst es nicht spüren. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man etwas erfährt, ohne es mit den Augen zu sehen. Damals, ja da hat es bei mir eine Zeit des Übergangs gegeben. Mit der Erblindung kam das innere Sehen, ohne das ich nicht in der Lage wäre, meine eigentlichen Fähigkeiten einzusetzen. Das schleichende Gift, das der Templer mir damals gab – es hat seine Wirkung gezeigt!«
Er verstummte und hörte zu, wie Talsah ein Kienholz entzündete und die Höhle durchsuchte. Er kehrte zufrieden zurück und berichtete, dass sich kein Ungeziefer und kein Raubtier in der Höhle aufhielt.
Sundhales lächelte. Sein Gesicht verstrahlte dieses gütige und alles einnehmende Lächeln, nur die Augen blieben tot, hellblauen Murmeln ähnlich, auf die jemand in künstlerischer Ignoranz zwei weiße Kleckse gemalt hatte.
»Lösche das Holz, wir benötigen es später!« Rajniv erhob sich und stützte sich mit der linken Hand gegen das feuchte Gestein. Die Hand strahlte Wärme ab und trocknete den Fels, und der Alte fuhr mit erhobener Stimme fort: »Es ist eine bösartige Ausstrahlung. Sie weht von Westen her, und sie hat von einem Menschen Besitz ergriffen. Er tut, was sie ihm eingibt. Er wird verfolgt, und er stellt seinen Verfolgern eine Falle. Sei still jetzt, störe deinen Meister nicht. Ich will versuchen, ihn zu retten.«
Er ertastete einen Felsvorsprung und setzte sich darauf, beugte Kopf und Oberkörper nach vorn und stützte den Kopf in die Hände. Seine Augenlider schlossen sich, und sein Geist richtete sich nach innen. Rajniv war jetzt nur er selber, ein alter Mann ohne Bezug zu der Welt, in der er lebte.
Er lauschte in sich hinein und erlebte einen Teil dessen mit, was geschah. Sein Körper vermochte nicht ganz, all das zu verbergen, was sein Geist entdeckte. Wie in Trance bewegte sich sein Oberkörper mal nach links, mal nach rechts, formten die Lippen lautlose Worte.
»Es sind drei. Sie reiten einen Hügelkamm entlang«, stieß er plötzlich hervor. »Sie brechen ein. Sie haben sich in der Falle gefangen, in die sie gelockt wurden. Aber warum, Monsieur? Warum sollen sie sterben? Die bösartige Ausstrahlung kommt von dem anderen. Nein, es darf nicht sein. Ich muss etwas tun. Ich muss sie retten!«
Er verstummte mit einem heiseren Röcheln, vergrub den Kopf noch tiefer in den Händen und krümmte sich.
Weit entfernt öffnete sich die Erde. Sie schuf einen dunklen Dom, eine Höhlung unter der Oberfläche, in die die drei Reiter und Pferde stürzten. Sundhales konnte nicht erkennen, was dort unten war, woran es ihn hätte erinnern können, wenn er es wahrgenommen hätte. Er erfuhr lediglich einen Namen, der Teil jener Bösartigkeit war, die die drei Menschen in die Falle gelockt hatte.
Rajniv holte nochmals tief Luft, rang sich in einem unterdrückten Aufstöhnen die letzte Kraft für seinen Einsatz ab. Das, was er bisher in der Art eines unbeteiligten Beobachters wahrgenommen hatte, veränderte übergangslos die Perspektive, bewegte sich auf ihn zu und wuchs vor ihm auf, als rase er durch einen Tunnel darauf zu. Er fand sich in der Höhlung wieder und spürte nur die Anwesenheit der drei Körper, die stürzten. Auf die Pferde achtete er nicht, sie waren für ihn nichts, weswegen er hätte handeln müssen.
Rajniv Sundhales mobilisierte seine Fähigkeit, die ihn zu einem Einzelgänger und Ausgestoßenen gemacht hatte, für die er von der Küste einst ins Landesinnere gejagt und vergiftet worden war. Etwas in ihm wurde glühend heiß, verströmte den Odem glühender Lava und griff nach den drei Körpern. Es begann sie zu umweben und einzuhüllen, rasend schnell, denn es blieb nicht viel Zeit.
Ein Knirschen und Quetschen drang an seine Ohren, die schweren Pferdeleiber waren auf Fels aufgeprallt und zerschlagen worden.
Jetzt! Der lautlose Befehl in ihm löste endgültig aus, wozu er fähig war. Der Odem hatte die drei stürzenden Körper ergriffen und ließ keine Lücke um sie herum.
Und es geschah. Ein kurzer, greller Lichtblitz zuckte durch das Dunkel der Höhlung und beleuchtete drei Männer, die wie in einer unsichtbaren Blase hin und her gewirbelt wurden. Der Lichtblitz erlosch, die Dunkelheit kehrte zurück. Die Höhlung verschwand rasend schnell in der Ferne, und dann gab es drei dumpfe Geräusche, als die Körper den felsigen Untergrund berührten.
Sundhales stieß einen Schrei aus und kippte vornüber. Talsah fing ihn behutsam auf und bettete ihn an die Felswand. Er fächelte ihm ein wenig Luft zu, und das Zucken im Körper des alten Mannes hörte übergangslos auf.
Langsam, voller Vorbehalte und Zögern, öffnete Rajniv die Lider. Die blauen Murmeln blickten den Schüler an.
»Monsieur?«, fragte Sundhales mit seltsam veränderter Stimme. »Es ist Nacht!«
»Draußen wird es dunkel«, antwortete Talsah. »Aber hier wird es gleich hell!«,
Ein Rascheln und Zischen entstand, dann flammte der Kienspan auf und beleuchtete die Höhle. Talsah reichte seinem Meister die Hand, und Rajniv erhob sich schwankend und machte ein paar Schritte weiter in die Höhle hinein. Er sah sie liegen, drei Körper. Vorsichtig ging er näher heran. Es waren zwei Männer mittleren Alters, Europäer, wie er feststellte. Der dritte war ein junger Inder, vermutlich der Führer.
»Sieh nach, was mit ihnen ist«, sagte der Alte.
Talsah beugte sich über sie und untersuchte sie. Er prüfte ihren Pulsschlag und ihre Atmung, tastete Brustkorb und Rücken ab, danach die Beine und Arme.
»Sie sind unverletzt!« Wieder nahm er Rajnivs Hand. »Aber die Ohnmacht hält sie umfangen!«
Einige wenige Augenblicke schwieg Rajniv Sundhales, dann begann er leise vor sich hin zu lachen.
»Wie war es?«, wollte er wissen. »Ich habe wieder Monsieur gesagt, ganz bestimmt!«
»Ja.«
»Es ist eine Fügung des Schicksals, dass diese Wunde in meiner Seele nicht verheilen will und unter großen Anstrengungen immer neu aufbricht«, seufzte der Alte. »Sei es, wie es will. Ich habe drei Männer, die dem Tod ausgeliefert waren, gerettet. Sage mir, Talsah, wird jenes Böse oben in den Ghats kommen, um mich dafür zu bestrafen?«
Talsah gab keine Antwort. Er führte Rajniv zu den drei Geretteten. Der Alte sah durch die Augen des Schülers und beobachtete, wie eine der Gestalten sich zu bewegen begann. Sie rollte sich auf den Rücken, fuhr mit der Hand über das Gesicht und öffnete dann die Augen.
Die Augen zogen Rajnivs Sundhales magisch an. Er machte einen Schritt zurück, wollte sich abwenden, aber Talsah starrte den Fremden unentwegt an. Rajniv meinte, in diesen Augen versinken zu müssen.
Und plötzlich wusste er es und stieß einen langen anhaltenden Schrei aus.
Passepartout hatte auf den ersten Meilen der Bahnfahrt sein Gewissen befragt und sich endgültig entschlossen, den Kampf zwischen Fassungslosigkeit und Resignation zu beenden. Kalte Entschlossenheit begann sich in ihm mit stoischer Ruhe zu paaren, und je länger die Fahrt dauerte, desto häufiger tauchte in seinen Gedanken die Vorstellung auf, dass die Reise in Bezwada oder spätestens in Bandar zu Ende sein musste.
In einer Weise zu Ende, die es nicht zuließ, dass noch einmal so etwas geschah wie in jener schrecklichen Nacht auf der Lichtung.
Seither war das schwankende Gemüt seines Herrn vollends ins Taumeln geraten. Einmal bat er ihn, notfalls mit Gewalt auf ihn aufzupassen, dann schrie er ihn wieder an oder erzählte mit funkelnden Augen von dem Kadath-Stein, unter dessen Bann er stand.
Der Stein beruhigte Passepartout ein wenig, stellte er doch unter Beweis, dass Mr. Fogg nach wie vor der gütige und charakterstarke Mensch war, der lediglich unter dem Einfluss dieses schwarzen Lederbeutels litt.
Wie durchsichtig doch alles war, wenn man es Stück für Stück von Anfang an betrachtete. Da war der äußerst unsympathische und verdächtige Professor Moriarty aufgetaucht und hatte Mr. Fogg zu einer recht ungewöhnlichen Wette herausgefordert, die so außergewöhnlich auch wieder nicht war, wenn man wusste, dass der Mann aus der Savile Row schon einmal in achtzig Tagen um die Welt gereist war, eine Leistung, die zuvor kein Mensch vollbracht hatte. Inzwischen gab es schnellere Eisenbahnen und schnellere Schiffe, warum also hätte es nicht jemand in sechzig Tagen schaffen können?
Der Haken bestand allein in diesem kleinen Lederbeutel, der gut versiegelt in der linken Rocktasche seines Herrn lag und angeblich den Verlauf der Reise kontrollierte, in Wirklichkeit jedoch viel schlimmer war. Es war ein Teufelsstein, da war sich Passepartout absolut sicher. Wenn er auch wenig von Magie und Zauberkünsten verstand – nicht viel mehr, als er in seiner Jugend auf Jahrmärkten Frankreichs erlebt hatte –, so begriff er doch, dass hier bösartige Kräfte am Werk waren; Kräfte, die aus einem edlen und harmlosen Menschen einen Verbrecher machten, einen Mörder.
Ein Frostschauer nach dem anderen jagte über den Rücken des Dieners, als Phileas Fogg sich erhob, ihn mit merkwürdigem Blick musterte, das Fenster öffnete und hinaussah. Der Fahrtwind blies ihm ins Gesicht und ließ die Haare flattern, machte aus der gepflegten Haartracht ein wirres Knäuel, während Mr. Fogg sich weit mit dem Oberkörper hinauslehnte, um nach vorn zu schauen, als gäbe es da etwas Wichtiges zu sehen.
Jetzt ist die Gelegenheit günstig, dachte der Diener bei sich. Wenn er jetzt aufsprang, Foggs Beine fasste und sie mit großer Wucht nach oben stieß, dann …
Aber nein! Passepartout schlug die Hand vor den Mund und machte ein Gesicht wie ein Kind, das bei einer unrechten Tat erwischt worden war. Wie konnte er nur, es war nicht auszudenken, und es lag allein an der tödlichen Ausstrahlung dieses Beutels, den Fogg wie seinen Augapfel hütete.
Zu Beginn der Reise hatte es harmlos angefangen. Sein Herr hatte begonnen unter Verfolgungswahn zu leiden. Er hatte sich eingebildet, jemand wolle den Beutel stehlen. In jedem Passanten und jedem Mitreisenden hatte er den Dieb vermutet. Dieser Zustand hatte sich immer weiter verstärkt, bis der Beutel mit dem Stein von Kadath Mr. Phileas Fogg gänzlich in seinen Bann gezogen und ihn seines eigenen Willens beraubt hatte. Er war herrisch und ungeduldig geworden, aufbrausend und menschenverachtend, und er hatte die Verfolger in eine tödliche Falle gelockt, von der er mit Sicherheit vorher nichts gewusst hatte.
Den Ausschlag hatte jener Augenblick gegeben, als Fogg den Beutel aus der Rocktasche gezogen und sich gegen die Stirn gehalten hatte.
»Mr. Fogg«, begann Passepartout, weil er irgendetwas sagen musste, um seine innere Spannung loszuwerden. »Mr. Fogg, seid Ihr bei Euch? Oder steht Ihr unter dem Einfluss des Beutels?«
»Was geht dich der Beutel an, du neugieriger Diener?« Fogg streckte für wenige Augenblicke den Kopf in das Abteil hinein. »Warum habe ich dich überhaupt mitgenommen?«
»Damit ich notfalls auch mit Gewalt auf Euch aufpasse!«
Fogg gab ein Brummen von sich. Er beugte sich wieder hinaus, ruderte nach hinten mit den Armen und lachte auf.
»Das wirst du nie schaffen, Passepartout. Abgesehen davon, dass ich selbst auf mich aufpassen kann.«
»Dann tut es doch!« Passepartout erhob sich und trat bis zur Tür zurück. »Es ist allein der Stein, der Euch lenkt, der auf Euch achtet. Nicht Ihr selbst, Sir!«
Ein meckerndes Lachen wie von einem Irren wehte draußen vorbei. Fogg hatte es ausgestoßen. Dabei bewegte er sich keinen Deut, und der Fahrtwind riss weiter an seinen Haaren und blies in sein Gesicht. Es war, als warte Fogg auf etwas. Und je länger er hinausgebeugt blieb, desto sicherer wurde Passepartout, dass sich bald etwas ereignen würde. Er setzte sich in den Sitz neben dem Türgriff, jederzeit bereit, den Zug zu verlassen, egal ob er hielt oder fuhr.
Nach einer Viertelstunde kam Fogg endlich wieder herein, aber er ließ das Fenster offen. Er nickte seinem Diener zu, der es mit dem Zucken seiner Mundwinkel quittierte.
»Erinnert Ihr Euch an den Tag, als ich mich vorstellte?«, fragte er leise. »Am selben Tag noch brachen wir zu unserer ersten Weltreise auf!«
»Ich erinnere mich«, sagte Phileas Fogg nachdenklich. »Aber es ist lange her. Es kommt mir vor, als sei es vor Ewigkeiten gewesen, in einem völlig anderen Land. England, was ist England? Ist nicht Kadath viel, viel mehr? Wo sind die Äonen geblieben, seit denen all das Großartige geschah? Wo sind die Mächtigen jener Zeit? Warum ruft niemand nach ihnen? Wo könnte man sie finden? Kadath selbst ist leer, ein totes Gebilde, von Würmern und Schlangen bewohnt.«
»Das ist es«, fiel Passepartout ein. Seine Wangen röteten sich; er handelte in dem Bewusstsein, die Gunst des Augenblicks nutzen zu müssen. »Habt Ihr Aouda vergessen und Eure Kinder? Was steht Euch am nächsten? Sind es nicht Eure Angehörigen? Habt Ihr nicht Aouda hier in Indien vor dem Tod errettet?«
In die Augen Mr. Foggs trat ein Funkeln, sein Gesicht nahm einen weichen und warmherzigen Ausdruck an.
»Ach, Passepartout«, sagte er, »es war alles so herrlich. Ich wünschte, ich könnte jene Zeiten zurückholen!«
»Gebt mir den Beutel, bitte!«, sagte der Diener energisch. »Ich tue es für Aouda und die Buben. Und für Euch!«
Foggs Gesicht blieb verklärt. Seine linke Hand fuhr in die Rocktasche, umfasste den Beutel und zog ihn heraus. Er streckte den Arm aus – und zog ihn im nächsten Augenblick mit einem Aufschrei zurück. Etwas riss Phileas Fogg von seinem Sitz empor, in den er sich niedergelassen hatte. Sein linker Arm stand in Flammen, und der große Mann krümmte sich zusammen und stürzte in die Arme seines Dieners, der ihn geschickt auffing und nach dem Beutel grapschte.
Es gelang ihm nicht, seinem Herrn das schwarze Ding zu entreißen. Mr. Fogg wälzte sich herum und schnellte seinen Oberkörper nach hinten in Richtung Fenster. Seine Augen verdrehten sich, und es gelang ihm mit letzter Kraft, sich an seinem Sitz festzuhalten und mit der freien Hand den Beutel wieder in der Rocktasche verschwinden zu lassen. Seine Brust hob und senkte sich, und er richtete sich mühsam auf, betastete verwundert den unversehrten Arm, an dem die Flammen längst erloschen waren.
»Ein Trugbild«, hauchte er, fuhr herum und starrte zum Fenster hinaus. »Dennoch hat sich etwas verändert. Passepartout, es war ein Fehler von dir. Du hättest den Kadath-Stein nicht herausfordern dürfen. Er besitzt die Macht, Kräfte zu wecken, die uns den Tod bringen können!«
Der Diener erschrak. Er musste an die Worte seines Herrn denken, der davon gesprochen hatte, dass sie das Ziel ihrer Reise wohl nie erreichen würden. Die Bilder auf dem Hügelkamm entstanden neu vor seinen Augen, das Nichts, das er gesehen hatte, und die Vision einer mächtigen Burg in den Wolken, die in sich zusammengestürzt war. Und das Haus im englischen Baustil, in dem es brodelte und dampfte.
All das hatte der Stein bewirkt, der sich nicht nur Foggs Gehirn bemächtigt hatte. Nein, er strahlte auch auf seinen Diener aus und machte ihm das Leben zur Hölle.
Mit Sicherheit besaß er auch die Macht, größere Dinge zu bewirken als das Öffnen eines Hügels, um drei Menschen und drei Pferden den Tod zu bringen.
»Vier Tage sind es«, sagte Fogg unvermittelt. »Ich befürchte, dass wir noch viel mehr Zeit verlieren. Mein lieber Passepartout, ich weiß, dass es ein Fehler war, auf Moriartys Verlockungen einzugehen. Betrachte mich als einen Dummkopf, aber halte mir zugute, dass ich bereits damals dem Blendwerk des Beutels zum Opfer fiel. Nicht unsere Verfolger sind in eine Falle gelockt worden, sondern wir. Du bist noch relativ frei, ich aber kann mich nicht befreien. Niemand kann das. Deshalb erteile ich dir jetzt – vom Herrn zum Diener – einen Befehl, dem du ohne Zögern nachkommen wirst!«
»Ja«, erwiderte Passepartout. »So lange ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann!«
»Du wirst dein Gewissen vergessen müssen, um Aouda und der Kinder willen. Du wirst Gewalt gegen deinen Herrn anwenden müssen. Sollten wir diese Zugfahrt überstehen, wirst du mich töten. Nimm das Messer aus der Reisetasche. Du wirst mich töten und mich vergraben, so wie ich bin, zusammen mit dem Beutel!«
Er wandte den Kopf und musterte seinen Diener. Passepartout wurde kreidebleich. Die Wangenmuskeln seines Gesichts begannen zu zucken, und er öffnete mehrmals den Mund, um zu sprechen.
»Ich … kann … nicht«, ächzte er dann. »Vergebung! Aber ich kann es nicht!«
»Du wirst es tun müssen!« Mr. Fogg blieb hart. »Wenn es nicht schon zu spät ist.«
Er deutete hinaus, stieg dann mit entschlossenem Gesicht in das Abteil zurück und griff den Diener an seinem Rock. Er zerrte ihn zum Fenster und deutete hinaus.
»Da!«, stieß er hervor. »Der Stein in meiner Tasche glüht. Er bewirkt etwas, was ich nicht glauben könnte, würde ich es nicht sehen!«
Der grüne Regenwald war verschwunden. An seiner Stelle glänzte kahles Gestein, eine Ebene, die nur aus Fels bestand. Es gab keinen einzigen Baum, kein Lebewesen. Der Himmel leuchtete in trübem Grau, obwohl sich keine einzige Wolke am Firmament befand. Das Licht von oben war dumpf, und die Luft roch stickig und besaß einen Beigeschmack von Schwefel.
Der Zug selbst rollte über einen schienenlosen Boden, ohne dass das Geräusch der Räder zu hören war. Fogg deutete hinab zum Boden, der sich in Wellen bewegte.
»Der Zug selbst steht still. Nur der Boden bewegt sich. Wie eine Schlange trägt er uns fort!«
Passepartout hörte seine Worte kaum. Viel zu sehr nahmen ihn die eigenen Beobachtungen in Anspruch. Er blickte nach vorn zur Spitze des leicht gekrümmten Zuges. Die Lokomotive hatte sich auf schreckliche Weise verändert. Es war keine Dampflok mehr mit ihrem charakteristischen Aussehen, sondern ein Feuer speiendes Ungeheuer, etwa zwanzig Yards hoch und sechzig lang. Es wand sich hin und her, und seine Oberfläche leuchtete in allen Regenbogenfarben. Ein schuppiges Ungeheuer, das mit den Wagen des Zuges verbunden war und sie mit sich riss.
Es schien den gellenden Schrei zu hören, den Passepartout bei seinem Anblick ausstieß. Es wandte den Kopf. Das riesige Vorderteil besaß die Proportionen eines Saurierschädels mit lang vorragendem Kiefer und kleinen, tückischen Augen. Der Kiefer öffnete und schloss sich, das Raubtiergebiss mit den Reißzähnen gab ein knirschendes Geräusch von sich, und dann brüllte und fauchte das Ding, dass die Zähne des Dieners mitzuklappern begannen und er beinahe aus dem Fenster gestürzt wäre, wenn Phileas Fogg ihn nicht am Kragen gepackt und zurückgerissen hätte.
Passepartout kroch wimmernd von dem Fenster fort in die Nähe der Tür und kauerte sich am Boden zusammen. Er barg das Gesicht in den Händen und schluchzte.
»Ich will nicht sterben«, hauchte er. »Ich bin nicht dafür geschaffen, dem Tod aufrecht ins Angesicht zu sehen!«
»Du wirst nicht sterben«, sagte Mr. Fogg kühl und beherrscht, wie es seine Art war. »Der Stein schützt uns. Solange du bei mir bist …« Er ließ den Satz offen und beugte den Oberkörper wieder hinaus. Es war seltsam, keiner der anderen Fahrgäste schien etwas zu bemerken. An den Fenstern der anderen Abteile und Wagen rührte sich nichts.
»Nicht sterben!« Dumpf kam das Echo aus des Dieners Kehle. Die Worte seines Herrn waren ein schwacher Trost angesichts dessen, was sich draußen abspielte.
Und was noch auf sie zukam, lautlos zunächst und unsichtbar, dafür aber mit umso größerer Härte.
Wieder stieß der Saurier ein Brüllen aus, und der Zug wurde durchgeschüttelt. Er geriet ins Schlingern, und es dauerte mindestens fünf Minuten, bis er sich beruhigt hatte. Das urweltliche Zugtier schien von einer unerschöpflichen Kraft beseelt, es machte sich nichts aus dem Gewicht der acht Waggons, die der Zug nach Bezwada mit sich führte.
Passepartout kam langsam wieder hoch. Er stützte sich an der Wand ab, fasste mit der einen Hand nach dem Sitzpolster und der anderen nach dem Türgriff. Die Tür ächzte und wackelte, und er ließ sie hastig los.
»Reiß dich zusammen«, vernahm er die Stimme seines Herrn. »Gemeinsam werden wir alles überstehen. Selbst den Tod.«
Der Diener des ehrenwerten Mr. Phileas Fogg wäre froh gewesen, er hätte eine Antwort geben können, die zumindest ein winziges Fünkchen Hoffnung beinhaltete. Aber da war nichts, rein gar nichts; sein Inneres war wie ausgebrannt, eine gähnende Leere ohne Eingeweide und ohne ein richtiges Denkvermögen.
Phileas Fogg trat ein wenig vom Fenster zurück. Seine Miene war ernster geworden, er senkte den Kopf zum Nachdenken.
Das Ungetüm dort vorn war neben der trostlosen Landschaft mit Sicherheit nicht die einzige Erscheinung, mit der sie es zu tun hatten. Andere Dinge mochten irgendwo auf den Zug lauern.
Er zog Passepartout zu sich heran und suchte mit den Augen das Abteil ab.
»Nicht hinsehen!«, sagte er dann. Aber Passepartout sah hin.
Überall aus den Ritzen und Fugen drängten kleine grünlich gelbe Tropfen heraus. Sie wuchsen rasch zu faustgroßen Bällen an, die an der Decke und den Wänden klebten wie Eiterbeulen.
»Was ist das?«, keuchte der Diener.
Mr. Fogg zuckte mit den Schultern und duckte sich. Die Beulen platzten auf und verspritzten ihren Inhalt in das Zugabteil.
Die Übergangsphase vom Diesseits ins Jenseits wurde begleitet von einer unbegreiflichen Art des Schwebens, von einer Leichtigkeit, die jeden Gedanken an eine körperliche Existenz vergessen machte. Howards Seele begann sich zu bewegen, sie drehte und wendete sich, und sie vermittelte ein Gefühl des Wohlbehagens und der Geborgenheit. Da entstand ein Traum in seinem Bewusstsein, und er berichtete vom ewigen Vergessen und der Vergangenheit all dessen, was bisher wichtig gewesen war und eine Bedeutung besessen hatte.
Ein Traum? Ein Traum, in dem die Kälte von der Wärme abgelöst wurde, in dem das Böse durch das Gute verdrängt wurde?
Der Traum besaß einen Hauch der Wirklichkeit, und irgendwo im Unterbewusstsein des Träumers setzte sich der Gedanke fest, dass es die Wirklichkeit des Jenseits war, und er dachte: Du bist tot, gestorben in einem Abgrund, umhüllt von der Finsternis. Und wenn du erwachst, dann wird Licht um dich sein, du wirst dich geborgen fühlen und auch keine Erinnerung mehr an das besitzen, was vor diesem Erwachen gewesen ist.
Der Gedanke, dieses Licht wahrzunehmen, es endlich mit körperlosen Augen sehen zu können, erregte das Bewusstsein des Träumers. Er glaubte einen Widerstand irgendwo zu spüren, benötigte eine Weile, um den ungewohnten Eindruck aufzunehmen und zu prüfen, erkannte dann das Gefühl von Feuchtigkeit und Kühle, das die Wärme verdrängte, die er mit dem Guten gleichsetzte.
Ein Traum? Er zweifelte in dem Augenblick, in dem etwas auf harten Untergrund stieß und ihm das Vorhandensein eines Körpers vorgaukelte. Alles in ihm wehrte sich gegen den Eindruck, doch er verschwand nicht, und die kühle Luft, die in seine Lungen eindrang, rief ihn rascher in die Wirklichkeit zurück, als es ihm lieb sein mochte. Sein Verstand begann klarer zu arbeiten, er signalisierte ihm Leben und Wirklichkeit, und der Träumer fragte sich, was Traum und was Wahrheit war. Das Gefühl für den Körper kehrte endgültig zurück, und er bewegte den Kopf und wälzte sich auf dem feuchten Untergrund herum. Seine Hand fuhr über das Gesicht, und er schlug die Augen auf.
Er sah eine Fackel, die zwei Gestalten beleuchtete.
Rowlf! Chavanda!, dachte er im ersten Augenblick. Dann erkannte er seinen Irrtum und verzog schmerzgepeinigt das Gesicht, als eine der beiden Gestalten einen lang anhaltenden Schrei ausstieß, von dem er nicht wusste, was er bedeutete. Er warf sich in dem Bewusstsein einer Gefahr herum, aber hinter ihm war nur das Dunkel einer Höhle und auf dem Boden lagen die reglosen Körper zweier Menschen.
Howard Lovecraft kam auf die Knie hoch und beugte sich nach vorn. Er tastete über Rowlfs großflächiges Gesicht, dessen Nasenspitze leicht zu zucken begann. Auch Chavanda Sringh, der junge Inder, bewegte sich. Howard atmete erleichtert auf. Sie waren am Leben.
Unsinn! Der Gedanke fraß sich in ihm fest. Sie konnten nicht leben. Sie waren von Fogg und seinem Diener in einen Hinterhalt gelockt worden. Die Erde hatte sich unter ihnen geöffnet, und sie waren in die Tiefe …
Howard erhob sich vorsichtig. Seine Glieder waren heil; er konnte nicht einmal einen Kratzer oder eine Hautabschürfung feststellen. Seine Kleider waren nur dreckig, wie auch sein Gesicht und die Haare. Er stützte sich an der Wand der Höhle ab und betrachtete seine Gefährten, die langsam zu sich kamen.
»Es ist gut«, sagte er leise. »Wir haben es überstanden!« Er kniete wieder neben Rowlf nieder und strich ihm die Haare aus der Stirn. Er fragte sich, wo sie hier waren, ob sie sich in einer Höhle unter dem Einbruch befanden und wie sie gerettet worden waren. Hatte es sich bei ihrem Erlebnis lediglich um eine Halluzination gehandelt?
Howard glaubte es nicht. Er dachte an Phileas Fogg und die Mächte, die mit dem Weltreisenden im Bund standen. Es waren bösartige Mächte, und wenn Necron nicht bereits tot gewesen wäre, dann hätte er ihn als den heimlichen Auftraggeber im Verdacht gehabt.
Aber Necron war nicht der Einzige gewesen, der dem Bösen diente. Da gab es mit Sicherheit noch andere, und immer wieder gelang es Einzelnen von ihnen, an den Schranken jenes furchtbaren Geheimnisses zu zerren, das die Erde tief in ihrem Schoß beherbergte. Immer wieder gelang es einzelnen Kreaturen, einen Weg an die Oberfläche und in die Freiheit zu finden, und sie beantworteten diese Freiheit mit der Versklavung anderer Lebewesen.
»Howard!« Rowlf stemmte sich ächzend auf die Ellbogen hoch und blickte den Freund fragend an. »Was is’n das? Sin’mer nich’ tot?«
Lovecraft schüttelte beruhigend den Kopf und reichte Rowlf die Hand, an der sich der Hüne in sitzende Stellung hinaufzog.
»Man könnte sagen, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Vorerst. Kümmerst du dich ein wenig um Chavanda? Der Junge wird größere Mühe haben als wir, das alles zu verkraften!«
Rowlf warf einen forschenden Blick auf die beiden Gestalten mit dem Kienspan, dann beugte er sich über den Inder und rüttelte ihn an der Schulter.
»Wach auf, Jüngelchen«, brummte er. »Die Fahrt is’ vorbei!«
Howard wandte sich ab und trat zu den beiden Fremden. Es waren Inder, ein junger und ein alter. Der Greis zog augenblicklich Howards ganze Aufmerksamkeit auf sich. Schulterlange schlohweiße Haare rahmten das asketische Gesicht ein, das von einer langen Nase und einem sanften Mund beherrscht wurde. Das Auffälligste jedoch waren die Augen, blaue, runde Murmeln mit weißen Flecken darin. Der Mann war blind, und er hielt die Hand des Jungen. Die Brust unter dem grauen Gewand hob und senkte sich, und er öffnete den Mund und sagte in fließendem Englisch: »Willkommen, Mr. Lovecraft. Es ist eine Ehre für mich, den Time-Master des Templerordens als Gast in meiner bescheidenen Höhle zu haben. Ich bin Rajniv Sundhales. Der Name wird Ihnen noch bekannt sein.«
Lovecraft war zunächst zwei Schritte zurückgewichen.
Fast unbewusst hatte er mit der rechten Hand in die Hosentasche gegriffen, wo der sechsschüssige Revolver steckte.
»Nein«, sagte er bedächtig. »Ich kenne Ihren Namen nicht. Ich möchte zudem einem Missverständnis vorbeugen. Ich war einmal Mitglied des Templerordens, aber das ist schon sehr lange her. Ich bin mein eigener Herr und dem Orden keine Rechenschaft schuldig. Ich höre es nicht gern, wenn man mich mit ihm in Zusammenhang bringt. Verstehen Sie das?«
Über die Lippen des Blinden kam ein Klagelaut. Seine Murmelaugen begannen sich unkontrolliert im Kreis zu drehen, und die freie Hand streckte sich tastend zur Seite aus, als wolle sie etwas fassen, was nicht da war. Sundhales riss an der Hand, die ihn mit dem Jüngling verband.
»Sie haben schwarze Haare, die schmutzig geworden sind, Mr. Lovecraft«, antwortete er. »Sie kratzen sich soeben an der Nase. Sie zucken leicht zusammen, und Sie fragen sich jetzt, wieso ich das alles erkennen kann. Ich bin wirklich blind, aber ich habe Fähigkeiten entwickelt, die mich durch die Augen meines Schülers Talsah sehen lassen, solange ich seine Hand halte. Als ich Sie erkannte, hoffte ich zunächst, dass der Orden Sie geschickt habe, um mich doch noch zu rufen. Ich weiß nun, dass sich mein innerster Traum Zeit meines Lebens nicht erfüllen wird. Seien Sie und Ihre Gefährten dennoch willkommen, denn ich rechne nicht nach dem eigenen Vorteil. Nehmen Sie mit meiner bescheidenen Habe vorlieb!«
Howards Stirn hatte sich in Falten gelegt. Um seinen Mund war ein Zug immer stärker werdender Nachdenklichkeit erschienen. Rajniv Sundhales war kein gewöhnlicher Mensch, das hatte er sofort erkannt. Die Worte des Mannes ließen ihn erahnen, dass er keine besonders positiven Erfahrungen mit den Templern gemacht hatte. Er wollte eine Frage stellen, unterließ es aber dann, denn Sundhales deutete an ihm vorbei auf seine Gefährten.
Rowlf hatte Chavanda Sringh auf die Beine geholfen und kam mit ihm näher. Der Junge blickte aus weit aufgerissenen Augen um sich und bekam den Mund nicht zu.
Howard wandte sich wieder an den Alten, dessen Augen ihn in einen seltsamen Bann zogen. In ihnen war nichts Magisches, und dennoch waren sie … so anders. Es lag ein Ausdruck in den toten Augen, der zwingend war, und die hoch aufgerichtete Gestalt des Blinden strahlte eine Macht und Autorität aus, wie sie sonst nur bei Herrschern und Mächtigen zu beobachten war.
»Ich glaube, Sie sind uns eine Erklärung schuldig«, sagte Howard leise. »Wo sind wir hier, und wie kommen wir her?«
Das verhaltene Lachen des Alten hatte weder etwas Drohendes noch etwas Beschwichtigendes an sich. Es klang wie das unbeschwerte Lachen eines Kindes, und Howard entspannte sich ein wenig. Sundhales machte eine einladende Geste und deutete auf ein paar Felsbrocken. Er selbst ließ sich dort nieder, wo er stand.
»Sie sind verwirrt«, begann Sundhales. »Deshalb spreche ich langsam zu Ihnen. Lassen Sie mich der Einfachheit halber von vorn beginnen, bei mir. Einst war ich ein Jüngling voller Lebenslust, zu allem bereit, als ich einem Guru begegnete, der meine in mir schlummernde Fähigkeit erkannte. Er nahm mich in seine Schule und lehrte mich in elf Jahren all das, was ich benötigte. Ich lernte die Geheimnisse der weißen Magie kennen und entwickelte meine Fähigkeit, und damit war mein Lebensweg vorgezeichnet. Als Guru Sabwan starb, trat ich sein Erbe an.«
Der Alte schwieg einen Augenblick, und Howard wollte einen Einwand bringen. Das Leben des Mannes interessierte ihn wenig; es brannten andere, wichtigere Fragen auf seiner Zunge. Er öffnete den Mund und beherrschte sich dann doch, weil Rajniv Sundhales fortfuhr, einen kurzen Abriss seines Lebens gab und dabei langsam auf die Gegenwart zusteuerte.
»Je älter ich wurde, desto deutlicher verstand ich, dass meine Fähigkeit brachlag, so lange ich sie nicht zum Vorteil der Menschen einsetzte«, erfuhren Howard und seine beiden Begleiter. »Ich suchte nach einer Möglichkeit, den Menschen zu dienen, und ich erfuhr von den Templern und deren Magiern, den Mastern. Weitere zehn Jahre beschäftigte ich mich mit ihnen, knüpfte Kontakte und fuhr schließlich nach Paris. Ich wurde vorgelassen und erhielt Gelegenheit, dem Großmeister Balestrano meine Fähigkeit zu demonstrieren. Die Templer waren beeindruckt, und sie teilten mir mit, dass sie sich mit mir in Verbindung setzen würden. Sie haben es getan – und mit welchem Erfolg!«
Die letzten Worte klangen wie ein Hilferuf. Die Stimme des Alten schwankte auf und ab, und Howard glaubte im Licht des brennenden Kienspans zwei feuchte Spuren zu sehen, die aus den toten Augen kamen und über die Wangen hinabliefen bis zum Kinn. Er verstand auch ohne Worte, dass die Sehnsüchte und Wünsche dieses Mannes nicht in Erfüllung gegangen waren.
»Was haben sie Ihnen angetan?«, fragte er kaum hörbar.
»Sie haben mir einen ihrer Männer geschickt. Er machte mir mehrere Angebote, aber sie dienten allein dazu, mich in Sicherheit zu wiegen. Ich wurde von dem Templer vergiftet, mit einem schleichenden Gift, das mir den Wahnsinn bringen sollte, mir jedoch nur das Augenlicht nahm.« Er lachte auf. »Mr. Lovecraft, die Templer waren dumm. Sie rechneten nicht damit, dass ich auf das Gift anders reagieren könnte als ein normaler Mensch. Es war ihr Fehler. Ich wurde blind, doch ich erhielt die Gabe, mit meinen anderen Sinnen zu sehen. Ich blicke durch Talsahs Augen auf Sie, und ich bin froh, dass Sie kein Templer sind, Monsieur!«
»Wenn Sie es sich auch anfangs gewünscht haben!«
Howard wandte sich zu Rowlf und Chavanda um. Der junge Inder begriff nur langsam, dass etwas geschehen war, was ihnen das Leben gerettet hatte.
Auch Rowlf befasste sich mit dieser drängendsten aller Fragen. Der Hüne bewegte sich unruhig.
»Mer ham da noch ’ne Frage«, begann er, doch der Alte brachte ihn mit einer Geste zum Schweigen.
»Warten Sie«, bat er. »Sie sollen den Grund erfahren, warum die Templer versuchen mich loszuwerden. Sie hätten mich zu einem der ihren gemacht, wenn es da nicht einen winzigen Haken gegeben hätte, ein kleines Problem. Dieses Problem erschien ihnen wichtiger als der Nutzen, den sie aus meiner Mitgliedschaft ziehen konnten. Da ich also nicht für sie arbeiten konnte, betrachteten sie mich als eine Gefahr und versuchten mich aus dem Weg zu schaffen oder wenigstens meine Fähigkeit auszuschalten.«
»Weil Sie ’n Hindu sind, denk ich. Un’ die nehm’ nur Christen, stimmt’s?«
Rajniv Sundhales senkte bestätigend den Kopf. Er beugte sich vor, streckte Howard die Hand entgegen, und Lovecraft ergriff und drückte sie.
»Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet, Rajniv. Ich glaube nicht, dass wir ihn jemals abtragen können«, stellte er fest. »Sie haben uns vor dem Tod errettet. Es kann sich nur um Sekunden gehandelt haben. Ist es zu viel verlangt, Einzelheiten zu erfahren?«
»Nein, nicht zu viel. Eher zu wenig. Ich bin froh, endlich einmal unter Beweis gestellt zu haben, was ich kann, Monsieur!«
»Über eine Entfernung von hundertfünfzig Meilen!«, fügte Talsah ein wenig zusammenhangslos hinzu, aber Howard verstand sofort, wie er es meinte. Seine Augen wurden ein wenig größer, dann verengten sie sich, zu schmalen Schlitzen, die das schwache Licht in der Höhle fast vollständig verblassen ließen.
»Wo sind wir?«, wollte er wissen. Sundhales sagte es ihm, und Howards erster Gedanke galt Fogg und seinem Diener, die sich inzwischen bestimmt von jener Lichtung entfernt hatten.
Und Passepartout ist trotz allem ahnungslos gewesen, redete Lovecraft sich ein. Fogg selbst ist auch nicht mehr als ein unfreiwilliger Handlanger.
»Ich versteh nich’ ganz«, brummte Rowlf. »Fähigkeit hin und her. Wie hamse uns gerettet?«
Howard lachte trocken auf. Ein zweites Mal drückte er die Hand des Alten. Er hatte längst erkannt, um welche Fähigkeit es sich handelte. Er erhob sich von dem unbequemen Felsbrocken und zog Sundhales zu sich empor.
»Der Orden könnte sich glücklich preisen, wenn er einen Mann wie Rajniv in seinen Reihen hätte«, rief er aus. »Dann wäre alles anders gekommen. Dann wäre die Spitze des Ordens nicht in der Mojave-Wüste umgekommen, dann hätten nicht fünfhundert Templer ihr Leben lassen müssen. Balestrano hätte kein Tor





























