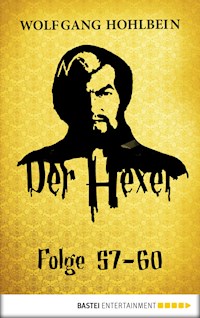
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Geistersturm" - Folge 57 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Auf den ersten Blick war es ein Moor wie jedes andere auch. Gasblasen zerplatzten mit leisem Blubbern und verströmten einen schwachen, aber trotzdem durchdringenden Fäulnisgestank. Ein paar verkrüppelte Bäume und Büsche hatten ihre Wurzeln in den morastigen Untergrund gekrallt. Feuchtigkeit hing in grauen Schwaden über dem Boden. Äußerlich gab es keinen Unterschied zu Dutzenden anderen Sumpfgebieten. Doch nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick wirkte es furchteinflößend. Und mehr noch als das: gefährlich! Und es wirkte nicht nur so...
"Hochzeit mit dem Tod" - Folge 58 - die letzte Episode der ursprünglich als eigenständige Romanheftreihe erschienenen Titel von DER HEXER.
Die Kathedrale war bis auf den letzten Platz besetzt, und überall in der Menge entdeckte ich vertraute Gesichter. Es war ein sehr angenehmes Gefühl, zum ersten Male seit so langer Zeit wieder unter Freunden zu sein. Mary Winden war ebenso da wie Howard, Rowlf, Nemo, Harvey und Dr. Gray, Kapitän Bannermann, Nizar, Sill, Shadow, Sherlock Homes und Dr. Watson und viele andere. Selbst Necron hatte sich die Ehre gegeben. Zufrieden lächelte ich ihm zu und sah, wie eine einzelne Träne der Rührung über seine faltige Wange lief.
"Das Erwachen" - Folge 59 aus DER HEXER-Reihe - enthält das überarbeitete erste Kapitel des Original-Taschenbuchs "Der Sohn des Hexers".
Ein gleißender Blitz schlug in das Gebäude am Ashton Place Nummer 9 ein. Es war kein gewöhnlicher Blitz. Der blauen Narbe, die er in die Nacht gebrannt hatte folgte eine Spur lodernder, blauweißer Funken, die wie winzige flammende Meteore auf das Dach niederregneten und rauchende Spuren in den Dachziegeln hinterließen. Ein unheimliches, flackerndes Glühen hatte den Himmel ergriffen, ein Sog aus Licht dessen loderndes Zentrum sich genau über dem brennenden Herrenhaus am Ashton Place befand. Andara-House brannte wie eine Fackel. Das Haus war unrettbar verloren. Hinter den Fenstern im Erdgeschoss wütete die Hölle. Für die Menschen der Stadt musste es so aussehen, als hätte die Hölle selbst ihre Pforten aufgetan, um ihre schlimmsten Gewalten über die Welt der Menschen auszuschütten. Für Howard sah es nicht so aus. Er wusste, dass es so war ...
"Bote aus dem Jenseits" - Folge 60 aus DER HEXER-Reihe - enthält das überarbeitete zweite Kapitel des Original-Taschenbuchs "Der Sohn des Hexers".
Die Ratte war so groß wie ein Airdale-Terrier und mindestens genauso angriffslustig, aber sie sah nicht halb so ansehnlich aus - und unglücklicherweise war sie nicht einmal annähernd so feige, wie es diese hysterischen Kläffer zumeist sind. Abgesehen von diesen Unterschieden zu den gestylten Luxushündchen, die normalerweise von ebenso gestylten Luxusdamen an vergoldeten Leinen spazieren geführt wurden und alles anbellten, was größer als sie selbst war (und sich in sicherer Entfernung befand), gab es allerdings noch einen Unterschied: Airdale-Terrier pflegen im Allgemeinen einzeln aufzutauchen. Die Ratte nicht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Geistersturm
Der Hexer – Hochzeit mit dem Tod
Der Hexer – Das Erwachen
Der Hexer – Bote aus dem Jenseits
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 57-60:
Der Hexer – Geistersturm
Der Hexer – Hochzeit mit dem Tod
Der Hexer – Das Erwachen
Der Hexer – Bote aus dem Jenseits
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 57–60
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1582-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 57-58
Mitautor Frank Rehfeld gibt in aufschlussreichen Vorworten Auskunft über Hintergründe und Inhalte der Hexer-Reihe. Seine Anmerkungen beziehen sich dabei in der Regel auf mehrere E-Book-Folgen. Hier das Vorwort zu Band 55 bis 58 (Die Folgen 55 und 56 finden Sie in Sammelband 12, Folgen 53-56).
Mit den E-Books 55 bis 58 geht die ursprüngliche Hexer-Heftserie zu Ende. Acht Romane waren innerhalb des »Gespenster-Krimis« erschienen, Band 49 war das letzte Heft der eigenständigen Serie.
Zahlreiche Leser waren darüber damals zutiefst betrübt (milde ausgedrückt), aber mich, der schon geraume Zeit vorher von Wolfgang über die Einstellung informiert wurde, traf sie gleich doppelt hart. Zum einen war ich vom Erscheinen des ersten Heftes an erklärter Fan der Serie, zum anderen hatte ich gerade ein hoffnungsvolles Comeback als Co-Autor hinter mir. Außerdem erlebte ich hier zum ersten Mal mit, dass eine Serie, an der ich mit Begeisterung mitgeschrieben hatte, eingestellt wurde; eine traurige Erfahrung, die ich wie wohl die meisten auf diesem Gebiet tätigen Autoren seither noch mehrfach machen musste.
Nach den ursprünglichen Bänden 22 und 23 hatte ich beim Hexer erst einmal eine längere Pause eingelegt und mich anderen Projekten zugewandt. Schließlich legte ich Wolfgang den Anfang eines Romans um Kapitän Nemo und die Traumwelt Kadath vor, der ihm sehr gut gefiel. Er forderte mich auf, den Roman unbedingt fertig zu schreiben, er erschien als Band 47 unter dem Titel »Stadt der bösen Träume«.
Zu dieser Zeit schien eine Umstellung von vierzehntägiger auf wöchentliche Erscheinungsweise ab Band 50 kurz bevorzustehen. Da Wolfgang das Arbeitspensum auf keinen Fall hätte allein bewältigen können, hätte ich verstärkt an der Serie mitarbeiten sollen. In einem Brief, den ich nostalgisch gerade aus dem Archiv hervorgesucht habe, teilte er mir schon Einzelheiten wie die Abgabetermine bis Heft 70 und dergleichen mit, ich erhielt sogar Andrucke der Titelbilder bis Band 52, die ich noch heute wie einen Schatz hüte.
Nur knapp eine Woche später folgte im Anschluss an einen Besuch im Bastei-Verlag dann in einem weiteren Brief die Nachricht, dass er alle hochfliegenden Pläne leider beerdigen müsste, dass die Serie aufgrund zu geringer Verkaufszahlen nicht wie erhofft auf wöchentlich um-, sondern mit Band 49 eingestellt würde.
Ich kann nicht mehr sagen, was mir damals durch den Kopf ging. Ich war wie erschlagen und wohl sogar den Tränen nahe. Es schien, als wäre das Kapitel Hexer für alle Zeit abgeschlossen.
Manches hat sich seit dieser Zeit relativiert. Zunächst einmal fand mein Comeback bei der Serie kein ganz so abruptes Ende wie befürchtet. Obwohl Wolfgang eigentlich vorhatte, die letzten noch ausstehenden Romane selbst zu schreiben, gab er aus Zeitnot (und wohl auch, weil er angesichts des bevorstehenden Endes selber niedergeschlagen war und die Arbeit an jedem noch fälligen Heft wie Salz in der Wunde gewesen wäre) die Bände 43, 45 und 48 an mich ab, nur das endgültige Finale ließ er sich freilich nicht nehmen.
Wie schon die Tatsache zeigt, dass dies nicht das letzte Buch der Edition ist, handelte es sich jedoch wider alle Erwartungen längst noch nicht um das Ende der Abenteuer Robert Cravens. So zäh der Hexer sich in seinem Kampf gegen die GROSSEN ALTEN behauptete, so erstaunliche Qualitäten als Stehaufmännchen entwickelte er in den folgenden Jahren.
Dazu mehr im nächsten Vorwort.
Frank Rehfeld
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 57Geistersturm
Auf den ersten Blick war es ein Moor wie jedes andere auch. Gasblasen zerplatzten mit leisem Blubbern und verströmten einen schwachen, aber trotzdem durchdringenden Fäulnisgestank. Ein paar verkrüppelte Bäume und Büsche hatten ihre Wurzeln in den morastigen Untergrund gekrallt. Äußerlich gab es keinen Unterschied zu Dutzenden anderer Sumpfgebiete.
Doch nur auf den ersten Blick.
Auf den zweiten wirkte es Furcht einflößend. Und mehr noch als das: gefährlich!
Und es wirkte nicht nur so …
Ich konnte das Gefühl nicht richtig in Worte kleiden, aber es erschien mir fast, als sei die Gegend von einer unsichtbaren, nur unterschwellig spürbaren Aura des Bösen durchdrungen. Jeder Stein, jeder Busch und jeder der wenigen, verkrüppelten Bäume schien Gefahr auszuatmen, ein unbestimmtes, vages Grauen, das wie auf dürren Spinnenbeinen in meine Seele kroch und mich mit einem ständig wachsenden Gefühl des Unbehagens erfüllte. Es war noch keine wirkliche Furcht, aber doch etwas, das ihr sehr nahe kam.
Unbehaglich blickte ich mich um. Ich hatte in den vergangenen Jahren gelernt, auf meine Ahnungen zu hören. Es hatte sich als der sicherste Weg erwiesen, am Leben zu bleiben.
Aber da war nichts.
Nur das Moor.
Ein Weg, gerade breit genug, um halbwegs sicher darauf gehen zu können, schlängelte sich vor und hinter mir zwischen den Moorgewächsen durch, die auf eine bizarre, mit dem Auge nicht zu erfassende Art tot anmuteten.
Nebelstreifen stiegen aus dem Sumpf. Wie die oktopoiden Arme eines gestaltlosen Ungeheuers schienen sie über die Pflanzen zu tasten, um ihnen alles Leben zu entziehen und die Atmosphäre der Düsternis noch zu vertiefen.
Über mir spannte sich ein grauer, an Quecksilber erinnernder Himmel. Am Horizont zeigten sich noch letzte rötliche Streifen und erinnerten an den Sonnenuntergang, der erst wenige Minuten zurückliegen konnte. Aber das Licht verblasste rasch. Immer rascher breiteten sich die Schatten der Abenddämmerung über die Landschaft aus und deckten sie wie ein finsteres Tuch aus Gestalt gewordener Nacht zu.
Ich ließ meinen Blick ziellos umherirren, doch in allen Richtungen zeigte sich das gleiche trostlose Bild. Nirgendwo gab es auch nur den geringsten Hinweis darauf, wo ich mich befand.
Ich wusste nicht einmal, wie ich hierhergekommen war.
Die vage Erinnerung an Feuer tauchte aus meinem Gedächtnis auf. Feuer und ein riesiges, mit seltsamen, unbegreiflichen Symbolen verziertes Portal, das mich aufgesogen und hierhin ausgespien hatte. Doch ich wusste nicht zu sagen, ob es sich um echte Erinnerungen handelte oder nur um eine Vision.
Es war auch gleichgültig.
Viel wichtiger war für mich, wie ich von hier wegkam, und das möglichst schnell. Die bizarre Landschaft flößte mir Angst ein. Eine Angst, die sich nicht allein durch meine Situation oder die trostlose Öde des Sumpfes erklären ließ.
Es war auch nicht allein der düstere Odem der Verderbnis und des Todes, der über diesem Landstrich zu liegen schien.
Es war eine Mischung aus allem, gepaart mit dem Gefühl einer von Sekunde zu Sekunde größer werdenden Gefahr. Ich konnte beinahe körperlich spüren, wie sich irgendetwas näherte; lautlos schleichend und unter dem brodelnden Morast verborgen.
Ein schwacher Windhauch, der den Geruch nach Moder und Verwesung mit sich trug, zerzauste mein Haar. Gleichzeitig spürte ich eine leichte Bewegung am Fuß. Ich schrie vor Schreck auf und sprang zurück. Der Stockdegen glitt wie von selbst in meine Hand. Dann erst merkte ich, dass mich nur ein vom Wind bewegtes Schilfgewächs genarrt hatte, das mein Bein streifte. Erleichtert strich ich mir mit der Hand den kalten Schweiß von der Stirn.
Aber das Gefühl einer nahenden Gefahr blieb und wurde immer noch stärker. Ich glaubte es wie einen unsichtbaren Reif zu spüren, der um meine Brust lag und mir die Luft abschnürte.
Willkürlich entschied ich mich für eine Richtung und lief den Weg entlang. Nun ja – Weg war fast zu viel gesagt. Es handelte sich um einen schmalen Trampelpfad, der sich wie eine gezackte Narbe durch den Sumpf zog. Nur die leichte Färbung des hier helleren Bodens und das Gras, das den Pfad einsäumte, zeigten an, wo der Untergrund fest genug war mein Gewicht zu tragen. Wenigstens hoffte ich es.
Nach einigen Dutzend Yards blieb ich stehen. Die Ahnung von Gefahr war sprunghaft noch stärker geworden.
Ich musste dem Ursprung der Bedrohung entgegengelaufen sein! Ein paar Mal drehte ich mich um die eigene Achse. Nirgendwo war etwas zu entdecken, das konkreten Anlass zur Sorge geboten hätte.
Und doch …
Angst überschwemmte mein Denken und löschte es aus. Angst von einer so direkten, kreatürlichen Art, dass ich hilflos dagegen war. Blindlings rannte ich den Weg wieder zurück, vorbei an der Stelle, wo ich zuvor gestanden hatte, und tiefer hinein ins Ungewisse. Ich floh vor etwas, von dem ich nicht einmal wusste, was es war – aber dass es dieses Etwas gab, spürte ich mit jeder Faser meines Körpers.
Allein schon die Tatsache, dass ich nichts über die Art der Bedrohung und die Identität meines unheimlichen Gegners wusste, trieb mich schier zur Raserei.
Die stickige, drückend schwüle Luft machte den Lauf zu einer Qual. Jeder Atemzug schien meine Lunge zum Bersten zu bringen. Die Seitenstiche waren so schmerzhaft, als ob jemand ein Messer in meine Hüfte stieße. Mein Herz raste, als wolle es zerspringen. Klebriger Schweiß bedeckte mein Gesicht und rann mir in die Augen.
Doch selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich nicht stehen bleiben können. Meine Beine bewegten sich wie von selbst, als wären sie meinem Willen entzogen, als gehörten sie gar nicht mehr zu mir. Ich rannte so schnell ich nur konnte, ohne auch nur im Geringsten zu spüren, dass das Gefühl der Bedrohung nachließ.
Im Gegenteil, auch in dieser Richtung nahm es an Intensität beständig zu. Ich strauchelte über einen Erdbrocken. Mit wild rudernden Armen versuchte ich, das Gleichgewicht zu halten.
Es gelang mir nicht. Instinktiv wollte ich meinen Sturz mit den Händen abfangen, aber der Stockdegen behinderte mich. Hart prallte ich zu Boden und mit dem Kopf gegen einen faustgroßen Stein. Dabei konnte ich bei meiner Ungeschicklichkeit noch von Glück sagen, dass ich mir beim Fallen die Klinge des Degens nicht selbst in den Leib rammte, sondern mir nur einen unbedeutsamen Schnitt am linken Handgelenk beibrachte.
Für Sekunden war ich benommen, bevor ich mich wieder auf die Beine quälen und taumelnd meinen Lauf fortsetzen konnte.
Ich kam nicht einmal drei Schritte weit.
Etwas Schwarzes, Formloses brach wie ein absurd langer Wurm neben mir aus dem Boden, peitschte in die Höhe und schlang sich blitzschnell um meinen Knöchel. Ein harter Ruck brachte mich zu Fall.
Ich strauchelte und schlug erneut schmerzhaft irgendwo mit dem Hinterkopf auf. Für einen Moment drohte ich das Bewusstsein zu verlieren, aber es gelang mir den Schmerz zurückzudrängen. Mühsam blinzelte ich die roten Schlieren weg, die vor meinen Augen wogten.
Einen Moment später wünschte ich mir, ich hätte es nicht getan.
Ich sah einen kaum fingerdicken, mit schwarz glänzenden Schuppen bedeckten Tentakel, der sich blitzschnell an meinem Bein in die Höhe schlängelte. Angeekelt schlug ich mit dem Degen zu.
Die Klinge fraß sich in die schuppige Panzerhaut und zerschnitt den Fangarm. Schwarzes Blut quoll aus der Wunde. Wo es den Boden berührte, verdorrte das Gras, und die Erde schien zu kochen. Das abgetrennte Ende des Tentakels verdorrte und zerfiel binnen weniger Sekunden zu Staub. Ein entsetzlich schriller Laut drang an mein Ohr.
Und im nächsten Moment explodierte neben mir der Sumpf! Mit gespenstischer Lautlosigkeit barst der Boden in einer gewaltigen, zwanzig, dreißig Yards hohen Fontäne aus Erdreich, Pflanzenteilen und stinkendem Wasser auseinander und überschüttete mich mit Schlamm. Etwas Großes, ungeheuer Finsteres wuchs wie ein schwarzer Berg neben mir in die Höhe. Mehr als ein Dutzend Tentakel peitschten gleichzeitig auf mich zu.
Zwei konnte ich zerstören, bevor die anderen wie ein Wall einander verschlungener Schlangenleiber auf mich niederprasselten.
Vor panischer Angst schrie ich auf und schlug blindlings um mich; ich schrie und schrie und bäumte mich auf. Etwas traf mit furchtbarer Wucht meinen Kopf – und dann war das Moor plötzlich verschwunden!
Um mich herum lastete Dunkelheit, aus der sich langsam vage bekannte Konturen schälten, als meine Augen sich daran gewöhnten. Die Einrichtung eines Zimmers. Genauer gesagt, einer Schiffskabine. Die Schatten des Albtraumes wichen zurück, und langsam fand ich mich in der Wirklichkeit zurück.
Ich befand mich an Bord der NAUTILUS, und was mich am Kopf getroffen hatte, war der niedrige Balken über meiner Pritsche, gegen den ich zum Gott-weiß-wie-vielten-Male geknallt war, als ich überhastet aufgesprungen war.
Der Schmerz zwang mich auf mein Lager zurück, zumal er diesmal schlimmer denn je war. Ganz flüchtig kam mir zu Bewusstsein, dass es durchaus gefährlich sein konnte, sich ein Dutzend Mal oder öfter an der gleichen Stelle zu verletzen. Aber selbst diesen Gedanken konnte ich nicht richtig zu Ende verfolgen. Alles drehte sich vor meinen Augen.
Benommen strich ich mir über das Gesicht. Ich hatte mich auch jetzt noch nicht ganz aus dem Bann des Albtraumes lösen können.
Alles war so ungeheuer real gewesen. Ich glaubte noch immer die Berührung der stinkenden, glitschigen Tentakel auf meiner Haut zu spüren. Ich fühlte mich besudelt und spürte das Verlangen, Schlamm und schwarzen Schleim von meiner Haut zu wischen, obwohl ich wusste, dass es beides in Wirklichkeit nicht gab.
Alles, was ich spürte, war eine beträchtliche Beule, die sich auf meiner Stirn bildete und heiße Schmerzwellen durch meinen Körper sandte, sobald ich sie berührte.
Hastige Schritte ertönten, die Tür wurde aufgerissen. Gegen die vom Gang hereinfallende Helligkeit hob sich Howards schlanke Gestalt als dunkler Schattenriss ab. In den vergangenen Tagen hatte er sich von den Erlebnissen in Kadath wieder weitgehend erholt, obwohl es anfangs schlimm um ihn gestanden hatte.
»Robert, was ist los?«, keuchte er und schaltete das elektrische Licht ein. Er bewohnte die Kabine neben mir und musste ebenfalls schon geschlafen haben. Sein Haar war zerzaust, seine Augen noch vom Schlaf getrübt. Eine wahrhaft atemberaubende Wolke von Tabakgestank umgab ihn. Einen Moment lang fragte ich mich ernsthaft, ob er wohl auch im Schlaf noch rauchte …
Ich verscheuchte den Gedanken, versuchte die Benommenheit wegzublinzeln und richtete mich auf. Wesentlich vorsichtiger als beim ersten Mal.
»Schon gut«, antwortete ich. »Es ist nichts.«
»Nichts?« Howard kam näher. Sein besorgtes Gesicht zeigte, dass er sich mit dieser Erklärung ganz und gar nicht zufriedengab.
»Ich habe schlecht geträumt«, fügte ich deshalb rasch hinzu. »Kein Grund zur Beunruhigung.«
Sein Gesicht zeigte, dass er auch jetzt noch ganz anderer Ansicht darüber war. »Geträumt? Mein Gott, du hast wie am Spieß geschrien.«
Er trat ein paar Schritte näher. Seine linke Augenbraue rutschte ein Stück nach oben, als er auf meine Hände herabsah. »Du blutest ja«, sagte er erstaunt.
Verwirrt betrachtete ich meine Hände. Am linken Handgelenk entdeckte ich einen kleinen Schnitt, aus dem etwas Blut quoll. Die Wunde tat nicht weh.
Trotzdem spürte ich selbst, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich …
Ich war gestolpert und gefallen, und dabei hatte ich mich an der Klinge des Stockdegens geschnitten und …
Unsinn, schalt ich mich, konnte die jäh in mir aufkeimende Angst aber nicht ganz unterdrücken. Alles, was sich im Moor ereignet hatte, war nichts weiter als ein Traum gewesen, und im Traum konnte man sich nicht verletzen.
Oder?
Ein eisiger Schauer lief über meinen Rücken. Es gelang mir nicht, die Furcht ganz zurückzudrängen. Da war etwas, was ich nicht wusste und was wichtig war. Ich hatte es vergessen (vergessen? verdrängt!), aber es war wichtig …
Ungeheuer wichtig.
Mit klopfendem Herzen sah ich mich um. Der Stockdegen lag mehr als drei Schritte von mir entfernt auf dem Tisch; die Klinge in der hölzernen Hülle verborgen. Aber es war doch unmöglich!
»Also, was war los?«, fragte Howard noch einmal. Hinter ihm erschienen weitere Leute auf der Türschwelle, Matrosen der NAUTILUS, die ich mit meinem Schrei ebenfalls aus dem Schlaf gerissen hatte. Einige hielten Waffen in den Händen und erforschten meine Kabine mit lauernden Blicken. Angst stand in ihren Gesichtern geschrieben.
Großer Gott – was geschah hier?
»Ich sagte doch schon, ein Albtraum«, wiederholte ich hastig. »Ich habe schlecht geträumt und dabei wohl geschrien. So etwas kommt vor«, fügte ich etwas schärfer hinzu. Die Erklärung beruhigte die Matrosen. Leise murmelnd wandten sie sich wieder ab und kehrten nach einem letzten forschenden Blick in ihre Kabinen zurück. Nach all dem, was sie in den vergangenen Tagen durchgemacht hatten, waren auch ihre Nerven stark mitgenommen. Unter dem Kommando Nemos hatten sie zwar schon allerhand Sonderbares erlebt, aber für die meisten von ihnen war es die erste direkte Begegnung mit dem Übernatürlichen gewesen. Es würde noch eine ganze Weile dauern, bis sie den Schock überwunden hatten. Bis dahin würden sie auf alles Ungewöhnliche übertrieben furchtsam und heftig reagieren.
Nur Howard blieb zurück. Wie gesagt – den Matrosen genügte diese Erklärung vollauf. Ihm nicht.
Er trat an die Pritsche, ergriff meinen Arm und betrachtete die Wunde.
»Nichts von Bedeutung«, sagte ich rasch. »Wahrscheinlich habe ich mir im Schlaf mit einem Fingernagel die Haut geritzt.« Mir fiel nichts Besseres ein, obwohl ich wusste, wie dürftig die Erklärung war. Auch Howard wusste es, aber er schwieg und sah mich nur an. Auf eine Art, die mir ganz und gar nicht gefiel.
»Also gut, sprechen wir morgen darüber«, sagte er nach ein paar Sekunden.
»Da gibt es nichts zu besprechen. Ich hatte einen Albtraum, das ist alles«, entgegnete ich wider besseres Wissen.
»Das ist alles«, echote er spöttisch, mit einer Stimme, die das genaue Gegenteil ausdrückte.
Wenn er nur endlich gehen würde!
Etwas hielt mich davon ab, ihm von meinem Traum zu erzählen. Ich war immer noch verwirrt, und auch meine Seekrankheit machte sich jetzt wieder bemerkbar. Ich verspürte im Augenblick keinerlei Lust, mich ausgiebig mit Howard zu unterhalten, was ich ihm durch ein übertrieben heftiges Gähnen deutlich machte.
Er musterte mich noch einige Sekunden lang, dann wandte er sich ab und ging schulterzuckend zur Tür zurück.
Kaum hatte er die Kabine verlassen, stand ich auf und eilte zum Tisch. Ich griff nach dem Stockdegen und löste die Arretierung. Mit einem leisen, quietschenden Laut glitt die Klinge aus ihrer hölzernen Umhüllung heraus.
Und obwohl ich geahnt hatte, was mich erwartete, erschreckte mich der Anblick zutiefst.
Auf der Klinge glänzte ein Tropfen frischen, noch nicht einmal geronnenen Blutes.
Mein Blut!
Ich wusste, dass es mein Blut war, obwohl ich den Gedanken gleichzeitig verdrängte, um nicht den Verstand zu verlieren.
Ein Zufall, versuchte ich mir einzureden, nichts als ein dummer Zufall, den ich nicht ernst nehmen konnte, nicht weiter beachten durfte. Großer Gott, was geschah hier?!
Ich blickte an mir herab. Mein Herz raste.
Weder entdeckte ich Schlamm noch sonst irgendetwas, das darauf hindeutete, dass auch nur das Geringste an dem Traum Realität gewesen sein könnte. Selbst wenn das Blut an der Klinge des Degens meines war, gab es noch eine ganz harmlose Erklärung dafür. Ich konnte im Schlaf unbewusst aufgestanden sein und nach der Waffe gegriffen haben, auch wenn Schlafwandeln bisher noch nie zu meinen Angewohnheiten gehört hatte.
Natürlich, das war es!
Ich ärgerte mich, dass ich nicht gleich auf den nahe liegenden Gedanken gekommen war. Halbwegs beruhigt kehrte ich in mein Bett zurück, lag aber noch lange wach, bevor ich endlich wieder in einen leichten Schlummer fiel. Irgendetwas war da, eine dünne, böse Stimme, die mich selbst noch bis in den Schlaf verfolgte und meine Träume vergiftete und die darauf bestand, dass diese Erklärung vielleicht die nahe liegendste war, aber dennoch denkbar falsch.
Früh am Morgen erreichte die NAUTILUS die englische Küste, wo wir in der Nähe von Brighton heimlich an Land gingen. Ich war übermüdet und dachte kaum mehr an den nächtlichen Albtraum.
Nicht einmal Howard verlor mehr ein Wort über den Zwischenfall, und da die kleine Wunde bereits verschorft war und nicht mehr schmerzte, vergaß ich schnell, was geschehen war.
Zumindest fast …
Wie stets ließ Professor Denham seine Hand einen Augenblick lang auf der Klinke liegen und atmete tief durch, bevor er die Tür des Zimmers mit der Nummer siebendunddreißig öffnete. Jedes Mal aufs Neue verspürte er ein dumpfes Unbehagen, wenn er diesen Raum betrat.
Etwas an der Frau, die allein in dem Zimmer lag, war seltsam, ohne dass er sich erklären konnte, was ihn an ihr beunruhigte.
Wenn sie sich von den anderen Patienten des Summers-Sanatoriums unterschied, dann scheinbar nur in positiver Hinsicht: Sie war stets freundlich, wirkte humorvoll und war sogar zu äußerst anspruchsvollen und geistreichen Gesprächen in der Lage. Sie zeigte sich kooperativ, randalierte nicht – alles in allem konnte man sie als eine geradezu mustergültige Patientin für eine Nervenheilanstalt bezeichnen.
Man hätte sie ohne weiteres für kerngesund halten können, wenn nicht diese gelegentlichen traumatischen Anfälle gewesen wären; manchmal mehrere Stunden während Phasen totaler Apathie, in denen sie sich von ihrer Umwelt völlig abkapselte, wie in Trance mit geöffneten Augen in ihrem Bett lag und nichts um sich herum wahrnahm.
In diesem Zustand war sie nicht ansprechbar und reagierte auch sonst auf keinerlei äußeren Reiz. Es war die einzige, harmlose Form, in der sich ihre geistige Verwirrung äußerte.
Aber dennoch …
Denham konnte sein Unbehagen niemals ganz unterdrücken. Eine leichte Gänsehaut überfiel ihn, wenn er Zimmer siebenunddreißig betrat. Vielleicht lag es an den undurchsichtigen Machenschaften, die Dr. Vernon Jackson betrieben hatte. Bis zu seinem ebenso geheimnisvollen Tod vor rund sechs Wochen hatte er sich ganz allein um die Frau gekümmert und ihre psychische Krise durch seine Experimente eher noch verstärkt, statt sie zu heilen.
Nun, gleich, was es war – jedenfalls wurde sie stets von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben, die Denham so beunruhigte. Wäre er sich dabei nicht selbst lächerlich vorgekommen, so hätte er sich vielleicht eingestanden, dass sie ihm Angst machte.
Er verdrängte die Grübeleien und lächelte, während er die Tür ganz öffnete und ins Zimmer trat.
»Guten Morgen, Priscylla«, sagte er. Von seiner Besorgnis war ihm nichts mehr anzumerken, wenigstens äußerlich nicht. Denham war lange genug Arzt, um zu wissen, wie wichtig es war, sich immer freundlich und gut gelaunt zu geben.
Die hübsche junge Frau, deren dunkles Haar in sanften Wellen über ihre Schultern fiel, hatte sich im Bett aufgerichtet. Sie erwiderte strahlend sein Lächeln.
»Hallo, Professor«, sagte sie mit glockenheller Stimme, die sein Unbehagen fortwischte.
Vielleicht war es einfach nur ihre Schönheit, die ihn so verwirrte, dachte er.
Er mochte sie mehr, viel mehr, als für ein ungezwungenes Verhältnis zwischen Arzt und Patient gut sein mochte. Manchmal erschien es ihm, als würde sie diese Sympathie durchaus erwidern, doch er hatte von ihr erfahren, dass sie verlobt war und seine Bewunderung für ihre Schönheit somit keine Hoffnung auf eine tiefere Zuneigung hatte; ganz abgesehen von dem Altersunterschied, der sie trennte. Er hätte ohne weiteres ihr Vater sein können, auch wenn sein Haar noch dunkel war und er wesentlich jünger als vierundfünfzig Jahre aussah.
»Wie fühlen Sie sich heute?«, fragte er, während er sich einen Stuhl heranzog und neben ihrem Bett Platz nahm.
»Prächtig. Ich könnte Bäume ausreißen. Gehen Sie wieder mit mir im Park spazieren?«
Bedauernd schüttelte Professor Denham den Kopf. »Das wird heute nicht möglich sein«, sagte er und fügte hinzu, als er Priscyllas Enttäuschung bemerkte: »Wir haben in ein paar Minuten eine wichtige Konferenz, bei der ich nicht fehlen darf. Ich wollte vorher nur kurz bei Ihnen hereinschauen. Vielleicht finde ich heute Nachmittag etwas mehr Zeit. Ansonsten wird eine Schwester sie begleiten.«
»Eine Konferenz?«, hakte Priscylla neugierig nach. »Erzählen Sie mir mehr davon. Um was geht es?«
Einen Herzschlag lang glaubte Denham, eine stumme Forderung in ihrem Blick zu entdecken. Er verdrängte den Gedanken. Sie war nur neugierig und er sah keinen Grund, ihre Neugier nicht zu befriedigen.
»Es geht um die Entlassung einiger Patienten«, erklärte er geduldig. »Diese Konferenzen führen wir jeden Monat. Dann beraten wir über besonders schwierige Fälle und Heilmethoden, über Neuaufnahmen, aber auch über eine Entlassung, wenn eine Krankheit geheilt werden konnte …« Er breitete die Hände aus und lächelte, um anzudeuten, dass sich die Aufstellung zwar beliebig fortsetzen ließ, sie aber bestimmt nicht interessieren würde.
»Und wann werde ich endlich entlassen?«, fragte Priscylla. »Ich bin doch gesund und will nicht mehr länger hier eingesperrt bleiben.«
Denham seufzte. Vielleicht war es doch ein Fehler gewesen, zu redselig zu sein.
»Von Einsperren kann doch gar keine Rede sein, Priscylla«, sagte er geduldig. »Sie dürfen sich auf dem Gelände weitgehend frei bewegen und bald können wir sicherlich auch einen Ausgang in Begleitung in Betracht ziehen. Sie sind eben noch nicht völlig gesund. Bisher ist es uns noch nicht gelungen herauszufinden, wie es zu diesen seltsamen Trancezuständen kommt.«
»Ich träume einfach gerne für eine Weile«, entgegnete Priscylla. Sie zog einen Schmollmund. »Deshalb bin ich aber doch nicht verrückt.«
»Von einer Verrücktheit im herkömmlichen Sinne kann sicherlich keine Rede sein«, sagte Denham, selbst für seinen Geschmack eine Spur zu hastig. Er lächelte verlegen. »Es dient Ihrem eigenen Schutz, wenn Sie noch hierbleiben. Stellen Sie sich nur vor, Sie bekommen einen solchen … Anfall, wenn Sie gerade allein über eine Straße gehen und eine Kutsche kann nicht rechtzeitig stoppen.«
»Das ist doch Unsinn«, wehrte Priscylla ab. Sie streckte ihre Hand aus und berührte Denham sanft an der Wange. Ihre Finger glitten weiter und streiften seinen Mund.
»Priscylla, was tun Sie?«, rief er. Er wollte ihre Hand wegschieben, konnte sich aber nicht bewegen. Die Berührung elektrisierte ihn regelrecht.
»Schauen Sie mir in die Augen«, sagte Priscylla leise, während sie ihn streichelte. »Schauen Sie mich an. Sehe ich so aus, als könne ich nicht auf mich selbst aufpassen?«
»Nein, das ist …« Er verstummte. Der leidenschaftliche Blick ihrer unergründlichen blauen Augen verwirrte ihn und fegte alle Überlegungen hinweg. Sein Herz schlug schneller. Er konnte diesem liebreizenden Geschöpf nicht mehr widerstehen. Er wusste, dass es falsch war, ein Fehler, ein entsetzlicher Fehler, der ihn mit Sicherheit seine Stellung und vielleicht noch mehr kosten würde, aber plötzlich war ihm dies alles egal.
»Küssen Sie mich«, hauchte sie. Ihre Lippen öffneten sich ein wenig, und er sah ihre Zunge, die flüchtig über ihre weißen Zähne glitt. Gleichzeitig richtete sie sich im Bett auf und schlang ihre Arme um seinen Nacken. Sanft, aber bestimmt zog sie ihn näher an sich heran. Ihre Finger spielten mit seinem Haar.
Denham stöhnte. Verzweifelt versuchte er sich zu wehren, sich selbst zur Ordnung zu rufen, aber er kam nicht gegen den suggestiven Klang ihrer Stimme an. Beinahe entsetzt registrierte er, wie sich seine Hände hoben, wie sein Gesicht sich dem ihren näherte. Er wollte es nicht, aber er war wehrlos; nicht mehr als ein hilfloser Gefangener in seinem eigenen Körper, verbannt zur Rolle eines Zuschauers, der unfähig war, in das Geschehen einzugreifen.
Seine Lippen berührten die ihren.
Es war wie ein Stromstoß, der durch seinen Körper fuhr. Jähe Begierde überfiel ihn und schwemmte auch den letzten Rest seines klaren Verstandes hinweg. Er glaubte in ihren Augen zu ertrinken. Die Welt um ihn herum verblasste zu einem fernen Nichts. Für ihn existierte nur noch diese Inkarnation all dessen, was eine Frau begehrenswert machte.
Leidenschaftlich presste er sie an sich und erwiderte ihren Kuss. Plötzlich war es ihm egal, welche Konsequenzen sein Tun hatte. Nur noch der Moment – dieser Moment – zählte!
Seine Hände streiften über ihren Rücken, verkrallten sich in ihrem Haar und glitten dann über ihr Nachthemd, bis er ihre Brüste berührte. Sie sträubte sich nicht gegen die Berührung, presste sich in entfesselter Leidenschaft sogar noch fester an ihn. Etwas schien aus ihrem Körper in ihn überzuströmen; es war wie ein Hauch ihrer Gedanken, der seinen Geist streifte, ein Gefühl höchsten Glücks. Für einen Sekundenbruchteil glaubte er mit ihrem Bewusstsein völlig zu verschmelzen, eins mit ihr zu sein.
Dann löste sie sich aus seiner Umarmung, als er fast rasend vor Begierde geworden war. Er wollte wieder nach ihr greifen, doch sie entzog sich ihm und stieß ihn energisch zurück.
»Glauben Sie immer noch, dass ich nicht gesund bin?«, fragte sie.
»Nein, natürlich sind Sie gesund«, keuchte er. Die Worte kamen fast von allein aus seinem Mund, als würde jemand anders an seiner Stelle sprechen.
Aber er war überzeugt davon, dass sie Recht hatte.
Priscylla fehlte nichts, es wäre nicht richtig, sie länger hier festzuhalten. Er erschauderte bei dem Gedanken, bedeutete eine Entlassung doch, dass er sie nicht mehr jeden Tag sehen konnte, doch das war jetzt bedeutungslos. »Dann werden Sie dafür sorgen, dass man mich entlässt? Ich muss zu Robert zurück.«
Der Name ihres Verlobten versetzte ihm einen schmerzhaften Stich.
»Das … habe ich nicht allein zu entscheiden«, antwortete Denham stockend. Kalter Schweiß perlte auf seiner Stirn. Was tat er? »Diese Entscheidung muss gemeinsam von allen Ärzten getragen werden, und …«
»Sie werden die anderen schon davon überzeugen können, da bin ich mir ganz sicher«, unterbrach sie ihn. »Und wenn Sie etwas erreicht haben, dann kommen Sie am besten direkt zu mir.« Wieder öffnete sich ihr Mund ein wenig, wie zu einem verheißungsvollen Versprechen, und ihre Zungenspitze glitt sanft über die Lippen.
Denham schluckte. Widerstrebend riss er sich von ihrem Anblick los und stand auf. Er würde alles tun, was sie von ihm verlangte.
Alles.
Vor den Fenstern meines Arbeitszimmers lastete tiefschwarze Dunkelheit wie eine massive Wand. Schneeregen klatschte gegen die Scheiben, unregelmäßig und im willkürlichen Takt, den ihm der böige Wind aufzwang, sodass es sich anhörte wie Trommeln und fernes Murmeln. Eisige Luft fauchte durch den geöffneten Fensterflügel herein, aber ich nahm die Kälte nicht wahr.
Genauso wenig nahm ich war, wie aus den Decken und Winkeln des Zimmers gestaltlose Schatten hervorkrochen und mit rauchigen Fingern in das blasse Licht der Petroleumlampe auf meinen Schreibtisch griffen; düstere Boten der Albträume, die wieder auf mich warteten, falls ich einschlafen sollte.
Aber ich wusste, dass ich keinen Schlaf finden würde. Heute so wenig wie in der Nacht zuvor.
Und es lag nicht nur an dem Traum, den ich an Bord der NAUTILUS gehabt und immer noch nicht ganz verwunden hatte. Die Sache mit der seltsamen Verletzung beunruhigte mich gelegentlich noch ein wenig, aber im Augenblick beschäftigten sich meine Gedanken mit etwas ganz anderem.
Ich sah immer wieder Priscyllas Gesicht vor mir.
Schon vor fast zwei Monaten hatte ich sie aus dem Summers-Sanatorium nach Hause holen wollen. Ich hatte sie ein paar Mal besucht, und sie war geistig gesund gewesen.
Jedenfalls hatte ich das geglaubt. Vielleicht hatte ich es auch nicht wirklich geglaubt, sondern mich einfach nur wider besseres Wissen an den Gedanken geklammert. Die immer noch undurchsichtigen Experimente Dr. Jacksons hatte sie in eine neue Krise gestürzt, doch auch diese schien nun behoben.
Als ich nach London zurückgekehrt war, hatte ich die Nachricht erhalten, dass man sie zwei Tage lang einer gründlichen abschließenden Untersuchung unterziehen würde. Wenn diese positiv ausfiel, galt Pri als endgültig geheilt und konnte entlassen werden.
Morgen sollte die Entscheidung fallen.
Ich wusste nicht, wie lange ich bereits reglos am Fenster stand und in die Nacht hinausstarrte, als die Tür hinter mir geöffnet wurde.
Jede Bewegung fiel mir schwer, als ich die Gardine fallen ließ, das Fenster schloss und mich umwandte. Einen Herzschlag lang sah ich mein Spiegelbild in der Scheibe. Ich erschrak vor mir selbst. Meine Wangen waren eingefallen; sie verliehen meinem ohnehin hageren Gesicht einen asketischen, hungrigen Ausdruck. Schwere dunkle Ringe lagen unter meinen geröteten Augen. Meine Haut sah so aus, wie ich mich fühlte – krank und übermüdet.
Mir war, als würde ich nach langem, tiefem Schlaf wieder in die Welt zurückkehren. Zuvor hatte ich gar nicht wahrgenommen, wie stark sich die Luft nach dem für Februar relativ milden Tag durch den Schneeregen abgekühlt hatte, doch nun spürte ich, wie ich trotz des im Kamin glimmenden Feuers fror.
Kein Wunder, da ich meinen Gehrock abgelegt hatte und nur eine Weste und darunter ein dünnes Hemd trug. Ich kreuzte die Arme vor der Brust und massierte sie ein wenig, um mich aufzuwärmen. Meine Finger waren steif und taub vor Kälte.
»Wollen Sie sich mit Gewalt eine Lungenentzündung holen?«, fragte Miss Winden, meine Haushälterin, vorwurfsvoll und legte ein neues Scheit in das erlöschende Kaminfeuer. Es knisterte, als die Flammen danach leckten und daran hochloderten.
Mary sah ebenso übernächtigt aus wie ich. Auch sie machte sich Sorgen um Pri, wenngleich sie es nicht so offen zeigte.
Zudem war sie in den vergangenen Tagen kaum von Sill el Mots Seite gewichen. Mit geradezu missionarischem Eifer bemühte sie sich, die junge Araberin an das Leben in der Großstadt zu gewöhnen; eine Aufgabe, um die ich sie nicht beneidete, ganz abgesehen davon, dass ich in letzter Zeit ohnehin kaum noch Zeit fand, mich um Sill zu kümmern. Das Mädchen war in einem ganz anderen Kulturkreis groß geworden, und in vielerlei Hinsicht befand sich Arabien noch auf einer Entwicklungsstufe, die mit dem europäischen Mittelalter vergleichbar war.
London musste für Sill eine völlig fremde und erschreckende Welt darstellen.
»Ich habe gar nicht bemerkt, dass es schon so spät geworden ist«, entgegnete ich schwach. Ich lächelte entschuldigend und warf einen Blick zur abgrundtief hässlichen Standuhr in der Ecke des Raumes. Es war bereits nach Mitternacht.
»Warum gehen nicht wenigstens Sie schlafen, Mary?«
Ihre Augen funkelten amüsiert. Sie versuchte zu lächeln, doch die Erschöpfung machte eher eine Grimasse daraus. Sofort wurde sie wieder ernst.
»Das Gleiche wollte ich Ihnen gerade vorschlagen«, sagte sie. »Aber wahrscheinlich mit größerem Recht. Sie haben schon in der vergangenen Nacht kein Auge zugemacht. Ich habe gehört, wie Sie ununterbrochen hin und her gelaufen sind. Und die Stunden, die Sie in den Nächten zuvor geschlafen haben, kann man wahrscheinlich auch an zwei Händen abzählen. Sie sahen schon wie ein zum Leben erweckter Leichnam aus, als sie zurückkehrten.«
Ich schwieg, was sie als Zustimmung aufzufassen schien.
»Sie richten sich zugrunde, Robert«, fügte sie in vorwurfsvollem Ton hinzu. »Hören Sie auf meinen Rat: Legen Sie sich für ein paar Stunden ins Bett. Sie können im Augenblick ohnehin nichts für Priscylla tun. Und wenn sich irgendetwas ergibt, wecke ich Sie. Mein Ehrenwort!«
Ihr Blick wurde fordernd. Ich versuchte einige Sekunden lang ihm standzuhalten, dann musste ich den Kopf abwenden.
Die Sorge in Marys Stimme war echt und zeigte mir wieder einmal deutlich, dass sie weit mehr als nur eine Angestellte für mich war. Schon eher ein Ersatz für meine Mutter, die ich niemals kennen gelernt hatte. Mit Ausnahme von Harvey, meinem reichlich senilen alten Butler, war sie der einzige Mensch, der es länger als ein paar Wochen in meinem Dienst ausgehalten hatte. Auf eine schwer zu beschreibende Art liebte ich sie; anders, als es bei Pri der Fall war, aber dennoch konnte man von Liebe sprechen.
Sie war einer der ganz wenigen Menschen, denen ich bedingungslos vertrauen konnte, neben Howard und Rowlf vielleicht sogar der Einzige; und sie hatte nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie die gleiche Zuneigung auch für mich empfand.
»Würden Sie mir bitte noch einen Kaffee kochen?«, bat ich.
Miss Winden schüttelte entschieden den Kopf. »Das werde ich nicht tun«, sagte sie fest. »Ich habe nicht die Absicht, ihren ratenweisen Selbstmord auch noch zu unterstützen.«
»So schlecht ist ihr Kaffee auch wieder nicht«, sagte ich lächelnd, aber Mary schien im Moment nicht in der Stimmung, auf den Scherz zu reagieren. Sie blickte mich nur böse an.
»Hören Sie mit dem Unsinn auf und gehen Sie ins Bett, mein Junge«, antwortete sie ärgerlich. Sie sagte noch mehr, aber ich verstand ihre Worte nicht mehr.
Es war wie ein Blitzschlag, der urplötzlich durch meinen Geist fuhr. Unerträgliche Hitze und Helligkeit schien mein Gehirn zu verbrennen. Die Finsternis selbst formte sich zu einem gigantischen Schatten, der mit gierigen Tentakelarmen durch meine Seele peitschte und sie mit Höllenglut erfüllte.
Zeit und Raum waren wie ein in sich gewundenes Band aus geflochtener Unendlichkeit, das Shadow umhüllte, aber längst nicht mehr so fest umschlang wie noch vor kurzer Zeit.
Ihre Gedanken vermochten die Kalte Wüste zu erforschen und zu durchdringen; es gelang ihr, die Grenzen Kadaths zu überwinden.
Robert Craven war ihrem Traumbild in dem schwarzen Onyxschloss begegnet, und er hatte die Mauern ihres Kerkers aus Gestalt gewordener Ewigkeit eingerissen. Auch wenn er es nur unbewusst getan und nicht einmal gewusst hatte, dass sie hier war, als er die Wächterkreatur und die Inkarnation Nyarlathoteps vernichtete. Immer noch erinnerte er sich nicht an sie und war nicht von seinem verhängnisvollen Weg abgewichen.
Sie musste sich vollends befreien, aber dazu benötigte sie mehr Kraft, als ihr zur Verfügung stand. Und sie musste ihn warnen.
Immer noch spürte Shadow das unsichtbare Band, das es zwischen ihr und Craven gab. Und behutsam begann sie auf ihn einzuwirken, sandte ihre Träume aus, um ihm einen Hinweis zu geben.
Der Plan, den die GROSSEN ALTEN geschmiedet hatten, war wahrlich teuflisch, und er würde die Welt ins Verderben stürzen. Sie musste es mit allen Mitteln verhindern und hoffte inbrünstig, dass Robert Craven aufwachen und die Wahrheit erkennen würde, damit sie nicht zum Äußersten greifen musste.
Denn sie durfte nicht zusehen, wie das Verhängnis seinen Lauf nahm. Eher würde sie gezwungen sein, Robert Craven zu töten …
Ich schrie auf und presste gepeinigt die Hände gegen den Kopf, ohne den entsetzlichen Schmerz dadurch auch nur im Mindesten lindern zu können. Jeder Nerv meines Körpers schien in Flammen zu stehen. Die Welt um mich herum versank hinter einem Vorhang aus grellem Licht. Schreiend taumelte ich umher, bis meine Beine unter mir nachgaben und ich in die Knie brach.
Immer stärker wurde der fremde Einfluss; der Schmerz steigerte sich ins Unermessliche und fegte mein Denken mit Urgewalt hinweg. Schreiend wälzte ich mich auf dem Boden. Mein Kopf schien zu explodieren.
Gleichzeitig erwachte etwas tief in meinem Inneren. Ich spürte etwas Dunkles in mir aufsteigen und an Macht gewinnen. Das magische Erbe meines Vaters, das mein Bewusstsein überflutete und den Kampf gegen die fremde Kraft aufnahm.
Ohne mir dessen bewusst zu sein, hatte ich die in mir schlummernden Kräfte in diesem Moment größter Pein geweckt. Verzweifelt klammerte ich mich daran. Irgendwie gelang es mir, die Schmerzen ein wenig zurückzudrängen und eine geistige Blockade in meinem Gehirn zu errichten.
Langsam ebbte der Schmerz ab.
Das Hämmern meines Herzschlages ließ nach, doch ich blieb noch liegen, reglos und mit geschlossenen Augen, auf einen neuen Angriff gefasst und bereit, erneut dagegen anzukämpfen.
Aber es geschah nichts, und schließlich wagte ich es, die Augen wieder zu öffnen. Mary kniete neben mir und schaute besorgt und aufgeregt auf mich herab.
»Robert, was ist mit Ihnen? Robert, sagen Sie doch etwas!«
Stöhnend massierte ich meine Schläfen. Ich hatte die vage Erinnerung an glühende Lava, die in meinen Adern zu fließen schien, das Gefühl, dass etwas aus mir herausgebrannt würde, dann …
Meine Gedanken rissen ab. Es war, als stieße ich an eine massive Mauer, die meine Erinnerung blockierte. Ich stemmte mich auf die Ellbogen hoch und schüttelte benommen den Kopf, als könnte ich dadurch die Mauer um mein Gedächtnis niederreißen.
Die Schmerzen waren verschwunden, aber tief in mir hatten sie ein Gefühl der Taubheit hinterlassen, das Gefühl, einen Teil von mir verloren zu haben.
»Es … geht schon wieder«, stieß ich mühsam hervor. »Ein Schwächeanfall. Ich habe mir wohl wirklich zu viel zugemutet. Alles wieder in Ordnung.«
Mary musterte mich skeptisch, half mir beim Aufstehen und trat einige Schritte zurück. Ihr Blick besagte deutlich, dass für sie noch längst nicht wieder alles in Ordnung war. Meine Schreie hatten gezeigt, welche Schmerzen ich gehabt hatte, doch davon war bis auf leichte Kopfschmerzen nun nichts mehr geblieben.
»Fühlen Sie sich wirklich besser?«, fragte Mary. »Soll ich nicht lieber einen Arzt rufen?«
»Nein, nein«, wehrte ich ab. »Ein Arzt ist nicht nötig, wirklich.« Und er könnte mir hierbei auch bestimmt nicht helfen, fügte ich in Gedanken hinzu, hütete mich aber es laut auszusprechen. Ich wollte Mary nicht noch mehr beunruhigen. Was ich erlebt hatte, war alles andere als ein Schwächeanfall gewesen, sondern ein magischer Angriff, aber von einer Form und Stärke, wie ich es bislang selten erlebt hatte. Doch ich behielt diese Gedanken wohlweislich für mich.
»Ich muss mich nur etwas hinlegen«, sagte ich stattdessen und bemühte mich, ein Lächeln zustande zu bringen.
»In der Tat«, stimmte sie immer noch misstrauisch zu. »Mindestens vierundzwanzig Stunden lang, dann ginge es Ihnen wahrscheinlich wieder besser.«
»Sie wissen, dass das nicht geht«, entgegnete ich. »Ich muss morgen früh zur Klinik. Genauer gesagt, heute früh«, verbesserte ich mit einem Blick zur Uhr.
»Ja, und danach gibt es sicherlich auch wieder einen Grund, um aufzubleiben«, sagte Mary gereizt. »Mit ein paar Litern Kaffee und einem Dutzend Tabletten können Sie es bestimmt noch ein paar Stunden aushalten, falls Sie vorher nicht wieder vor Schwäche zusammenbrechen. Robert, Sie richten sich zugrunde. Meinen Sie wirklich Priscylla damit helfen zu können? Hören Sie auf mich, Junge, versuchen Sie wenigstens bis zum Morgen noch ein paar Stunden zu schlafen.«
Unter normalen Umständen hätte ich ihr Recht gegeben und wäre spätestens jetzt ihrer Aufforderung gefolgt und hätte mich hingelegt. Was mich davon abhielt, war nicht mehr nur das Wissen, dass ich mich hinterher nur umso müder fühlen würde.
Es war Angst.
Nackte, panische Angst vor weiteren Träumen, wie ich einen an Bord der NAUTILUS gehabt hatte.
Einen Albtraum, der mich dazu treiben würde, im Schlaf unbewusst irgendwelche Dinge zu tun, so wie ich mich am Stockdegen verletzt hatte. Der magische Angriff gerade hatte gezeigt, dass ich auch in diesem Haus nicht vor dem fremden Einfluss geschützt war, wie ich bislang gehofft hatte. Im Schlaf hätte ich mich gegen die Beeinflussung nicht wehren können, hätte sie nicht einmal wahrgenommen. Und wenn, dann erst nach dem Aufwachen – nachdem ich mir mit dem Degen möglicherweise nicht mehr nur den Finger geritzt, sondern die Kehle durchgeschnitten hätte.
Ich wandte mich ab, um mir meine Unsicherheit und Angst nicht allzu deutlich anmerken zu lassen – und im gleichen Augenblick zuckte ich zusammen.
Der Raum hatte sich verändert.
Ich wusste nicht zu sagen, worin die Veränderung bestand, aber sie war da. Auf den ersten Blick schien alles wie zuvor; alle Möbel standen noch an ihrem Platz, das Feuer im Kamin brannte noch – und doch war alles mit einem Schlag anders geworden.
Die Veränderung war mit dem Auge nicht wahrzunehmen, aber ich spürte sie so deutlich, als ob ich alles sehen könnte.
Die Atmosphäre im Raum hatte sich auf Furcht erregende Art gewandelt; jeder Gegenstand schien ein unheimliches und bedrohliches Eigenleben zu entwickeln. Ich hatte den Eindruck, als wären die Schatten in den Ecken länger und stofflicher geworden, als würden sie aus ihren Winkeln hervorkriechen, um mit unsichtbaren Armen nach mir zu greifen.
Ich vernahm unheimliche Geräusche, Laute, die nicht an mein Ohr drangen, sondern direkt in meinem Gehirn aufklangen. Sie waren düster und so unvorstellbar fremdartig, dass sie sich jedem Versuch einer Beschreibung entzogen, meine Angst aber erneut zu blinder Panik anfachten.
Ich wusste einfach, dass ich in Gefahr war, wenngleich die Bedrohung gänzlich anderer Art war als der magische Angriff zuvor. Deutlich spürte ich, dass sich etwas Fremdes eingeschlichen hatte. Es war wie ein eisiger Pesthauch, der mich mit einem Mal einhüllte.
Und dann erkannte ich, was mich so erschreckte.
Die Petroleumlampe auf meinem Schreibtisch und das zuckende Kaminfeuer reichten nicht aus, das Zimmer vollständig zu erhellen. Aber sie genügten, dass ich selbst einen deutlichen Schatten warf, der bei jeder meiner Bewegungen unruhig über die Möbel und Wände huschte.
Aber es war nicht mein Schatten, obwohl ich ihn verursachte …
Es war der Schatten eines Dinges, größer als ich, so verzerrt, dass er wie die boshafte Karikatur eines menschlichen Wesens anmutete, doch mit einem Paar riesiger Flügel versehen und von einer Schwärze, die mehr war als nur die Abwesenheit von Licht. Viel mehr eine Finsternis, die wie ein Gestalt gewordenes Nichts wirkte, als würde die Welt dort, wo mein Schatten sie berührte, zu existieren aufhören, um sie mit tiefer, Licht schluckender Nacht zu erfüllen.
Ich spürte eine Berührung am Arm und schrie instinktiv auf. Doch sofort beruhigte ich mich wieder, als ich erkannte, dass es nur Mary war.
»Robert, was ist nun schon wieder?«
Ich gab keine Antwort, sondern konzentrierte mich weiterhin auf den Schatten. Mit Entsetzen stellte ich fest, dass mein erster Eindruck richtig gewesen war.
Der Schatten kam näher, fast unmerklich, aber zu deutlich, als dass ich es als Einbildung abtun könnte. Ich wich zurück, doch sofort vollzog die gestaltlose Kreatur die Bewegung nach und rückte sogar noch einige Hand breit näher.
Natürlich, kein Mensch konnte vor seinem eigenen Schatten fliehen.
Ich hatte etwas Derartiges schon einmal erlebt; es lag Jahre zurück, und doch erinnerte ich mich so deutlich daran, als ob es gestern gewesen wäre. Als ich einen der GROSSEN ALTEN getötet hatte, eine schreckliche, im Vergleich zu Cthulhus Gezücht jedoch vergleichsweise unbedeutende Kreatur, hatte sie sich in mir eingenistet und versucht, meinen Schatten als Werkzeug zu benutzen, um mich zu töten. Die weiße Strähne in meinem Haar erinnerte mich noch heute immer wieder neu an jene Tage des Schreckens.
»Robert, was ist los?«, fragte Mary noch einmal, drängender als zuvor.
»Der Schatten«, hauchte ich. »Sehen Sie es nicht, mein Schatten …«
»Jetzt aber marsch ins Bett«, unterbrach sie mich. »Sie leiden ja schon an Halluzina–«
Die Bestie nutzte meine sekundenlange Unachtsamkeit. Einer der rauchigen Schattenarme peitschte gedankenschnell auf mich zu. Im letzten Moment konnte ich mich darunter hinweg bücken und versetzte Mary einen Stoß, der sie auf den Schreibtisch zutaumeln ließ. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, der Bestie zu entkommen.
»Das Licht!«, schrie ich. »Löschen Sie das Licht, schnell!« Mary schaute mich nur verständnislos an, sie hielt mich für vollends übergeschnappt.
Mit einem verzweifelten Satz sprang ich vor, um die Lampe selbst vom Tisch zu schlagen. Ich kam nicht einmal einen Schritt weit, bis ich erkannte, in welche Falle ich gegangen war.
Der Schatten sprang mich wie ein Raubtier an, umklammerte mich und verwandelte sich gleichzeitig in etwas gänzlich anderes.
Wieder spürte ich, wie eine Feuerlohe durch meinen Körper tobte. Ich sah meinen Körper unter mir zusammenbrechen, während mich ein unvorstellbarer Sog packte und mit sich fortriss. Ein gigantisches, über und über mit sinnverwirrenden Symbolen bedecktes Portal erschien vor mir und schwang auf.
Ich stemmte mich gegen den Sog, doch er war zu stark und riss mich weiterhin auf das Portal zu. Verzweifelt versuchte ich mich irgendwo festzuklammern, aber um mich herum war nur das Nichts.
Dann stürzte ich haltlos durch das Portal, hinein in die Unendlichkeit …
Mary schrie auf. Erschrocken starrte sie auf den regungslos vor ihren Füßen liegenden Körper herab. Sie trat einen Schritt vor und streckte ihre Hand nach Robert aus, führte ihr Vorhaben jedoch nicht zu Ende. Etwas hielt sie davon ab den Körper zu berühren.
Ein Schwächeanfall, durchzuckte es sie. Roberts Kreislauf war zusammengebrochen, kein Wunder bei seinem selbstmörderischen Verhalten in den letzten Tagen. Es war erstaunlich, dass er überhaupt so lange durchgehalten hatte.
Zugleich aber wusste sie, dass dies nicht die einzige Erklärung sein konnte. Robert war nicht einfach nur zusammengebrochen. Immer noch glaubte sie seine gellenden Schreie zu hören. Kein Kreislaufkollaps, nicht einmal ein Herzanfall konnte solche Schmerzen verursachen.
Und auch sein merkwürdiges Verhalten, nachdem es so ausgesehen hatte, als ob er sich von dem Anfall erholte, ging ihr nicht aus dem Sinn.
Er hatte etwas über seinen Schatten gesagt, und sie hatte den Eindruck gehabt, als fühle er sich davon bedroht. Es wäre einfach, das mit seiner Erschöpfung zu erklären, aber sie ahnte, dass auch das nicht die einzige Erklärung war. Seit sie Robert kennen gelernt hatte, hatte sie so viel Unbegreifliches erlebt, dass sie das Wort unmöglich aus ihrem Sprachschatz gestrichen hatte.
Und hier war etwas geschehen, das sie nicht begreifen konnte. Und eigentlich auch nicht wollte. Sie begriff nur, dass Robert in Gefahr war.
»Mr. Lovecraft!«, schrie sie. »Mr. Lovecraft, schnell!«
Erst dann wurde ihr bewusst, dass sich das Arbeitszimmer in einem ganz anderen Flügel des Hauses befand als die Schlafzimmer. Niemand konnte ihre Rufe durch die dicken Mauern hören.
Einen Moment lang zögerte sie noch und sah fast verzweifelt auf Robert herab. Alles ihn ihr sträubte sich dagegen, ihn allein zu lassen. Dann begriff sie, dass sie nur wertvolle Zeit verlor.
Mary eilte in die Halle und die Treppe hinauf. »Mr. Lovecraft!«, rief sie noch einmal mit schriller, fast überschnappender Stimme.
Irgendwo wurde eine Tür aufgerissen, doch nicht Howard kam herbeigelaufen, sondern Rowlf. Er war vollständig angezogen. Anscheinend hatte auch er noch nicht im Bett gelegen.
»Was’n los?«, fragte er.
»Robert ist zusammengebrochen«, erklärte sie hastig, während sie bereits in den ersten Stock zurückeilten. »Schnell, Rowlf, holen Sie Dr. Gray!«
Rowlf nickte und stürmte die Treppe hinab, immer zwei, drei Stufen auf einmal nehmend und so lautstark, dass das gesamte Haus unter seinen Schritten zu erbeben schien. Mary wusste, dass er den Arzt und Notar auf dem schnellsten Wege herbeischaffen würde, und wenn er ihn packen und im Nachthemd hinter sich herschleifen musste. In seiner Fürsorglichkeit für Robert kannte Rowlf keine Grenzen.
»Was ist geschehen?«, vernahm sie eine Stimme hinter sich. Howard war in aller Eile nur in seine Hosen und ein Hemd geschlüpft, das auch noch falsch geknöpft war. In seinem rechten Mundwinkel klebte eine erloschene Zigarre. Ein ungewöhnlicher Anblick bei dem sonst stets übermäßig korrekt gekleideten Mann, aber Mary hatte keinen Blick dafür. In aller Eile sprudelte sie hervor, was geschehen war.
»Rowlf ist bereits zu Dr. Gray unterwegs«, schloss sie. »Ich … ich hoffe, er kommt bald. Großer Gott, ich habe ihn gewarnt. Aber er hört ja nicht, der dumme Junge. Du bringst dich noch selbst um, habe ich gesagt, aber er wollte nicht auf mich hören!«
Howard nickte nur und trat an ihr vorbei ins Arbeitszimmer.
Hastig kniete er neben Robert nieder und streckte die Hände aus, um ihn bei den Schultern zu ergreifen und herumzudrehen.
Aber noch in der Bewegung verharrte er. Ein verwunderter Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. Unwillig schüttelte er den Kopf, hob seine Hand vor die Augen und betrachtete sie stirnrunzelnd.
Noch einmal streckte er die Hand aus, aber wieder hinderte ihn irgendetwas daran, den reglosen Körper zu berühren.
»Warten wir, bis … bis Dr. Gray kommt«, sagte er unsicher und richtete sich wieder auf. Mary glaubte, einen Unterton von Angst in seiner Stimme zu hören. Auch sie selbst hatte Angst, wenn auch weniger um Roberts Gesundheit. Ein paar Stunden Schlaf und vielleicht eine Spritze, dann würde er wieder wie neugeboren sein. Wovor sie sich fürchtete, war die Unheimlichkeit, mit der alles geschehen war.
Die Minuten dehnten sich zu Ewigkeiten. Sie konnte ihren Blick nicht von Robert wenden, bis Dr. Gray endlich kam. Auch der Arzt hatte sich nur in aller Eile und reichlich unordentlich angekleidet. Rowlf musste ihm unterwegs bereits erklärt haben, um was es ging, denn er murmelte nur einen flüchtigen Gruß und kümmerte sich sofort um Robert.
Auch er hatte Mühe, den Bewusstlosen zu berühren, überwand sich aber selbst und drehte ihn herum. Er griff nach Roberts Handgelenk und fühlte den Puls. Seine Augen weiteten sich in fassungslosem Entsetzen, als er die Hand wie ein glühendes Stück Eisen wieder losließ.
Sekundenlang starrte er Howard aus ungläubig geweiteten Augen an, dann beugte er sich herab und griff noch einmal nach Roberts Handgelenk.
»Was ist, Doktor?«, fragte Howard ungeduldig.
Gray starrte ihn an. Seine Augen waren dunkel vor Furcht. »Kein … kein Puls«, keuchte er. »Ich fühle keinen Puls, Howard!«
Der Innenraum der St. Paul’s Cathedral war gewaltig. Immer wieder glitt mein Blick zu der weit über zweihundert Fuß hohen Kuppel über meinem Kopf, der zweitgrößten der Welt. Mehrere Galerien liefen an den Wänden entlang, von denen die unterste, die »Flüstergalerie«, weit über London hinaus bekannt geworden war. Wenn man gegen die Wand flüsterte, waren die Worte noch weit entfernt zu hören. Ein akustisches Phänomen.
Ich drängte die Gedanken beiseite und versuchte mich auf die Predigt zu konzentrieren, aber es gelang mir nicht. Ich war nervöser, als ich mir selbst eingestehen wollte.
Nun ja – schließlich heiratete ich auch zum ersten Mal im Leben.
Neben der verschleierten Priscylla kniete ich auf einer niedrigen Bank vor dem Altar. Vor uns stand der Priester, der die Hochzeitsmesse zelebrierte, aber seine Worte waren ein fernes Murmeln, das ich nicht verstand.
Mein Blick schweifte über die zahlreichen Menschen, die zur Trauung gekommen waren.
Die Kathedrale war bis auf den letzten Platz besetzt. Ich wunderte mich flüchtig, wer die vielen Menschen waren. Die meisten waren mir unbekannt oder kamen mir höchstens vom Ansehen her ganz vage bekannt vor, aber überall in der Menge verstreut entdeckte ich auch vertraute Gesichter. Es war ein sehr angenehmes Gefühl, zum ersten Mal seit so langer Zeit wieder unter Freunden zu sein.
Mary Winden war ebenso da wie Howard, Rowlf, Nemo, Harvey und Dr. Gray, Kapitän Bannermann, Jean Balestrano, Sarim de Laurec, Shannon, Nizar, Sill, Shadow, Sherlock Holmes und Dr. Watson und viele andere. Selbst Necron hatte sich die Ehre gegeben. Zufrieden lächelte ich ihm zu und sah, wie eine einzelne Träne der Rührung über seine faltige Wange lief. Es tat gut, so viele gute Freunde an diesem Freudentag um mich zu wissen, die mein Glück mit mir teilten.
Kurz darauf entdeckte ich auch Roderick Andara, meinen Vater, der zusammen mit einer hübschen Frau ein Stück seitlich von mir saß. Ohne sie je gesehen zu haben, wusste ich, dass die Frau meine Mutter war.
Mein Vater! Meine Mutter!
Ich wollte auffahren, war aber wie gelähmt.
Etwas stimmte nicht. Meine Eltern waren tot; vor vielen Jahren gestorben, ebenso wie zahlreiche andere Anwesende. Sie waren tot! Tot! TOT!
Der Gedanke entglitt mir wieder, bevor ich ihn richtig fassen konnte. Ich nickte kurz in Andaras Richtung.
Alles in Ordnung, Dad, du kannst stolz auf mich sein, und du auch, Mum. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Nachher werden wir Gelegenheit haben, uns ausführlich über alles zu unterhalten.
Erneut versuchte ich mich auf die Worte des Priesters zu konzentrieren. Erst jetzt erkannte ich, dass es sich um Dagon handelte. Wo er stand, bildete sich langsam eine grünlich schimmernde Pfütze auf dem Stein. Abn el Gurk Ben Amar Chat Ibn Lot Fuddel der Dritte, mein gnomenhafter Freund aus der elften Dimension, der mich schon oft mit seinen lustigen Späßchen aufgeheitert hatte, thronte auf seiner Schulter und grinste mich fröhlich an, während er seine Faxen schnitt. Niemand schien etwas Anstößiges daran zu finden, und auch ich amüsierte mich köstlich.
Schließlich war es so weit, dass Pri und ich die Trauringe wechselten, und dann wurde sie von Dagon aufgefordert, den Schleier zu lüften, damit ich unsere Trauung mit einem Kuss besiegeln konnte.
Mit einem Ruck schlug sie den Schleier zurück.
Ich schrie gellend auf.
Zwei schleimige, fast schwarze Blutfäden rannen aus den zerfransten Löchern, die einmal ihre Augen gewesen waren. Kleine, weiße Maden krochen über ihre Lippen. Ihre Haut war nicht glatt und zart, wie ich sie kannte, sondern faltig wie die einer uralten Frau; zudem mit Warzen und Runzeln übersät. Eine abgrundtief hässliche Fratze grinste mich an, doch damit war das Grauen noch nicht beendet.
Priscylla (Priscylla???) alterte noch weiter. Binnen weniger Sekunden verflossen für sie Jahre, binnen einer Minute Jahrzehnte. Ihr Gesicht trocknete aus und fiel ein; das Fleisch verdörrte, und schließlich spannte sich nur noch mumifizierte, an Pergament erinnernde Haut über ihren Knochen, bis auch diese zu Staub zerfiel und nur ein Totenschädel übrig blieb, in dessen leeren Augenhöhlen immer noch ein verzehrendes Feuer brannte und auf dessen Zügen auch jetzt noch ein satanisches Grinsen lag. Ihre verfaulten Zahnstümpfe bewegten sich, als sie zu sprechen versuchte.
»Nun sind wir für alle Zeit vereint, Robert«, sagte sie mit brüchiger Stimme. Es klang wie das Knistern jahrhundertealten Papiers.
Es war spät geworden.
Die Untersuchungen waren schon seit fast einer Stunde abgeschlossen, und so lange saßen sie in dem Konferenzraum zusammen, ohne dass sie bisher eine Einigung hatten erzielen können. Träge schwebte eine übel riechende Wolke aus Zigarren und Pfeifenrauch unter der Decke. Ein paar Mal waren die Fenster schon geöffnet worden, ohne dass es viel half, denn bei der hereinfauchenden Februarkälte und dem Schneeregen konnten sie nicht lange geöffnet bleiben, ohne dass man die Wahl zwischen Ersticken oder Erfrieren hatte.
Die Fronten lagen klar. Denham ließ seinen Blick über die Gesichter der anderen gleiten.
Williams und Porter hatten sich aufgrund der Untersuchungen seiner Meinung angeschlossen, dass Priscylla kerngesund wäre und es keinen Grund gäbe sie noch länger in der Klinik zu halten. Es gab viele Anmeldungen, und das Bett wurde dringend gebraucht.
Brown, Parker und Jameson waren anderer Ansicht, was einen Stimmengleichstand bedeutete, während eine Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Entscheidung erforderlich wäre. Seit Jacksons Tod hatte sich ihr zahlenmäßiges Gleichgewicht ungünstig verschoben.
»Sieht schlecht aus«, sagte Williams leise und beugte sich herüber. »Wenn wir nicht bald eine Einigung erzielen können, werde ich ebenfalls für eine weitere Beobachtung stimmen. Meine Frau erwartet mich, ich möchte endlich nach Hause.«
Denham beachtete ihn nicht, aber seine Verbitterung wuchs. Er ließ seinen Blick zu Jameson weiterwandern. Das Wort des Chefarztes und Klinikleiters besaß besonderes Gewicht. Wenn er ihn überzeugen könnte, hätte er gewonnen. Parker war noch jung und zudem überaus ehrgeizig. Denham war überzeugt, dass ihm völlig egal war, was er selbst zu diesem Fall dachte. Er hatte sich Jamesons Meinung lediglich angeschlossen, weil er sich berufliche Vorteile davon versprach. Er würde auch einen Stimmungsumschwung des Chefarztes wieder mitvollziehen.
Frank Brown hingegen würde auf seiner jetzigen Meinung bestehen, gleichgültig, wie gut die ins Feld geführten Argumente auch sein mochten. Er war ein sturer alter Dickschädel und seine Gründe, gegen die Entlassung zu stimmen, waren durchaus stichhaltig. Sicher, die Untersuchungen hatten weder eine organische Krankheit erkennen lassen, noch Hinweise für eine geistige Verwirrung geliefert.
Aber die letzte Zeit hätte ja gezeigt, dass die Anfälle sporadisch auftraten, während Priscylla zwischenzeitlich ganz normal gewirkt hätte. Deshalb wäre es günstiger, die junge Frau noch eine Weile unter Beobachtung zu halten; darauf lief seine Argumentation kurz gefasst hinaus.
Jameson argumentierte genauso, doch Denham konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es dem Klinikleiter in erster Linie darauf ankam, das sehr hohe Honorar, das Craven zahlte, weiterhin zu bekommen. An diesem Punkt musste er einhaken. Es war sinnlos, weiterhin nur vom medizinischen Standpunkt aus zu diskutieren.
»In drei Wochen wird eine Inspektion des Sanatoriums durchgeführt, nicht wahr?«, sagte er. »Es wird schwierig werden, dem Londoner Ärztekollegium diesen Fall zu erklären. Wir müssten zugeben, mit unserem Fachwissen am Ende zu sein.«
Er sah, wie Jamesons Gesicht sich verdunkelte, und erkannte, dass er auf dem richtigen Weg war.
»Wenn nun jemand auf die Idee kommt, diesen Fall genauer zu untersuchen, würden zudem auch die Machenschaften Jacksons wieder in den Blickpunkt geraten, die wohl unzweifelhaft zu den dunkelsten Kapiteln in der Geschichte des Sanatoriums gehören. Allzu genaue Nachforschungen würden ein schlechtes Licht auf die Klinik werfen. Das ist in unserem Gespräch bislang noch nicht berücksichtigt worden.«
Potter und Williams nickten zustimmend; Parker warf Jameson einen unsicheren Blick zu, und als von dessen Gesicht keine eindeutige Regung abzulesen war, zog er es ebenfalls vor nicht zu reagieren. Brown hingegen blickte in die Runde, als hätte man ihm gerade einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet.
»Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein, meine Herren!«, fuhr er auf. »Vergessen Sie nicht, wir sind Ärzte und als solche nur unserem Gewissen und der Medizin verpflichtet. Hier geht es um das Schicksal eines Menschen, da dürfen wir unsere Entscheidung nicht durch mögliche Unannehmlichkeiten vonseiten dieser ohnehin sinnlosen Ärztekammer beeinflussen lassen.«
»Professor, Ihre Ansicht über die Ärztekammer steht hier nicht zur Diskussion«, ermahnte Jameson ihn scharf.
»Das Zimmer Priscyllas ist ursprünglich für drei Personen gedacht, nicht wahr?«, sagte Denham mit nachdenklichem Blick, als würde er nur laut denken. »Wir könnten gleich drei andere Patienten dort unterbringen. Es liegen Anmeldungen von Familienangehörigen sehr einflussreicher und wohlhabender Personen vor, die wir ablehnen müssen, weil wir keine Kapazitäten mehr freihaben.«
Er sah das unmerkliche Zucken, das über Jamesons Gesicht glitt, und wusste im gleichen Moment, dass er gewonnen hatte. Alles Weitere war nur noch ein Rückzugsgefecht des Chefarztes.
»Wie lange, sagten Sie, ist es her, dass zuletzt ein Anfall der Patientin auftrat?«, erkundigte sich Jameson mit plötzlich neu erwachendem Interesse an den medizinischen Fakten.
»Fast zwei Wochen. Zuvor traten die Anfälle zwei bis dreimal pro Tag auf. In meinen Augen ist die Gefahr endgültig gebannt.«
»Aber was ist, wenn es wieder einen Rückfall gibt? Die Folgen könnten für uns sehr unangenehm sein. Craven besitzt die Möglichkeiten, uns wegen einer solchen Fehldiagnose die Hölle heiß zu machen.«





























