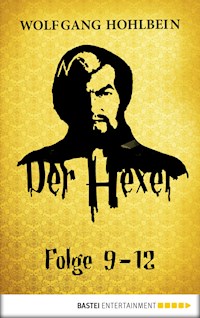
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
4 Mal Horror-Spannung zum Sparpreis!
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein - vier HEXER-Romane in einem Sammelband.
"Tage des Wahnsinns" - Folge 9 - der letzte Titel der ursprünglich als Gespensterkrimi erschienenen Episoden des HEXERS.
Es war ein Anblick von einer morbiden Faszination, die es mir unmöglich machte, wegzusehen. Mein Ebenbild im Spiegel begann sich zu verändern, sich aufzulösen. Die Gesichtshaut wurde braun und rissig, zitterte wie ein welkes Blatt in einer steifen Herbstbrise. Zuerst begriff ich gar nicht was ich sah. In meiner zitternden Linken hielt ich immer noch den Rasierpinsel, in einer erstarrten, nur halb zu Ende geführten Bewegung. Mein Mund war zu einem stummen Schrei geöffnet. Hinter den Lippen sah ich schwarzbraune Zähne, die zusehends verfielen. Langsam, ganz langsam begann sich die welke Haut abzulösen, bis ich glaubte den blanken Knochen darunter zu sehen. Mein Spiegelbild wurde zu einer Fratze, dann zu einem Totenschädel, meine Augen krochen in die Höhlen zurück und schienen mich satanisch anzufunkeln. Gleichzeitig setzte ein feines Singen ein, ein hoher, schriller Ton, der von überall her zu kommen schien, sich zu einem hellen Kreischen steigerte und mit einem peitschenden, splitternden Knall abbrach.
"Das Erbe der Dämonen" - Folge 10 - der Beginn der eigenständigen Romanheftreihe DER HEXER.
Das Böse war stark in jenen Tagen; all zu schnell erlag der Mensch seinen Lockungen. Doch wisse - ein Mann stellte sich gegen die Dämonen, ein Mann, der ein schreckliches Erbe in sich trug. Er machte sich eine uralte, sagenumwobene Macht zum Feind. Und wurde gnadenlos von ihren Todesboten gejagt. Doch er war nicht wehrlos. Wissen war seine Macht, Magie seine Waffe. Die Menschen mieden ihn ob seiner unheimlichen Kräfte. Und man nannte ihn den HEXER...
"Der Seelenfresser" - Folge 11 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Die Nacht war still und fast endlos gewesen, und als die Dämmerung kam, wirkte die Morgensonne grell und hart. Lowry Temples wusste, dass es ein böser Tag werden würde- für ihn, für Jane, für sie alle und für Innsmouth. Er hatte die ganze Nacht gebetet und zu Gott gefleht, ihn zu schonen. Aber als aus dem angrenzenden Zimmer der erste, dünne Schrei des Neugeborenen drang und wenige Augenblicke später die Tür aufging und er in die Augen des Arztes sah, wusste er, dass seine Gebete nicht erhört worden waren. Der Fluch, der seit Generationen auf Innsmouth lag, hatte sich ein weiteres Mal erfüllt...
"Cthulhu lebt!" - Folge 12 - gehörte ursprünglich zu der Romanheftreihe DER HEXER.
Necron erwachte. Seine Lider hoben sich, aber der Blick der dunklen, fast pupillenlosen Augen dahinter blieb leer. Es dauerte lange, bis sich seine Brust in einem ersten, mühsamen Atemzug hob. Während der letzten Tage hatte er nicht geatmet. Sein Herz hatte nicht geschlagen, und seine Haut war so kalt gewesen wie der Fels, auf dem er lag. Jeder Arzt hätte seinen Tod festgestellt. Und doch - er lebte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Ähnliche
Inhalt
Cover
DER HEXER – Die Serie
Über diese Folge
Über den Autor
Titel
Impressum
Der Hexer – Tage des Wahnsinns
Der Hexer – Das Erbe der Dämonen
Der Hexer – Der Seelenfresser
Der Hexer – Cthulhu lebt!
Vorschau
DER HEXER – Die Serie
Die Kultreihe von Starautor Wolfgang Hohlbein kehrt wieder zurück! Insgesamt umfasste DER HEXER 68 Einzeltitel, die erstmalig als E-Books zur Verfügung stehen.
Über diese Folge
Dieser Sammelband beinhaltet die Hexer-Romane 9-12:
Der Hexer – Tage des Wahnsinns
Der Hexer – Das Erbe der Dämonen
Der Hexer – Der Seelenfresser
Der Hexer – Cthulhu lebt!
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, am 15. August 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern in der Nähe von Neuss, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere. Er ist der erfolgreichste deutsche Autor der Gegenwart. Seine Romane wurden in 34 Sprachen übersetzt.
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Folgen 9–12
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG
Erstmals veröffentlicht 1990 als Bastei Lübbe Taschenbuch
Titelillustration: © shutterstock / creaPicTures
Titelgestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1570-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort Hexer Band 9
Um eines ganz klarzumachen: So weit ich das beurteilen kann, habe ich es einzig und allein dem Fandom zu verdanken, dass DER HEXER keine Ein (bzw. Drei)tagesfliege blieb, sondern in rekordverdächtiger Zeit auf den Olymp der »eigenen« Serien erhoben wurde, aber es gab da eine klitzekleine Kleinigkeit, die zwei der drei Michaels wohl erst erfahren, wenn sie dieses Vorwort lesen – ich jedenfalls habe mich gehütet, es ihnen jemals zu sagen: Es gab eine Unzahl von Briefen, die mit dem HEXER zu tun hatten, aber die allermeisten beschäftigten sich weniger mit den Romanen, der Handlung oder den tollen Ideen, sondern schlicht mit der Frage: Wer ist eigentlich dieser Robert Craven?
Um die regelrechte Hysterie zu begreifen, die damals um diese simple Frage ausbrach, muss ich noch einmal kurz zurück zum damaligen »Fandom«. Es war einfach so etwas wie eine große Familie. Man kannte sich untereinander, liebte oder hasste sich, und auch die Autoren machten da keine Ausnahme.
Alle – außer eines gewissen Robert Craven eben. Im Nachhinein betrachtet muss ich gestehen, dass ich damals äußerst (wenn auch ganz und gar unabsichtlich) clever entschieden hatte, mir ein neues Pseudonym zuzulegen – und es streng geheim zu halten. Selbst die Quasselstrippe Michael – kein Telefonat unter drei Stunden, wobei der andere kaum zu Wort kommt – hielt eisern dicht, und niemand wusste, wer sich hinter dem »Feigling« verbarg. Die Gerüchteküche kochte. Jeder mögliche Autor wurde erwogen, durchdiskutiert und wieder verworfen. Ich auch, aber ich scheine ein ganz guter Lügner zu sein, denn irgendwie ist mir in den ersten Monaten niemand auf die Schliche gekommen, trotz einiger sehr direkter Fragen.
Bezeichnend ist da vielleicht eine kleine Episode, die ich seither immer wieder zur (fast) allgemeinen Belustigung erzähle: Ich war damals schon mit Frank Rehfeld befreundet, einem der späteren Mitautoren der HEXER-Reihe und selbst Autor zahlreicher Romane. Wie wir alle war er damals sehr viel mehr im Fandom engagiert als heutzutage, und selbstverständlich führten wir endlose Telefongespräche über die weltbewegende Frage, wer dieser geheimnisvolle Robert Craven eigentlich ist. Das eine oder andere Mal hatte ich wohl einen Grinsekrampf in den Backen, nachdem ich aufgelegt und meiner Frau erzählt hatte, wen er gerade mal wieder verdächtigt hatte, Robert Craven zu sein. Gleichwie – wenige Tage später besuchte mich Frank in unserer damaligen 2-Zimmer-Dachwohnung, die natürlich keinen Platz für ein eigenes Arbeitszimmer bot. Will sagen: Mein Schreibtisch stand mitten im Wohnzimmer, direkt darüber (!) hing ein 120 x 80 cm-Poster des Original-Titelbildes des ersten HEXER-Bandes (Frank habe ich erzählt, ich hätte das Bild so toll gefunden, dass ich mir eine Vergrößerung davon besorgt habe …), und die ganzen zwei Stunden, in denen wir Kaffee tranken, eine Zigarette nach der anderen rauchten und uns die Köpfe über die Frage heiß redeten, wer denn nun Robert Craven sein könnte (XYZ? Nö. Viel zu literarisch, das könnte der nie. ZXY? Bestimmt nicht. Das wäre viel spannender) hämmerte mein Typenrad-Drucker eine Zeile nach der anderen des sechsten HEXER-Romanes auf Endlospapier, das sich allmählich zu einem gewaltigen Stapel am Fuße des Schreibtisches aufhäufte – der Ablieferungstermin rückte näher, und, wie gesagt, es gab noch keine E-Mail, sondern nur altmodische Manuskripte auf Papier, die eben ausgedruckt werden mussten. Wäre ich nicht aufgestanden, um mir einen Kaffee zu holen, und hätte Frank die Chance nicht genutzt, meine Ausdrucke zu »ordnen«, hätte er es wahrscheinlich überhaupt nicht gemerkt …
Dafür sehe ich seinen betroffenen Gesichtsausdruck (den Ausdruck »dämlich« vermeide ich hier ganz bewusst) noch heute vor mir, als ihm klar wurde, mit wem er die ganze Zeit über die Frage philosophiert hatte, wer denn dieser geheimnisvolle Robert Craven eigentlich war.
Und das entschädigt für vieles …
Tja, so war das damals. Lang ist’s her. Aber langer Rede, kurzer Sinn: Tatsächlich habe ich es nur den Fans zu verdanken, dass der HEXER VON SALEM überhaupt als eigenständige Serie das Licht der Welt erblickte.
Danke!
Wolfgang Hohlbein
DER HEXER
Band 09Tage des Wahnsinns
Es war ein Anblick von einer morbiden Faszination, die es mir unmöglich machte wegzusehen. Mein Ebenbild im Spiegel begann sich zu verändern, sich aufzulösen. Die Gesichtshaut wurde braun und rissig, zitterte wie ein welkes Blatt in einer scharfen Herbstbrise. Zuerst begriff ich gar nicht, was ich sah. In meiner zitternden Linken hielt ich noch immer den Rasierpinsel, in einer erstarrten, nur halb zu Ende geführten Bewegung. Mein Mund war zu einem stummen Schrei geöffnet. Hinter den Lippen sah ich schwarzbraune Zähne, die zusehends verfielen. Langsam, ganz langsam begann sich die welke Haut abzulösen, bis ich glaubte, den blanken Knochen darunter zu sehen. Mein Spiegelbild wurde zu einer Fratze, dann zu einem Totenschädel, meine Augen krochen in die Höhlen zurück und schienen mich satanisch anzufunkeln. Gleichzeitig setzte ein feines Singen ein, ein hoher, schriller Ton, der von überallher zu kommen schien, sich zu einem hellen Kreischen steigerte und mit einem peitschenden, splitternden Knall abbrach.
Der Spiegel barst. Ein Hagel silberner Glassplitter überschüttete mich, Dutzende scharfkantiger, winziger Raubtierzähne bissen in mein Gesicht. Ich merkte es nicht einmal. Noch immer hielt mich das Grauen gepackt und schnürte mir unbarmherzig die Luft ab. Der Nachhall der Explosion drohte meinen Verstand mit sich zu reißen.
Mein Denken war wie gelähmt, aber in meinem Inneren bäumte sich ein starkes, wildes Gefühl auf. Eine Saite, zum Zerreißen gespannt, mehr war ich in diesem Augenblick nicht, und doch wusste ich, dass es nichts weiter als eine Illusion gewesen war, gewesen sein musste …
Der Schmerz und die grausige Verwandlung, die Furcht – alles war nichts als Einbildung, eine perfekte, tödliche Illusion.
Meine Fingerspitzen fuhren wie von selbst über den Spiegelrahmen, und dann, ganz plötzlich, hatte ich wieder ein Bild vor Augen: das Bild einer jungen Frau, fast noch ein Mädchen. Fassungslos starrte ich auf das Gesicht, begriff nicht, was ich da sah, starrte nur in dieses Gesicht und bemerkte nicht die Ähnlichkeit der Haare mit der Form des Totenschädels, die gleiche Schwärze und das gleiche Wallen, das mich noch vor Sekunden gelähmt hatte. Dann …
»Priscylla«, krächzte ich.
Die braunen, ausdrucksvollen Augen musterten mich mit einer Kälte, die ich nur zu gut kannte und die mich doch im gleichen Maße erschreckte wie beim ersten Mal. Das war nicht Priscylla, meine süße, kleine Priscylla, das war Lyssa, die Hexe, die noch immer in ihr schlummerte und die mich schon einmal hatte vernichten wollen.
Aber wie war das möglich? Howard hatte mir versichert, glaubhaft versichert, dass sie keinen Schaden mehr anrichten konnte, dass sich seine Freunde ihrer annehmen und sie isolieren würden. Und er hatte geschworen, dass ihr kein Leid zugefügt werden würde.
Aber das, was ich jetzt sah, sprach all seinen Beteuerungen Hohn.
»Priscylla!«
Diesmal schrie ich fast. Meine Hände, die auf den dünnen Latten des Rahmens gelegen und so fest zugedrückt hatten, dass das Holz knirschte, wollten sich in ihr Haar graben, aber irgendetwas hielt mich zurück.
»Robert.«
Es war kein gesprochenes Wort, keine Stimme. Es war wie eine unsichtbare, unwiderstehliche Kraft, die durch die Luft peitschte, mir meinen Namen entgegenschleuderte, meinen Willen brach und mich zurücktaumeln ließ wie durch einen Faustschlag.
»Robert«, wiederholte die Kraft. Ich schlug die Hände vor die Ohren, keuchte und kämpfte mühsam gegen den Wahnsinn, der seine Finger nach mir ausstreckte.
»Robert! Hör mir zu!«
Ich taumelte, griff ziellos in die Luft und wäre fast gestürzt. Das Zimmer begann sich vor meinen Augen zu drehen und verschwamm; einzig den Spiegel und das schmale Mädchengesicht vermochte ich noch klar zu erkennen. Aber es begann sich zu verändern.
Priscyllas schönes, mädchenhaftes Antlitz verzerrte sich zu einer Grimasse des Schreckens, und einen Moment lang fürchtete ich, dass es sich abermals in den grauenhaften Totenschädel verwandeln würde.
Aber dann fing sie sich. Das Bild stabilisierte sich und gewann wieder an Festigkeit, und ihre Mundwinkel verzogen sich sogar zur Andeutung eines Lächelns. Eines kalten, eisigen Lächelns, das beinahe schlimmer war als der Anblick des Totenschädels zuvor.
»Robert«, flüsterte die Kraft, als hätte sie gemerkt, dass ich dem Ansturm ihrer geballten Gewalt nicht mehr lange standhalten konnte. »Hilf mir. Er will mich holen. Hilf mir. Rette mich.«
Ich wollte antworten, aber meine Kehle fühlte sich ausgetrocknet und verkrampft an, ein einziger Klumpen aus Schmerz, der mir den Gehorsam verweigerte. Ich schluckte mühsam, räusperte mich, und versuchte es dann noch einmal. Diesmal ging es, wenn auch nur unter Schmerzen.
»Wo … wo bist du?«, brachte ich hervor.
Priscyllas Mundwinkel zuckten. Sie musterte mich traurig, ein Mädchengesicht in einem Rahmen, der kein Fenster und kein Gemälde einrahmte, und ich wusste in diesem Augenblick nur, dass ich sie liebte, unbändig liebte, immer noch.
Mir war egal, wer oder was sie war und was sie getan hatte. Ich spürte nichts als das starke Gefühl, das zwischen uns war und uns für immer aneinanderketten würde, die Flamme, die noch immer – und heißer denn je – in mir brannte.
»Andara …«, stieß Priscylla hervor und diesmal spürte ich, dass wirklich sie es war, und dass sie die Kraft benutzte, um mit mir in Verbindung zu treten und nicht umgekehrt. »Andara … hat mir eine Falle gestellt. Er kommt, mich zu holen.«
Sie schrie auf, und plötzlich schrie auch ich. Eine Woge eisiger Kälte drang auf mich ein und ließ mich abermals zurücktaumeln. Dann glaubte ich Flammen zu sehen, und ein unsichtbarer Blitz spaltete die Welt von einem Ende zum anderen.
Und dann war da nichts mehr als Schwärze.
Sean warf einen langen Blick in die Runde, ehe er sich von seinem Platz neben der Tür löste und an die Theke trat.
Es herrschte erstaunlich wenig Betrieb; nur ein paar alte Männer, die Karten spielten, und zwei junge Burschen mit mürrischen Gesichtern, die sich schweigend an halbvollen Biergläsern festhielten.
Hinter der Theke stand ein feister Mann mit rundem Gesicht und roten Haaren, der aus halb geschlossenen Augen das Kartenspiel verfolgte. Neben ihm verbreitete ein offener Kamin die Illusion von Wärme und Behaglichkeit.
Sean nickte dem Wirt zu und bestellte ein Pint des örtlichen Bitters. Er machte sich nicht viel aus Bier, aber manchmal war es besser, sich den Gepflogenheiten der Gegend anzupassen, in der man war – vor allem dann, wenn man nicht auffallen wollte. Und es war Seans Beruf, nicht aufzufallen.
Das Bitter hatte einen scharfen Nebengeschmack und war so dünn wie Regenwasser. Trotzdem stürzte es Sean in zwei, drei kräftigen Schlucken herunter und schob das Glas anschließend quer über die Theke. Der Wirt füllte es schweigend.
»Auf der Durchreise, Sir?«
»Ich bleibe über Nacht hier«, antwortete Sean in betont gelangweilter Art und ohne den Mann anzusehen. »Man hat mir gesagt, dass ich in der Pension auf der anderen Seite des Waldes eine Bleibe finde.«
»Glaube ich kaum. Sie meinen doch bestimmt die Anstalt von Mr. Baltimore. Wäre mir neu, wenn der jetzt auch noch an Reisende Zimmer vermietet.«
»Anstalt?« Sean nippte an seinem Bier und sah den Wirt mit einer perfekt geschauspielerten Mischung zwischen Desinteresse und einer gelinden Spur von Neugier über den Rand des Glases hinweg an. »Davon weiß ich nichts. Man hat mir nur gesagt, dass ich dort für ein paar Tage unterkommen könnte.«
Der Wirt musterte Sean schweigend und stützte sich dann mit beiden Armen auf die Theke. »Sind Sie ganz sicher, dass Sie das Haus jenseits des Waldes meinen? Das Haus von Mr. Baltimore?«
»Baltimore?« Sean runzelte die Stirn und stierte einen Moment vor sich hin, als überlege er. »Hm … Glaube nicht, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Sie wissen ja, wie das ist. Irgendein Bursche war schon mal in der Gegend, in die man muss, und empfiehlt eine Bleibe.«
»Irgendein Bursche«, wiederholte der Wirt nachdenklich.
Obwohl er sich bemühte, sich nichts anmerken zu lassen, spürte Sean sein wachsendes Misstrauen. »Sie scheinen viel herumzukommen, Sir.«
»Nun, in dem Nest, in dem ich aufgewachsen bin, hat mich wirklich nichts gehalten.« Sean lachte rau und bemühte sich, in seiner Stimme eine Spur von Bitterkeit mitklingen zu lassen. »Ich bin sogar ein paar Jahre zur See gefahren. Fast hätte ich es bis Kap Horn geschafft, aber dann passierte diese schreckliche Sache.«
Die Augen des Wirts verengten sich. »Was für ein schreckliche Sache?«
Sean wusste, dass er vorsichtig sein musste, aber irgendwann war einmal ein Punkt erreicht, an dem man mit Vorsicht nicht mehr weiterkam. In dieser Gegend fiel er nicht allein durch seine Körpergröße auf. Er konnte sicher sein, dass man bereits begonnen hatte, über das »Wer« und »Woher« des breitschultrigen Fremden nachzudenken.
Die Blicke der beiden Kartenspieler, die an einem Tisch hinter ihm saßen, konnte er direkt fühlen. Sie waren nicht unbedingt freundlich. Es war an der Zeit, die Gerüchte und Vermutungen in die richtige Bahn zu lenken.
Er lächelte unbestimmt und nippte wieder an dem Bier. »Es ist nicht die Art von Geschichten, die man gern erzählt«, behauptete er. »Außerdem wurde der Untergang der BERMUDA damals in allen Zeitungen breitgetreten.«
Der Wirt nickte verständnisvoll, füllte ein Bierglas und kippte den Inhalt in einem Zug herunter.
»Geschichten wie die kenne ich zur Genüge«, sagte er. »Was meinen Sie, was sich hier alles abspielt. Tragödien, sage ich Ihnen, Tragödien, da hätte Shakespeare seine wahre Freude dran gehabt.« Plötzlich grinste er. »Aber nur die Hälfte davon ist wahr.«
»Ach, ja?«, fragte Sean, seinen letzten Satz bewusst ignorierend. »Das sollte man gar nicht für möglich halten. Hier sieht doch alles so friedlich aus.«
»Finden Sie? Da sieht man, wie man sich täuschen kann.« Er beugte sich etwas vor und blinzelte Sean verschwörerisch zu. »Ich an Ihrer Stelle wäre etwas vorsichtiger mit der Wahl meiner Bleibe. Haben Sie wirklich noch nie von Mr. Baltimores Anstalt gehört?«
Sean schüttelte den Kopf und gab sich Mühe, ein möglichst gelangweiltes Gesicht zu machen. Es gelang ihm nicht ganz, aber der Wirt merkte gottlob nichts davon.
»Man erzählt sich so manches«, fuhr der Wirt fort. »Nicht unbedingt Dinge, die in die Zeitung gehören. Aber fest steht, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht.«
»Tatsächlich?« Sean brauchte seine Überraschung nicht zu heucheln. Er hatte nicht erwartet, dass er so schnell vorankommen würde. Bisher war er auf eine Mauer des Schweigens gestoßen, gleichgültig, wonach er gefragt hatte.
»Wie merkwürdig, dass man mir ausgerechnet dieses Haus empfohlen hat«, fuhr er fort. »Aber daran sieht man mal wieder, wie wenig man auf die Ratschläge von Fremden geben sollte.«
»Da haben Sie allerdings recht, Sir«, pflichtete ihm der Wirt bei. Einen Moment blickte er Sean an, und in seinen Augen blitzte eine Mischung aus Misstrauen und stärker werdender Neugier. Die Neugier gewann.
»Und wenn ich mir einen Vorschlag erlauben dürfte«, fügte er mit einem raschen, listigen Lächeln hinzu. »Bleiben Sie doch einfach hier. Wir haben unter dem Dach noch ein Zimmer frei. Gar nicht teuer.«
Sean nickte zögernd. »Das ist … sehr freundlich. Da ist … nur noch eine Kleinigkeit.«
Er schloss die Hand fest um das Bierglas und warf einen Blick in die Runde. Die alten Männer hatten eine Pause gemacht und unterhielten sich leise. Es war nicht schwer zu erraten, worum sich ihr Gespräch drehte.
»Ruhiger Abend«, bemerkte Sean.
»Ganz recht, Sir. In der Woche ist hier nie viel los. Die meisten hier können es sich nicht leisten, unter der Woche in den Pub zu kommen. Es ist nicht viel Geld in der Gegend.« Der Wirt beugte sich noch ein Stück vor. Das Feuer hinter ihm knackte und warf bizarre Schatten auf die gegenüberliegende Wand. »Wollten Sie mir nicht noch etwas sagen, Sir?«
Sean zuckte zusammen, hielt dem Blick des anderen einen Moment stand und lächelte dann verlegen. »Ich … weiß nicht. Nach allem, was Sie bisher angedeutet haben, möchte ich zwar nicht unbedingt mit diesem Mr. Baltimore Bekanntschaft machen, aber ich fürchte, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe mich für morgen Früh mit jemandem dort verabredet.«
»Wenn das so ist.« Der Wirt zuckte mit den Achseln und zog sich ein Stück zurück.
Sean glaubte fast, einen Fehler gemacht zu haben, aber der Wirt goss sich nur sein Glas voll und lehnte sich dann wieder über die Theke. Sein Gesichtsausdruck wirkte noch immer verschlossen, aber in seinen Augen glomm ein sonderbares Feuer.
»Sie glauben mir wohl nicht, was?«, fragte er provozierend. »Sie meinen wohl, ich wollte Ihnen unbedingt ein Zimmer aufschwatzen?«
»Das habe ich nicht gesagt«, antwortete Sean eine Spur zu schnell. »Es ist nur …«
Der Wirt winkte mit einer großzügigen Geste ab. »Vergessen Sie es. Sie müssen selber wissen, was Sie tun, junger Mann.«
»Aber dieses Haus …« Sean versuchte so etwas wie ein nervöses Zittern in seiner Stimme mitklingen zu lassen. »Was ist denn damit los?« Er lächelte, und er tat es absichtlich nervös. »Wenn ich schon dahin muss … Sie verstehen?«
»Tja«, brummte der Wirt. Er warf einen Blick in die Runde, als wolle er sich vergewissern, dass ihnen niemand zuhörte. Wahrscheinlich tat ihm seine Redseligkeit bereits wieder leid, aber offensichtlich wollte er auch vor dem Fremden nicht das Gesicht verlieren. »Es kehren merkwürdige Leute dort ein. Nicht als Pensionsgäste, sondern … was weiß ich.« Er richtete sich zur vollen Größe auf und warf Sean einen misstrauischen Blick zu. »Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das alles erzähle«, fügte er hinzu, als müsse er sich vor sich selbst rechtfertigen.
»Was für Leute?«, fragte Sean ungerührt.
Der Wirt sah ihn gleichmütig an. »Nur Leute, Sir. Fremde. Londoner. Man kriegt sie höchstens mal bei der Durchreise zu Gesicht.«
Er starrte auf das leere Glas, das Sean auf die Theke zurückgestellt hatte.
Sean nickte ihm zu und bat um erneute Füllung. Während er das Bier zapfte, fuhr der Wirt fort: »Nicht einmal in der Kirche lassen sie sich blicken. Wenn Sie mich fragen: Es ist Gesindel, gottloses Gesindel, das man schon längst zum Teufel hätte jagen sollen.«
»Und warum tun Sie es dann nicht?«, fragte Sean lächelnd.
Der Wirt kniff die Augen zusammen und wischte mit einem speckigen Lederlappen über die Theke.
»Weil Mr. Baltimore einflussreiche Freunde hat«, sagte er schließlich.
In seiner Stimme schwang Resignation mit. Es schien nicht gerade das erste Mal zu sein, dass er sich mit dieser Frage beschäftigte. Und die Antwort, zu der er gelangte, schien ihm nicht zu behagen.
»Was für Freunde?«
Der Wirt drehte sich wortlos um und machte sich am Feuer zu schaffen. Als er ein paar neue Holzscheite in die Flammen warf, stoben Funken auf.
»Wollen Sie nun das Zimmer, oder nicht?«, fragte er über die Schulter.
Sean zuckte mit den Achseln. Er spürte, dass er aus dem Mann nichts mehr herausbekommen würde. Zumindest nicht mehr heute Abend. Wenn er weiter in ihn drang, würde sein Misstrauen nur erneut aufflammen.
»Gut«, sagte er, »ich nehme es. Ich kann mich morgen Früh immer noch auf den Weg zu diesem seltsamen Haus machen. Können Sie mir den Weg beschreiben?«
Der Wirt nickte widerstrebend, reichte ihm sein Bier und erklärte ihm, wie er Mr. Baltimores Haus fand.
»Nein, Sir.«
Das Gesicht des fahrenden Händlers verzog sich zu einer Grimasse, die wahrscheinlich ein Lächeln darstellen sollte, aber eher wie ein höchst schadenfrohes Grinsen wirkte. Sein Atem bildete kleine, neblige Fetzen vor seinem Gesicht und verlieh seinen Worten etwas Unwirkliches.
Es war wieder kalt geworden in den letzten Tagen, und widerwillig hatte ich erkennen müssen, dass auch in den großen Städten noch tiefer Winter herrschte. Die Ereignisse im Wald von Durness hatten meinen Zeitsinn durcheinandergebracht und mich vergessen lassen, dass der Frühling nicht mehr fern war.
Es wurde Zeit, dass die Sonne die finsteren Wintertage zurückdrängte und die Menschen aufatmen ließ. Auch ich brauchte Ruhe und Wärme, nicht nur körperlich. Aber ich ahnte, dass mir das vorerst nicht vergönnt sein würde.
»Würden Sie mir dann wenigstens sagen, wie ich zur Grafschaft komme?«, fragte ich.
Mein Gegenüber schüttelte den Kopf, langsam, aber mit der Bedächtigkeit eines Mannes, der weiß, was er will.
»Ich sehe keine Veranlassung dazu«, sagte er schließlich.
Die Waren, die er vor sich in dem kleinen, selbstgezimmerten Bauchladen trug, klimperten leise, als er sich wieder in Bewegung setzen wollte. Ich hielt ihn am Ärmel seines zerschlissenen Mantels fest.
»Nicht so rasch, Freund«, sagte ich, und bevor er an Gegenwehr denken konnte, brachte ich eine Pfundnote zum Vorschein.
In seinen Augen schimmerten gleichermaßen Misstrauen wie Habgier. Ich sah, wie er nach dem Geldschein greifen wollte, aber irgendetwas hielt ihn zurück.
»Ich bin doch kein Auskunftsbüro, Sir«, knurrte er. »Und wenn Sie jetzt so freundlich wären, mich loszulassen, bevor ich meine gute Kinderstube vergesse.«
Ich gab ihn überrascht frei und trat einen Schritt zurück.
Bis jetzt hatte ich dem Mann keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt und ihn für einen der fliegenden Händler gehalten, die alles verkaufen und oft mehr über die Gegend wissen, durch die sie ziehen, als die einheimische Bevölkerung. Ich hatte es für eine gute Idee gehalten, mich an ihn zu wenden, um an Informationen zu kommen, die ich brauchte, aber irgendetwas in dem Tonfall des Mannes ließ mich aufhorchen.
Es schien beinahe so, als wisse er mehr über den Ort, nach dem ich fragte, als ich vermutet hatte.
»Ist ein Pfund für eine einfache Auskunft etwa zu wenig?«, fragte ich scharf.
»Geld.« Der Händler spuckte das Wort fast aus. »Sie, Sir, und Ihresgleichen setzen wohl immer auf die Kraft des Geldes, was? Sie meinen wohl, Sie könnten sich alles kaufen, nur weil Sie als Sohn eines fetten Geldsacks zur Welt gekommen sind!«
Ich spürte, wie Ärger in mir hochwallte. Ärger vor allem darüber, dass man mich für einen jungen Stutzer halten konnte, obwohl ich doch weiß Gott in den Slums von New York mehr als nur flüchtige Bekanntschaft mit den Härten des Lebens gemacht hatte.
Immerhin war ich dort aufgewachsen.
Das konnte dieser Mann zwar nicht wissen, aber er hatte kein Recht, so mit mir zu reden – und dann noch in einem Tonfall, der im krassen Gegensatz zu seinem Äußeren stand.
»Sie hüten besser Ihre Zunge, Mann«, sagte ich so ruhig wie möglich. »Ich habe Ihnen ein schließlich nicht uninteressantes Angebot gemacht. Wenn Sie so wenig von Geld halten, warum laufen Sie dann überhaupt mit Ihrem Ramsch in der Gegend herum?«
»Ich werde dir den Ramsch gleich um die Ohren hauen, du Grünschnabel«, zischte mein Gegenüber. »Was weißt denn du überhaupt von ehrlicher Arbeit? Ein Modegeck wie du, der sich sein Haar mit gezackten Streifen verziert und es noch nicht einmal nötig hat, sich zu rasieren. Willst du wissen, was ich davon halte, Kleiner?«
Er stemmte die Hände in die Hüften und funkelte mich herausfordernd an. Obwohl er fast einen Kopf kleiner als ich war, strahlte er in diesem Moment etwas Bedrohliches aus.
Langsam begann ich wirklich ärgerlich zu werden. Was bildete sich dieser Kerl ein? Die auffällige weiße Haarsträhne, die ich normalerweise unter einem Hut verbarg, war die bleibende Erinnerung an einen fürchterlichen Kampf mit einem alptraumhaften Monster, das mich fast vernichtet hätte, und jetzt hielt mir dieses dahergelaufene Subjekt das auch noch als Modetorheit vor.
Nicht, dass ich nicht daran gewöhnt wäre. Aber es ärgerte mich trotzdem. Musste man denn jedem, der anders als die anderen war, gleich mit Feindschaft – oder, im besten Fall – mit Spott und Hohn begegnen?
Bevor ich meiner Verärgerung Luft machen konnte, bemerkte ich einen Schatten, der auf uns zuhielt. Trotz der beginnenden Dämmerung hatte ich keine Mühe, den Schatten zu identifizieren.
Ich stieß einen stummen Fluch aus und wandte mich dem Ankömmling zu.
»Was machst du denn hier?«, fragte ich.
In meiner Stimme musste noch immer Aggressivität mitschwingen, denn Howard verzog tadelnd das Gesicht und schlug mit dem Stock leicht auf das harte Kopfsteinpflaster. Sein Blick wanderte zwischen mir und dem Händler hin und her, und was er sah, schien ihm nicht zu gefallen.
»Kann ich mal mit dir sprechen, Robert?«, fragte er. In seiner Stimme schwang soviel Bestimmtheit mit, dass ich unwillkürlich zusammenzuckte. Es war keine Frage, sondern ein Befehl.
»Natürlich kannst du mit mir sprechen«, sagte ich ärgerlich. »Wenn ich nicht irre, tust du es ja bereits.«
Howard nickte stumm. Er schien darauf zu warten, dass ich ihm folgte, aber ich hatte noch eine Kleinigkeit zu erledigen.
Ich wandte mich wieder dem Händler zu, der Howards Auftritt schweigend verfolgt hatte.
»Was ist nun«, herrschte ich ihn an. »Wollen Sie das Geld, oder verstößt es gegen Ihre Prinzipien, Modegecken etwas zu verkaufen?«
Der Mann war verunsichert. Wahrscheinlich überlegte er, wie er den Preis hochtreiben konnte, aber Howards Erscheinen schien seine Pläne durcheinandergebracht zu haben. Mit einem »Modegecken« wie mir traute er sich wohl zu, fertig zu werden, aber Howard verunsicherte eigentlich jeden, der ihn zum ersten Mal sah. Es war etwas Düsteres an diesem Mann. Selbst ich spürte es noch, obgleich ich ihn weiß Gott lange genug kannte.
Er griff mürrisch nach der Pfundnote und ließ sie in seinem Bauchladen verschwinden.
»Gehen Sie nach Lowgreen«, sagte er mürrisch. »Das ist ein Nest sechs Meilen nördlich. Fragen Sie dort nach Baltimore.«
»Und weiter?«
»Nichts weiter. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.«
Er setzte sich wieder in Bewegung, und diesmal ließ ich ihn gehen. Ich hätte ihn gerne noch weiter ausgefragt – ein Pfund war eine Menge Geld, gerade in einer Gegend wie dieser, aber die Anwesenheit Howards hielt mich davon zurück.
»Und nun zu dir.« Ich wandte mich an Howard. »Was willst du?«
Howard presste die Lippen zusammen und musterte mich einen Herzschlag lang schweigend.
»Du hast dich verändert, Junge«, sagte er schließlich. »Es geht mich vielleicht nichts an, aber du solltest besser nicht ohne Hut auf die Straße gehen. Die Leute beginnen schon über dich zu reden.«
»Die Leute«, sagte ich verächtlich. »Was gehen mich die Leute an? Die sollen sich um ihren eigenen Dreck scheren.«
»Du solltest mittlerweile wissen, dass sie gerade das nicht tun«, sagte Howard. »Oder hast du vergessen, dass man dich vor kurzem noch beinahe gelyncht hätte?«
»Nicht nur mich«, brummte ich. »Außerdem ist das hier etwas ganz anderes.«
»Ach ja? Und warum, wenn ich fragen darf?«
Ich holte tief Luft, stemmte die Hände in die Hüften und sah Howard so feindselig an, wie ich konnte. Howard wusste ja nicht, wovon er redete.
»Kümmere dich bitte um deinen eigenen Kram«, sagte ich schärfer, als ich beabsichtigt hatte. »Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum du und dein Gorilla immer noch hinter mir herschleichen.«
Howard schluckte. Der kummervolle Ausdruck in seinen Augen verschwand und machte einem ärgerlichen Funkeln Platz. Fast begann mir meine gehässige Bemerkung leid zu tun, aber anstatt ruhiger zu werden, spürte ich eine wachsende Erregung in mir.
Die Worte sprudelten aus mir hervor, bevor ich sie zurückhalten konnte.
»Und wo wir gerade dabei sind«, fuhr ich fort, »lass bitte dein altväterliches Getue sein, ja? Ich weiß sehr gut, was ich zu tun und zu lassen habe.«
Howard nickte, ganz langsam und bedächtig. »Vielleicht hast du recht, Junge. Trotzdem würde ich gerne mit dir reden. Und wenn es geht, nicht unbedingt auf der Straße …«
»Damit die Leute nicht über uns reden, was?« Ich versuchte mich zusammenzureißen und die bösen Worte zu unterdrücken, die mir noch auf der Zunge lagen. Es war mir vollends bewusst, dass ich mich unmöglich und ganz gegen meine Natur verhielt, aber dieses Wissen machte mich nur noch wütender.
»Von mir aus«, brachte ich schließlich halbwegs ruhig hervor. »Und wo?«
Howard griff mich beim Arm und führte mich wortlos in eine Seitenstraße, in der eine Kutsche wartete. Bevor ich wusste, was er vorhatte, stieg er ein und forderte mich auf, es ihm gleichzutun. Ich zögerte einen Moment und folgte ihm dann.
Sean trank sein Glas aus, bedankte sich für die Unterhaltung und ließ sich von dem Wirt sein Zimmer zeigen.
Es war klein, schäbig eingerichtet und natürlich ungeheizt, aber es war auch preiswert. Sean konnte sich an weit schlechtere Zimmer erinnern, in denen es von Ungeziefer wimmelte, Wasser von der Decke tropfte und eisige Zugluft durch schlecht verkleidete Ritzen blies.
»In Ordnung«, sagte er und nickte dem Wirt zu. »Ich werde mich gleich aufs Ohr legen. Ich habe einen recht anstrengenden Tag hinter mir.«
Der Wirt wünschte ihm eine gute Nacht und ließ ihn allein. Sean setzte sich auf die Kante des Bettes, das für einen kleineren Menschenschlag gezimmert worden war, und fragte sich, warum man ihm immer zumutete, sich wie eine Sardine zwischen zwei zu eng stehende Bettpfosten zu quetschen.
Eine große Gestalt brachte nicht immer nur Vorteile mit sich. Es machte keinen besonderen Spaß, entweder kalte Füße oder Kopfschmerzen zu haben, wenn man erwachte.
Allerdings hatte er nicht vor, die ganze Nacht im Bett zu verbringen. Das Gespräch mit dem Wirt hatte ihm bestätigt, dass er auf der richtigen Spur war.
Natürlich konnte er den Morgen abwarten und sich im Tageslicht Mr. Baltimores sonderbares Etablissement ansehen, aber seine Erfahrung sagte ihm, dass man nachts oft viel mehr zu Gesicht bekam als bei Tag.
Er lehnte sich gegen die Wand und döste vor sich hin; eigentlich nicht mit der Absicht zu schlafen.
Nach einer Weile schreckte er von einem Geräusch auf. Irgendjemand stieg die Treppe zum Dachboden hinauf, dann quietschte eine Tür, und jemand murmelte etwas vor sich hin. Sean glaubte die Stimme des Wirts zu erkennen.
Es kehrte Stille ein. Sean richtete sich vorsichtig auf, zog die Jacke über, die er vorher auf dem Stuhl neben dem Bett abgelegt hatte, und wartete noch einen Moment. Dann öffnete er vorsichtig die Tür, schlich den dunklen Flur bis zur Treppe entlang und stieg Stufe für Stufe hinab.
Obwohl er sich bemühte, kein Geräusch zu machen, konnte er nicht verhindern, dass die Bohlen unter seinem Gewicht protestierend knarrten, aber die Stimmen und polternden Schritte, die er halbwegs als Echo erwartete, blieben aus.
Er erreichte den Schankraum, öffnete mit einem Dietrich die Tür und trat in die Nacht hinaus.
Es war kalt; kalt und dunkel. Ein feuchter Abendnebel zog den Weg herauf, der hinter dem Wirtshaus verlief. Er ließ alles undeutlich und verschwommen wirken, als ob in der Umgebung bis auf ein paar kahle Bäume und verfilzte Büsche alles Leben ausgestorben wäre. Als Sean an einem Tor vorbeikam, das den Weg zu einem dunklen Bauernhaus versperrte, kroch der Nebel wie ein graues, giftiges Gas über die Straße auf ihn zu; ein Vorhang aus nebelhaftem Nichts, hinter dem sich huschende Schatten und Bewegungen zu verbergen schienen.
Sean konnte sich eines unbehaglichen Gefühls nicht erwehren.
Trotzdem folgte er dem Weg nach rechts, überquerte ein dunkles Feld und gelangte schließlich auf eine feuchte Wiese, die sich bis zu einem großen Buchenhain hügelabwärts zog.
Er versuchte sich an die Beschreibung des Wirts zu erinnern, aber irgendwie bereitete es ihm Mühe, die Erklärungen, die er in einem hellen, freundlichen Schankraum gehört hatte, mit der kalten, nebelwallenden Wirklichkeit in Einklang zu bringen.
Er sah sich um.
Der Nebel war ihm nachgekrochen wie ein schwerfälliges Tier, das seiner Beute folgte, und ein sonderbarer, schwer zu definierender Geruch hing in der Luft. Sean erinnerte sich an den Buchenhain, und daran, dass er sich zwischen den Hügeln halten musste, um auf den Wald zu stoßen.
Vor ihm erstreckte sich eine Wiese, die durch eine dicht wuchernde Hecke vom Dorf abgetrennt war und irgendwo in der Ferne auslief, ohne dass er erkennen konnte, wo. Der Nebel erstreckte sich jetzt auch vor ihm und begann die Welt in ein Schattenkabinett zu verwandeln.
Als er die Hecke erreichte, entdeckte Sean eine Lücke in der grünen Mauer, die von einem Tor verschlossen wurde. Er zerrte am Gatter und zog es mühelos zur Seite. Obwohl ihm nicht wohl dabei war, zog er es hinter sich wieder zu.
Es war immerhin möglich, dass er nicht mehr ins Gasthaus zurückkehrte, und er wollte nicht, dass sie sofort wussten, wohin er gegangen war, auch wenn es sicher nicht schwer sein würde, es zu erraten. Er beschleunigte seine Schritte.
Es dauerte nicht lange, bis ihn das bedrohliche Dunkel des Waldes einhüllte. Die Hecke war an der Waldseite licht und wirkte teilweise wie abgefressen; er hatte keine Mühe, sie zu übersteigen und einen Pfad zu erreichen, der zwischen den Bäumen verschwand.
Aber der Boden war glitschig, und er verfluchte sein leichtes Schuhwerk, mit dem er nur schwer Halt fand. Der Nebel wanderte ziellos zu beiden Seiten des Pfads hin und her, verschonte aber seltsamerweise den Weg.
Die Baumreihen zu beiden Seiten wurden immer dichter, und er hatte Mühe, sich zurechtzufinden. Immer wieder stieß er gegen Äste und Gestrüpp, und manchmal musste er sich mit ausgestreckten Händen weitertasten wie ein Blinder.
Und dann entdeckte er das Licht.
Zuerst hielt er es für Mondschein, der durch die dichte Wolkendecke brach, aber dann bemerkte er das Schwanken und unruhige Flackern einer Lampe. Es war ein trüber Lichtschein von der anderen Seite des Waldpfads, und er hielt auf ihn zu.
Sean blieb stehen. Er spürte, wie ihn ein kaltes Frösteln überlief. Es war ausgeschlossen, dass er um diese Zeit und in dieser Gegend auf einen Spaziergänger traf, und noch dazu auf einen, der mit einer Lampe ausgerüstet war. Er kannte keine Angst vor der Dunkelheit, auch nicht in gespannten Situationen, aber dieser Wald und dieser Nebel waren etwas Besonderes.
Er versuchte sich zu erinnern, wie weit er nach der Beschreibung des Wirts noch von seinem Ziel entfernt war, aber seine Erinnerung war wie weggeblasen; die Worte des Mannes schienen in keinem Zusammenhang mit seiner Umgebung zu stehen.
Langsam zog er den schmalen Revolver aus der Jackentasche und entsicherte ihn.
Die Lichtquelle war noch immer nicht zur Ruhe gekommen, tänzelte auf und ab, verschwand hinter Büschen oder Bäumen, tauchte aber immer wieder auf.
Mit sanfter Beharrlichkeit hielt sie auf ihn zu.
Sean verspürte den unwiderstehlichen Drang, sich umzudrehen und wegzulaufen, so weit und so schnell er konnte. Was oder wer auch immer da auf ihn zukam, schien genau zu wissen, wonach er suchte.
»Rowlf«, sagte ich überrascht, als ich sah, wer in der Kutsche auf uns gewartet hatte. »Wie kommst du denn hierher?«
Rowlfs breites, nicht gerade übermäßig sympathisches Gesicht verzog sich zu der Andeutung eines Lächelns.
»Wammir zu langweilisch in London, Kleener. Dacht mir, dass ihr mich vielleicht brauchen tut. Und wie ich seh, hattich recht.«
»Was meinst du damit?«, fragte ich scharf.
Ich bemerkte, wie Howard den Kopf schüttelte und dann aus dem schmalen Fenster blickte, als ginge ihn der weitere Verlauf der Unterredung nichts mehr an. Aber es gelang ihm nicht ganz, seine Nervosität zu überspielen.
»Nix«, behauptete Rowlf. »Nur so’ne Bemerkung.«
Ich wusste sehr gut, was er meinte. Meine wuchernden Bartstoppeln mussten in scharfem Kontrast zu meinem ansonsten gepflegten Äußeren stehen. Aber wie sollte ich meinen Gefährten erklären, warum ich es in den letzten Tagen krampfhaft vermieden hatte, in einen Spiegel zu sehen? Sie wussten nichts von Priscyllas Hilferuf und dem zersprungenen Spiegel, und sie wussten erst recht nichts von meiner panischen Angst, nochmals mit dem Irrsinn konfrontiert zu werden, dessen eisigen Hauch ich in jenen Augenblicken verspürt hatte.
»Du hättest dich nicht hierherbemühen sollen«, sagte ich kühl.
Es fiel mir schwer, meiner Stimme einen beiläufigen Klang zu geben. Alles in mir schrie danach, mich so schnell wie möglich auf die Suche nach Priscylla zu machen und meine Zeit nicht mit unnötigen Gesprächen zu vergeuden. Sie war in Gefahr, und jede Minute, die ich hier mit Reden vertat, war kostbar. Ich hatte eine Spur, und ich würde sie verfolgen, solange sie heiß war.
»Wie geht es dir eigentlich?«, fragte ich, um irgendetwas zu sagen.
Rowlf zuckte mit den Achseln. »Unkraut vergeht nich. Mary hat mich gut zusammgeflickt.«
Mary Winden hatte es nach dem, was in Durness geschehen war, nicht gewagt, in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Sie hatte ihre Tochter nachkommen lassen und erst einmal bei Howard Unterschlupf gefunden.
Rowlf, noch immer von den schweren Brandwunden gezeichnet, war mit Mary in London zurückgeblieben, als ich überraschend für alle plötzlich abgereist war. Howard dagegen war mir sofort gefolgt. Und jetzt hatte er noch Rowlf nachkommen lassen, wohl um mich noch besser unter Kontrolle zu haben. Es blieb mir wohl nichts anderes übrig, als vorerst gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Er durfte auf keinen Fall erfahren, warum ich wirklich hier war.
Howard zuallerletzt …
Er streckte den Kopf durch das Fenster und rief dem Kutscher einen Befehl zu. Durch den Wagen lief ein Zittern; eine Peitsche knallte, dann setzte er sich langsam in Bewegung.
»Was soll das?«, fragte ich Howard. »Ich dachte, du wolltest mit mir reden. Von einer Kutschfahrt war nicht die Rede.«
Howard nickte. »Du hast recht, Robert. Aber wie ich hörte, willst du nach Lowgreen. Du wirst wohl kaum etwas dagegen haben, wenn wir dich begleiten.« Er lächelte dünn. »Es reist sich angenehmer in Begleitung.«
Das war keine Frage, das war eine Feststellung. Natürlich hatte ich etwas dagegen, eine ganze Menge sogar, aber andererseits würde Howard noch misstrauischer werden, wenn ich es ablehnte. Und es war ein verlockendes Angebot, noch heute mit einer Kutsche weiterzukommen.
»Warum lasst ihr mich eigentlich nicht in Ruhe?«, fragte ich mürrisch.
Howard gestattete sich ein dünnes Lächeln. »Wir würden dich sehr gerne in Ruhe lassen, Robert. Aber ich dachte, du hättest schon mehr begriffen.« Er schüttelte leicht den Kopf. »Irgendetwas in dir lässt dich nicht zur Ruhe kommen, etwas, das von einer dunklen Macht gesteuert wird und deinen Geist verwirrt. Du solltest mal einen Blick in den Spiegel werfen. Du siehst erschreckend aus.«
Ich zuckte zusammen. Nicht wegen der dunklen Macht, die Howard erwähnt hatte, sondern wegen der Vorstellung, in einen Spiegel zu sehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich dort alles Mögliche sehen würde.
Nur nicht mich selbst.
»Is was?«, mischte sich Rowlf ein. »Siehst plötzlich so blass aus.«
Es kostete mich alle Kraft, den Kopf zu schütteln. Ich spürte, wie Schweiß auf meiner Stirn perlte. Trotzdem fror ich.
»Schon gut«, keuchte ich. »Es ist … nichts.«
Howard nickte. »Genau, und wegen diesem Nichts werden wir in den nächsten Tagen nicht mehr von deiner Seite weichen. Bis sich das Nichts verflüchtigt hat oder …«
Er sprach den Satz nicht zu Ende, aber ich ahnte auch so, was er hatte sagen wollen. Es war ein Kampf gegen eine noch unbestimmte Macht, den ich nur gewinnen konnte, wenn Howard mir half.
Aber ich hatte auch erlebt, wie wenig Howard gegen die Kräfte hatte ausrichten können, die uns in der Vergangenheit verfolgt hatten. Er war weder ein Hexer, noch verfügte er über magische Fähigkeiten, die er den Gewalten entgegensetzen konnte, mit denen er sich immer wieder einließ.
Und bei dem, was ich vorhatte, würde er sich höchstens gegen mich stellen.
Als wir Lowgreen erreichten, war es stockfinster. Graue, dünne Nebelfetzen trieben die Straße entlang, und ich spürte, wie die Feuchtigkeit in den Wagen kroch und sich in unseren Kleidern festzukrallen begann.
Während der Fahrt hatten wir kaum ein Wort miteinander gewechselt. Es hatte etwas Gespenstisches an sich, mit zwei Männern durch die beginnende Dunkelheit zu fahren, mit denen ich mich einerseits sehr verbunden fühlte, die ich aber andererseits fast als meine Feinde betrachtete. Die ganze Zeit über hatte ich darauf gewartet, dass Howard mich fragen würde, nach wem oder was ich eigentlich suchte. Aber entweder wusste er es bereits, oder er spürte, dass ich ihm keine Antwort geben würde.
Es war mir klar, dass er nicht zulassen würde, dass ich mit Priscylla Kontakt aufnahm. Schließlich war er es gewesen, der für ihren sicheren Gewahrsam gesorgt hatte. Er kannte meine Gefühle für sie, und er wusste auch, welche Gefahr sie für mich – und uns alle – darstellte. Aber das waren rationale Gründe. Was wusste ein Mann wie Howard von Liebe?
Die Kutsche rollte vor dem einzigen Wirtshaus im Ort aus und kam schließlich ganz zum Stillstand. Der Schlag wurde aufgerissen, und das Gesicht des Kutschers erschien in der Öffnung, rotäugig und von einer durchfahrenen Nacht gezeichnet.
»Alles schon zu Bett gegangen, Sir«, knurrte er. »Ich habe Ihnen ja gesagt, dass man um diese Zeit hier niemanden antrifft.«
»Und Sie haben mir gesagt, dass der Wirt ein entfernter Cousin von Ihnen ist«, fiel ihm Howard ins Wort. Er zog etwas aus seiner Jackentasche und drückte es dem Kutscher in die Hand. »Wenn Sie so freundlich wären, über Ihre verwandtschaftlichen Beziehungen ein Bett für uns aufzutreiben.«
»Wenn nur noch ein Strohlager frei ist, ist es aber nicht meine Schuld«, sagte der Mann halb mürrisch, halb versöhnt durch die Banknote, die ihm Howard zugesteckt hatte.
Er trat zur Seite, und ehe er sich versah, war ich bereits aus der Kutsche gesprungen und hielt auf den Eingang des Wirtshauses zu.
Howards Gehabe und seine plötzliche, völlig neue Art, mit dem Geld um sich werfen, wurde mir zusehends unerträglicher. Schließlich war ich Manns genug, allein für mein Nachtlager zu sorgen, und hatte es nicht nötig, den Mann von Welt zu spielen.
Ich stolperte über eine Schwelle, die den Gartenweg von der Straße trennte, und kämpfte einen Moment um mein Gleichgewicht. Es war eine dunkle Nacht, und der Nebel, der in zerrissenen Fetzen herantrieb, machte sie nicht gerade heller. Im Gegenteil … Vorsichtig ging ich weiter, erreichte die Eingangstür, drehte den Knopf und betrat den dunklen Schankraum.
Ein erstaunter Ausruf hinter mir verriet, dass der Kutscher mir gefolgt war.
»Komisch, dass die Tür aufsteht«, sagte der Mann und drängte sich an mir vorbei.
Einen Moment lang hörte ich ihn im Dunkeln hantieren, dann stieß er krachend gegen ein paar Stühle und begann lauthals zu fluchen.
Irgendwo über uns regte sich etwas. Ich kniff die Augen zusammen und entdeckte einen trüben Lichtschein, der hin und her zu tanzen schien. Es dauerte nicht lange, bis polternde Schritte verrieten, dass sich jemand zu uns herab bemühte. Zuerst sah ich nichts weiter als ein Stück schimmerndes Metall, das sich aber rasch als Gewehrlauf entpuppte, und dann einen älteren Rotschopf mit tief zerfurchtem Gesicht, der misstrauisch um die Ecke schielte.
»Guten Abend«, sagte ich freundlich und deutete eine knappe Verbeugung an. »Mein Name ist Craven. Haben Sie für mich und meine beiden Begleiter noch ein Zimmer frei?«
Die Augen des Rotschopfs weiteten sich, als sein Blick auf die umgestürzten Stühle fiel.
»Keine Bewegung, oder ich knall euch über den Haufen«, brummte er. »Sieht so aus, als wäre ich gerade noch rechtzeitig gekommen.«
Sein Kopf fuhr ein Stück zurück, und ich hörte, wie er nach oben schrie. »Ann! Diebespack! Hol die Nachbarn! Sie sollen Stricke mitbringen! Mit dem Gesindel hier machen wir kurzen Prozess!«
Das Flattern seines Nachthemdes unterstrich seine Worte wie das ärgerliche Flügelschlagen einer gereizten Fledermaus.
»Uns geht es in erster Linie um ein Zimmer, Sir«, sagte ich vorsichtig. »Obwohl ich Ihnen versichern darf, dass ich nichts gegen Ihre Nachbarn habe, möchte ich sie heute Abend nicht mehr unbedingt kennen lernen.«.
»Hör auf zu quatschen!«, fuhr mich der Rothaarige an. »Erst klaut ihr unser Vieh, und jetzt brecht ihr schon in unsere Häuser ein. Wer stiehlt, mordet auch. Und wer mordet, mit dem machen wir kurzen Prozess.« So, wie er die Worte aussprach, schienen sie sogar fast logisch. »Sprecht euer letztes Gebet, bevor wir euch am nächsten Baum aufknüpfen und eure Hälse langziehen …«
»Entschuldigung, Sir, dass ich Sie unterbrechen muss«, sagte ich. »Aber Ihr irrt. Wir sind Reisende, harmlose Reisende. Das ist die Wahrheit und …«
Ich schluckte und beeilte mich angesichts des Gewehrlaufs, der genau auf meinen Kopf gerichtet war, konkreter zu werden. »Sehen Sie sich doch mal das Gesicht meines Begleiters an. Na? Erkennen Sie ihn jetzt?«
Der Rothaarige funkelte mich wütend an. »Wie, zum Teufel, soll ich da unten eure Gesichter sehen, was? Aber das, was ich sehe, reicht mir. Soweit ich erkennen kann, bist du ein unrasierter Lump, und dein Kumpan ein taubstummer Gewaltmensch.«
»Aber Charles«, brachte der Kutscher schließlich hervor. Seine Stimme hatte etwas Klägliches. »Du wirst doch nicht auf dein eigen Fleisch und Blut schießen wollen?«
»Was soll der Quatsch? Ich heiße nicht Charles. Charles ist mein Zwillingsbruder.«
»Sie haben einen Zwillingsbruder, Sir?«, fragte ich schnell. »Das würde erklären …«
»Mir ist schon seit ein paar Minuten alles klar«, fauchte Charles’ Zwillingsbruder. »Ich selbst habe die Tür erst vor einer guten halben Stunde abgeschlossen, und jetzt stehen plötzlich zwei Halunken in meiner Gaststube und behaupten, harmlose Reisende zu sein.«
In diesem Moment ging der Radau los. Ein paar bewaffnete Männer stürmten durch die Hintertür in den Schankraum. Das Zimmer war mit einem Mal mit flackerndem Licht und schreienden Menschen erfüllt.
Die Nachbarn des Wirts, die seine Frau zusammengetrommelt hatte. So schnell hatte ich sie nicht erwartet. Die meisten hatten sich nur Mäntel über ihre Nachthemden geworfen, aber alle hielten Gewehre in den Händen.
Möglicherweise war Charles unter ihnen, aber ich hatte keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Ich fühlte mich unsanft ergriffen und gegen die Wand geschleudert. Bevor ich auch nur an Gegenwehr denken konnte, hatte man mir schon die Hände auf den Rücken verdreht, und irgendein Idiot zielte mit einem altertümlichen Gewehr auf mich. Ein anderer presste mir den Doppellauf seiner Schrotflinte so hart in die Seite, dass ich kaum Luft bekam, während ein dritter dicht vor meinem Gesicht mit einem Messer herumfuchtelte, als wolle er mir die Augen ausstechen.
»Schluss jetzt!«, rief jemand von der Tür her.
Howard und Rowlf standen wie hingezaubert im Eingang. Beide hielten Revolver in den Händen.
»Die Komplizen«, keuchte der rothaarige Wirt, der gerade im Begriff war, die Treppe herunterzusteigen.
Das Gewehr in seinen Händen wirkte auf einmal schäbig und unnütz, und in seinem Blick war ein Zögern, das nicht zu diesem grobschlächtigen Kerl passen wollte. Er starrte auf den Kutscher, den man gleich mir unsanft gegen die Wand geschleudert hatte.
»Albert! Du steckst mit diesen Männern unter einer Decke?«
War der Kerl so blöd, oder tat er nur so?
In diesem Moment hätte man eine Stecknadel im Raum fallen hören können. Die bleichen Gesichter der aus dem Schlaf gerissenen Männer, die uns mit ihren Gewehren bedrohten, spiegelten wachsende Verwirrung wider. Sie hatten die zwei Diebe festsetzen wollen, die seit geraumer Zeit das Dorf heimsuchten, und sahen sich nun plötzlich vier Mann gegenüber, die ihren Vorstellungen von Dieben wohl kaum entsprechen konnten.
Zwar wirkten weder Rowlf noch ich in unserem augenblicklichen Zustand besonders vertrauenswürdig, aber dass wir keine Strauchdiebe waren, ließ schon ein flüchtiger Blick auf unsere Kleidung erkennen.
Und dass der Wirt unseren Kutscher mit Namen kannte, musste sie total verwirren.
»Ich habe die Herrschaften hergefahren, Cousin«, bekannte Albert. »Die Tür war auf, und –«
»Moment, Moment«, unterbrach ihn ein mittelgroßer, breitschultriger Mann, der mit gesenktem Gewehr neben dem Hintereingang stehen geblieben war und das Geschehen schweigend verfolgt hatte. »Soll das heißen, dass du uns wegen ein paar späten Gästen aus dem Bett gerissen hast, Flenelton? Den hier …«, – er deutete auf unseren Kutscher – »… kennen wir doch alle. Ist ja schließlich nicht das erste Mal, dass er dir oder deinem arbeitsscheuen Bruder Gäste verschafft.«
Es dauerte nicht mehr lange, bis sich der ganze Irrtum aufgeklärt hatte. Wie wir ins Haus gekommen waren, blieb allerdings weiterhin ein Rätsel. Flenelton blieb dabei, dass er den Schankraum wie jeden Abend abgeschlossen hatte. Aber zumindest hielt er uns nicht mehr für Diebe.
Nachdem er seine Nachbarn grundlos aus dem Bett gejagt hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als eine Runde zu geben, und es blieb nicht bei der einen. Howard zeigte sich von der großzügigen Seite und ließ Bier auf Bier folgen. Nachdem es uns wie selten zuvor gelungen war, gleich mit unserer Ankunft die allgemeine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, tat er wohl gut daran, dieses merkwürdige Nachbarschaftsfest zu organisieren.
Die Männer in ihren Nachthemden oder hastig übergeworfenen Kleidungsstücken, die vor einem Pint Bitter hockten, zunehmend redseliger wurden und uns dennoch ab und zu einen misstrauischen Blick zuwarfen, hatten etwas Bizarres an sich. Obwohl ihre Gewehre alt waren und einige von ihnen nicht gerade kräftig wirkten, hatten sie sehr schnell reagiert.
So schnell, wie es nur Menschen tun, die sich vor einer gemeinsamen Gefahr zusammenschließen. Ich fragte mich, wovor sie wirklich Angst hatten.
Es war nicht leicht gewesen, von den mittlerweile schon reichlich angetrunkenen Männern etwas über Mr. Baltimore zu erfahren. Sein Haus am anderen Ende des Waldes wurde von den Dorfbewohnern gemieden. Mehr noch – als ich versuchte, das Gespräch behutsam in die von mir gewünschte Richtung zu lenken, spürte ich deutlich, dass sie es sogar vermieden, über ihn zu reden, und dass meine Fragen, obgleich ich mir Mühe gab, sie so beiläufig wie möglich zu stellen, ihr Misstrauen erneut wachriefen. Aber schließlich, nach einer Stunde und mehr als einer Runde Ale, die ich spendiert hatte, erhielt ich doch eine halbwegs brauchbare Wegbeschreibung.
Ich hatte mich entschlossen, mich gleich auf den Weg zu machen. Kurz bevor der allgemeine Aufbruch begann, nutzte ich einen Besuch auf der Toilette, um aus dem Fenster zu steigen und mich aus dem Dorf zu schleichen. Schon nach wenigen hundert Metern blieben die Häuser hinter mir zurück; nur die Fenster der Gaststube waren hell erleuchtet, sonst war alles stockdunkel.
Ich hatte eine Lampe mitgenommen, aber ich wagte noch nicht, sie zu entzünden. Es war nicht nötig, dass jemand auf meine nächtliche Expedition aufmerksam wurde; Howard würde mein Fehlen früh genug bemerken und die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Ich kämpfte mich einen schmalen Pfad entlang und hielt mich an der ersten Hecke, auf die ich stieß, links in Richtung Buchenhain. Der Mann, der mir halb lallend den Weg beschrieben hatte, hatte mir geraten, nicht über die Wiese zu gehen, um einen mehrere Meilen langen Umweg zu vermeiden.
Nach kaum hundert Metern erreichte ich eine mit Heidekraut bewachsene Lichtung, über der lose Nebelfetzen hingen. Ich folgte einem Pfad, der an einer Hecke parallel zum Wald vorbeilief. Erst jetzt wagte ich den Docht der Lampe zu entzünden. Bis jetzt hatte ich mich nach der Beschreibung gut zurechtgefunden, und ich hoffte, dass es so bleiben würde.
Der Wind fuhr sanft durch die Äste und erzeugte ein Geräusch, das an das leise Atmen eines großen Tieres erinnerte, und die Lampe warf tanzende Schatten auf den Nebel. Die weißen Schwaden reflektierten das Licht, und die Helligkeit blendete mich mehr, als sie mir half, meine Umgebung zu erkennen.
Die Lampe war praktisch nutzlos, und ich überlegte, ob ich sie wieder löschen sollte. Aber dann ließ ich sie doch brennen, in der Hoffnung, dass es im Wald nicht ganz so neblig sein würde.
Ich täuschte mich. Je näher ich den Bäumen kam, umso weniger sah ich. Die weißen Schwaden schienen wie mit geisterhaften Fingern nach mir zu greifen und meine Kleidung mit Feuchtigkeit zu durchtränken.
Das rhythmische Rascheln kahler Bäume und dunkler Tannen verstärkte sich. Auf und ab schwoll das Geräusch, mit der mechanischen Monotonie eines schweren Uhrpendels oder eines gigantischen, schlagenden Herzens. Ich spürte, wie mir trotz der Kälte Schweißtropfen den Rücken herunterrannen.
Auf und ab, ein unnatürliches Geräusch in der umfassenden Dunkelheit. Es vermischte sich mit meinem eigenen Herzschlag, lief eine Zeit lang synchron mit ihm und verlangsamte sich dann.
Ich hielt unwillkürlich an, hob die Lampe höher über den Bodennebel, der mich jetzt schon bis zum Bauchnabel umspülte, und versuchte mit einigen Blicken, die tanzende, weiße Schicht zu durchdringen. Aber da war nichts.
Jedenfalls nichts Fassbares.
Und doch spürte ich etwas, irgendetwas Ungeheuerliches, das in der Dunkelheit auf mich lauerte. Mein Atem beschleunigte sich, und die Hand, mit der ich die Lampe hielt, zitterte. Ich fragte mich, was ich hier überhaupt wollte.
War es wirklich nur Priscylla, die mich gerufen hatte? Oder war es eine andere, finstere Kraft, die sie nur benutzte, um mich in eine Falle zu locken?
Aber das gab keinen Sinn. Ich versuchte mich zu konzentrieren, aber immer, wenn ich den Gedanken zu fassen glaubte, verschwand er hinter einem Strom brodelnder Gefühle.
Ich keuchte, schloss die Augen, versuchte, den Schleier von meinen Gedanken zu reißen, der seit ein paar Tagen mein Denken vergiftete. Was war das, was da in meinem Inneren lauerte, bereit, hervorzubrechen und meine Umgebung mit Gewalttätigkeit zu tyrannisieren?
Warum diese plötzliche Abneigung gegen Howard und Rowlf und das Gefühl, mich von ihnen lösen zu müssen?
Meine bohrenden Fragen fanden keine Antwort, obwohl ich ahnte, dass nicht mehr viel fehlte, um die Schwelle des Begreifens zu durchbrechen. Unter meinem bewussten Denken lauerte ein tiefes, vergrabenes Wissen, zu dem ich einfach nicht vorstoßen konnte – noch nicht.
Und trotzdem versuchte ich es. Mit aller Gewalt konzentrierte ich mich. Ein dumpfer Schmerz pochte zwischen meinen Schläfen, und ich hatte das Gefühl, mein Schädel würde bersten, aber ich gab nicht auf.
Ich wollte und musste endlich Klarheit haben. Und ich spürte, dass ich Erfolg hatte. Etwas trat an die Oberfläche meines Bewusstseins, ein vager Gedanke, den ich nur zu greifen brauchte, den ich nur weiterverfolgen musste, um alles zu verstehen.
Es hatte etwas mit Andara, meinem Vater, zu tun, aber auch mit Priscylla und mit mir selbst, und es war …
Nichts.
Wieder riss der Faden ab, das beinahe greifbare Verständnis entglitt mir erneut.
Ich atmete tief ein und versuchte die Angst abzuschütteln, die ich vor dem hatte, was in mir lauerte. Es war sinnlos und gefährlich, mich auf metaphysische Gedankenspielereien einzulassen. Ich versuchte mich gewaltsam gegen den Druck zu stemmen, der meinen Schädel auseinander zu sprengen schien.
Es war die plötzlich greifbare Erinnerung an Priscylla, an die Gefahr, in der wir beide schwebten und die wir meistern mussten, um zueinander zu finden, die mir die nötige Kraft gab, die Lähmung abzuschütteln und die Augen zu öffnen.
Der Nebel tanzte mit verspielter Bosheit auf mich zu, griff mit dünnen, faserigen Händen nach mir, die mich wie die Tentakel eines Ungeheuers mit sich zu ziehen versuchten.
Trotz der Feuchtigkeit fühlte sich meine Kehle ausgetrocknet an. Ich atmete mehrere Male tief durch und bewegte mich langsam auf den Waldrand zu.
Was auch immer dort drinnen auf mich wartete, würde nicht eher ruhen, bis ich kam.
Jedes Weglaufen war sinnlos, das spürte ich einfach.
Unter meinen Füßen raschelte feuchtes Laub. Ich konnte es nicht sehen, aber selbst durch die schweren Stiefel spürte ich den elastischen, federnden Belag, der sich wie ein gigantisches Netz über den Boden spannte.
Der Nebel war in den letzten Minuten immer höher gestiegen, aber jetzt schien er sich zurückzuziehen. Er strömte zu beiden Seiten davon, langsam, aber mit der Zielstrebigkeit eines eigenständig denkenden Wesens.
Das Licht meiner Lampe fiel auf einen schmalen Pfad, der sich vor mir auftat und irgendwo in der Dunkelheit verschwand, zu einem Teil des schwarzen Waldes wurde und mit ihm verschmolz. Während auf dem Pfad selbst nur noch wenige Nebelfetzen trieben, verschwammen die Bäume zu beiden Seiten hinter einem dichten, weißen Schleier.
Ich warf einen Blick nach oben. Selbst der Himmel war jetzt mit Nebel verhangen. Nur der Pfad war frei, ein schmaler Tunnel, der sich durch den Nebel wand und direkt zu dem Etwas führte, das auf mich wartete. Es war wie eine Einladung; mehr noch: Es war ein Befehl, dem sich zu widersetzen sinnlos war.
Ich zögerte nicht mehr länger. An Priscylla dachte ich in diesem Moment kaum noch, obwohl mich der Gedanke an sie hierhergetrieben hatte. Stattdessen konzentrierte ich mich vollständig auf meine Umgebung, versuchte aus den Augenwinkeln beide Waldränder gleichzeitig unter Kontrolle zu halten, ohne mich von dem Pfad vor mir ablenken zu lassen, was natürlich nicht gelang.
Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Die Geräusche aus meiner Umgebung wurden von der feuchten, mit tausend feinen Wassertropfen gesättigten Luft gedämpft, aber auch ohne es zu hören spürte ich, dass etwas auf mich zuhielt. Etwas Unsichtbares, Böses.
Und dann sah ich es.
Ein dunkler, mächtiger Schatten, den ich aus der Ferne für einen Baum gehalten hätte, hätte er nicht mitten auf dem Pfad gestanden. Der Schein meiner Lampe reichte nicht weit genug, um mich Einzelheiten erkennen zu lassen. Ich erkannte nur, dass dieses Etwas groß war.
Groß genug, um ein Shoggote sein zu können.
Ich blieb abrupt stehen. Mein Herz hämmerte bis zum Hals, und einen Moment musste ich gegen den Impuls ankämpfen, herumzuwirbeln und wegzulaufen. Mühsam bezwang ich meine Angst, starrte dem Ungeheuer entgegen und konzentrierte mich auf die bevorstehende Auseinandersetzung.
Der Angriff erfolgte ohne Vorwarnung. Etwas raste auf mich zu, eine Wolke dunkel zusammengeballter Ausdünstungen, der stinkende Odem einer vorzeitlichen Bestie.
Ich riss den Arm hoch, zu spät und zu langsam, um den Wirbel aufzufangen, der mich mit der geballten Kraft grausamen Zornes zurücktaumeln ließ. Die Lampe schwankte wild im Kreis, beschrieb, meiner Hand entrissen, wirre Muster in den Nebel und schlug krachend auf dem Boden auf. Das Karbid dampfte auf, grelle Lichtfinger griffen nach mir, und dann war vollkommene Dunkelheit um mich.
Ich blieb wie erstarrt stehen. Das Fremde, das mich wie eine tosende Brandung umspülte, war nicht materiell, wie ich zuerst geglaubt hatte.
Albtraumhafte Zwerge und Hexen tanzten den Pfad entlang, brachen aus dem Nebel hervor und überschütteten mich mit ihrem Spott. Sie wirkten nicht stofflich und auf grausame Weise doch real, wie Kobolde in einem Gemälde, die auf mysteriöse Weise zum Leben erwacht waren, aus dem Rahmen sprangen und den fassungslosen Betrachter mit ihrer plötzlichen Lebendigkeit in Schrecken versetzten.
Kleine, drollige Kerle mit Pudelmützen auf gehörnten Köpfen trieben heran, dürre hexenartige Wesen drängten sie beiseite, zu wirklich, um nur Phantasiegeschöpfe sein zu können. Das waren keine vom Nebel geschaffenen Trugbilder, das war grausame, lähmende Wirklichkeit.
Ein seltsames Geschöpf, halb Ratte, halb Frau, deutete mit ihrem klauenhaften Zeigefinger auf mich und verzog das Gesicht zu einer abstoßenden Grimasse. Die Rattenschnauze, die listigen, heimtückischen Augen und der schlanke, mädchenhafte Körper, der in den Sprunggelenken einer menschengroßen Ratte auslief, bildeten eine abscheuliche Mischung. Ich wich Schritt für Schritt zurück, ohne meinen Blick von der Kreatur wenden zu können.
Die feuchten Ausläufer des Nebels umklammerten meine Beine, krochen meinen Körper empor und erstickten mein Denken. Ich spürte fast panische Angst in mir, aber ein Teil meines Geistes blieb von dem Grauen unberührt und beobachtete die laufende Veränderung der Rattenfrau mit geradezu wissenschaftlicher Neugier.
Ihr Körper überzog sich langsam mit dichtem, borstigem Fell, und die Finger wurden zu Klauen. Die Wesen, die sie umtanzten, waren nicht mehr als Kobolde, Geschöpfe reiner Phantasie.
Ich beachtete sie nicht. Ich starrte nur auf die Rattenfrau. In ihrem Blick lag kalte, tierische Entschlossenheit, aber da war auch noch etwas anderes. Etwas Bekanntes, etwas, das ich in dem Spiegel gesehen hatte, bevor er barst, und zuvor in Lyssas Augen, in den Augen der Hexe, die zeitweise Macht über Priscylla gewonnen hatte.





























