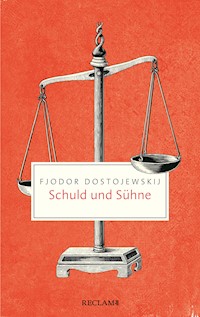12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fjodor M. Dostojewskij, Werkausgabe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. »Dostojewskij ist eine hervorragende Lektüre, wenn nicht jetzt, dann in einer nicht allzu fernen Zukunft, wenn man … ihn rein literarisch auffassen und damit zum ersten Mal überhaupt richtig lesen und verstehen wird.« (Ossip Mandelstam, 1922)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1319
Ähnliche
Fjodor Dostojewskij
Der Idiot
Roman
Aus dem Russischen von Swetlana Geier
FISCHER E-Books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Inhalt
Erster Teil
I
ENDE November, bei Tauwetter, gegen neun Uhr morgens, näherte sich ein Zug der Petersburg–Warschauer-Eisenbahnlinie mit Volldampf Petersburg. Es war so feucht und neblig, daß es nur zögernd hell wurde; aus den Waggonfenstern ließ sich auf zehn Schritt rechts und links vom Bahndamm kaum etwas erkennen. Ein Teil der Reisenden kehrte aus dem Ausland zurück; aber am stärksten besetzt waren die Abteile dritter Klasse, und zwar durchweg von kleinen Leuten und Geschäftsreisenden, die nicht von sehr weit her kamen. Alle waren, verständlicherweise, müde, alle hatten nach dieser Nacht schwere Lider, alle fröstelten, alle Gesichter waren blaßgelb von der Farbe des Nebels draußen.
In einem der Waggons dritter Klasse fanden sich, als es zu tagen begann, zwei Reisende einander gegenüber, beide auf den Fensterplätzen – beide jung, beide so gut wie ohne Gepäck, beide nicht gerade elegant gekleidet, beide mit ziemlich bemerkenswerten Gesichtern und beide mit dem Wunsch, endlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn beide gewußt hätten, was an ihnen in diesem Augenblick bemerkenswert war, dann hätten sie sich natürlich gewundert, daß der Zufall sie sonderbarerweise in denselben Waggon dritter Klasse der Petersburg–Warschauer-Eisenbahnlinie einander gegenüber gesetzt hatte. Der eine war gerade noch mittelgroß, etwa siebenundzwanzig, mit krausem, beinahe schwarzem Haar und kleinen grauen, jedoch feurigen Augen. Seine Nase war breit und platt, er hatte hohe Backenknochen und schmale Lippen, die sich unentwegt zu einem dreisten, spöttischen und sogar boshaften Lächeln verzogen; aber seine Stirn war hoch, wohlgeformt und hielt der unedel entwickelten unteren Gesichtspartie die Waage. Besonders auffallend an diesem Gesicht war seine tödliche Blässe, die der ganzen Physiognomie des jungen Mannes etwas Ausgezehrtes verlieh, ungeachtet seines ziemlich kräftigen Körperbaus, gleichzeitig aber auch etwas Leidenschaftliches, gequält Leidenschaftliches, das mit dem unverschämten, rohen Lächeln und dem scharfen, überheblichen Blick keineswegs harmonierte. Er trug einen warmen, weit geschnittenen schwarzen Tuchmantel, der mit Lammfell gefüttert war, und hatte die Nacht über nicht gefroren, während sein Gegenüber alle Wonnen einer feuchten russischen Novembernacht, mit der er offensichtlich nicht gerechnet hatte, auf seine durchfrorenen Schultern hatte nehmen müssen. Er war in einen ziemlich weiten, ärmellosen und dicken Mantel mit riesiger Kapuze gehüllt, wie sie oft von Reisenden im Winter getragen werden, irgendwo im fernen Ausland, in der Schweiz zum Beispiel oder in Norditalien, wo man nicht mit solchen Entfernungen rechnen muß wie der von Eydtkuhnen bis Petersburg. Aber das, was in Italien passend war und vollkommen genügte, erwies sich nur bedingt passend in Rußland. Der Besitzer des Kapuzenmantels war ein junger Mann von ebenfalls sechs- oder siebenundzwanzig Jahren, etwas mehr als mittelgroß, mit hellblondem, dichtem Haar, eingefallenen Wangen und einem leichten, spitzen, fast völlig weißen Bärtchen. Seine Augen waren groß, blau und aufmerksam; ihr Blick war sanft, aber auch schwer, mit jenem merkwürdigen Ausdruck, an dem manche Menschen sofort den Epileptiker erkennen. Das Gesicht des jungen Mannes war angenehm, feingeschnitten, schmal und trocken, aber farblos und im Augenblick sogar blau vor Kälte. Auf seinen Knien schaukelte ein dürftiges Bündel, in einen alten, verblichenen Foulard eingeschlagen, offenbar sein einziges Gepäckstück. An den Füßen trug er Schuhe mit dicken Sohlen und Gamaschen – alles nicht nach russischer Art. Der schwarzhaarige Nachbar im gedeckten Lammpelz betrachtete dies alles eingehend, zum Teil aus Langeweile, und fragte schließlich mit jenem ungenierten Lächeln, in dem mitunter das rücksichtslose und herablassende Behagen angesichts des Mißgeschicks des Nächsten zum Ausdruck kommt:
»Kalt?«
Und er hob die Schultern.
»Sehr«, antwortete der Nachbar außerordentlich bereitwillig, »und dabei haben wir auch noch Tauwetter. Wie wäre es erst bei Frost; ich hatte nicht gedacht, daß es bei uns so kalt ist. Ich wußte es nicht mehr.«
»Sie kommen aus dem Ausland? Oder?«
»Ja, aus der Schweiz.«
»P-f-f-f-f, da hat es Sie aber weit verschlagen! …«
Der Schwarzhaarige stieß einen kurzen Pfiff aus und lachte laut.
Die Unterhaltung kam in Gang. Die Bereitwilligkeit des blonden jungen Mannes im Schweizer Mantel, auf sämtliche Fragen seines dunklen Nachbarn einzugehen, war erstaunlich und völlig arglos, obwohl manche herablassend, deplaziert und müßig waren. Unter anderem ließ sich seinen Antworten entnehmen, daß er in der Tat lange Zeit außerhalb Rußlands verbracht hatte, über vier Jahre, und daß er krankheitshalber ins Ausland geschickt worden war; es hatte sich um ein eigentümliches Nervenleiden gehandelt, ähnlich der Epilepsie oder dem Veitstanz, begleitet von Muskelzuckungen und Krämpfen. Der Dunkle grinste mehrmals beim Zuhören; und er lachte laut, als auf seine Frage: »Haben die’s kuriert?« der Blonde antwortete: »Nein, sie haben es nicht kuriert.«
»He! Hat Sie bestimmt ’ne Menge Geld gekostet! Für nichts und wieder nichts, aber wir glauben ja denen da drüben«, bemerkte der Dunkle gehässig.
»Wahr und wahrhaftig!« mischte sich ein Mitreisender ins Gespräch, der neben ihm saß und ein in seinem Amt verkrusteter subalterner Beamter sein mochte, schlecht gekleidet, etwa vierzig Jahre alt, von kräftiger Statur, mit roter Nase und einem Gesicht voller Mitesser. »Wahr und wahrhaftig, die ziehen nur für nichts und wieder nichts alle russische Kraft zu sich herüber.«
»Oh, in meinem Fall irren Sie sich aber«, widersprach der Patient aus der Schweiz mit sanfter und versöhnlicher Stimme. »Freilich, ich kann Ihnen nicht widersprechen, denn ich weiß nicht alles, aber mein Arzt hat mir von seinem eigenen Geld auch diese Reise bezahlt und hatte mich vorher beinahe zwei Jahre dort auf seine Kosten leben lassen.«
»Wieso, gab’s denn keinen, der für Sie zahlte?« fragte der Dunkle.
»Nein, Herr Pawlistschew, der für meinen Unterhalt aufkam, ist vor zwei Jahren gestorben. Ich habe dann hierher geschrieben, an die Generalin Jepantschina, meine entfernte Verwandte, aber keine Antwort erhalten. Und so komme ich hierher.«
»Hierher? Wohin denn?«
»Sie meinen, wo ich absteige? … Ich weiß es noch nicht, wirklich … Ich …«
»Sie wissen’s noch nich’?«
Darauf brachen beide Zuhörer von neuem in Lachen aus.
»Und in diesem Bündel is’ wohl Ihr ganzes Hab und Gut?« fragte der Dunkle.
»Wetten, daß es so ist«, fiel der rotnasige Beamte mit höchst zufriedener Miene ein, »und daß die Gepäckwagen keine weiteren Koffer mitführen, obwohl Armut keine Schande ist, was nicht unbemerkt bleiben darf.«
Es erwies sich, daß es sich wirklich so verhielt: Der blonde junge Mann hatte es ungewöhnlich eilig, es zu bestätigen.
»Trotz und alledem kommt Ihrem Bündelchen eine gewisse Bedeutung zu«, fuhr der Beamte fort, nachdem beide sich satt gelacht hatten (bemerkenswerterweise hatte auch der Besitzer des Bündelchens bei ihrem Anblick schließlich in das Lachen eingestimmt, was ihre Heiterkeit noch erhöhte), »auch, wenn man wetten kann, daß es weder Gold noch ausländische Rollen mit Napoléons d’or, noch Friedrichs d’or oder gar holländische Dukaten enthält, worauf schon allein Ihre Gamaschen schließen lassen, die Ihre ausländischen Schuhe umhüllen, aber … wenn man zu Ihrem Bündelchen eine solche Verwandte wie etwa die Generalin Jepantschina hinzuaddieren könnte, dann würde auch diesem Bündelchen eine andere Bedeutung zukommen, vorausgesetzt, daß die Generalin Jepantschina in der Tat Ihre Verwandte ist und Sie keinem Irrtum erlegen sind, etwa aus Zerstreutheit … was einem Menschen sehr, sehr leicht passieren kann, aus … sagen wir … aus … einem Übermaß an Phantasie.«
»O ja, Sie haben es wieder getroffen«, beeilte sich der blonde junge Mann zu bestätigen, »ich bin in der Tat fast so gut wie einem Irrtum erlegen, das heißt, sie ist fast keine Verwandte von mir; so wenig sogar, daß ich damals keineswegs erstaunt war, daß man mir nicht dorthin zurückschrieb. Ich hatte es nicht anders erwartet.«
»Sie haben das Geld für das Porto umsonst ausgegeben. Hm! … Jedenfalls sind Sie gutherzig und aufrichtig, und solches ist lobenswert. Hm! … General Jepantschin ist uns wohlbekannt, schon deshalb, weil er eine allgemein bekannte Persönlichkeit ist; und der selige Herr Pawlistschew, der für Ihren Unterhalt in der Schweiz aufgekommen ist, ebenfalls, das heißt, wenn es sich um Nikolaj Andrejewitsch Pawlistschew handelt, es gab nämlich zwei Vettern dieses Namens. Der andere lebt heute noch auf der Krim, und Nikolaj Andrejewitsch, der Verstorbene, war ein angesehener Mann mit Beziehungen und besaß seinerzeit viertausend Seelen …«
»Ganz richtig, er hieß Nikolaj Andrejewitsch Pawlistschew«, sagte der junge Mann und sah den Herrn Allwissend aufmerksam und interessiert an.
Solchen Herren Allwissend begegnet man gelegentlich, und gar nicht einmal so selten, in einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Sie wissen alles, und ihre ganze unruhige Wißbegier und ihre Fähigkeiten bewegen sich unaufhaltsam in einer einzigen Richtung, freilich in Ermangelung bedeutender Lebensinteressen und Anschauungen, wie ein moderner Denker sagen würde. Unter den Worten ›sie wissen alles‹ ist eine allerdings recht eng begrenzte Sphäre zu verstehen: bei welchem Amt dieser oder jener beschäftigt ist, mit wem er verkehrt, wie groß sein Vermögen ist, wo er Gouverneur war, mit welcher Geborenen er verheiratet ist, wie hoch die Mitgift seiner Gattin war, wer sein Cousin, wer sein Cousin zweiten Grades ist und so weiter, und so weiter, alles dieser Art. Meistenteils laufen diese Herren Allwissend mit durchgescheuerten Ärmeln herum und beziehen ein Gehalt von siebzehn Rubeln monatlich. Die Menschen, über die sie bis zum Schwarzen unter dem Nagel unterrichtet sind, könnten es sich nie erklären, welches Interesse sie leitet, während für viele von ihnen selbst ihr Wissen, das einer ganzen Wissenschaft gleichkommt, ein wirkliches Vergnügen bedeutet und ihnen ein Gefühl des eigenen Wertes, ja, sogar eine höhere geistige Genugtuung verschafft. Und es ist eine in der Tat verführerische Wissenschaft. Mir sind Gelehrte, Literaten, Dichter und Politiker begegnet, die in dieser Wissenschaft ihre tiefste Erfüllung und ihre Ziele gesucht, gefunden und sogar einzig dank ihr Karriere gemacht haben.
Während der ganzen Unterhaltung gähnte der dunkle junge Mann, starrte ziellos aus dem Fenster und wartete ungeduldig auf das Ende der Reise. Er war irgendwie zerstreut, irgendwie ganz besonders zerstreut, fast wie von einer Unruhe getrieben, mitunter wirkte er sonderbar: Bald hörte er zu, ohne zu hören, bald sah er hin, ohne zu sehen, und bald lachte er, ohne es zu wissen und ohne ersichtlichen Grund.
»Gestatten Sie, mit wem habe ich die Ehre …?« fragte plötzlich der finnige Herr den blonden jungen Mann mit dem Bündelchen.
»Fürst Lew Nikolajewitsch Myschkin«, antwortete dieser augenblicklich mit größter Bereitwilligkeit.
»Fürst Myschkin? Lew Nikolajewitsch? Mir unbekannt. Sogar nie gehört«, sagte der Beamte nachdenklich, »das heißt, ich meine nicht den Familiennamen, der Name ist historisch, in Karamsins Geschichte wird man ihn finden können und müssen, sondern die Person, und auch von dem Fürstenhaus Myschkin weiß man heutzutage nichts mehr, man hört nicht einmal mehr den Namen.«
»O ja, gewiß!« Der Fürst ging sofort darauf ein. »Es gibt ja heutzutage keine Fürsten Myschkin mehr außer mir; ich bin, glaube ich, der letzte. Und was die Väter und Großväter angeht, so waren manche aus unserer Familie Freisassen. Mein Vater allerdings war bei der Armee, Second-Lieutenant, nach der Offiziersschule. Ich weiß nur nicht, wie auch die Generalin Jepantschina eine geborene Prinzessin Myschkina sein soll, ebenfalls die Letzte ihres Geschlechts …«
»He-he! Die Letzte ihres Geschlechts! He-he! Das haben Sie gut gesagt!« kicherte der Beamte.
Auch der Dunkle mußte lächeln. Der Blonde war etwas erstaunt, daß ihm ein wenn auch ziemlich dürftiges Wortspiel gelungen war.
»Stellen Sie sich vor, ich habe das gesagt, ohne mir etwas dabei zu denken«, erklärte er schließlich verwundert.
»Versteht sich, versteht sich«, stimmte der Beamte erheitert bei.
»Sagen Sie, Fürst, hab’n Sie auch Wissenschaften gelernt, dort, bei Ihrem Professor?« fragte plötzlich der Dunkle.
»Ja … Ich habe … gelernt.«
»Und ich hab’ nie gelernt, gar nix.«
»Ich ja auch nur so, nur weniges«, ergänzte der Fürst, fast entschuldigend. »Wegen meines Leidens hielt man es nicht für möglich, mich systematisch zu unterrichten.«
»Kennen Sie die Rogoschins?« fragte der Dunkle rasch.
»Nein, ich kenne sie nicht, ganz und gar nicht. Ich kenne ja in Rußland kaum jemand. Sie sind ein Rogoschin?«
»Ja, bin ich, Rogoschin Parfjon.«
»Parfjon? Doch nicht etwa einer von jenen Rogoschins?« begann der Beamte mit besonderem Nachdruck.
»Ja, genau einer von jenen«, unterbrach ihn rasch und mit rücksichtsloser Ungeduld der Dunkle, der sich übrigens kein einziges Mal an den finnigen Beamten gewendet, sondern von Anfang an nur zu dem Fürsten gesprochen hatte.
»Aber … wie geht denn das nur?« Der Beamte schien vor Staunen fast zu erstarren, und seine Augen quollen ihm geradezu aus dem Kopf, während sein ganzes Gesicht einen andächtigen und unterwürfigen, ja sogar erschrockenen Ausdruck annahm. »Doch nicht von Semjon Parfjonowitsch Rogoschin, dem erblichen Ehrenbürger, der vor einem knappen Monat verschieden ist und zwei und eine halbe Million Kapital hinterließ?«
»Un’ woher willst du wissen, daß er zwei und eine halbe Million Kapital in bar hinterließ?« fiel ihm der Dunkle ins Wort, ohne auch dieses Mal den Beamten eines Blickes zu würdigen. »Sieh mal an!« (er zwinkerte dem Fürsten zu). »Un’ was hab’n die davon, daß sie sofort um einen herumschwänzeln? Aber stimmt, mein Alter is’ tot, un’ ich komme aus Pskow ’nen Monat später so gut wie ohne Stiefel nach Hause. Weder der Lump von Bruder noch meine Mutter hab’n mir Geld oder ’ne Nachricht geschickt – nix! Bin ich vielleicht ’n Hund? Ich hab’ in Pskow ’nen ganzen Monat lang mit Wechselfieber im Bett gelegen! …«
»Und nun gilt es, auf einen Schlag ein Milliönchen und noch einiges darüber in Empfang zu nehmen, mindestens, o Gott!« Der Beamte schlug die Hände zusammen.
»Jetzt sag mir doch einer, was das den da angeht!« rief Rogoschin abermals gereizt mit einer wütenden Kopfbewegung in seine Richtung. »Denn du kriegst von mir nich’ ’ne einzige Kopeke, un’ wenn du vor mir auf den Händen läufst!«
»Mach’ ich, ich lauf’ auf den Händen!«
»Sieh mal an! Un’ ich geb’ dir nix, gar nix, kannst ruhig ’ne ganze Woche vor mir tanzen!«
»Du brauchst mir nichts zu geben! Geschieht mir recht; nichts brauchst du mir zu geben! Ich werde trotzdem tanzen. Weib und Kind werde ich verlassen, nur um vor dir zu tanzen. Gönn’s mir, gönn’s mir!«
»Pfui Teufel!« Der Dunkle spuckte aus. »Vor fünf Wochen bin ich genauso wie Sie«, er wandte sich an den Fürsten, »mit ’nem kleinen Bündel vorm Vater nach Pskow getürmt, zur Tante: un’ dort hat mich’s hitzige Fieber umgehauen, der aber is’ ohne mich gestorben. Der Schlag hat ihn getroffen. Gott hab ihn selig, aber damals fehlte nich’ viel und er hätt’ mich totgeschlagen! Sie können’s mir glauben, Fürst, bei Gott! Wär’ ich damals nich’ getürmt, hätt’ er mich bestimmt totgeschlagen.«
»Haben Sie ihn irgendwie erzürnt?« fragte der Fürst, der mit ganz besonderer Neugier den Millionär im Lammpelz betrachtete. Wenn auch eine Million und eine Erbschaft schon an und für sich etwas Beachtenswertes darstellten, so war es doch noch etwas anderes, was den Fürsten in Erstaunen versetzt und sein Interesse geweckt hatte; und auch Rogoschin war aus irgendeinem Grunde besonders viel an dem Fürsten als Gesprächspartner gelegen, obwohl eine Unterhaltung ihm eher ein mechanisches als ein moralisches Bedürfnis zu sein schien; es entsprang eher einer Zerstreutheit als einer Offenherzigkeit; eher einer Erregung, einer Unruhe, bloß um jemand vor Augen zu haben und der Zunge freien Lauf zu lassen. Er machte den Eindruck, als habe er immer noch Wechselfieber, wenigstens Schüttelfrost. Und was den Beamten betraf, so verschlang er Rogoschin mit Augen, wagte kaum zu atmen, ließ sich kein Wort entgehen und wägte jedes einzelne, als suche er einen Brillanten.
»Erzürnt? Freilich hab’ ich ihn erzürnt, und vielleicht hab’ ich’s verdient«, antwortete Rogoschin, »aber den größten Ärger machte mir der Bruder. Über unsere Mutter gibt’s nix zu sagen, sie is’ ’ne alte Frau, liest Heiligen-Leben, sitzt da, mit ihren alten Weibern, und sagt zu allem und jedem, was Bruder Senka dünkt, ja und amen. Aber warum hat er mir nie rechtzeitig einen Wink gegeben? Das durchschauen wir, meine Herrschaften! Stimmt, ich lag damals bewußtlos da, sie sagen auch, sie hätten mir ’n Telegramm geschickt. Also kommt das Telegramm bei der Tante an. Die is’ seit dreißig Jahren verwitwet und hockt von morgens bis abends mit Gottesnarren herum. ’ne richtige Nonne is’ sie nich’, aber was noch Schlimmeres. Also kriegt sie vor dem Telegramm ’nen Schrecken und läßt’s ungeöffnet aufs Polizeirevier bringen, da liegt’s bis auf den heutigen Tag. Konew, Wasilij Wasilijwitsch, war der einzige, der zu mir hielt, der hat mir alles im Brief geschrieben. Von dem Leichentuch aus Brokat, das auf Vaters Sarg lag, hat mein Bruder nachts die massiven Quasten abgeschnitten, reines Gold: ›Die kosten ’nen Haufen Geld.‹ Schon dafür könnt’ er, wenn ich will, nach Sibirien kommen, denn das is’ so was wie Kirchenschändung! He, du Vogelscheuche!« wandte er sich an den Beamten. »Was sagt das Gesetz; is’ das Kirchenschändung?«
»Kirchenschändung, jawohl, Kirchenschändung!« bejahte der Beamte eilfertig.
»Un’ dafür kommt man nach Sibirien?«
»Nach Sibirien, jawohl, nach Sibirien! Umgehend nach Sibirien!«
»Die glauben immer noch, daß ich krank bin«, fuhr Rogoschin fort, sich an den Fürsten wendend, »aber ich stieg heimlich, ohne ’n Wort zu verlieren, in die Eisenbahn und komm’ nun angefahren: Mach die Türen auf, Bruder Semjon Semjonowitsch! Der hat mich beim seligen Vater schlechtgemacht, das weiß ich. Aber daß ich unsern Vater damals Nastassja Filippownas wegen in Rage gebracht habe, das stimmt. Das war ich selbst. Der Böse hat mich verleitet.«
»Wegen Nastassja Filippowna?« wiederholte der Beamte servil, während er zu überlegen schien.
»Die kennste doch nich’«, fuhr ihn Rogoschin ungeduldig an.
»Die kenn’ ich doch«, trumpfte der Beamte auf.
»Von wegen! Gibt viele Nastassja Filippownas auf der Welt! Du bist ’ne gemeine Kreatur, das will ich dir sagen! Hab’ doch gewußt, daß so ’ne Kreatur sich sofort an mich hängt!« fuhr er fort, sich wieder an den Fürsten wendend.
»Aber vielleicht kenne ich sie doch, mein Herr!« Der Beamte gab sich nicht geschlagen. »Lebedjew kennt sie! Und Euer Erlaucht gefällt es, mich zu schelten, wie aber, wenn ich es beweisen kann? Und wenn sie dieselbe Nastassja Filippowna ist, um derentwillen Ihr Vater Sie mit dem Krückstock belehrt hat, dann ist diese Nastassja Filippowna eine Baraschkowa, eine, wenn man so sagen will, sogar hochherrschaftliche Dame, in ihrer Art auch eine Prinzeß und hat Umgang mit einem gewissen Tozkij, Afanassij Iwanowitsch, ausschließlich mit ihm, einem Gutsbesitzer und ganz großen Kapitalisten, Mitglied verschiedener Compagnien und Gesellschaften, und aus diesem Grunde enge Beziehungen zu General Jepantschin unterhaltend …«
»Aha, so einer bist du!« Rogoschin war nun wirklich verblüfft. »Hol’s der Teufel, er kennt sie tatsächlich.«
»Er kennt alle! Lebedjew weiß alles! Ich bin, Euer Durchlaucht, zwei Monate lang mit Lichatschow, Alexaschka, herumgezogen, ebenfalls nach dem Ableben des Vaters, und kenne alle Winkel und alle Schliche, und ohne Lebedjew ging es schließlich überhaupt nicht mehr, so weit war es gekommen. Heute weilt er im Schuldturm, aber damals nutzte er die Gelegenheit, Armance und Coralie und die Fürstin Pazkaja und Nastassja Filippowna kennenzulernen, und auch sonst ließ er sich keine Gelegenheit entgehen, manches kennenzulernen.«
»Nastassja Filippowna? Hat sie was mit Lichatschow …?« Rogoschin sah ihn grimmig an, sogar seine Lippen wurden weiß und begannen zu zittern.
»N-nichts! N-n-n-ichts! Rein gar nichts!« beteuerte der Beamte hastig, »mit seinem ganzen Geld konnte Lichatschow nicht zum Ziel kommen! Nein, die ist etwas ganz anderes als die Armance. Da gibt es nur den Tozkij. Und abends sitzt sie im Großen Theater oder im Französischen in der eigenen Loge. Da können die Offiziere untereinander reden, was sie wollen, aber nicht einmal die können etwas beweisen: ›Da sitzt ja diese bewußte Nastassja Filippowna‹, das ist alles; und weiter – nichts! Denn es gibt auch weiter nichts.«
»Stimmt alles haargenau«, bestätigte Rogoschin mit finster gerunzelter Stirn. »Saljoschew hat mir damals dasselbe gesagt. Ich lief damals in Vaters Pekesche über den Newskij, die Pekesche hatt’ ich vor gut drei Jahren von ihm geerbt, da kommt sie aus ’nem Laden und steigt in ihre Equipage. Da traf’s mich wie ein Blitz. Un’ dann begegne ich Saljoschew, der ist ’ne ganz andere Sorte als ich, der sieht aus wie ’n Frisörgehilfe, trägt Monokel, wir aber hatten vom Vater aus Schmierstiefel an un’ mußten Fasten-Stschi löffeln. Die da, sagt er, is’ nix für dich – die is’ ’ne Fürstin, un’ heißen tut sie Nastassja Filippowna, mit Familiennamen Baraschkowa, un’ sie lebt mit Tozkij, un’ Tozkij weiß nich’ mehr, wie er sie loskriegen soll, denn inzwischen is’ er in die Jahre gekommen, fünfundfünfzig, un’ will die erste Schönheit von ganz Petersburg heiraten. Un’ weiter hör’ ich von ihm, du kannst Nastassja Filippowna heute noch im Bolschoj sehen, im Ballett, in ihrer Loge, in einer Penoire. Bei uns daheim, beim Vater, da sollt’ einer mal wagen, ins Ballett zu gehen – da gab’s nur eins – halb totschlagen! Ich renn’ trotzdem heimlich für ’ne Stunde hin und seh’ Nastassja Filippowna wieder; die ganze Nacht lag ich wach. Am Morgen gibt mir der Vater, Gott hab ihn selig, zwei fünfprozentige Papiere, fünftausend Rubel jedes, ich soll, sagt er, also hingehen un’ sie verkaufen, siebentausendfünfhundert zu Andrejew ins Kontor bringen und einzahlen, und den Rest von den Zehntausend ohne Umwege dem Vater abliefern: ›Ich wart’ auf dich.‹ Ich verkaufte die Papiere, steckte das Geld ein, ging aber nich’ zu Andrejew ins Kontor, sondern schnurstracks in den Englischen Laden un’ suchte dort ein Paar Ohrringe aus, in jedem einen Brillanten, beinahe wie ’ne Haselnuß, vierhundert Rubel bin ich schuldig geblieben, sagte meinen Namen und kriegte Kredit. Mit den Ohrringen zu Saljoschew: So un’ so, Freund, laß uns zu Nastassja Filippowna gehen. Wir machten uns auf den Weg. Was damals unter meinen Füßen war, was vor mir, was links und rechts – nix weiß ich mehr und kann mich an nix mehr erinnern. Traten einfach bei ihr in den Salon ein, sie erschien. Ich gab mich damals sozusagen nich’ zu erkennen, daß ich’s bin; sondern ›von Parfjon Rogoschin‹, sagte Saljoschew, ›für Sie als Erinnerung an die Begegnung von gestern; haben Sie die Güte, dies anzunehmen.‹ Sie machte auf, guckte, lächelte: ›Überbringen Sie Ihrem Freund Herrn Rogoschin meinen Dank für seine liebenswürdige Aufmerksamkeit‹, verneigte sich und ging. Warum bin ich damals nich’ auf der Stelle tot umgefallen! Bin ja nur hingegangen, weil ich dachte: ›Egal, lebend überstehst du’s nich’!‹ Schlimmer als alles andere war mir damals, daß dieses Rindvieh Saljoschew sich in den Vordergrund gespielt hat. Bin nich’ groß, angezogen wie ein Knecht, stehe da, schweige, starr’ sie an, genier’ mich, aber er is’ nach der letzten Mode, Pomade im Haar, gebrannte Locken, rote Backen, karierte Krawatte – scharwenzelt, ein Kratzfuß nach dem anderen, bestimmt hält sie ihn für mich! ›Also,‹ sag ich, kaum daß wir draußen sind, ›daß du mir jetzt auch nich’ mal irgendwas zu denken wagst, verstanden?!‹ Der lacht: ›Aber wie willst du jetzt mit Semjon Parfjonytsch abrechnen?‹ Ich wollt’, ehrlich, damals sofort ins Wasser gehen statt nach Hause, dacht’ aber: ›Jetzt is’ doch alles egal!‹ un’ ging wie ’n Verdammter heim …«
»Au!« Der Beamte hatte immer wieder das Gesicht verzogen und sogar geschaudert. »Dabei konnte der Selige nicht erst wegen zehntausend, sondern wegen eines bloßen Zehners Menschen ins Jenseits befördern«, erklärte er dem Fürsten. Der Fürst beobachtete Rogoschin interessiert; in diesem Augenblick schien dieser noch bleicher.
»Ins Jenseits befördern!« äffte Rogoschin nach, »was willst du schon wissen! Der hatte«, wandte er sich wieder an den Fürsten, »schon alles gehört, un’ auch Saljoschew schwatzte davon mit jedem, der ihm über den Weg lief. Mein Vater schloß sich mit mir oben ein un’ belehrte mich ’ne ganze Stunde lang. ›Das is’ erst der Vorgeschmack. Ich komme später noch mal, um dir Gute Nacht zu sagen.‹ Und was glaubste wohl? Fuhr der doch mit seinem weißen Haar zu Nastassja Filippowna, verneigte sich vor ihr bis zur Erde, beschwor sie un’ greinte; schließlich brachte sie ihm das Kästchen und warf’s ihm vor die Füße: ›Hier, du alter Geizhals, deine Ohrringe! Jetzt sind sie mir zehnmal so teuer, da Parfjon Semjonytsch sie trotz solcher Gefahr erstanden hat. Grüß ihn‹, sagte sie, ›und richt ihm meinen Dank aus.‹ Nun, und ich hab’ mir währenddessen mit Mutters Segen zwanzig Rubel geliehen von Serjoschka Protuschin, un’ bin mit der Eisenbahn nach Pskow, aber als ich dort ankam, hatt’ ich das Fieber; die alten Weiber beteten über mir, un’ ich sitze da, wie betrunken, un’ dann zog ich mit meinem letzten Geld durch die Kneipen und lag besinnungslos die ganze Nacht auf der Straße, gegen Morgen hatt’ ich das Wechselfieber, un’ nachts haben mich auch noch die Hunde angenagt, bin kaum hochgekommen.«
»Ja, ja, jetzt wird Nastassja Filippowna uns ein anderes Liedchen singen«, kicherte händereibend der Beamte, »was sind jetzt schon Ohrringe! Jetzt werden die Ohrringe so vergütet, daß …«
»… daß ich dich mit dem Stock, bei Gott, durchprügle, wenn du ein einziges Wort von Nastassja Filippowna sagst, merk’s dir, ob du mit Lichatschow rumgezogen bist oder nich’!« fuhr ihn Rogoschin an und packte ihn fest am Arm.
»Wenn du mich prügelst, heißt das, daß du mich nicht davonjagst! Du kannst mich ruhig prügeln! Geprügelt ist besiegelt … Und jetzt sind wir da!«
Der Zug fuhr tatsächlich in den Bahnhof ein. Obwohl Rogoschin gesagt hatte, er wäre heimlich abgereist, wurde er schon von mehreren Personen erwartet. Sie riefen und schwenkten ihre Mützen.
»Sieh mal an, der Saljoschew is’ auch dabei!« murmelte Rogoschin, indem er sie mit einem triumphierenden, sogar irgendwie hämischen Lächeln musterte, und drehte sich plötzlich nach dem Fürsten um. »Ich weiß nich’, warum ich dich gern hab’. Vielleicht, weil ich dir in so ’nem Augenblick begegnet bin. Aber dem da« (er wies auf Lebedjew) »bin ich auch begegnet un’ hab’ ihn doch nich’ gern. Du mußt zu mir kommen, Fürst. Wir woll’n dir diese komischen Gamaschen ausziehen, un’ ich werd’ dir ’nen Marderpelz kaufen, den allerbesten; dann lass’ ich dir den allerbesten Frack schneidern un’ ’ne Weste, ’ne weiße, oder sonst ’ne nach deinem Geschmack, dann stopf’ ich dir die Taschen voll mit Scheinen, un’ dann … machen wir ’nen Besuch bei Nastassja Filippowna. Kommste oder nich’?«
»Merken Sie auf, Fürst Lew Nikolajewitsch!« ließ sich Lebedjew eindringlich und feierlich vernehmen. »Lassen Sie sich solches nicht entgehen! Lassen Sie es sich nicht entgehen! …«
Fürst Myschkin erhob sich kurz von seinem Platz, bot Rogoschin höflich die Hand und sagte liebenswürdig:
»Es wird mir das größte Vergnügen sein, zu kommen, und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, daß Sie mich gern haben. Vielleicht werde ich sogar heute schon kommen, falls meine Zeit es erlaubt. Weil Sie mir, ich gestehe es aufrichtig, ebenfalls sehr gefallen haben, ganz besonders, als Sie von den Brillantohrringen erzählten. Sie haben mir sogar vor den Ohrringen schon gefallen, obwohl Ihr Gesicht düster ist. Ich danke gleichfalls für die versprochenen Kleider und den Pelz, denn ich werde in der Tat sehr bald andere Kleidung und einen Pelz benötigen. Geld aber habe ich augenblicklich so gut wie keines.«
»An Geld soll’s nich’ fehlen, gegen Abend is’ es da, komm nur!«
»Soll’s nicht fehlen, soll’s nicht fehlen!« fiel der Beamte ein. »Gegen Abend, noch vor Sonnenuntergang!«
»Un’ sind Sie ’n Liebhaber vom weiblichen Geschlecht, Fürst? Sagen Sie’s gleich!«
»Ich, n-n-nein! Ich bin ja … Sie wissen es vielleicht nicht, ich kenne bei meiner angeborenen Krankheit die Frauen sogar überhaupt nicht.«
»Nun, wenn’s so is’!« rief Rogoschin aus, »dann biste ja ganz und gar ’n Gottesnarr, und solche wie dich hat Gott der Herr lieb!«
»Solche hat Gott der Herr lieb!« wiederholte der Beamte.
»Und du kommst mit, du Tintenklexer«, sagte Rogoschin zu Lebedjew, und sie stiegen zusammen aus.
Lebedjew hatte sein Ziel erreicht. Es dauerte nicht lange, und die ganze lärmende Gesellschaft setzte sich in Richtung des Wosnesenskij-Prospekts in Bewegung. Der Fürst mußte in die Litejnaja. Es war feucht und regnerisch; der Fürst erkundigte sich bei Passanten nach dem Weg – bis zu seinem Ziel hätte er drei Werst zurücklegen müssen, und so beschloß er, eine Droschke zu nehmen.
II
GENERAL Jepantschin wohnte im eigenen Haus, in der Nähe der Litejnaja, in der Richtung der Kirche Christi Verklärung. Außer diesem ausgezeichneten, zu fünf Sechsteln vermieteten Haus besaß General Jepantschin ein weiteres, riesiges Haus in der Sadowaja, das ebenfalls außerordentlich einträglich war. Außer diesen beiden Häusern nannte er einen sehr gewinnbringenden und bedeutenden Landbesitz unmittelbar vor den Toren Petersburgs sein eigen; im Bezirk von Petersburg gehörte ihm eine Fabrik. Früher einmal hatte sich der General, wie allgemein bekannt war, an der Branntweinpacht beteiligt. Inzwischen jedoch war er Aktionär einiger solider Compagnien geworden, auf dessen Stimme gehört wurde. Er galt als ein Mann mit großem Vermögen, großem Wirkungskreis und großen Konnexionen. An manchen Stellen hatte er es verstanden, sich absolut unentbehrlich zu machen, unter anderem auch in seinem Amt. Indes war ebenso wohlbekannt, daß Iwan Fjodorowitsch Jepantschin ein Mann von geringer Bildung und der Sohn eines einfachen Soldaten war; letzterer Umstand hätte ihm zweifellos nur zur Ehre gereichen können, aber der General, sonst ein kluger Kopf, hatte seine kleinen, durchaus verzeihlichen Schwächen und reagierte empfindlich auf gewisse Anspielungen. Aber ein kluger Kopf und geschickt war er zweifellos. Er befleißigte sich zum Beispiel mit System einer besonderen Zurückhaltung, trat gegebenenfalls völlig in den Hintergrund und wurde von vielen gerade wegen seines unkomplizierten Wesens geschätzt, insbesondere deshalb, weil er immer seinen Platz kannte. Hätten diese Richter doch nur geahnt, was im Herzen Iwan Fjodorowitschs, der angeblich so gut seinen Platz kannte, manchmal vorging! Obwohl er wirklich ein Praktiker war, über Lebenserfahrung verfügte und gewisse, durchaus bemerkenswerte Fähigkeiten besaß, zog er es dennoch vor, eher als Ausführender einer fremden Idee aufzutreten denn als ein eigenwilliger Kopf, als »ehrliche Haut«, als »ergeben, ohne zu schmeicheln« und sogar – man geht eben mit der Zeit – als ein echter, herzlicher Russe. Was das letztere angeht, erzählte man sich sogar einige amüsante Anekdoten; aber der General gab sich nie geschlagen, nicht einmal bei den amüsantesten Anekdoten; außerdem hatte er immer Glück, sogar beim Kartenspiel – und er spielte außerordentlich hoch, wobei er sogar absichtlich kein Hehl aus dieser kleinen scheinbaren Schwäche machte, die ihm bei manchen Gelegenheiten so entscheidend zustatten kam, vielmehr frönte er ihr gleichsam mit Nachdruck. Die Menschen, mit denen er verkehrte, waren zwar recht verschieden, aber in jedem Fall, wie sich von selbst versteht, lauter »Asse«. Aber alles lag noch vor ihm, die Zeit drängte nicht, die Zeit drängte überhaupt nicht, alles würde im rechten Augenblick und bei rechter Gelegenheit eintreten. Zumal General Jepantschin, was das Alter anging, noch, wie man so sagt, in vollem Saft stand, das heißt, er war sechsundfünfzig, kein bißchen älter, was in jedem Fall ein blühendes Alter genannt werden kann, in dem das wirkliche Leben recht eigentlich erst beginnt. Gesundheit, frisches Aussehen, kräftige, wenn auch schwarze Zähne, stämmige, korpulente Figur, ein besorgter Gesichtsausdruck vormittags im Dienst, ein heiterer abends am Kartentisch oder bei Seiner Erlaucht – all das förderte die gegenwärtigen und künftigen Erfolge und streute Rosen auf den Lebensweg Seiner Exzellenz.
Den General umgab eine blühende Familie. Freilich gab es da nicht nur Rosen, sondern auch manches andere, worauf sich schon seit geraumer Zeit die größten Hoffnungen und Absichten seiner Exzellenz mit zunehmendem Ernst und Hingabe konzentrierten. Was sonst, welche Absichten könnten bedeutender und heiliger genannt werden als die elterlichen? Wo könnte man Anker werfen, wenn nicht in der Familie? Die Familie des Generals bestand aus seiner Gattin und drei erwachsenen Töchtern. Geheiratet hatte der General schon vor sehr langer Zeit, noch im Range eines Leutnants, und zwar eine junge, fast gleichaltrige Dame, die sich weder durch besondere Schönheit noch durch Bildung auszeichnete und nur fünfzig Seelen in die Ehe mitbrachte – welche allerdings die Grundlage seiner späteren Fortune werden sollten. Aber der General haderte in der Folge nicht mit seinem Schicksal wegen der frühen Ehe, tat sie niemals als eine Verwirrung der unüberlegten Jugend ab und achtete seine Gemahlin so hoch und fürchtete sie bisweilen so sehr, daß er sie sogar liebte. Die Generalin entstammte dem fürstlichen Haus der Myschkins, einem zwar nicht besonders glanzvollen, dafür aber sehr alten Geschlecht, und tat sich auf ihre Herkunft nicht wenig zugute. Eine der damals einflußreichen Persönlichkeiten, einer von jenen Protektoren, denen das Protegieren keinerlei Unkosten verursacht, hatte sich bereitgefunden, der Heirat der jungen Prinzeß ein gewisses Interesse entgegenzubringen. Er öffnete dem jungen Offizier ein Türchen und wies ihm den Weg; dieser aber bedurfte nicht einmal eines Anstoßes, ihm genügte schon ein einziger Blick – er wäre nicht vergeblich gewesen! Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hatten die Ehegatten während der vielen Jahre in Eintracht gelebt. Bereits in ihrer Jugend war es der Generalin gelungen, als Prinzeß von Geblüt und Letzte ihres Geschlechts, vielleicht auch dank ihrer persönlichen Eigenschaften, einige sehr hochgestellte Gönnerinnen zu finden. Später, als ihr Gatte zu Geld und Ansehen gekommen war, fühlte sie sich in diesem höchsten Kreise sogar einigermaßen heimisch.
In diesen letzten Jahren waren alle drei Generalstöchter – Alexandra, Adelaida und Aglaja – herangewachsen und herangereift. Alle drei freilich nur geborene Jepantschins, aber mütterlicherseits aus fürstlichem Geschlecht, mit einer nicht unbedeutenden Mitgift und einem Vater, der vielleicht auf einen sehr hohen Posten prätendierte – und alle drei sahen sie, was ebenfalls nicht ganz unwesentlich ist, bemerkenswert gut aus, die Älteste, Alexandra, die bereits die Fünfundzwanzig überschritten hatte, nicht ausgenommen. Die Mittlere war dreiundzwanzig und die Jüngste, Aglaja, gerade zwanzig Jahre alt. Diese Jüngste war sogar eine wirkliche Schönheit und begann in der Gesellschaft allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber auch das war noch nicht alles: Alle drei zeichneten sich durch ihre Bildung, ihren Verstand und ihre Talente aus. Es war bekannt, daß sie mit ganz besonderer Liebe aneinander hingen und zueinander hielten. Man sprach sogar von gewissen Opfern der beiden Älteren zugunsten des Abgotts der ganzen Familie – der Jüngsten. In Gesellschaft vermieden sie es nicht nur, sich aufzuspielen, sondern gaben sich sogar auffallend bescheiden. Niemand konnte ihnen Hochmut oder Dünkel vorwerfen, indes war bekannt, daß sie stolz und sich ihres Wertes bewußt waren. Die Älteste widmete sich der Musik, die Mittlere war eine vorzügliche Malerin; aber jahrelang hatte fast niemand etwas davon gewußt, erst in der allerletzten Zeit war es bekanntgeworden, und auch nur rein zufällig. Mit einem Wort, es wurde von ihnen außergewöhnlich viel Lobenswertes erzählt. Aber es gab auch Mißgünstige. Es wurde mit Entsetzen davon gesprochen, wie viele Bücher sie gelesen hätten. Mit dem Heiraten hatten sie es nicht eilig, auf einen bestimmten gesellschaftlichen Umgang legten sie zwar Wert, aber mit Maßen. Das war um so bemerkenswerter, als alle die Absichten, den Charakter, die Ziele und Wünsche ihres Vaters kannten.
Es war bereits elf Uhr, als der Fürst an der Wohnungstür des Generals läutete. Der General bewohnte den zweiten Stock und war betont prunklos, wenn auch seiner Stellung angemessen eingerichtet. Ein Diener in Livree öffnete, und der Fürst mußte ziemlich lange mit ihm verhandeln, weil dieser Mann nach einem Blick auf ihn und sein Bündel mißtrauisch geworden war. Endlich, nach wiederholter, ausdrücklicher Versicherung, er sei in der Tat ein Fürst Myschkin und müsse den General unbedingt in einer dringenden Angelegenheit sprechen, geleitete der immer noch befremdete Diener ihn weiter, in einen kleinen Vorraum, der zu dem Empfangszimmer vor dem Kabinett führte, und übergab ihn der Obhut eines zweiten Dieners, der sich vormittags in diesem Vorzimmer aufzuhalten und dem General die Besucher zu melden hatte. Dieser zweite Diener trug einen Frack, mochte die Vierzig überschritten haben, und seine besorgte Miene ließ darauf schließen, daß er, der spezielle Kabinetts- und Meldediener Seiner Exzellenz, sich seiner besonderen Würde bewußt war.
»Bitte warten Sie im Empfangszimmer. Das Bündelchen können Sie hier ablegen«, sagte er, indem er sich würdevoll und ohne Eile in seinem Sessel niederließ und mit strenger Verwunderung den Fürsten betrachtete, der, das Bündel immer noch in der Hand, direkt neben ihm auf einem Stuhl Platz genommen hatte.
»Wenn Sie gestatten«, sagte der Fürst, »würde ich lieber hier warten, bei Ihnen, was soll ich dort ganz allein?«
»Das Vorzimmer ist für Sie nicht angemessen, denn Sie sind ein Besucher, das heißt, ein Gast. Möchten Sie zum General persönlich?«
Der Diener konnte sich offenbar mit der Vorstellung nicht abfinden, diesen Besucher anmelden zu müssen, und beschloß, sich noch einmal zu vergewissern.
»Ja, ich habe ein Anliegen, das …«, begann der Fürst.
»Ich frage Sie nicht nach Ihrem Anliegen – meine Pflicht ist, Sie nur anzumelden, und ohne den Sekretär kann ich Sie nicht anmelden, wie schon gesagt.«
Das Mißtrauen des Mannes schien zuzunehmen; der Fürst paßte kaum in die Kategorie der üblichen Besucher, und obwohl der General ziemlich oft, beinahe täglich, zur festgesetzten Stunde, vorwiegend geschäftlich die unterschiedlichsten Besucher zu empfangen pflegte und der Kammerdiener allerlei gewohnt und im Besitz recht umfassender Instruktionen war, fühlte er sich nun ausgesprochen ratlos; ohne Befürwortung des Sekretärs durfte er diesen Besucher nicht anmelden.
»Sind Sie denn wirklich … aus dem Ausland gekommen?« fragte er schließlich fast unwillkürlich – und stockte; er hatte wahrscheinlich fragen wollen: “Sind Sie denn wirklich ein Fürst Myschkin?”
»Ja, ich komme direkt von der Bahn. Ich glaube, Sie wollten mich fragen: Sind Sie denn wirklich ein Fürst Myschkin? Aber Sie haben es aus Höflichkeit nicht gesagt.«
»Hm! …«, räusperte sich der verblüffte Diener.
»Ich versichere Ihnen, daß ich Sie nicht belüge und daß Sie meinetwegen keinen Ärger haben werden. Und über meinen Aufzug und das Bündel braucht man sich nicht zu wundern; im Augenblick sind meine Verhältnisse nicht gerade glänzend.«
»Hm. Ich fürchte etwas anderes, wissen Sie. Es ist meine Pflicht, Sie anzumelden, und dann holt Sie hier der Sekretär ab, wenn man Sie … Das ist es ja eben, dieses ›wenn man Sie …‹ Sie haben doch nicht etwa vor, den General um eine Unterstützung zu bitten, wenn ich das fragen darf?«
»O nein, da können Sie ganz ohne Sorge sein. Ich habe ein anderes Anliegen.«
»Sie müssen schon entschuldigen, ich habe es ja nur so gefragt, Ihrem Aussehen nach. Warten Sie, bis der Sekretär kommt; beim General ist jetzt der Oberst, dann kommt auch der Sekretär … der von der Compagnie.«
»Nun, da ich länger warten muß, möchte ich Sie fragen, ob ich hier nicht irgendwo rauchen darf? Pfeife und Tabak habe ich bei mir.«
»Rauchen?« Der Kammerdiener riß mit verächtlichem Staunen die Augen auf, als traute er seinen Ohren nicht. »Rauchen? Nein, hier darf man nicht rauchen, und außerdem sollten Sie sich schämen, auch nur einen Gedanken darauf zu verschwenden. Hm! … Komisch!«
»Oh, ich habe doch nicht an dieses Zimmer gedacht; so etwas weiß ich doch; ich wäre hinausgegangen, wohin Sie mich gewiesen hätten, denn ich bin sehr daran gewöhnt und habe seit gut drei Stunden nicht mehr geraucht. Aber das macht nichts, wie Sie meinen, wissen Sie, nach dem Sprichwort: Im fremden Kloster …«
»Aber wie kann ich jemanden wie Sie anmelden?« murmelte der Kammerdiener beinahe fassungslos. »Erstens sollten Sie sich überhaupt nicht hier aufhalten, sondern im Empfangszimmer Platz nehmen, denn Sie gelten als Besucher, also als Gast, und ich werde Rede und Antwort stehen müssen … Und wie ist es, haben Sie die Absicht, bei uns abzusteigen?« fragte er und schielte abermals nach dem Bündel des Fürsten, das ihm offenbar keine Ruhe ließ.
»Nein, das habe ich nicht vor. Ich werde nicht bleiben, sogar wenn man mich dazu auffordern sollte. Ich bin nur gekommen, damit wir uns kennenlernen, das ist alles.«
»Wie? Kennenlernen?« fragte der Kammerdiener verblüfft und dreifach mißtrauisch. »Aber wieso sagten Sie vorhin, Sie hätten ein Anliegen?«
»Ach, das ist fast gar kein Anliegen! Das heißt, es gibt da ein Anliegen, und ich will nur um Rat fragen, aber eigentlich wollte ich mich nur vorstellen, das ist der Hauptgrund, weil ich ein Fürst Myschkin bin und die Generalin Jepantschina gleichfalls die letzte Prinzeß Myschkin ist, und außer uns beiden gibt es keine Myschkins mehr.«
»Dann sind Sie auch noch ein Verwandter?« Der inzwischen fast endgültig erschreckte Diener fuhr in die Höhe.
»Auch das trifft kaum zu. Freilich, wenn man es großzügig nimmt, sind wir verwandt, aber so entfernt, daß man es eigentlich kaum gelten lassen kann. Ich hatte einmal aus dem Ausland an die Generalin geschrieben, aber sie hat mir nicht geantwortet. Ich habe dennoch beschlossen, nach meiner Rückkehr in Verbindung mit ihr zu treten. Ich erkläre Ihnen das so genau, damit Sie nicht länger zweifeln, weil ich sehe, daß Sie sich noch immer Sorgen machen: Melden Sie den Fürsten Myschkin, schon aus der Anmeldung ist der Grund meines Besuches zu erkennen. Werde ich empfangen – gut, werde ich nicht empfangen – auch gut, vielleicht sogar sehr gut. Aber es ist doch wohl ausgeschlossen, daß sie mich nicht empfangen: Die Generalin wird natürlich wünschen, den ältesten und einzigen Nachfahren ihres Geschlechts zu sehen, sie legt großen Wert auf ihre Abstammung, wie ich gehört habe.«
Es schien, als wäre alles, was der Fürst sagte, ganz einfach; aber je einfacher es schien, desto absurder klang es bei dieser Gelegenheit, und der erfahrene Kammerdiener konnte nicht umhin, etwas zu empfinden, was von Mensch zu Mensch durchaus schicklich, aber zwischen einem Besucher und einem Domestiken völlig unschicklich ist. Und da die Domestiken in der Regel wesentlich klüger sind, als ihre Herrschaften es von ihnen annehmen, befand auch dieser Kammerdiener, daß hier mit zwei Möglichkeiten zu rechnen sei: Entweder ist der Fürst ein Herumtreiber und gekommen, um zu betteln, oder er ist einfach ein Narr ohne alle Ambitionen, denn ein gescheiter Fürst mit Ambitionen würde niemals im Vorzimmer sitzen und vor einem Lakaien die eigenen Bewandtnisse ausbreiten, wonach zu befürchten stand, daß man sich in beiden Fällen zu rechtfertigen hätte.
»Sie möchten sich aber trotzdem in das Empfangszimmer bemühen«, bemerkte er mit denkbar größtem Nachdruck.
»Aber wenn ich dort gesessen hätte, dann hätte ich Ihnen ja nichts erklären können.« Der Fürst lachte vergnügt. »Folglich wären Sie beim Anblick meines Mantels und meines Bündels immer noch besorgt. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr auf den Sekretär zu warten, Sie gehen hinein und melden mich selbst.«
»Nein, einen solchen Besucher wie Sie darf ich ohne den Sekretär nicht melden. Und außerdem haben Exzellenz persönlich uns vorhin befohlen, Exzellenz unter keinen Umständen zu inkommodieren, solange der Oberst dort ist, Gawrila Ardalionytsch aber darf jetzt eintreten.«
»Ein Beamter?«
»Gawrila Ardalionytsch? Er hat eine Stellung bei der Compagnie. Legen Sie wenigstens Ihr Bündel hier ab.«
»Ich habe schon daran gedacht, wenn Sie erlauben. Wissen Sie, könnte ich nicht auch den Mantel ablegen?«
»Selbstverständlich, Sie können doch nicht im Mantel bei Exzellenz eintreten.«
Der Fürst stand auf, legte schnell seinen Mantel ab und stand nun in einem durchaus ansehnlichen und gut geschnittenen, wenn auch schon abgetragenen Rock da. Über der Weste hing eine Stahlkette. Zu dieser Kette gehörte, wie sich später herausstellte, eine silberne Genfer Uhr.
Auch wenn der Fürst ein Narr war (das stand für ihn bereits fest), so schien es dem Kammerdiener des Generals schließlich doch ungehörig, das Gespräch mit dem Besucher weiter fortzusetzen, obwohl ihm der Fürst aus irgendeinem Grund gefiel, natürlich auf seine Art. Andererseits jedoch erregte er seinen entschiedenen und unverhohlenen Unwillen.
»Und wann empfängt die Generalin?« fragte der Fürst, indem er sich wieder auf seinen alten Platz setzte.
»Das ist nun nicht mein Bereich. Ganz verschieden, je nach Person. Die Modistin wird schon um elf vorgelassen. Gawrila Ardalionytsch wird gleichfalls früher als die anderen vorgelassen. Sogar schon zum ersten Frühstück wird er vorgelassen.«
»Hier, bei Ihnen, ist es in den Zimmern wärmer als im Ausland während der Wintermonate«, bemerkte der Fürst. »Dort ist es draußen wärmer als bei uns, aber in den Häusern ist es im Winter so, daß ein Russe, der nicht daran gewöhnt ist, es nicht aushalten kann.«
»Heizen die denn nicht?«
»Doch, aber die Häuser sind anders gebaut, das heißt, die Öfen und die Fenster.«
»Hm! Und sind Sie dort lange gereist?«
»Ganze vier Jahre. Allerdings bin ich fast die ganze Zeit im selben Ort geblieben, auf dem Lande.«
»Sie haben wohl vergessen, wie es bei uns ist?«
»Auch das ist wahr. Wissen Sie, ich wundere mich selber, daß ich das Russische nicht verlernt habe. Ich unterhalte mich jetzt mit Ihnen und denke dabei im stillen: ›Aber ich spreche ja gut‹ – vielleicht spreche ich deshalb so viel. Wirklich, seit gestern möchte ich nichts anderes, als immerzu russisch sprechen.«
»Hm, hm. Haben Sie früher Gelegenheit gehabt, in Petersburg zu wohnen?« (Wie sehr sich der Lakai auch beherrschte, es ging doch über seine Kraft, eine derart höfliche und umgängliche Unterhaltung abzubrechen.)
»In Petersburg? So gut wie überhaupt nicht, nur auf der Durchreise. Ich habe mich früher hier gar nicht ausgekannt, und jetzt soll es ja, wie man hört, so viel Neues geben, daß man sagt, auch jene, die sich hier ausgekannt haben, müßten umlernen. Jetzt soll hier viel von den Gerichten die Rede sein.«
»Hm! … Von den Gerichten. Gerichte, das ist wahr, sind eben Gerichte. Und wie ist es dort, geht es in den Gerichten gerechter zu oder nicht?«
»Das weiß ich nicht. Ich habe viel Gutes über die unseren gehört. Bei uns gibt es ja auch keine Todesstrafe.«
»Und dort gibt’s Hinrichtungen?«
»Ja. Ich habe es in Frankreich gesehen, in Lyon. Schneider hatte mich mitgenommen.«
»Gehängt?«
»Nein, in Frankreich wird nur geköpft.«
»Und wie ist das, schreit der?«
»Woher! Es ist ein einziger Augenblick. Sie legen den Menschen hin, und schon fällt so ein breites Messer herab, in einer Maschine, sie nennen sie Guillotine, es ist schwer und stark … Der Kopf springt ganz schnell weg, einfach in einem Nu. Die Vorbereitungen sind qualvoll. Wenn das Urteil verlesen wird, wenn die Arme gefesselt werden und es auf das Schafott hinaufgeht, das ist entsetzlich! Das Volk läuft zusammen, sogar Frauen, obwohl es dort nicht gern gesehen wird, wenn Frauen zuschauen.«
»Ist auch nicht ihre Sache.«
»Natürlich! Natürlich! Diese Qual! … Der Verbrecher war ein kluger Mann, furchtlos, stark, nicht mehr ganz jung, er hieß Legros. Und nun will ich Ihnen sagen, Sie mögen mir glauben oder nicht, als er auf das Schafott stieg – da weinte er und war weiß wie ein Blatt Papier. Ist so etwas möglich? Ist so etwas nicht grauenhaft? Wer wird schon vor Angst weinen? Ich hätte nie gedacht, daß man vor Angst weinen kann, und zwar nicht als Kind, sondern als ein Mann, der noch nie geweint hat, ein Mann von fünfundvierzig Jahren. Was geschieht in diesem Augenblick mit seiner Seele, was tut man ihr an? Die Seele wird verhöhnt, das ist es! Es steht geschrieben: ›Du sollst nicht töten‹, darf man denn jemanden, weil er getötet hat, gleichfalls töten? Nein, das darf man nicht. Jetzt ist es einen Monat her, daß ich das gesehen habe, aber noch immer steht mir alles vor Augen. Bestimmt fünfmal habe ich davon geträumt.«
Der Fürst hatte sich sogar in Eifer geredet, eine leichte Röte zeigte sich auf seinem blassen Gesicht, obwohl er nach wie vor ruhig sprach. Der Kammerdiener hatte ihm mit teilnahmsvollem Interesse zugehört, als könne er nicht genug bekommen; vielleicht war er auch ein Mensch mit Vorstellungskraft, der zu denken versuchte.
»Es ist nur gut, daß die Qual kurz ist«, bemerkte er, »wenn der Kopf wegfliegt.«
»Wissen Sie was?« fiel der Fürst eifrig ein. »Sie denken daran, und genau wie Sie denken alle daran, und die Maschine ist in diesem Sinne konstruiert, die Guillotine. Mir aber kam damals sofort ein Gedanke: Wie, wenn es sogar noch schlimmer ist? Sie finden das komisch, Sie finden das unsinnig, aber bei einiger Einbildungskraft kann einem sogar dieser Gedanke kommen. Stellen Sie sich einmal vor: Zum Beispiel die Folter; also Leiden und Wunden, körperliche Pein, das alles lenkt von der seelischen Qual ab, so daß man nur seine Schmerzen und Wunden spürt, bis der Tod eintritt. Aber der eigentliche, der allerstärkste Schmerz rührt vielleicht gar nicht von den Wunden her, sondern von der Gewißheit, daß in einer Stunde, und dann in zehn Minuten, und dann in einer halben Minute, und dann jetzt, gleich – die Seele den Körper verläßt, daß man dann nicht mehr Mensch ist, und daß dies gewiß ist; die Hauptsache ist, daß es gewiß ist. Wenn man den Kopf unter das Messer legt und hört, wie es über dem Kopf saust, diese Viertelsekunde muß das Furchtbarste sein. Und wissen Sie, daß das gar nicht meine Phantasie ist, sondern daß viele dasselbe gesagt haben? Ich glaube so unerschütterlich daran, daß ich Ihnen meine Meinung offen sagen möchte. Töten für Töten ist eine Strafe, die zu dem begangenen Verbrechen in keinem Verhältnis steht. Das Töten nach einem Gerichtsurteil ist unverhältnismäßig schrecklicher als der Tod von Räuberhand. Jemand, den die Räuber töten, dem sie nachts die Kehle durchschneiden, mitten im Wald oder sonst irgendwo, hofft immer noch auf Rettung, bis zum allerletzten Augenblick. Man kennt Beispiele, daß jemand mit durchgeschnittener Kehle immer noch hofft und flieht oder um Gnade fleht. Hier aber wird diese letzte Hoffnung, mit der es sich zehnmal leichter sterben läßt, diese Hoffnung wird einem mit Gewißheit genommen; hier gibt es das Urteil, und in dieser Gewißheit, daß man ihm nicht entgehen kann, liegt die ganze entsetzliche Qual, und es gibt nichts Schrecklicheres auf der Welt als diese Qual. Nehmen Sie einen Soldaten und stellen Sie ihn während der Schlacht genau vor ein Geschütz und geben Sie Feuerbefehl, er wird immer noch hoffen, aber wenn Sie demselben Soldaten sein Todesurteil vorlesen, dann wird er den Verstand verlieren oder in Tränen ausbrechen. Wer kann behaupten, daß die menschliche Natur imstande ist, so etwas zu ertragen, ohne in Wahnsinn zu verfallen? Weshalb diese Verhöhnung, so sinnlos, überflüssig und zwecklos? Vielleicht gibt es irgendwo einen Menschen, dem man das Urteil vorgelesen, ihm die Qual gegönnt hat, um dann zu sagen: ›Du kannst gehen, du bist begnadigt.‹ Dieser Mensch könnte wohl manches erzählen. Von dieser Qual und diesem Grauen hat auch Christus gesprochen. Nein, so darf man den Menschen nicht behandeln.«
Obwohl der Kammerdiener dies alles selbst nicht hätte ausdrücken können, hatte er zwar nicht alles, aber das Wichtigste verstanden, wie sogar seine ergriffene Miene erkennen ließ.
»Wenn Sie so dringend zu rauchen wünschen, so ließe sich das wohl machen, nur möglichst schnell. Weil er plötzlich nach Ihnen fragt, und dann sind Sie nicht da. Sehen Sie, hier, unter dem Treppchen, diese Tür. Gehen Sie rein, rechter Hand ist eine Kammer, dort geht es, Sie müssen nur das Klappfenster öffnen, denn es ist gegen die Ordnung …«
Aber der Fürst fand keine Zeit mehr zu rauchen. Plötzlich trat ein junger Mann mit Papieren in der Hand in das Vorzimmer. Der Kammerdiener half ihm aus dem Pelz. Der junge Mann schielte nach dem Fürsten.
»Hier, Gawrila Ardalionytsch«, begann der Kammerdiener vertraulich, beinahe familiär, »der Herr lassen sich melden als Fürst Myschkin und Verwandter der Gnädigen, Sie sind soeben mit der Eisenbahn aus dem Ausland hier eingetroffen und haben ein Bündel als Reisegepäck, nur …«
Das weitere konnte der Fürst nicht verstehen, weil der Kammerdiener zu flüstern begann. Gawrila Ardalionytsch hörte ihn aufmerksam an und musterte den Fürsten mit großer Neugier, nach einer Weile hatte er genug gehört und trat ungeduldig auf den Fürsten zu.
»Sie sind Fürst Myschkin?« fragte er äußerst liebenswürdig und höflich. Er war ein sehr gut aussehender junger Mann, schlank und blond, ebenfalls um die Achtundzwanzig, mittelgroß, mit einem Bärtchen à la Napoléon und einem intelligenten, sehr schönen Gesicht. Nur sein Lächeln war bei aller Liebenswürdigkeit zu fein; seine Zähne bildeten eine zu gleichmäßige Perlenreihe; sein Blick, ungeachtet aller Heiterkeit und scheinbaren Offenherzigkeit, war irgendwie zu aufmerksam und prüfend. “Wenn er allein ist, hat er vermutlich einen ganz anderen Blick und lacht möglicherweise niemals”, spürte der Fürst.
Der Fürst erklärte alles, so gut es ging, beinahe Wort für Wort dasselbe, was er vorher dem Kammerdiener und noch früher Rogoschin erklärt hatte. Gawrila Ardalionytsch schien sich währenddessen an etwas zu erinnern.
»Waren Sie es etwa«, fragte er, »der vor ungefähr einem Jahr, oder sogar später, einen Brief gesandt hat, ich glaube, aus der Schweiz, an Jelisaweta Prokofjewna?«
»Jawohl.«
»Dann sind Sie hier bekannt, und man wird sich Ihrer erinnern. Sie möchten zu Seiner Exzellenz? Ich werde Sie umgehend anmelden … Er wird gleich zu sprechen sein. Sie hätten jedoch … einstweilen im Empfangszimmer warten sollen … Wieso wartet der Fürst hier?« wandte er sich streng an den Kammerdiener.
»Hab’ ich doch gesagt, der Fürst wollten es nicht anders …«
In diesem Augenblick ging plötzlich die Tür zum Kabinett auf, und ein Offizier, ein Portefeuille unter dem Arm, kam laut redend und sich verbeugend heraus.
»Bist du da, Ganja?« rief eine Stimme aus dem Kabinett. »Bitte komm rein!«
Gawrila Ardalionytsch nickte dem Fürsten zu und ging mit schnellen Schritten ins Kabinett.
Nach etwa zwei Minuten ging die Tür abermals auf, und man hörte die helle und freundliche Stimme Gawrila Ardalionytschs: »Darf ich bitten, Fürst?«
III
GENERAL Iwan Fjodorowitsch Jepantschin stand in der Mitte seines Kabinetts und betrachtete den eintretenden Fürsten mit außerordentlichem Interesse, er kam ihm sogar zwei Schritte entgegen. Der Fürst ging auf ihn zu und stellte sich vor.
»Also«, sagte darauf der General, »womit kann ich dienen?«
»Ich habe kein dringliches Anliegen; ich hatte nur die Absicht, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich möchte Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen, aber ich kenne weder Ihren jour fix noch überhaupt Ihre Gepflogenheiten … Ich komme ja direkt von der Bahn … aus der Schweiz …«
Der General wollte schon lächeln, überlegte aber und hielt inne; er überlegte weiter, kniff die Augen zusammen, musterte noch einmal seinen Besucher, und zwar von Kopf bis Fuß, deutete schnell auf einen Stuhl, nahm selbst ihm schräg gegenüber Platz und wandte sich mit ungeduldiger Erwartung dem Fürsten zu. Ganja stand in der Ecke am Pult und ordnete Papiere.
»Für Bekanntschaften habe ich im allgemeinen sehr wenig Zeit. Da Sie aber gewiß eine bestimmte Absicht haben, bitte ich …«
»Genau das habe ich geahnt«, unterbrach ihn der Fürst, »daß Sie unbedingt bei mir eine besondere Absicht vermuten werden. Aber ich habe, bei Gott, keine besondere Absicht, außer dem Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen.«
»Das Vergnügen ist natürlich auch meinerseits ein außerordentliches, aber es geht nicht immer um den Spaß, gelegentlich, wissen Sie, muß man auch etwas tun … Außerdem will es mir immer noch nicht gelingen, das uns beide Verbindende zu erkennen … den Grund, sozusagen, Ihres …«
»Einen Grund gibt es nicht, unstreitig, und natürlich auch nicht viel Verbindendes, denn der Umstand, daß ich ein Fürst Myschkin bin und Ihre Gattin unserem Geschlecht angehört, kann selbstredend kein hinlänglicher Grund sein. Das verstehe ich sehr gut. Aber dennoch dient es mir zum einzigen Anlaß. Ich bin seit gut vier Jahren nicht mehr in Rußland gewesen, sogar länger; und wie habe ich Rußland verlassen: beinahe geistesgestört! Damals wußte ich nichts, und jetzt weiß ich noch weniger. Ich bin auf gute Menschen angewiesen; ich habe sogar ein bestimmtes Anliegen, weiß aber nicht, wo ich damit anfangen soll. Noch in Berlin dachte ich: “Sie sind beinahe Verwandte, ich will bei ihnen anfangen; vielleicht haben wir einander etwas zu sagen, sie mir und ich ihnen – wenn sie gute Menschen sind.” – Und ich habe gehört, daß Sie gute Menschen sind.«
»Verbindlichsten Dank«, sagte der General verwundert. »Darf ich fragen, wo Sie abgestiegen sind?«
»Ich bin noch nirgendwo abgestiegen.«
»Sie kommen also direkt zu mir von der Bahn? Und … mit Gepäck?«
»Mein Gepäck besteht nur aus einem kleinen Bündel mit Wäsche, das ist alles; ich habe es bei mir. Ich kann ja am Abend ein Hotelzimmer nehmen.«
»Sie haben also immer noch die Absicht, ein Hotelzimmer zu nehmen?«
»O ja, freilich.«
»Ihren Worten glaubte ich entnehmen zu können, daß Sie auf mich rechneten.«
»Das wäre möglich gewesen, aber nicht ohne Ihre Einladung. Aber ich würde, muß ich gestehen, auch auf Ihre Einladung hin nicht bleiben, zwar ohne bestimmten Grund, einfach … weil es mein Charakter ist.«
»Dann trifft es sich ja ausgezeichnet, daß ich Sie nicht eingeladen habe und auch jetzt nicht einlade. Gestatten Sie, Fürst, wir wollen die Lage klären: Da wir beide soeben übereingekommen sind, daß von verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen uns kaum die Rede sein kann, obwohl ich solche, versteht sich, als schmeichelhaft empfinden würde …«
»… habe ich mich jetzt zu erheben und Adieu zu sagen?« Der Fürst erhob sich mit einem sogar fröhlichen Lachen, ungeachtet der offenkundig peinlichen Situation. »Obwohl ich praktisch weder mit den hiesigen Sitten noch mit der hiesigen Lebensweise vertraut bin, hatte ich mir unsere Begegnung genau so vorgestellt, wie sie jetzt stattgefunden hat. Nun, vielleicht mußte das so sein … Und Sie haben mir ja auch damals auf meinen Brief nicht geantwortet … So leben Sie denn wohl, und entschuldigen Sie, daß ich Sie aufgehalten habe.«
Die Augen des Fürsten blickten in diesem Moment so freundlich, sein Lächeln war so frei von jeder unterdrückten feindseligen Empfindung, daß der General plötzlich innehielt und seinen Gast plötzlich mit anderen Augen betrachtete; diese Wandlung vollzog sich in einem einzigen Augenblick.
»Wissen Sie, Fürst«, sagte er mit einer fast völlig veränderten Stimme, »ich kenne Sie eigentlich gar nicht, und auch Lisaweta Prokofjewna möchte vielleicht einen Träger ihres Namens kennenlernen … Bleiben Sie doch, wenn Ihre Zeit es erlaubt.«
»Oh, meine Zeit erlaubt es durchaus; meine Zeit steht mir völlig zur Verfügung«, (und der Fürst legte seinen weichen runden Hut sofort auf den Tisch). »Ich gestehe, daß ich darauf rechnete, Lisaweta Prokofjewna könnte sich vielleicht daran erinnern, daß ich ihr geschrieben habe. Vorhin befürchtete Ihr Kammerdiener, während ich bei ihm wartete, ich könnte Sie anbetteln; das fiel mir auf, bei Ihnen muß es für solche Fälle strenge Vorschriften geben; aber ich hatte wirklich an so etwas nicht gedacht, es war mir wirklich nur daran gelegen, Menschen kennenzulernen. Aber ich muß immer daran denken, daß ich Sie gestört habe, und das bekümmert mich.«
»Wissen Sie, Fürst«, sagte der General mit einem heiteren Lächeln, »wenn Sie in der Tat so sind, wie Sie scheinen, dann wird es ein Vergnügen sein, Sie näher kennenzulernen; nur – sehen Sie, ich habe immer viel zu tun, ich muß sofort wieder an den Schreibtisch, dies und jenes überfliegen und unterschreiben, mich dann zu Seiner Erlaucht begeben, anschließend in mein Amt, und so kommt es, daß ich, obwohl ich gern mit Menschen zusammen bin … mit guten Menschen, natürlich … übrigens bin ich so fest davon überzeugt, daß Sie ausgezeichnete Manieren haben, daß … Wie alt sind Sie, Fürst?«
»Sechsundzwanzig.«
»Ach nein! Ich hielt Sie für bedeutend jünger.«
»Ja, man sagt, ich sähe jünger aus. Ich werde lernen, Sie nicht zu stören und es mir schnell merken, weil ich selbst nicht gerne störe … Und schließlich sind wir, wie mir scheint, so verschiedene Menschen … aus verschiedenen Gründen, daß es zwischen uns möglicherweise nicht allzu viele Berührungspunkte geben kann; aber dieser letzten Idee glaube ich selbst nicht, wissen Sie, denn sehr oft scheint es nur so, daß es keine Berührungspunkte gibt, während sie durchaus vorhanden sind … Das liegt an der menschlichen Trägheit, weil die Menschen einer den anderen nach dem bloßen Augenschein sortieren und keine finden … Aber vielleicht langweile ich Sie? Ich glaube, Sie möchten …«
»Zwei Worte: Besitzen Sie ein vielleicht auch nur unbedeutendes Vermögen? Oder haben Sie die Absicht, sich eine Beschäftigung zu suchen? Verzeihung, daß ich …«
»Aber bitte, ich verstehe Ihre Frage sehr gut und weiß sie zu schätzen. Vermögen besitze ich einstweilen nicht, und eine Beschäftigung habe ich einstweilen auch nicht, obwohl es nötig wäre. Das Geld, das ich zuletzt hatte, gehörte mir nicht, Schneider hatte es mir gegeben, mein Professor, der mich in der Schweiz behandelt und unterrichtet hat, für die Reise, und zwar sehr knapp, so daß jetzt nur noch ein paar Kopeken übrig sind. Allerdings habe ich ein bestimmtes Anliegen und benötige Rat, aber …«
»Können Sie mir sagen, wie Sie einstweilen Ihren Unterhalt zu bestreiten gedenken und welches Ihre Absichten waren?« unterbrach ihn der General.
»Ich wollte irgend etwas arbeiten.«
»Aha, Sie sind ja ein Philosoph; übrigens … verfügen Sie denn über irgendwelche Fähigkeiten, Talente, auch geringe, jedenfalls solche, mit denen man sein täglich Brot verdienen kann? Entschuldigen Sie noch einmal, daß …«
»Oh, Sie haben sich nicht zu entschuldigen. Nein, ich glaube, daß ich weder Talente noch besondere Fähigkeiten habe; sogar eher im Gegenteil, denn ich bin ein kranker Mensch und habe nichts Ordentliches gelernt. Was das tägliche Brot angeht, so glaube ich …«
Der General unterbrach ihn abermals und fragte ihn