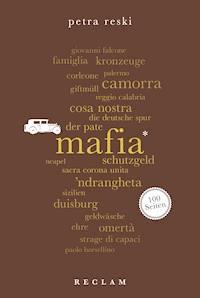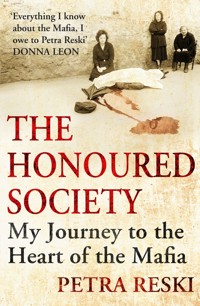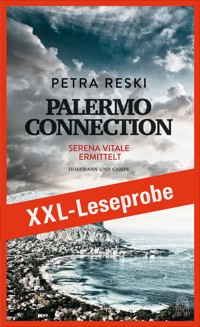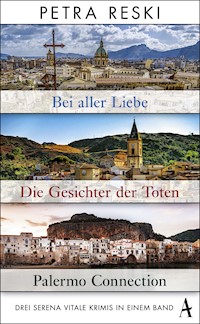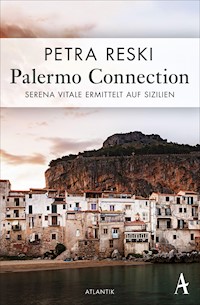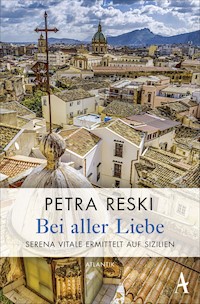7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
»Vor siebzehn Jahren ist mir in Venedig ein Italiener zugelaufen. Ich war beruflich in der Stadt und entschlossen, Venedig für überschätzt zu halten. Seitdem haben wir uns nicht mehr getrennt. Der Italiener und ich und Venedig.« In ihrem augenzwinkernden Bericht über ihr Leben an der Seite eines Italieners erzählt Petra Reski von der hohen Kunst, einen Palazzo zu renovieren – und diese Renovierung ohne ernsthafte Beziehungskrise zu überleben. Sie berichtet vom Geheimnis der italienischen Steuernummer, ohne die niemand in Italien existieren kann, nicht mal der Mafioso. Und von der italienischen Post, bei der sie sich immer noch beschwert, wenn ein Päckchen nach drei Monaten nicht angekommen ist. Du bist wirklich deutsch, sagt der Italiener dann, und es klingt schaudernd und bewundernd zugleich. Eine wundervolle Geschichte von Petra Reski über ihre Liebe zu Venedig und den Italienern an sich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Ähnliche
Petra Reski
Der Italiener an meiner Seite
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Prolog
Vor siebzehn Jahren ist mir in Venedig ein Italiener zugelaufen. Ich war beruflich in der Stadt und entschlossen, Venedig für überschätzt zu halten. Seitdem haben wir uns nicht mehr getrennt. Der Italiener und ich und Venedig.
Wenn ich Italien länger als eine Woche verlasse, bekomme ich Heimweh. Die reine Abhängigkeit. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, von einem Tag auf den anderen, ein einzigartiger Triumph der Willenskraft, aber gegen Italien bin ich machtlos. Als ich einmal mit dem Zug nach Venedig zurückfuhr und am Grenzübergang das Schild Italia sah, fragte ich mich, was ich tun würde, wenn man mich nicht mehr hineinließe. So etwas gibt es ja. Falls die Italiener auf die Idee kämen, mich abzuschieben, wüsste ich nicht, wohin ich gehen sollte. Wenn ich damals vor siebzehn Jahren geahnt hätte, wohin das führt. Da läuft dir ein Italiener zu, und bevor man sich versieht, ist man ihm verfallen.
Und jetzt hat der Italiener keinen Empfang. Der Teilnehmer habe sein Telefon entweder ausgeschaltet oder sei nicht erreichbar, verkündet eine metallische Stimme. Ich stehe auf dem kleinen Platz vor der Kirche von San Moisè, wiege mein Telefon in der Hand wie ein Stück Seife und blicke auf den Engel über dem Portal rechts, der etwas rührend Verdrossenes hat, so wie ein Kind bei einem Sonntagsausflug. Ich frage mich, ob ich ihn jemals zuvor bemerkt habe. Bis heute gibt es Momente, in denen mich Venedigs Schönheit ganz unverhofft erwischt. Wenn sich in einer Schirokko-Nacht die Lichter der Prokuratien in den Hochwasserpfützen auf dem Markusplatz spiegeln. Wenn ich nachts an der Anlegestelle von San Marco stehe und die Punta della Dogana im Mondwasser schwimmt. Wenn ich vor Sonnenaufgang durch die Lagune fahre und sich langsam der Tag in die Nachtschwärze schiebt. Und jetzt der Engel.
Warum hat der Italiener keinen Empfang? Während ich weiter Richtung Markusplatz laufe, tippe ich eine SMS: Warte auf dich im Florian. Eigentlich telefonieren wir ständig miteinander. Egal ob wir ganze Kontinente oder nur zwei Gassen voneinander entfernt sind. Egal, ob wir uns erst vor einer Stunde noch gesehen haben oder vor einer Woche. Das Mitteilungsbedürfnis des Italieners ist existenziell, meines ist das einer Konvertitin. Ich erinnere mich noch an einen Sommerabend, als wir über den Markusplatz zum Abendessen liefen. Der Italiener an meiner Seite hatte seit kurzem ein telefonino, ich nicht.
Sein telefonino war so groß, wie es heute nur noch ein Video-Satellitentelefon ist, mit dem man auch in den Bergen Afghanistans an einer Konferenzschaltung teilnehmen kann. Ich hingegen lehnte das telefonino aus ideologischen und ästhetischen Gründen ab und stellte fest: Eine Frau mit Stil lässt sich entweder durch ihren Sekretär verleugnen oder hat einen Anrufbeantworter und denkt nicht im Traum daran, jeden Anruf selbst und noch dazu in jeder Lebenslage entgegenzunehmen.
Kaum hatten wir den Markusplatz betreten, klingelte sein Telefon. Es klingelte siebenmal allein auf dem Weg vom Markusplatz bis zur Seufzerbrücke, man hätte glauben können, er sei ein Feuerwehrhauptmann, der immer und überall erreichbar sein muss, tatsächlich aber rief ihn erst der Anwalt an, dann der Zahnarzt, schließlich der Hausverwalter, der Italiener an meiner Seite sprach laut in das große schwarze Kästchen, nein, der Treppenlift muss weg! Dottore Bassi hat das bereits angekündigt!, und ich dozierte über den Erreichbarkeitswahn, dem ich auf keinen Fall erliegen wolle, aber er hörte mich nicht. Als wir die Ponte della Paglia überquerten, rief ein Anstreicher an, der schon seit einer halben Stunde vergeblich versucht hatte, ihn zu erreichen, vor den Bleikammern rief ein Freund an, der neuerdings auch ein telefonino hatte, auf der Höhe der Pietà-Kirche meldete sich der Hausverwalter noch ein zweites Mal, nein, Signora Maiorana sei unter keinen Umständen bereit, den Treppenlift wieder zu entfernen, und ich überlegte mir, wie viele Koffer ich für meine Besitztümer benötigen würde, wenn ich Venedig und ihn für immer verließe. Es kam nur deshalb nicht dazu, weil mir meine Mutter ein telefonino schenkte. Als ich es kurz danach in einem Taxi verlor, weinte ich. Und heute könnte ich ohne telefonino nicht mehr leben. Und ohne den Italiener auch nicht. Aber das würde ich ihm gegenüber nie zugeben.
1.
Es war bereits Nacht, als ich ankam, damals, vor siebzehn Jahren. Ein Wassertaxifahrer nahm mir erst meinen Koffer und später eine Summe ab, die höher war als die meines Flugtickets. Ich war nicht zu meinem Vergnügen unterwegs, sondern rein dienstlich, wegen des Filmfests, was ich mir immer wieder sagte, denn ich wollte nicht zu denjenigen gehören, die es wegen der Romantik und des Nebels nach Venedig zog. Schließlich ist nichts nahe liegender, als Venedig schön zu finden, eine Stadt, die mitten im Wasser steht. Da gehört wirklich nicht viel dazu.
Ich kam aus Palermo, wo mich der Bürgermeister damit beeindruckt hatte, mir während der Ratssitzung durch einen Ratsdiener auf einem silbernen Tablett ein Billett reichen zu lassen. Ein Billett, auf dem auf Deutsch stand: Der verlorenste Tag in deinem Leben ist der, an dem du nicht gelacht hast. Das war schwer zu übertreffen, in Venedig. Jedenfalls nicht mit einem Interview mit Lina Wertmüller. Und mit dem Auftrag, sie zu fragen, warum ihre Hauptfiguren immer Kommunisten oder Feministinnen sind.
Ich glitt durch die Finsternis und sah Paläste aus dem Wasser aufsteigen. Paläste mit weißen Spitzbögen und bemoosten, schuppigen Fundamenten. Ich sah ein Gebirgsmassiv aus Stein, von dem ich vermutete, dass es die Rialtobrücke sei, ein Höhenzug aus Marmor, an dessen Stufen das Wasser leckte. Ich sah Gondeln vorbeifahren, so erhaben und selbstverständlich wie Kardinäle, die sich im Messgewand den Weg durch eine Menschenmenge bahnen. Die Ruder der Gondoliere tauchten in das Wasser ein, das zähflüssig aussah wie Pech. Nichts als die winzigen Lichter der Gondeln leuchteten im Dunkel, und dann kam ich im Hotel Luna an, und mein Zimmer war klein wie eine Schiffskajüte.
Gleich nach meiner Ankunft ging ich in das gegenüberliegende Restaurant essen, ich musste nur die Gasse überqueren und trat in einen glitzernden Saal voller Tellergeklapper, Gesprächsfetzen und Gläserklang. Von den Jahrhunderten ermattete Spiegel hingen an den Wänden, der Marmorboden hatte ein schwarz-weißes Schachbrettmuster, und in der Mitte des Saales wölbte sich eine Kuppel, unter der ein Kronleuchter aus Muranoglas hing, funkelnd wie mit Goldstaub bedeckt. Kaum hatte ich den Saal betreten, führte mich ein birnenförmiger, sehr beflissener Kellner an den einzigen freien Platz. Ich weiß noch, dass ich Spaghetti mit Venusmuscheln bestellte und einen allein sitzenden Herrn im dunklen Jackett bemerkte, der in einem Kunstband blätterte, während er auf das Essen wartete.
Als ich am nächsten Morgen in meiner Schiffskajüte aufwachte, wunderte ich mich darüber, dass die Aussicht aus meinem Fenster immer noch die gleiche war. Ich fragte mich, wo der Lido lag und was sich dahinter überhaupt verbarg: Eine Insel? Ein Strand? Ein Stadtteil? Normalerweise bewegte ich mich in fremden Städten mit Taxis fort, ohne mir Fragen stellen zu müssen. Auf dem Nachttisch lag ein Stadtplan, der aussah wie ein Schnittmusterbogen. Ich sah Nähte, die über das Wasser verliefen, Säume und Webkanten und Quernähte, die Inseln und Plätze verbanden, nur den Lido fand ich nicht. Die Sache mit dem Wertmüller-Interview gestaltete sich komplizierter, als ich angenommen hatte. Es sah so aus, als bliebe mir nichts anderes übrig, als meinen Auftrag mit einem öffentlichen Transportmittel zu erfüllen. Ich schämte mich etwas, als ich den Portier nach dem Weg zum Lido und zum Vaporetto fragen musste, vermutlich wusste die ganze Welt, wo der Lido lag, nur ich nicht. Der Portier sagte: Einfach nur geradeaus!
Ich ging erst in die falsche Richtung, fragte dann aber einen Gondoliere, der mir die Richtung zur Vaporettostation wies. Bis ich nach Venedig kam, hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie der Transport in dieser Stadt aussehen könnte. Stadt auf dem Wasser, gut und schön, aber eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass es schon ein paar Straßen und damit Autos geben würde, schließlich könnte es sich keine Stadt auf der Welt leisten, den Verkehr auf eine so umständliche Weise wie auf dem Wasserwege zu regeln. Ich hatte geglaubt, dass man die Innenstadt zu touristischen Zwecken im Wasser stehen gelassen hätte, den Rest der Stadt aber befahrbar gemacht haben würde. Dass man in Venedig tatsächlich konsequent auf Autos verzichtet hatte, überraschte mich.
Während ich in dem schwimmenden Wartehäuschen auf das Vaporetto wartete, redete ich mir ein, dass es auch nichts anderes als eine Metrostation sei, und versuchte, mir nicht ansehen zu lassen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in Venedig war und noch nie eine Vaporettostation betreten hatte. Ich blickte vorwurfsvoll wie die Venezianerinnen auf die Uhr – schon wieder ist das Vaporetto drei Minuten zu spät! – und gab mir Mühe, ernst und beschäftigt zu schauen, als gäbe es nichts Wichtigeres als diese Drei-Minuten-Verspätung, als sei auch ich all der Widrigkeiten des venezianischen Alltags überdrüssig.
Als ich schließlich zum Lido fuhr und den Geruch der Luft einsog, fühlte ich mich verwegen. Die Welt roch nach Meer. Nach Meer und Algen und Diesel und toten Seesternen – und schon die Tatsache, dass ich allein und nur mit Hilfe eines Schnittmusterbogens die Vaporettostation sowie die richtige Verbindungslinie gefunden hatte, berauschte mich.
Das Morgenlicht in der Lagune war milchig und etwas melancholisch, es kündigte das Ende des Sommers an. Venedig schimmerte rosa, der Dogenpalast war ein Rosenquarz auf einem Meer aus Opal, das Ufer ein Geschmeide, und ich bemühte mich, mir meine Berauschtheit nicht anmerken zu lassen und ungerührt und ohne zu schwanken auf dem Vaporetto zu stehen, unmerklich mit den Beinen den Wellengang ausgleichend, so wie die Venezianerinnen, die auch keine Haltegriffe brauchten, um das Gleichgewicht zu halten. Neben mir stand eine Gruppe von italienischen Filmjournalisten, die sich über die mangelnde Organisation des Filmfestivals beschwerten, immer werde noch bis zur letzten Minute gesägt und geschraubt und getagt, sie beklagten die Schlangen vor den Kinosälen und die unmöglichen Vorführungszeiten, solo in Italia!, riefen sie, jedes Jahr sei es das Gleiche, jedes Jahr sei es so, als breche das Festival wie ein Gewitter über Venedig herein, und ich versuchte so zu tun, als führe auch ich zum zehnten Mal zu diesem Filmfest, als ermüdete mich die italienische Desorganisation genau wie sie, weshalb ich ein Gähnen unterdrücken müsse – selbst bei dem Anblick einer Stadt, die wie eine abgerissene Blüte im Wasser trieb.
An der Anlegestelle des Lidos standen echte Taxis, was mich beruhigte. Die Straßen waren Straßen und keine Gassen. Ich fuhr zum Festivalgebäude und tauchte in ein Meer von reizbaren Filmjournalisten und aufgelösten PR-Agenten ein. Ich ließ mich in Listen eintragen und füllte Formulare aus, zog Faxe hervor, die ich geschickt hatte, Gegenfaxe mit Bestätigungen, die mit anderen Bestätigungsfaxen verglichen und dann abgeheftet wurden, ich zeigte meinen Journalistenausweis vor, musste mich setzen und dann wieder hinstellen, hörte endlosen Telefonaten zu, wurde vertröstet, und schließlich hieß es, Lina Wertmüller habe schon sehr viele Interviewtermine, vielleicht später, ich solle es am Nachmittag noch mal probieren, anrufen oder noch mal vorbeikommen, vielleicht.
Und dann begegnete ich ausgerechnet dem einzigen deutschen Filmjournalisten, den ich kannte und den ich nicht leiden konnte und der so tat, als würde er mich nicht kennen. Schon von weitem hatte ich ihn an seinen dünnen Beinen erkannt, er trug einen Trenchcoat, den der Wind aufblähte, als er an mir vorbeieilte. Auch ich tat so, als würde ich ihn nicht kennen, aufgeblähte dünne Männer kenne ich grundsätzlich nicht. Das war der Moment, in dem ich beschloss, auf Lina Wertmüller, auf ihre Kommunisten und ihre Feministinnen, ja, auf das ganze Filmfest zu verzichten und einfach wieder nach Venedig zurückzufahren.
Als ich an der Anlegestelle San Marco das Vaporetto verließ, fühlte ich mich erleichtert. Ich hatte fast noch den ganzen Tag vor mir, eine unvermutete Freiheit, die in mir zunächst etwas Ratlosigkeit auslöste. Schließlich beschloss ich, mich mit einem Mittagessen zu belohnen. Ich ging langsam durch die Gassen, denn ich befürchtete bei jedem Schritt, in dem venezianischen Labyrinth verloren zu gehen. Diese Stadt war ein schwankendes, überfülltes Floß, voller Touristen, die sich ebenso unsicher wie ich durch die Gassen tasteten, Gassen, die nie verliefen, wie man es vermutete, sondern die Haken schlugen, hohnlachend im Nichts endeten und alle Himmelsrichtungen auf den Kopf stellten. Ich dachte an meine Tante Gertrud, die vor zwanzig Jahren auf der Rückfahrt von Jugoslawien in Venedig Station gemacht hatte und seitdem davon sprach, dass es in Venedig schlecht rieche. Eigentlich war es eine Stadt für Tante Gertruds und keine Stadt für mich. Eine Stadt, die man auf der Durchreise einen Nachmittag lang besucht, eine Karnevalsmaske kauft und sie wieder verlässt. Eine Stadt, in der es kein Norden gab und kein Süden, sondern nur den Markusplatz und die Rialtobrücke und die Accademia und gelbe Schilder, die in die eine Richtung wiesen, und darunter hingen weiße Schilder, die ihnen widersprachen. Alles um mich herum schwankte, die Besucher und das Marmorpflaster, der Himmel und die Schaufenster, alles drehte sich, und schon stand ich in einem Maskengeschäft und kaufte zwei Karnevalsmasken, eine mit Federn und Pailletten beklebte für mich und eine weiße Pestmaske für meine Freundin Anna, und ich glaube, dass sie darüber etwas erstaunt war, weil sie mir eine solche Schwäche nicht zugetraut hätte.
Noch heute befindet sich das Geschäft an der gleichen Stelle, unweit des Postamtes, kurz vor dem Markusplatz, die blonde Besitzerin steht heute wie damals rauchend auf der Straße, wie eine Kuppelmutter, die auf Kundschaft wartet. Damals ahnte ich nicht, dass ich mich so nah am Markusplatz befand, ein Schritt hätte genügt, und ich hätte ihn entdeckt, hinter den Säulen des Napoleonischen Flügels, doch ich irrte weiter auf der Suche nach einem geeigneten Lokal, wobei ich mich ermahnte, mich zu konzentrieren, mir alles einzuprägen, jeden Haken, jeden Winkel, jede Biegung, um später den Weg zum Hotel wiederzufinden: Bei dem Schaufenster mit den Muranoglaskronleuchtern rechts, am blaugelben Fußbodenmosaik geradeaus, das barocke Kirchenportal mit den Dromedaren halbrechts liegen lassen, die Brücke links überqueren. Nach einer schier endlosen Odyssee durch halb Venedig fand ich schließlich eine Pizzeria, die mir vertrauenswürdig erschien. Erschöpft aß ich eine Pizza Margherita und fühlte mich wie Indiana Jones nach der Durchquerung des Tals des Todes. Heute weiß ich, dass die Pizzeria nur hundert Meter vom Hotel Luna entfernt ist.
Nach dem Mittagessen wollte ich versuchen, den Markusplatz zu finden. Schließlich konnte ich die Stadt nicht verlassen, ohne ihn gesehen zu haben. Obwohl ich eigentlich lieber sitzen geblieben wäre und den Passanten zugeschaut hätte. Schon die alleinige Vorstellung, wieder auf die Suche zu gehen, mich von neuem durch dieses Labyrinth zu winden, das aller Lebenserfahrung und allen Himmelsrichtungen widersprach, ermüdete mich. Aber mein Pflichtgefühl sagte mir: Es ist die vornehmste Aufgabe eines Venedigbesuchers, den Markusplatz zu besuchen. Also zog ich den Stadtplan hervor und versuchte mir den Weg zu merken, es sah ziemlich einfach aus, ich müsste zuerst dieser breiten Gasse folgen, geradeaus über die Brücke, mich dann halblinks halten, der Gasse nach, ihren Windungen müsste ich nachgehen, die Abzweigungen nach rechts und links allerdings ignorieren, auch die Tatsache, dass die tückische Gasse an einer Stelle so tat, als ende sie, denn sie endete keineswegs, davon würde ich mich nicht verwirren lassen, schließlich würde die hinterhältige Gasse in einer etwas breiteren, aufrichtigeren Gasse enden, und mit etwas Glück verbarg sich dahinter der Markusplatz. Ich stand auf und steckte den Stadtplan ein. Um ganz sicher zu sein, fragte ich auch noch den Kellner nach dem Weg. Er sagte: Immer geradeaus.
Ich bemühte mich, zügig zu gehen wie die Venezianer. Und geschäftig wie eine Dienstreisende. Auch wenn ich meinen Dienst vorübergehend eingestellt hatte, war ich letztlich im höheren Auftrag unterwegs. Ich besuchte den Markusplatz nicht zum Vergnügen wie Millionen andere Besucher, ich besuchte ihn aus reinem Pflichtgefühl heraus. Ich besuchte ihn nur, um mir später keine Vorwürfe machen zu müssen. Als Dienstreisende blieb ich auch nicht wie die Touristen auf der Brücke stehen, um die darunter passierende Gondelpartie mit dem Funiculi-Funicula-singenden Sänger zu beklatschen, sondern lauschte nur heimlich und warf einen verstohlenen Blick auf den Kanal, ich fotografierte nicht, ich kaufte mir kein Eis, obwohl ich gerne eines gegessen hätte, ich eilte über die Brücke und betrat ein Marmorpapiergeschäft. Wobei ich den Gedanken verwarf, dass der Kauf von Marmorpapier vermutlich auch eher Touristen vorbehalten sein könnte. Ich betrat das Marmorpapiergeschäft als Dienstreisende und kaufte mir ein in Marmorpapier eingeschlagenes Adressbuch. Dann ging ich weiter auf die Suche nach dem Markusplatz. Es konnte doch nicht so schwer sein. Einfach nur geradeaus. Wichtig war nur eines: immer im Auge zu behalten, woher man kommt. Was nicht leicht war, weil der Blick immer von unzähligen anderen orientierungslosen Menschen verstellt war.
Ich fragte mich, ob es häufig geschah, dass Menschen in Venedig abhanden kamen. Männer auf der Suche nach einem Tabakladen, Frauen beim Shopping, Kinder beim Eiskaufen. Nie wieder etwas von ihnen gehört. Und dann stellte ich mir meine Vermisstenanzeige vor: Junge deutsche Frau, ca. 1,67 Meter groß, brünettes Haar. Trug am Tag ihres Verschwindens eine türkisfarbene Hose und ein schwarzes T-Shirt. Sie ist Fremden gegenüber sehr zurückhaltend. Trägt kein Halsband.
Da der Weg zum Markusplatz noch unendlich weit schien, war ich froh, auf dem Weg so etwas Vertrautes wie einen Benetton-Laden zu finden. Endlich war etwas in dieser Stadt so wie in anderen Städten. Ich warf mich in den Benetton-Laden wie eine Ertrinkende. Und kaufte einen schwarzen Wollpullover. Und dachte, dass dieser Wollpullover ein ganz besonderer schwarzer Wollpullover sei, ein Wollpullover, der mich vor dem Verschwinden gerettet hatte.
Mit der Benetton-Tüte in der einen Hand und der Marmorpapiertüte in der anderen fühlte ich mich schon etwas weniger touristisch und mehr venezianisch, denn auch die Venezianer liefen alle mit Dolce-&-Gabbana-Taschen, Versace- und Prada-Tüten herum. Ich schaute einer Frau in ihre Prada-Tüte und sah darin ein paar abgelaufene Schuhe. Die Venezianer schienen ausschließlich damit beschäftigt zu sein, in luxuriösen Einkaufstüten etwas von einem Ort zum anderen zu transportieren.
Bei dem Versuch, nicht als Touristin aufzufallen, empfand ich meine brünetten Haare von Vorteil. Wäre ich blond, dachte ich, könnte mich hier jeder als Touristin und, schlimmer noch, als Deutsche identifizieren. Einer Brünetten würde so etwas nicht passieren. Eine Brünette könnte alles sein, Französin, Belgierin, Ungarin. Dienstreisende. Eine Brünette ist praktisch unsichtbar, dachte ich.
Heute weiß ich, dass diese Vorstellung eine Illusion ist. In Venedig bleibt kein Fremder unbemerkt. Touristen erkennt man hier allein an ihrer Art, sich zu bewegen – zerstreut, kindlich, staunend. Daran denke ich, als ich den Markusplatz betrete. Es ist später Nachmittag, die Sonne lässt die Goldmosaiken der Markuskirche leuchten, und auf der Piazza stehen Tausende von Menschen, die alle glauben, unsichtbar zu sein. Sie laufen über den Platz mit riesigen, orangefarbenen Filzhüten, mit Schellenhüten und Chinesenhüten und Wikingerhüten mit Filzhörnern, sie springen in die Tauben und freuen sich, wenn die Tauben erschreckt aufflattern. Vor der Markuskirche windet sich die Schlange der wartenden Besucher bis zur Riva degli Schiavoni. Aus der Ferne wirkt die Warteschlange wie ein bunter chinesischer Drachen am Neujahrsfest.
Vor mir überqueren drei Männer die Piazza mit so steifen Schritten, als seien sie Statisten eines sehr billigen Mafiafilms: Alle drei haben schwarze Schnurrbärte, die aussehen wie angeklebt, alle drei tragen fabrikneue Borsalinos und Gürteltaschen, die sie wie ein Pistolenhalfter schräg über die Brust geschnallt haben. Und vor dem Orchester des Caffè Florian steht ein junger Mann und spielt Luftgitarre, wobei seine tief sitzende Jeans immer tiefer rutscht und seine Freundin ihn so entgeistert betrachtet, als hätte sie ihn noch nie in einem so würdelosen Zustand erlebt.
Ich mag die Piazza am Nachmittag, das Licht schmeichelt, wenn die Sonne im Westen steht, es ist ein Licht, das den Dingen Kraft verleiht, es zieht Bucklige gerade und macht Blinde sehend, es verklärt. Die Flügel der zum heiligen Markus aufschauenden Engel flirren, und im Florian beginnt die Stunde des Spritz, jenes Aperitifs, in dem die Venezianer die einzig bemerkenswerte Hinterlassenschaft der ansonsten verhassten Österreicher sehen. Kinder werden in die Kamera gehalten, Paare umarmen sich und erinnern sich jenen Bruchteil einer Sekunde lang, in dem sich die Linse öffnet, dass sie sich irgendwann geliebt haben. Es ist mehr als ein Licht, das alle festhalten, mitnehmen, in einen Bilderrahmen stecken wollen. Es ist Glück.
Ich suche im Caffè Florian nach einem freien Platz – an einem der schmalen Marmortische unter den Arkaden, auf einer der gepolsterten Bänke zwischen Terrasse und Bogengang, um nicht allzu nah beim Orchester zu sitzen. Wenn ich einen Kaffee im Florian trinke, habe ich immer das Gefühl, als sei ich auf der Suche nach einer verlorenen Zeit, nach jenem Moment, in dem ich Venedig zum ersten Mal betrat und mich fühlte, als würde der Boden unter meinen Füßen schwanken, und vielleicht tat er das auch, denn in den ersten Jahren in Venedig wurde ich auf jedem Vaporetto seekrank.
Bevor ich Platz nehme, versuche ich zu klären, in wessen Herrschaftsgebiet die Tischreihe sich befindet, in die ich mich setzen möchte. Hoffentlich in dem von Signor Claudio, dem dienstältesten Kellner des Florian, der seit vierzig Jahren wie ein beflissener Zirkusdirektor durch die Tischreihen läuft, die Haltung der Nachwuchskellner kontrollierend und verstohlen an Tischdecken zupfend, während er die Bestellungen für heiße Schokolade aufnimmt. Signor Claudio begrüßt mich jedes Mal, als hätte er mich schon lange vermisst, und knüpft freundlich an einen imaginären Gesprächsfaden an, selbst wenn es ein Jahr her ist, dass ich zuletzt bei ihm einen Kaffee getrunken habe.
Sollte ich mich jedoch weder im Reich von Signor Claudio befinden noch in dem eines anderen Kellners meines Vertrauens – dem des Narbengesichtigen vielleicht oder des dünnen Schnurrbärtigen –, dann steht mir bevor, gedemütigt zu werden: durch den Musikzuschlag, der nur Touristen auferlegt wird. Die Befreiung vom Musikzuschlag kann man nicht erwerben, nicht fordern, man kann sie nur huldvoll entgegennehmen wie einen Ritterschlag. Es ist ein Privileg aus alten Zeiten, ein Privileg, auf das man kein Anrecht hat: Als ich zum ersten Mal im Florian meinen Espresso ohne supplemento musica trinken durfte – ganz allein, ohne dass sich der Italiener an meiner Seite befunden hätte –, da fühlte ich mich, als sei ich soeben in die Ehrenlegion aufgenommen worden, als gehörte ich dazu, zu den gepuderten venezianischen Gräfinnen, die damals noch im Florian saßen, zu Signor Claudio, zu den Taubenfutterverkäufern, zum Markusplatz, zu Venedig.
Und nichts ist erniedrigender, als durch einen kleinen, langzähnigen, weißhaarigen Kellner um ein hart erkämpftes Privileg gebracht zu werden. Eines Kellners, dessen Perfidie darin besteht, auch noch in dreißig Jahren so zu tun, als sähe er mich zum allerersten Mal. Der mir den Kaffee auf dem ovalen Silbertablett serviert, mit einem kalten Lächeln, das er sich morgens anlegt wie sein Kellnerjackett, ein Lächeln, mit dem er unterschiedslos Amerikaner, Chinesen oder Pandabären bedient und mit dem er klar macht, dass es in der Welt des Florian keine Unterschiede gibt und erst recht keine Privilegien. Und wenn ich den Kassenbon hervorziehe, der aus Gründen der Diskretion unter dem Papierdeckchen versteckt ist, weiß ich, dass der Langzähnige es wieder mal geschafft hat, mich zu degradieren – suppl. musica. Jetzt nähert er sich mit kleinen engen Schritten, den Bestellblock in der Hand. Schon mache ich mich bereit, den Platz zu wechseln, aber da taucht Signor Claudio hinter einer Säule auf, um mir den Stuhl zurechtzurücken, und ich atme auf.
Sein Haar ist grau geworden, aber sein Blick ist immer noch der gleiche, prüfend blickt er über den Rand seiner Brille, wie ein Arzt, der eine Diagnose stellt. Er verordnet mir einen Kaffee, für den Anfang. Ohne Milch. Per carità. Um Gottes willen. Nur Amerikaner trinken cappuccino und latte macchiato am Nachmittag. Und dann zieht er einen piccolo herbei – durch einen kurzen, ganz kurzen Blick über die Brillengläser –, er reicht dem Hilfskellner die Bestellung und widmet sich wieder mir, was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Wie immer fragt er mich, ob ich viel gereist sei in den letzten Monaten, wobei er mit mir deutsch spricht, was ihn ganz glücklich macht. Anders als ich, die ständig in Bewegung sei, bewege er sich nicht fort von diesem Platz, auf dem er arbeite, seitdem er fuffzehn sei, sagt er, und ich frage mich, wo er auf diesem Platz das »fuffzehn« gefunden haben mag. Nun müsse er aber weiter, sich um die anderen Gäste kümmern. Schon beendet er unser kurzes Gespräch mit einer großen, weltumspannenden Geste, die auf die Piazza weist. Da ist immer etwas, das im Herzen bleibt, sagt er, wobei er klingt, als spreche er zu einer Durchreisenden. Der er die Erinnerung an die Piazza ins Gepäck stecken müsse.
Als ich mich an jenem Septembertag vor siebzehn Jahren auf den Weg zum Markusplatz machte und glaubte, unsichtbar zu sein, hatte ich auf den letzten Metern den Eindruck, in einen Feierabendverkehr geraten zu sein – so viele Menschen strömten zum Markusplatz hin und vom Markusplatz weg. Ich sah nichts als Köpfe und Leiber, und mittendrin sprach mich jemand an. Es war der beflissene, birnenförmige Kellner aus dem Restaurant, in dem ich am Vorabend gegessen hatte, der meinen Versuch, unsichtbar zu sein, zunichte machte. Er grüßte freundlich, ich grüßte freundlich, wohin des Weges, ach zum Markusplatz, tatsächlich, nein, welche Überraschung. Er wich mir nicht von der Seite und bot mir an, mich zum Markusplatz zu begleiten und einen Kaffee im Florian zu trinken. Mit einem Mal befand ich mich in einem ideologischen Zwiespalt.
Denn einerseits wollte ich den Kellner nicht kränken, ihn nicht für sein Kellnerdasein diskriminieren, sondern beweisen, wie sehr mir der Gleichheitsgedanke am Herzen lag, ich wollte großzügig sein, klassenlos – einerseits. Andererseits hätte ich den Markusplatz lieber allein betreten, um den ersten Eindruck ganz für mich allein zu haben, ungetrübt. Ich wollte nicht mit einem onkelhaften Kellner Kaffee trinken, bereits die Vorstellung, mit ihm Freundlichkeiten und Gemeinplätze auszutauschen, bedrückte mich, aber da war mir meine Menschenfreundlichkeit bereits zum Verhängnis geworden. Ich saß etwas gequält da, an einem der schmalen Marmortische im Florian unter den Arkaden, trank aus Gründen der Humanität einen Kaffee und hörte, wie mir der Kellner vorschlug, mit ihm am Abend tanzen zu gehen. Er kenne ein paar gute Adressen von venezianischen Tanzlokalen, ich solle nur wieder ins Restaurant kommen, der Rest würde sich schon finden. Ich nickte, beschloss, nie wieder in das Restaurant zu gehen, stürzte den Kaffee herunter und lief über den Markusplatz davon. Ich sah weder Porphyrsäulen noch Engelsflügel, ich sah weder den Markusdom noch die beiden Heiligen auf den Marmorsäulen, ich sah nicht Theodor, den Drachentöter, der aussieht, als führe er ein Krokodil an der Leine, und auch nicht den geflügelten Markuslöwen mit zuckendem Schwanz. Ich sah nur Tauben, gefangen in einem ewigen Kreislauf aus Körnerpicken, schreckhaftem Aufflattern und kurzen, allzu kurzen Formationsflügen, Tauben auf Touristenköpfen und auf Touristenbeinen sitzend, fressend, pickend, schnäbelnd, gurrend – und dann rettete ich mich in ein Café an der Riva degli Schiavoni, bestellte einen Prosecco und schrieb dem Bürgermeister von Palermo eine Postkarte.
Später, im Hotel Luna, telefonierte ich noch einmal mit der Pressedame von Lina Wertmüller und fühlte mich wieder sehr gewissenhaft. Wenigstens konnte mir niemand vorwerfen, mich nicht bemüht zu haben. Denn ich hatte es geschafft, meinen nach wie vor bestehenden Wunsch nach einem Interview nochmals glaubhaft zu versichern. Und Enttäuschung darüber zu äußern, dass Frau Wertmüller keine Interviews mehr gebe, weder heute Abend noch morgen, noch überhaupt. Denn sie reise früher als geplant ab, sagte die Pressedame. Dies sei bedauerlich, aber unabänderlich. Bedauerlich war daran vor allem, dass ich nun keinen weiteren Vorwand haben würde, noch länger in Venedig zu bleiben.
Am Abend gab mir der Hotelportier die Adresse eines Restaurants, in dem man ganz ausgezeichnet esse, es heiße Do Forni und liege unweit vom Markusplatz entfernt. Er würde mir gerne einen Tisch bestellen, wenn ich es wünschte, und ich wünschte es, weil ich nicht ahnte, dass venezianische Hotelportiers für jeden vermittelten Gast mit Kopfgeld belohnt werden. Er zeichnete mir auf dem Stadtplan den Weg ein, es sah aus wie eine Schatzkarte, und er sagte: Einfach immer geradeaus.
Um zum Restaurant zu gelangen, musste ich den Markusplatz erneut überqueren. Es war dunkel, und der Platz, der mir zuvor wie ein gigantischer Taubenkäfig erschienen war, hatte sich verwandelt. Es war, als beträte ich ein Wunder. Ein Wunder, in dem gerade Die schöne blaue Donau und La vie en rose