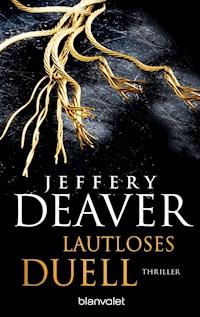9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der 1. Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs! In dem packenden SPIEGEL-Bestseller treibt ein grausamer Serienmörder sein Unwesen.
Ein Serienkiller versetzt New York in Angst und Schrecken: Scheinbar wahllos verschleppt und tötet er unschuldige Menschen und hinterlässt an jedem Tatort einen obskuren Hinweis auf den nächsten Mord. Die letzte Hoffnung der Polizei ist der geniale Forensiker Lincoln Rhyme, der seit einem Arbeitsunfall querschnittsgelähmt ist. Die brutalen Fälle wecken sein Interesse – und nach und nach kommt ihm der Verdacht, dass er den Mörder kennen muss …
Lesen Sie auch die anderen Romane mit Lincoln Rhyme und Amelia Sachs!
Alle Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Ähnliche
Buch
Als die junge New Yorker Streifenpolizistin Amelia Sachs eine aus dem Boden ragende Männerhand entdeckt, die, wie sich später herausstellt, zu einem senkrecht begrabenen Leichnam gehört, lässt sie sofort weiträumig den Fundort abriegeln. Der Aufruhr, den diese Aktion auslöst, weckt das Interesse des frühpensionierten Detective Lincoln Rhyme. Seit einem Dienstunfall ist dieser querschnittsgelähmt, doch inoffiziell arbeitet er immer noch für seine ehemalige Abteilung, da man dort nicht auf sein überragendes kriminalistisches Gespür verzichten will. Als sich weitere Morde ereignen, fordert Rhyme die couragierte Amelia als Assistentin an. Sie wird seine rechte Hand – und trotz seiner schroffen Art wird sie immer mehr in den Bann des hochbegabten und zynischen Mannes gezogen.
Ein erstes Täterprofil ergibt, dass es sich offenbar um einen psychopathischen Rachetäter handelt, der seine völlig willkürlich ausgewählten Opfer leiden sehen will. Und er hinterlässt an jedem Tatort einen Hinweis auf seinen nächsten Mord. Schritt für Schritt kreisen Amelia und Lincoln den Killer ein – bis dieser plötzlich seine Taktik ändert. Und Lincoln Rhyme beginnt sich zu fragen, ob er den Täter vielleicht sogar persönlich kennt.
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Jeffery Deaver
Der Knochenjäger
Thriller
Ins Deutsche übertragen von Hans-Peter Kraft
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel The Bone Collector bei Viking, New York.
Copyright © Dezember 2014 by Blanvalet, in der Penguin Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Copyright © 2012 by Gunner Publications, LLC
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1999
by Wilhelm Goldmann Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Der Roman erschien erstmals im Juni 1999 unter dem Titel
Die Assistentin.
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: plainpicture/LPF; Heiko Graf-Warnecke / EyeEm;
AF ∙ Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15718-0V006www.blanvalet.de
Für meine Familie, Dee, Danny, Julie, Ethel und Nelson … Äpfel fallen nicht weit.Und auch für Diana
INHALT
1 – KÖNIG FÜR EINEN TAG
2 – LOCARDS PRINZIP
3 – DIE TOCHTER DES STREIFENPOLIZISTEN
4 – BIS AUF DIE KNOCHEN
5 – WENN MAN IN SCHWUNG IST, KRIEGT EINEN KEINER
ANHANG
ANMERKUNG DES AUTORS
1 ____KÖNIG FÜREINEN TAG
In New York ist die Gegenwart so mächtig,dass die Vergangenheit vergessen ist.
JOHN JAY CHAPMAN
Freitag, 22.30 Uhr, bis Samstag, 15.30 Uhr
EINS
Sie wollte nur noch schlafen.
Die Maschine war mit zwei Stunden Verspätung gelandet, und sie hatten ewig lange auf das Gepäck warten müssen. Und dann hatte auch noch die Mietwagenfirma Mist gebaut – die Limousine war vor einer Stunde weggefahren. Deshalb mussten sie jetzt auf ein Taxi warten.
Sie stand mit den anderen Passagieren in der Schlange, die schlanke Gestalt leicht zur Seite geneigt, um das Gewicht des Laptop-Computers auszugleichen, den sie über der Schulter hängen hatte. John quasselte unentwegt über Zinssätze und neue Möglichkeiten zur Umschichtung des Transitgeschäfts, doch sie konnte nur noch an eins denken: Freitag abends, halb elf. Ich will mir bequeme Klamotten anziehen und mich hinhauen.
Sie musterte den endlosen Strom der gelben Taxis. Irgendetwas an der Farbe und der Gleichförmigkeit der Wagen erinnerte sie an Insekten. Und sie erschauderte leicht, spürte wieder dieses gruslig-krabbelige Gefühl, das sie aus ihrer Kindheit in den Bergen kannte, wenn sie und ihr Bruder einen toten Dachs mit heraushängenden Eingeweiden gefunden oder einen Waldameisenhaufen umgetreten und das Gewusel feuchter Beine und Leiber betrachtet hatten.
T. J. Colfax trat vor, als das nächste Taxi kam und mit quietschenden Bremsen anhielt.
Der Fahrer ließ den Kofferraumdeckel aufspringen, blieb aber im Wagen sitzen. Sie mussten ihr Gepäck selbst einladen, was John sauer aufstieß. Er war es gewohnt, dass man ihn bediente. Tammie Jean störte sich nicht daran; sie war gelegentlich immer noch überrascht, dass sie eine Sekretärin hatte, die ihre Korrespondenz tippte und verwaltete. Sie warf ihren Koffer hinein, schlug den Deckel zu und setzte sich in den Wagen.
John stieg nach ihr ein, knallte die Tür zu und wischte sich über das schwammige Gesicht und die beginnende Glatze, so als hätte er sich beim Verstauen seiner Reisetasche völlig verausgabt.
»Zuerst zur Zweiundsiebzigsten Ost«, brummte John durch die Trennscheibe.
»Danach zur Upper West Side«, fügte T. J. hinzu. Das Plexiglas zwischen den Vordersitzen und dem Fond war völlig verkratzt, sodass sie den Fahrer kaum sehen konnte.
Das Taxi schoss davon und rollte kurz darauf über die Stadtautobahn in Richtung Manhattan.
»Schau«, sagte John. »Daher die vielen Menschen.«
Er deutete auf eine riesige Reklametafel, auf der die Delegierten zu der am Montag beginnenden UN-Friedenskonferenz willkommen geheißen wurden. Rund zehntausend Besucher sollten in der Stadt weilen. T. J. betrachtete die Reklametafel – Schwarze, Weiße und Asiaten, alle lachten und winkten. Irgendetwas störte an diesem Bild. Die Proportionen und die Farben stimmten nicht. Und die Gesichter wirkten alle viel zu blass.
»Leichenräuber«, murmelte T. J.
Sie rasten über die breite Stadtautobahn dahin, die schmutzig gelb im Licht der Straßenbeleuchtung schimmerte. Vorbei am alten Navy Yard, vorbei an den Piers von Brooklyn.
John hörte endlich auf zu reden, holte seinen Taschenrechner heraus und tippte irgendwelche Zahlen ein. T. J. lehnte sich zurück, blickte hinaus auf die flirrenden Bürgersteige und die mürrischen Mienen der Menschen, die auf den Vordertreppen der Sandsteinhäuser entlang der Stadtautobahn hockten. Sie wirkten wie besinnungslos vor Hitze.
Auch im Taxi war es ziemlich heiß. T. J. streckte die Hand nach dem Knopf aus, mit dem sich das Fenster senken ließ. Sie war nicht weiter überrascht, als er nicht funktionierte. Sie griff über John hinweg. Der Fensterheber auf seiner Seite war ebenfalls kaputt. Erst dann stellte sie fest, dass die Türverriegelungen fehlten.
Die Türgriffe ebenfalls.
Ihre Hand glitt über die Tür, tastete nach der Griffnabe. Nichts – als hätte sie jemand abgesägt.
»Was ist?«, fragte John.
»Tja, die Türen … Wie kriegen wir die wieder auf?«
John schaute von der einen zur anderen, als das Hinweisschild auf den Midtown Tunnel auftauchte und vorbeihuschte.
»He!« John klopfte an die Trennscheibe. »Sie haben die Ausfahrt verpasst. Wo wollen Sie hin?«
»Vielleicht fährt er über die Queensboro«, meinte T. J. Die Strecke über die Brücke war zwar weiter, aber man sparte dadurch die Tunnelmaut. Sie setzte sich auf und klopfte mit ihrem Ring an das Plexiglas.
»Fahren Sie über die Brücke?«
Er beachtete sie nicht.
»He!«
Und im nächsten Moment raste er an der Ausfahrt zur Queensboro Bridge vorbei.
»Scheiße«, schrie John. »Wo fahren Sie denn hin? Nach Harlem. Ich wette, er bringt uns nach Harlem.«
T. J. blickte aus dem Fenster. Ein anderer Wagen fuhr neben ihnen her, zog langsam vorbei. Sie trommelte an die Scheibe.
»Hilfe!«, schrie sie. »Bitte …«
Der andere Fahrer warf ihr einen Blick zu, dann noch einen, und runzelte die Stirn. Er fuhr langsamer und reihte sich hinter ihnen ein, doch das Taxi scherte jäh aus, nahm schlitternd eine Ausfahrt nach Queens, bog in eine Gasse ab und raste durch eine menschenleere Lagerhausgegend. Sie mussten um die hundert Stundenkilometer fahren.
»Was machen Sie da?«
T. J. hämmerte an die Trennscheibe. »Fahren Sie langsamer. Wohin …?«
»O Gott, nein«, murmelte John. »Schau.«
Der Fahrer hatte eine Skimaske übergezogen.
»Was wollen Sie?«, rief T. J.
»Geld? Wir geben Ihnen Geld.«
Noch immer kein Ton von vorne.
T. J. riss ihre Targus-Tasche auf und zog ihren schwarzen Laptop heraus. Sie holte aus und knallte die Kante des Computers gegen die Trennscheibe. Das Glas hielt, doch der Schlag hatte den Fahrer anscheinend zu Tode erschreckt. Der Wagen brach aus und hätte beinahe die Ziegelwand des Hauses gestreift, an dem sie gerade vorüberrasten.
»Geld! Wie viel? Ich kann Ihnen jede Menge Geld geben!« John geiferte geradezu, und die Tränen liefen ihm über die dicken Backen.
Wieder rammte T. J. ihren Laptop mit aller Kraft gegen das Fenster. Der Bildschirm flog weg, doch die Trennscheibe blieb ganz.
Sie versuchte es noch mal, und diesmal zerbrach das Computergehäuse und rutschte ihr aus der Hand.
»O Mist …« Sie wurden beide heftig nach vorn geschleudert, als das Taxi in einer schmuddeligen, unbeleuchteten Sackgasse scharf abbremste.
Der Fahrer stieg aus. Er hatte eine kleine Pistole in der Hand.
»Nein, bitte«, flehte sie.
Er ging zur Hintertür, beugte sich hinab und schaute durch das schlierige Glas. Er stand eine ganze Weile so da, während sie und John sich in die andere Ecke drängten und die schweißnassen Leiber aneinanderdrückten.
Der Fahrer schirmte die Augen mit der Hand ab und schaute sie sich genau an.
Plötzlich ertönte ein lautes Krachen, und T. J. fuhr zusammen. John schrie kurz auf.
In der Ferne, hinter dem Fahrer, zuckten rot-blaue Feuerzungen über den Himmel. Dann weiteres Geknatter und Geheul. Er drehte sich um und blickte auf, als eine riesige orangerote Spinne ihre Beine über der Stadt ausstreckte.
Ein Feuerwerk. T. J. fiel ein, dass sie in der Times etwas darüber gelesen hatte. Ein Geschenk des Bürgermeisters und des UN-Generalsekretärs, mit dem sie die Konferenzteilnehmer in der großartigsten Stadt der Welt empfingen.
Der Fahrer wandte sich wieder dem Taxi zu. Mit einem lauten Schnappen entriegelte er das Schloss und öffnete langsam die Tür.
Ein anonymer Anruf. Wie üblich.
Folglich konnte man nicht nachhaken und feststellen, welches unbebaute Grundstück der Anrufer meinte. »Siebenunddreißigste, Nähe Eleventh Avenue, hat er gesagt. Das ist alles«, hatte die Zentrale über Funk durchgegeben.
Anonyme Anrufer waren, was genaue Ortsbeschreibungen anging, bekanntlich nicht die Zuverlässigsten.
Amelia Sachs, die jetzt schon schwitzte, obwohl es erst neun Uhr morgens war, kämpfte sich durch das hohe Gras. Sie ging in Schlangenlinie, schritt den Suchabschnitt ab – so nannte man das bei der Polizei. Nichts. Sie beugte sich zu dem Funkmikrofon, das an ihrer marineblauen Uniformbluse befestigt war.
»Streife 5885. Kann nichts feststellen, Zentrale. Haben Sie weitere Angaben?«
»Nicht zur Örtlichkeit, 5885«, meldete sich knisternd und knackend die Einsatzzentrale. »Aber eins noch … der Anrufer hat gesagt, er hofft, dass das Opfer tot ist. Ende.«
»Sagen Sie das noch mal, Zentrale.«
»Der Anrufer hat gesagt, er hofft, dass das Opfer tot ist. Um seinetwillen. Ende.«
»Ende.«
Hofft, dass das Opfer tot ist?
Sachs kletterte über einen durchhängenden Stacheldrahtzaun und suchte eine weitere unbebaute Parzelle ab. Nichts.
Sie wollte am liebsten aufgeben. Einen 10-90 melden, eine Fehlanzeige, und zum Deuce zurückkehren, ihrem üblichen Streifenbezirk. Ihre Knie schmerzten, und sie kochte förmlich vor Hitze in diesem mistigen Augustwetter. Sie wollte sich zur Hafenbehörde verziehen, bei den Kollegen herumhängen und eine große Dose Arizona-Eistee trinken. Danach, um halb zwölf – in etwas über zwei Stunden –, wollte sie ihren Spind in Midtown South ausräumen und zur Fortbildung ins Präsidium nach Downtown fahren.
Doch sie blies den Einsatz nicht ab – sie brachte es nicht über sich. Sie ging weiter: den heißen Gehsteig entlang, durch eine Lücke zwischen zwei verlassenen Wohnblocks, über ein weiteres verwildertes Grundstück.
Sie grub den langen Zeigefinger in das flache Dach ihrer Uniformmütze, in das Nest ihrer langen, hochgesteckten roten Haare. Sie kratzte sich krampfhaft, griff dann unter die Mütze und kratzte weiter. Schweiß rann ihr über die Stirn und kitzelte sie, worauf sie sich auch die Augenbrauen vornahm.
Sie dachte: Die letzten zwei Stunden auf der Straße. Damit kann ich leben.
Als Sachs tiefer in das Gestrüpp vordrang, war ihr an diesem Morgen zum ersten Mal unwohl zumute.
Jemand beobachtete sie.
Raschelnd strich der heiße Wind durch das dürre Gestrüpp, dazu kam der Lärm der Personen- und Lastwagen am Lincoln Tunnel. Ein Gedanke ging ihr durch den Kopf, der Streifenpolizisten häufig zu schaffen machte: Diese Stadt ist so verdammt laut, dass sich jemand von hinten mit dem Messer an mich ranschleichen könnte, ohne dass ich es überhaupt mitbekäme.
Oder ein Zielfernrohr auf meinen Rücken richten …
Sie fuhr herum.
Nichts als trockenes Laub, rostige Maschinenteile und Müll.
Sie zuckte ein paar Mal zusammen, als sie auf einen Steinhaufen kletterte. Amelia Sachs, einunddreißig Jahre alt – erst einunddreißig, wie ihre Mutter sagen würde –, litt an Arthritis. Ein Erbteil ihres Großvaters, und zwar ebenso eindeutig, wie sie die gertenschlanke Figur von ihrer Mutter und das gute Aussehen von ihrem Vater hatte, in dessen Fußstapfen sie auch beruflich getreten war (woher die roten Haare stammten, wussten die Götter). Ein weiterer stechender Schmerz, als sie sich durch ein hohes, halbvertrocknetes Gebüsch zwängte. Sie blieb gerade noch rechtzeitig stehen, denn nur einen Schritt vor ihr fiel das Gelände mindestens zehn Meter steil ab.
Unter ihr lag eine düstere Schlucht – tief in das Muttergestein der West Side eingegraben. In ihr verlief die Gleisbettung für die Amtrak-Züge in Richtung Norden.
Sie kniff die Augen zusammen und blickte hinunter auf den Grund der Schlucht, auf eine Stelle unmittelbar neben der Bahntrasse.
Was war das?
Ein kreisrunder Fleck aufgewühlter Erde, aus dem eine Art Ast aufragte? Es sah aus wie …
Ach, du lieber Gott …
Sie erschauderte beim bloßen Anblick. Spürte, wie ihr schlecht wurde, wie ihre Haut zu prickeln begann. Sie musste sich mit aller Macht zusammennehmen, denn am liebsten hätte sie kehrtgemacht und so getan, als hätte sie nichts gesehen.
Er hofft, dass das Opfer tot ist. Um seinetwillen.
Sie rannte zu einer eisernen Leiter, die vom Gehsteig hinab zum Bahnkörper führte. Sie griff nach dem Geländer, hielt sich aber gerade noch rechtzeitig zurück. Mist. Der Täter könnte über diese Leiter geflüchtet sein. Wenn sie sie anfasste, ruinierte sie womöglich die Fingerabdrücke, die er hinterlassen hatte. Na schön, dann eben auf die komplizierte Art. Sie atmete tief durch, um die Schmerzen in ihren Gelenken zu unterdrücken, setzte ihre Dienstschuhe – sie hatte sie für den ersten Tag in ihrer neuen Stellung eigens auf Hochglanz poliert – in die ins Gestein gekerbten Spalten und kletterte am Felsen hinab. Sie sprang die letzten anderthalb Meter zur Bahntrasse hinunter und rannte zu dem Fleck, an dem das Erdreich aufgegraben worden war.
»O Mann …«
Es war kein aus dem Boden ragender Ast, es war eine Hand. Die Leiche war aufrecht begraben und mit Erde zugeschüttet worden, bis nur mehr Unterarm, Handgelenk und Hand herausstanden. Sie starrte auf den Ringfinger: Sämtliches Fleisch war entfernt worden, und auf dem blanken, blutigen Knochen steckte ein mit Diamanten besetzter Damenring.
Sachs kniete sich hin und fing an zu graben.
Als sie mit den Händen die Erde nach hinten schleuderte wie ein Hund, fiel ihr auf, dass die nicht verstümmelten Finger weit gespreizt und unnatürlich durchgebogen waren. Was ihr verriet, dass das Opfer noch am Leben gewesen war, als man ihm die letzte Schaufel Erde auf das Grab geworfen hatte.
Und vielleicht immer noch lebte.
Sachs wühlte wie wild im lockeren Erdreich und zerschnitt sich die Hand an einer Glasscherbe, worauf sich ihr dunkles Blut mit der dunkleren Erde mischte. Sie stieß auf die Haare, dann auf die Stirn, sah die typischen Anzeichen einer Zyanose, die bläulich rote Verfärbung, die auf Tod durch Ersticken hindeutete. Sie grub weiter, bis sie die gebrochenen Augen sah und den Mund, der zu einem grausigen Grinsen verzerrt war. Vermutlich hatte das Opfer bis zur letzten Sekunde versucht, den Kopf über der schwarzen Erde zu halten.
Es war keine Frau. Trotz des Ringes. Es war ein korpulenter Mann, um die fünfzig. So tot wie der Boden, in dem er steckte.
Sie wich zurück, konnte aber den Blick nicht von ihm abwenden und wäre beinahe über ein Bahngleis gestolpert. Eine ganze Minute lang war sie zu keinerlei Gedanken fähig. Stellte sich nur immer wieder vor, was für ein Gefühl es gewesen sein musste, so zu sterben.
Dann: Komm schon, Schätzchen. Du hast hier einen Mord an der Hand, und du bist die erste Polizistin vor Ort.
Du weißt, was du tun musst.
FAUST.
F steht für Festnahme eines Täters, falls bekannt.
A steht für Aufschreiben von Zeugen und Verdächtigen.
U steht für Überblick über den Tatort verschaffen.
S steht für …
Wofür stand S doch gleich wieder?
Sie senkte den Kopf und sprach ins Mikrofon. »Streife 5885 an Zentrale. Einsatzmeldung. Habe einen 10-29 bei den Bahngleisen an der Siebenunddreißigsten, Ecke Eleventh Avenue. Tötungsdelikt. Brauche Kripo, Spurensicherung und Polizeiarzt. Kommen.«
»Verstanden, 5885. Täter festgenommen? Kommen.«
»Kein Täter.«
»Verstanden, 5885.«
Sachs starrte auf den Finger, von dem das Fleisch entfernt worden war. Den Ring, der nicht passte. Die Augen. Und das Grinsen … oh, dieses verfluchte Grinsen. Wieder schauderte es sie am ganzen Leib. Amelia Sachs war im Sommerlager in Flüssen geschwommen, in denen es vor Schlangen wimmelte, sie hatte sich zu Recht gebrüstet, dass es ihr nichts ausmachen würde, am Bungeeseil von einer dreißig Meter hohen Brücke zu springen. Aber sobald sie an Gefangenschaft dachte, an enge Räume … sobald sie sich vorstellte, in der Falle zu sitzen, nicht wegzukönnen, packte sie die helle Panik. Deswegen ging Sachs schnell, wenn sie zu Fuß unterwegs war, und deswegen fuhr sie mit dem Auto wie der Teufel persönlich.
Wenn man in Schwung ist, kriegt einen keiner …
Sie hörte ein Geräusch und spitzte die Ohren.
Ein dumpfes Rumpeln, das lauter wurde.
Papierfetzen wehten die Bahngleise entlang. Staubwolken umwirbelten sie wie wütende Geister.
Dann ein tiefes Heulen …
Streifenpolizistin Amelia Sachs, einen Meter fünfundsiebzig groß, stellte fest, dass sie es mit einer dreißig Tonnen schweren Amtrak-Lokomotive zu tun hatte, einem rot-weiß-blauen Stahlkoloss, der mit fünfzehn Stundenkilometern entschlossen auf sie zuhielt.
»Sie da, stehen bleiben!«, schrie sie.
Der Lokführer beachtete sie nicht.
Sachs rannte auf den Bahnkörper, stellte sich breitbeinig mitten auf die Gleise und winkte ihm zu, dass er anhalten solle. Quietschend kam die Lokomotive zum Stehen. Der Lokführer streckte den Kopf aus dem Fenster.
»Sie können hier nicht durch«, erklärte sie ihm.
Er fragte sie, was sie damit meine. Ihrer Ansicht nach sah er furchtbar jung aus, viel zu jung, um einen so großen Zug zu fahren.
»Sie haben hier einen Tatort vor sich. Stellen Sie bitte den Motor ab.«
»Gute Frau, ich seh’ nirgendwo eine Tat.«
Aber Sachs hörte nicht zu. Sie schaute hinauf zu einem Loch im Maschendrahtzaun, oben an der Westseite der Bahnstrecke, nahe der Eleventh Avenue.
Auf diesem Weg hätte er sein Opfer ungesehen hierher schaffen können – wenn er an der Eleventh Avenue parkte und es durch die enge Gasse zu dem Steilabfall schleppte. An der Siebenunddreißigsten, der Querstraße, lief er Gefahr, dass jemand aus einem der zahllosen Fenster schaute und ihn bemerkte.
»Der Zug, Sir. Lassen Sie ihn einfach stehen.«
»Ich kann ihn hier nicht stehen lassen.«
»Stellen Sie bitte den Motor ab.«
»So eine Lok stellt man nicht ab. Die läuft immerzu.«
»Und rufen Sie Ihren Einsatzleiter an. Oder irgendwen. Die Züge in Richtung Süden müssen ebenfalls angehalten werden.«
»Das können wir nicht machen.«
»Auf der Stelle, Sir. Ich habe die Nummer Ihres Fahrzeugs.«
»Fahrzeug?«
»Ich rate Ihnen, meinen Anweisungen unverzüglich Folge zu leisten«, herrschte Sachs ihn an.
»Was wollen Sie denn machen, gute Frau? Mir einen Strafzettel verpassen?«
Doch Amelia Sachs kletterte bereits mit ächzenden Gliedmaßen die Felswand hinauf, den Geschmack von Kalk, Erde und Schweiß im Mund. Sie rannte zu der Gasse, die sie von der Bahntrasse aus bemerkt hatte, und warf einen Blick auf die Eleventh Avenue und das Javits Center auf der anderen Straßenseite. Im Foyer wimmelte es von Menschen – Schaulustige und Presse. Auf einem riesigen Spruchband stand Ein herzliches Willkommen den UN-Delegierten! Aber am frühen Morgen, als die Straße menschenleer war, hätte der Täter hier mühelos einen Parkplatz finden und das Opfer unbemerkt zu den Gleisen schleppen können. Sachs ging zur Eleventh Avenue und betrachtete die sechsspurige Straße, auf der sich der Verkehr staute.
Packen wir’s an.
Sie trat mitten zwischen die Pkws und Lkws und riegelte kurzerhand sämtliche Spuren in Richtung Norden ab. Etliche Fahrer versuchten sich durchzuschlängeln, sodass sie zwei Verwarnungen aussprechen und schließlich mehrere Mülltonnen mitten auf die Straße schleppen und eine Barrikade errichten musste, damit die braven Bürger ihrer Pflicht nachkamen.
Endlich fiel Sachs auch der nächste Punkt der Verhaltensregeln am Tatort ein.
S steht für Sichern des Tatorts.
Wütendes Hupen schallte durch die dunstige Morgenluft, kurz darauf untermalt von den aufgebrachten Rufen der Fahrer. Wenig später hörte sie, wie Sirenen in das allgemeine Getöse einstimmten, als die ersten Einsatzwagen eintrafen.
Vierzig Minuten später wimmelte es am Tatort von Uniformierten und Kriminalpolizisten, Dutzenden von Kripoleuten – viel mehr, als bei einem Mord in Hell’s Kitchen gerechtfertigt schien, so grausig die Tat auch sein mochte. Aber das hier, so erfuhr Sachs von einem anderen Polizisten, war ein heißer Fall, ein gefundenes Fressen für die Medien – bei dem Opfer handelte es sich um einen Fluggast, der gestern Nacht am John F. Kennedy Airport gelandet, gemeinsam mit einer Mitreisenden in ein Taxi gestiegen und in die Stadt gefahren war. Keiner von beiden war zu Hause angekommen.
»CNN schaut uns auf die Finger«, flüsterte der Uniformierte.
Daher war Amelia Sachs nicht weiter überrascht, als sie sah, wie Vince Peretti, der blond gelockte Chef der Investigation & Resource Division, des zentralen Kriminaldezernats, die Böschung hinaufkletterte, oben kurz innehielt und den Staub von seinem Tausend-Dollar-Anzug klopfte.
Überrascht war sie allerdings, als sie feststellte, dass er Notiz von ihr nahm, das glattrasierte Gesicht zu einem schmalen Lächeln verzog und sie zu sich winkte. Vermutlich erntete sie ein wohlwollendes Nicken für ihre Kletterpartie. Wollte die Fingerabdrücke auf der Leiter nicht beschädigen, Jungs. Vielleicht gab es sogar eine Belobigung. Am letzten Tag, an dem sie Streifendienst schob, in allerletzter Stunde. Ein wahrhaft ruhmreicher Abgang.
Er musterte sie von oben bis unten. »Streifenpolizistin, Sie sind doch keine Anfängerin mehr, oder? Davon gehe ich einfach mal aus.«
»Wie bitte, Sir?«
»Sie sind doch keine Anfängerin mehr, nehme ich an.«
Genau genommen war sie das nicht, obwohl sie erst drei Dienstjahre auf dem Buckel hatte; andere Streifenpolizisten in ihrem Alter waren meist bereits seit neun oder zehn Jahren dabei. Sachs hatte ein paar Jahre lang gegammelt, ehe sie die Akademie besucht hatte. »Ich weiß nicht recht, worauf Sie hinauswollen.«
Er warf ihr einen entnervten Blick zu und hörte auf zu lächeln. »Sie waren doch zuerst am Tatort?«
»Ja, Sir.«
»Warum haben Sie die Eleventh Avenue gesperrt? Was haben Sie sich dabei nur gedacht?«
Sie schaute die breite Straße entlang, die noch immer mit Mülltonnen versperrt war. Sie hatte sich mittlerweile an das Gehupe gewöhnt, stellte jetzt aber fest, dass es wirklich ganz schön laut war. Die Autos stauten sich inzwischen kilometerweit.
»Sir, der erste Polizist vor Ort hat die Aufgabe, den Täter festzunehmen, Zeugen ausfindig zu machen, den Tatort …«
»Ich kenne die Dienstvorschriften, Officer. Sie haben also die Straße gesperrt, um den Tatort zu sichern?«
»Ja, Sir. Ich glaube nicht, dass der Täter in der Querstraße geparkt hat. Von den Wohnungen dort hätte er leicht beobachtet werden können. Sehen Sie? Die Eleventh Avenue war meiner Meinung nach die bessere Wahl.«
»Nun, Ihre Meinung war falsch. Es gibt keinerlei Fußspuren jenseits der Gleise, aber zwei, die zu der Leiter führen, über die man hinauf zur Siebenunddreißigsten gelangt.«
»Die Siebenunddreißigste habe ich ebenfalls gesperrt.«
»Darauf will ich ja hinaus. Das hätte gereicht, mehr Sperren wären nicht nötig gewesen. Und der Zug?«, fragte er. »Warum haben Sie den angehalten?«
»Na ja, Sir. Ich dachte, wenn der Zug mitten durch den Tatort fährt, zerstört er vielleicht Spuren. Oder irgendwas.«
»Oder irgendwas, Officer?«
»Ich hab’ mich nicht besonders gut ausgedrückt, Sir. Ich meine …«
»Was ist mit dem Flughafen drüben in Newark?«
»Ja, Sir.« Hilfesuchend blickte sie sich um. Andere Polizisten standen in der Nähe, nahmen aber tunlichst nicht wahr, wie sie abgekanzelt wurde. »Was ist mit dem Flughafen in Newark?«
»Warum haben Sie den nicht auch gesperrt?«
Na wunderbar. Ein Schulmeister. Ihr Julia-Roberts-Mund wurde eine Idee schmäler, aber ruhig sagte sie: »Sir, meiner Ansicht nach wäre es durchaus möglich, dass …«
»Der New York Thruway hätte sich ebenfalls angeboten. Dazu der Jersey Pike und der Long Island Expressway. Der Interstate 70, bis rüber nach St. Louis. Das sind lauter mögliche Fluchtwege.«
Sie senkte den Kopf etwas und erwiderte Perettis Blick. Sie waren beide gleich groß, obwohl er die höheren Absätze hatte.
»Ich habe Anrufe vom Polizeipräsidenten erhalten«, fuhr er fort, »vom Chef der Hafenbehörde, vom Büro des UN-Generalsekretärs, dem Chef der Expo …« Er nickte zum Javits Center hin. »Wir haben den Zeitplan der Konferenz über den Haufen geworfen, die Ansprache eines US-Senators verpatzt und den Verkehr an der gesamten West Side zum Erliegen gebracht. Die Bahngleise sind fünfzehn Meter vom Fundort des Opfers entfernt, und die Straße, die Sie gesperrt haben, ist gut sechzig Meter weit weg und liegt rund zehn Meter höher. Ich meine, nicht mal Hurrikan Eva hat den Bahnbetrieb auf der Nordoststrecke derart zusammenbrechen lassen.«
»Ich dachte nur …«
Peretti lächelte. Weil Sachs eine wunderschöne Frau war – während des »Gammellebens«, das sie vor dem Besuch der Polizeiakademie geführt hatte, hatte sie unter anderem regelmäßig für die Chantelle Modelling Agency an der Madison Avenue als Mannequin gearbeitet –, wollte ihr der Kripomann noch einmal verzeihen.
»Streifenpolizistin Sachs.« Er warf einen Blick auf das Namensschild an ihrer Brust, die durch die kugelsichere Weste züchtig platt gedrückt wurde. »Eine Lektion zur Lage. Arbeit am Tatort erfordert Fingerspitzengefühl. Es wäre schön, wenn wir nach jedem Mord die ganze Stadt abriegeln und rund drei Millionen Menschen festhalten könnten. Aber das können wir nicht. Ich sage das mit allem Wohlwollen. Zu Ihrer Erbauung.«
»Genau genommen, Sir«, erwiderte sie forsch, »werde ich aus dem Streifendienst versetzt. Mit Wirkung ab heute Mittag.«
Er nickte, lächelte freundlich. »Dann genug davon. Aber für die Akten: Es war Ihre Entscheidung, den Zug anzuhalten und die Straße zu sperren.«
»Ja, Sir«, sagte sie schnell. »Daran gibt’s nichts zu deuteln.«
Mit schweißnassen Händen zückte er Stift und Notizbuch und schrieb ihre Aussage auf.
Oh, bitte …
»Und jetzt entfernen Sie die Mülltonnen. Weisen Sie den Verkehr ein, bis die Straße wieder frei ist. Haben Sie verstanden?«
Ohne ein »Ja, Sir«, »Nein, Sir« oder irgendeine andere Bestätigung lief sie zur Eleventh Avenue und entfernte langsam die Mülltonnen. Jeder Fahrer, der vorbeikam, bedachte sie mit finsteren Blicken oder grummelte irgendetwas. Sachs schaute auf ihre Uhr.
Noch eine Stunde.
Damit konnte sie leben.
ZWEI
Der Wanderfalke schlug kurz mit den Flügeln und landete auf dem Fenstersims. Es war ein strahlender Vormittag, und die Luft draußen schien zu glühen.
»Da bist du ja«, flüsterte der Mann. Er legte den Kopf schief und spitzte die Ohren, als unten die Türglocke ertönte.
»Ist er das?«, rief er die Treppe hinab. »Ist er’s?«
Lincoln Rhyme bekam keine Antwort und wandte sich wieder dem Fenster zu. Der Vogel verdrehte den Kopf, eine rasche, ruckartige Bewegung, die bei dem Falken trotzdem elegant wirkte. Rhyme stellte fest, dass seine Fänge blutig waren. Ein gelbliches Fleischstück hing aus seinem schwarzen Schnabel. Er reckte den kurzen Hals und begab sich zu dem Nest. Seine Bewegungen erinnerten eher an eine Schlange als an einen Vogel. Der Falke ließ das Fleisch in den hochgereckten Schnabel des flaumigen blauen Jungtiers fallen. Das hier, dachte Rhyme, ist das einzige Lebewesen in ganz New York, das keine natürlichen Feinde hat. Von Gott höchstselbst einmal abgesehen.
Er hörte, wie jemand langsam die Treppe heraufkam.
»Ist er das?«, fragte er Thom.
»Nein«, antwortete der junge Mann.
»Wer dann? Es hat doch an der Tür geschellt, oder?«
Thoms Blick schweifte zum Fenster. »Der Vogel ist zurück. Schau, da sind Blutflecken am Fenstersims. Kannst du sie sehen?«
Das Falkenweibchen kam in Sicht. Blaugrau und schillernd wie ein Fisch. Es suchte den Himmel ab.
»Sie sind immer zusammen. Ob sie sich wohl ein Leben lang treu bleiben?«, fragte sich Thom laut. »Wie Gänse?«
Rhyme wandte sich wieder Thom zu, sah dessen jugendlich schlanke Taille, als er sich vorbeugte und durch das schmutzige Fenster zum Nest blickte.
»Wer war es?«, wiederholte Rhyme. Der junge Mann hielt ihn hin, und das ärgerte Rhyme.
»Ein Besucher.«
»Ein Besucher? Ha«, schnaubte Rhyme. Er versuchte sich zu erinnern, wann er zum letzten Mal Besuch bekommen hatte. Es musste drei Monate her sein. Wer war es gewesen? Dieser Reporter vielleicht, oder irgendein entfernter Cousin. Nun ja, Peter Taylor, einer von Rhymes Rückenmarkspezialisten. Und Blaine war mehrmals dagewesen. Aber sie war selbstverständlich keine Besucherin.
»Es ist eiskalt«, beschwerte sich Thom. Er wollte das Fenster öffnen. Auf der Stelle für Abhilfe sorgen. Die Jugend.
»Mach das Fenster nicht auf«, befahl Rhyme. »Und sag mir endlich, wer da ist.«
»Es ist eiskalt.«
»Du störst den Vogel. Du kannst die Klimaanlage niedriger stellen. Ich stelle sie niedriger.«
»Wir waren zuerst da«, sagte Thom und schob die riesige Fensterscheibe hoch. »Die Vögel haben sich hier niedergelassen, obwohl sie genau wussten, dass du da bist.« Mit funkelnden Augen blickten die Tiere sich nach der Ursache dieses Lärms um. Andererseits funkelten sie immer mit den Augen. Trotzdem blieben sie auf dem Sims, von wo aus sie über ihr Reich herrschten, das aus kümmernden Ginkgo-Bäumen und auf beiden Seiten der Straße parkenden Autos bestand.
»Wer ist es?«, wiederholte Rhyme.
»Lon Sellitto.«
»Lon?«
Was wollte der hier?
Thom blickte sich prüfend um. »Hier sieht es scheußlich aus.«
Rhyme konnte das Gewusel beim Putzen nicht leiden. Er konnte die Unruhe nicht leiden, den Staubsaugerlärm – den er besonders lästig fand. Er war zufrieden, wenn alles so blieb, wie es war. Dieses Zimmer, das er als sein Büro bezeichnete, befand sich im ersten Stock seines alten, mit allerlei Stuck und Schnörkeln verzierten Stadthauses an der Upper West Side und ging auf den Central Park hinaus. Das Zimmer war groß, rund vierzig Quadratmeter, und buchstäblich jeder Meter wurde genutzt. Manchmal schloss er spaßeshalber die Augen und versuchte den Geruch der verschiedenen Gegenstände im Raum festzustellen. Tausend Bücher und Zeitschriften, windschief übereinander getürmte Stapel von Fotokopien, die heißen Transistoren des Fernsehgeräts, die staubbedeckten Glühbirnen, die Korkpinnwände. Vinyl, Hyperoxid, Latex, Polster.
Drei verschiedene Sorten Malt-Whisky.
Falkenmist.
»Ich will ihn nicht sehen. Sag ihm, ich bin beschäftigt.«
»Und ein junger Polizist. Ernie Banks. Nein, das war ein Baseballspieler, stimmt’s? Du solltest mich wirklich mal putzen lassen. Man merkt immer erst, wie schmutzig es ist, wenn einem jemand aufwartet.«
»Aufwartet? Meine Güte, klingt das schrullig. Viktorianisch. Ich hab’ auch was: Sag ihm, er soll sich zum Teufel scheren. Na, wie passt das zum guten Ton der Jahrhundertwende?«
Scheußlich …
Thom sprach vom Zimmer, aber Rhyme vermutete, dass er auch seinen Boss meinte.
Rhyme hatte dichtes schwarzes Haar, wie ein Zwanzigjähriger – obwohl er doppelt so alt war –, aber es stand wild und wuschelig ab und musste dringend gewaschen und geschnitten werden. Sein Gesicht war von einem schwarzen, ungepflegt wirkenden Dreitagebart überwuchert, und beim Aufwachen hatte ständig sein Ohr gejuckt, was wiederum hieß, dass auch diese Haare gestutzt werden mussten. Rhymes Fuß- und Fingernägel waren zu lang, und er trug seit einer Woche dieselbe Kleidung – einen getupften, potthässlichen Pyjama. Er hatte ein schmales Gesicht, dunkelbraune Augen und sah, wie Blaine ihm in leidenschaftlichen und auch anderen Momenten versichert hatte, ausgesprochen gut aus.
»Sie möchten mit dir reden«, fuhr Thom fort. »Sie sagen, es sei sehr wichtig.«
»Wie schön für sie.«
»Du hast Lon seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen.«
»Warum sollte ich ihn dann jetzt sehen wollen? Hast du den Vogel verscheucht? Wenn ja, werde ich stinksauer.«
»Es ist wichtig, Lincoln.«
»Sehr wichtig, hast du meines Wissens gesagt. Wo bleibt dieser Doktor? Vielleicht hat er angerufen. Ich bin vorhin weggedöst. Und du warst außer Haus.«
»Du bist seit sechs Uhr morgens wach.«
»Nein.« Er schwieg einen Moment. »Da bin ich aufgewacht, ja. Aber dann bin ich wieder eingedöst. Ich habe fest geschlafen. Hast du den Anrufbeantworter abgehört?«
»Ja«, sagte Thom. »Keine Nachricht von ihm.«
»Er hat gesagt, dass er am Vormittag vorbeikommt.«
»Und jetzt ist es erst kurz nach elf. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen abwarten, ehe wir den Seenotrettungsdienst verständigen. Was meinst du?«
»Hast du telefoniert?«, fragte Rhyme unvermittelt. »Vielleicht hat er angerufen, als du am Apparat warst.«
»Ich habe nur mit …«
»Habe ich irgendetwas gesagt?«, fragte Rhyme. «Jetzt bist du wütend. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du nicht telefonieren sollst. Das darfst du durchaus. Das durftest du schon immer. Ich will damit nur sagen, dass er angerufen haben könnte, während du telefoniert hast.«
»Nein, du willst damit sagen, dass du heute Morgen beschissen gelaunt bist.«
»Da haben wir’s wieder. Weißt du, es gibt da so ein Ding – eine Doppelschaltung. Damit kann man zwei Anrufe auf einmal entgegennehmen. Ich wünschte, wir hätten das. Was will denn mein alter Freund Lon? Und sein Freund, der Baseballspieler?«
»Frag sie doch.«
»Ich frage dich.«
»Sie möchten dich sprechen. Mehr weiß ich auch nicht.«
»Wägen etwas sähr Wichti–chem.«
»Lincoln.« Thom seufzte. Der gut aussehende junge Mann fuhr sich mit der Hand durch die blonden Haare. Er trug eine braune Hose, ein weißes Hemd, dazu einen blau geblümten Schlips, tadellos gebunden. Er könne jederzeit Jeans und T-Shirt tragen, wenn er wolle, hatte Rhyme gesagt, als er Thom vor einem Jahr eingestellt hatte. Aber er war jeden Tag einwandfrei gekleidet gewesen. Rhyme wusste nicht genau, inwiefern das bei seinem Entschluss, den jungen Mann zu behalten, eine Rolle gespielt hatte, aber es hatte auf jeden Fall dazu beigetragen. Keiner von Thoms Vorgängern hatte länger als sechs Wochen durchgehalten. Die einen, etwa die Hälfte, hatten von sich aus gekündigt, und die anderen hatte er gefeuert.
»Na schön, was hast du ihnen gesagt?«
»Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mir fünf Minuten Zeit lassen, damit ich dafür sorgen kann, dass du halbwegs anständig aussiehst, dann könnten sie raufkommen. Kurz.«
»Das hast du getan. Ohne mich zu fragen. Vielen Dank.«
Thom zog sich ein paar Schritte zurück und rief über die schmale Treppe hinab: »Kommen Sie, meine Herren.«
»Die haben dir was erzählt, oder?«, sagte Rhyme. »Du verheimlichst mir etwas.«
Thom antwortete nicht, und dann sah Rhyme die Männer hochkommen. Als sie das Zimmer betraten, ergriff Rhyme das Wort. »Zieh die Vorhänge zu«, sagte er zu Thom. »Du hast die Vögel schon viel zu sehr aufgeregt.«
Was in Wahrheit hieß, dass er genug von der grellen Sonne hatte.
Stumm.
Sie konnte kein Wort sagen, weil sie das widerliche Klebeband über dem Mund hatte, und das beeinträchtigte sie weit mehr als die eisernen Handschellen, die ihre Gelenke einschnürten. Dann griff er mit seinen kurzen, kräftigen Fingern nach ihrem Bizeps.
Der Taxifahrer, der immer noch die Skimaske trug, führte sie durch einen schmutzigen, feuchten Korridor, vorbei an allerlei Rohren und Leitungen. Sie waren im Keller eines Bürogebäudes. Sie hatte keine Ahnung, wo.
Wenn ich bloß mit ihm reden könnte … T. J. Colfax war eine Zockerin, die ausgebuffteste im ganzen zweiten Stock von Morgan Stanley. Die konnte verhandeln.
Geld? Sie wollen Geld? Ich besorge Ihnen Geld, jede Menge, mein Junge. Haufenweise. Immer wieder dachte sie daran, suchte seinen Blick, als könnte sie es ihm suggerieren.
Bittebittebitte, betete sie stumm und überlegte sich dabei, dass sie sich ihre Lebensversicherung auszahlen lassen und ihm ihre Rücklagen fürs Alter geben könnte. Ach bitte …
Sie dachte an letzte Nacht – als sich der Mann vom Feuerwerk abgewandt, sie aus dem Taxi gezerrt und mit Handschellen gefesselt hatte. Er hatte sie in den Kofferraum geworfen und war dann wieder losgefahren. Erst über holpriges Kopfsteinpflaster und rissigen Asphalt, dann über glatte Straßen, ehe es wieder holprig geworden war. Am Surren der Reifen hatte sie erkannt, dass sie eine Brücke überquerten. Danach weitere Kurven, noch mehr holprige Straßen. Schließlich war der Fahrer ausgestiegen und hatte offenbar ein Tor oder irgendwelche Türen geöffnet. Ihrer Meinung nach war er in eine Garage gefahren. Der ständige Lärm der Großstadt war plötzlich abgerissen, und das Motorengeräusch des Wagens war lauter geworden, so als hallte es von nahen Wänden wider.
Dann war der Kofferraum des Taxis geöffnet worden, und der Mann hatte sie herausgezerrt. Er hatte ihr den Diamantring vom Finger gerissen und ihn eingesteckt. Dann hatte er sie an allerlei Wandbildern vorbeigeführt, grusligen Gesichtern, die sie mit ausdruckslosem Blick anstarrten: ein Schlachter, ein Teufel, drei armselige Kinder – alle auf den abbröckelnden Putz gemalt. Hatte sie in einen schimmligen Keller gezerrt und zu Boden gestoßen. Sie hatte gehört, wie er nach oben ging, sie im Dunkeln zurückließ, in diesem widerlichen Geruch – nach verfaultem Fleisch, nach Müll. Seit Stunden lag sie nun schon da, hatte ein bisschen geschlafen und viel geweint. Ein lautes Geräusch hatte sie geweckt. Ein trockener Knall. Ganz in der Nähe. Dann hatte sie wieder eine Zeit lang unruhig geschlafen.
Vor einer halben Stunde war er zurückgekommen. Hatte sie wieder in den Kofferraum steigen lassen und war etwa zwanzig Minuten durch die Gegend gefahren. Hierher. Wo immer das auch sein mochte.
Jetzt gingen sie in einen düsteren Kellerraum. In der Mitte befand sich ein dickes schwarzes Rohr. Er kettete sie mit den Handschellen daran fest, ergriff dann ihre Füße und zog sie nach vorn, sodass sie aufrecht saß. Er kauerte nieder und band ihre Beine mit einem dünnen Seil zusammen – es dauerte ein paar Minuten, denn er hatte Lederhandschuhe an. Dann stand er auf, betrachtete sie eine Zeit lang, bückte sich und riss ihre Bluse auf. Er trat hinter sie, und sie keuchte, als sie seine Hände auf ihrer Schulter spürte, wie sie tasteten, ihre Schulterblätter abdrückten.
Sie weinte, flehte ihn stumm an.
Ahnte, was ihr bevorstand.
Die Hände schoben sich tiefer, an ihren Armen entlang, glitten über ihren Bauch. Aber er fasste ihr nicht an die Brüste. Nein, seine Finger, die wie Spinnenbeine über ihre Haut wanderten, schienen vielmehr ihre Rippen zu suchen. Er betastete und streichelte sie. T. J. erschauderte und versuchte sich loszureißen. Er hielt sie fest und betastete sie weiter, drückte zu, prüfte, inwieweit die Knochen nachgaben.
Er stand auf. Sie hörte, wie sich seine Schritte entfernten. Eine ganze Zeit lang herrschte Stille, vom Ächzen der Klimaanlage und der Fahrstühle einmal abgesehen. Dann entfuhr ihr ein erschrecktes Schnauben, als sie unmittelbar hinter sich ein Geräusch hörte. Dann noch einmal. Wuschsch. Wuschsch. Sehr vertraut, aber sie konnte es nicht recht einordnen. Sie versuchte sich umzudrehen, wollte sehen, was er machte, aber es ging nicht. Was war das? Sie lauschte auf das rhythmische Geräusch, wieder und immer wieder. Und mit einem Mal war ihr, als wäre sie wieder daheim bei ihrer Mutter.
Wuschsch. Wuschsch.
Samstag morgen in dem kleinen Bungalow in Bedford, Tennessee. Der einzige Tag, an dem ihre Mutter nicht arbeiten ging, und daher ihr Putztag. Wenn T. J. von der heißen Sonne geweckt wurde, kam sie immer gleich in die Küche gestolpert, um ihrer Mutter zu helfen. Wuschsch. Sie weinte beim Gedanken daran, horchte zugleich auf das Geräusch und fragte sich, wieso, um alles auf der Welt, er so sorgfältig und peinlich genau den Boden fegte.
Er sah ihnen am Gesicht an, wie überrascht sie waren und wie unwohl sie sich fühlten.
Was bei Polizisten, die bei der Mordkommission von New York City beschäftigt waren, eher selten vorkam.
Lon Sellitto und der junge Banks (Jerry, nicht Ernie) setzten sich auf zwei staubige, unbequeme Rattansessel, auf die Rhyme mit seinem verwuschelten Kopf gedeutet hatte.
Rhyme hatte sich erheblich verändert, seit Sellitto ihn zum letzten Mal gesehen hatte, und der Detective konnte sein Erschrecken nur schwer verhehlen. Banks wusste nicht ganz, wie er das Bild, das sich ihm bot, beurteilen sollte, doch der Anblick schockierte ihn nichtsdestoweniger. Das verlotterte Zimmer, der ungepflegte Kerl, der sie argwöhnisch musterte. Und dann der Geruch – ein fauliger Gestank, der das Wesen umgab, das Lincoln Rhyme heute war.
Er bereute es zutiefst, dass er sie zu sich gelassen hatte.
»Warum hast du nicht vorher angerufen, Lon?«
»Weil du gesagt hättest, wir sollen nicht herkommen.«
Wohl wahr.
Thom kam die Treppe hoch, und Rhyme kam ihm zuvor: »Nein, Thom, du wirst nicht gebraucht.« Ihm war eingefallen, dass der junge Mann die Gäste immer fragte, ob sie etwas zu essen oder zu trinken wollten.
Verdammt, ganz die perfekte Gastgeberin.
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Sellitto, groß, zerzaust, ein alter Hase mit über zwanzig Dienstjahren, warf einen Blick in einen Karton neben dem Bett und wollte etwas sagen. Als er die Papierwindeln für Erwachsene sah, verschlug es ihm die Sprache.
»Ich habe Ihr Buch gelesen, Sir«, sagte Jerry Banks. Der junge Mann hatte, was das Rasieren anging, kein gutes Händchen – jede Menge Schnitte. Und was für eine reizende Haartolle! Guter Gott, der konnte kaum älter als zwölf sein. Je mehr die Welt verwittert, dachte Rhyme, desto jünger wirken anscheinend ihre Bewohner.
»Welches?«
»Na ja, Ihr Handbuch über Tatortarbeit natürlich. Aber ich habe das mit den Abbildungen gemeint. Das, was vor zwei Jahren rausgekommen ist.«
»Da war auch Text drin. Genau genommen sogar hauptsächlich Text. Haben Sie den gelesen?«
»Oh, na ja, sicher«, sagte Banks rasch.
Ein großer Stapel Restexemplare von Tatorte stand an einer Zimmerwand.
»Ich habe nicht gewusst, dass Sie und Lon befreundet sind«, fügte Banks hinzu.
»Ah, Lon hat also nicht das Jahrbuch gezückt? Ihnen die Bilder gezeigt? Die Ärmel hochgeschoben, auf seine Narben gedeutet und gesagt, diese Verletzungen habe ich erlitten, als ich mit Lincoln Rhyme zusammen war?«
Sellitto lächelte nicht. Tja, wenn er es darauf anlegte, konnte er dafür sorgen, dass ihm das Grinsen gänzlich verging. Der ältere Detective wühlte in seinem Aktenkoffer. Was er da wohl drin hatte?
»Wie lange wart ihr zusammengespannt?«, fragte Banks, um Konversation bemüht.
»Was für eine nette Formulierung!«, sagte Rhyme. Und schaute auf die Uhr.
»Wir waren kein Gespann«, sagte Sellitto. »Ich war bei der Mordkommission, er war Chef der IRD.«
»Oh.« Banks war jetzt noch beeindruckter. Die Leitung des Kriminaldezernats, der IRD, war einer der angesehensten Posten bei der New Yorker Polizei.
»Jawohl«, sagte Rhyme und schaute aus dem Fenster, als könnte sein Arzt auf einem Falken einreiten. »Die zwei Musketiere.«
»Sieben Jahre haben wir ab und an zusammengearbeitet«, sagte Sellitto geduldig, was Rhyme auf die Palme brachte.
»Und schöne Jahre waren das«, tönte er.
Entweder entging Sellitto der spöttische Unterton, oder aber er achtete nur nicht darauf. »Wir haben ein Problem, Lincoln«, sagte er. »Wir brauchen ein bisschen Hilfe.«
Rums. Der Papierstapel landete auf dem Nachttisch.
»Ein bisschen Hilfe?« Rhyme lachte laut auf, hauptsächlich durch die schmale Nase, die Blaine immer für das Werk eines fantasievollen Schönheitschirurgen gehalten hatte, was nicht stimmte. Sie war auch der Meinung gewesen, seine Lippen seien zu vollkommen (eine Narbe könnte nichts schaden, hatte sie einst im Scherz gesagt, und einmal hätte sie ihm im Streit fast eine zugefügt). Und warum, so fragte er sich, habe ich heute ständig ihr verlockendes Bild vor Augen? Er hatte beim Aufwachen an seine Exgemahlin gedacht und sich prompt genötigt gefühlt, ihr einen Brief zu schreiben, der in diesem Moment am Bildschirm des Computers stand. Jetzt speicherte er das Dokument ab. Alle schwiegen, während er mit einem Finger die Befehle eingab.
»Lincoln?«, fragte Sellitto.
»Ja, Sir. Ein bisschen Hilfe. Von mir. Ich hab’s vernommen.«
Banks lächelte nach wie vor, obwohl es keinerlei Anlass dazu gab, und rutschte unbehaglich auf dem Stuhl hin und her.
»Ich habe einen Termin. In, nun ja … jeden Moment«, sagte Rhyme.
»Einen Termin.«
»Einen Arzttermin.«
»Wirklich?«, fragte Banks, vermutlich um dem Schweigen zuvorzukommen, das erneut einzukehren drohte.
Sellitto, der nicht recht wusste, in welche Richtung das Gespräch eigentlich lief, fragte: »Und wie ist es dir so ergangen?«
Banks und Sellitto hatten sich bei ihrer Ankunft nicht nach seinem Befinden erkundigt. Diese Frage verkniffen sich die Leute für gewöhnlich, wenn sie Lincoln Rhyme sahen. Allzu verzwickt drohte die Antwort auszufallen, und unerfreulich war sie ganz sicherlich.
»Mir geht’s gut, danke«, sagte er nur. »Und was ist mit dir? Und Betty?«
»Wir haben uns scheiden lassen«, sagte Sellitto rasch.
»Wirklich?«
»Sie hat das Haus gekriegt und ich ein halbes Kind.« Der bullige Polizist sagte es so gezwungen fröhlich, als hätte er den Spruch schon öfter gebracht, und Rhyme vermutete, dass hinter dieser Trennung eine schmerzliche Geschichte steckte. Eine Geschichte, die er nicht hören wollte. Dennoch war er nicht überrascht, dass die Ehe in die Brüche gegangen war. Sellitto war ein Arbeitstier. Er war einer von rund hundert Detectives Ersten Grades, und zwar schon seit vielen Jahren – man hatte ihm diesen Rang verliehen, als man ihn noch für besondere Verdienste bekam und nicht aufgrund der Dienstjahre. Er hatte nahezu achtzig Stunden die Woche gearbeitet. Rhyme hatte nicht einmal gewusst, dass er verheiratet war, als sie zum ersten Mal ein paar Monate lang zusammengearbeitet hatten.
»Wo wohnst du jetzt?«, fragte Rhyme, der darauf hoffte, dass ihnen die Lust auf alles Weitere verging, wenn er über private Angelegenheiten plauderte, und er sie auf diese Weise abwimmeln konnte.
»Brooklyn Heights. Manchmal geh’ ich zu Fuß zur Arbeit. Weißt du noch, wie ich ständig irgendwelche Fastenkuren gemacht habe? Fasten bringt gar nichts. Fit muss man sich halten.«
Er wirkte weder dicker noch dünner als vor dreieinhalb Jahren. Oder vor fünfzehn Jahren.
»Ein Arzt also«, sagte Banks, der ewige Student, »haben Sie gesagt. Wegen einer …«
»Einer neuen Behandlungsmethode?«, beendete Rhyme die unvollständige Frage. »Genau.«
»Viel Glück.«
»Danke vielmals.«
Es war 11 Uhr 36. Der Vormittag war eindeutig vorbei. Säumigkeit ist bei einem Mediziner unverzeihlich.
Er sah, wie Banks zweimal seine Beine betrachtete. Er ertappte den pickligen Jüngling noch einmal dabei und war nicht weiter überrascht, als er errötete.
»Daher«, sagte Rhyme, »habe ich leider keine Zeit, euch zu helfen.«
»Aber noch ist er nicht da, der Doktor, oder?«, fragte Lon Sellitto im gleichen unnachgiebigen Tonfall, mit dem er für gewöhnlich die Ausflüchte von Verdächtigen zerpflückte.
Thom tauchte mit einer Kaffeekanne unter der Tür auf.
»Pfeife«, murmelte Rhyme tonlos.
»Lincoln hat vergessen, den Herrschaften etwas anzubieten.«
»Thom behandelt mich wie ein Kind.«
»Wem das Pantöffelchen passt«, entgegnete Thom.
»Na schön«, blaffte Rhyme. »Nehmt euch Kaffee. Ich trinke derweil einen Schluck Muttermilch.«
»Zu früh«, sagte Thom. »Die Bar hat noch nicht geöffnet.« Und wacker hielt er Rhymes finsterer Miene stand.
Wieder ließ Banks den Blick über Rhymes Körper schweifen. Vielleicht hatte er nichts als Haut und Knochen erwartet. Doch der Muskelschwund hatte nicht lange nach dem Unfall aufgehört, und sein erster Physiotherapeut hatte bis zur Erschöpfung Gymnastik mit ihm getrieben. Auch Thom, der manchmal zwar eine Pfeife sein mochte und sich mitunter wie eine alte Glucke aufführte, war ein verdammt guter Physiotherapeut. Jeden Tag unterzog er Rhyme einem passiven reziproken Bewegungsprogramm. Prüfte sorgfältig die Krampfneigung der Muskulatur, während er mit Armen und Beinen in steter Abfolge Abduktions- und Adduktionsübungen durchführte. Das reziproke Durchbewegen wirkte keine Wunder, aber es baute einen gewissen Tonus auf, half unwillkürliche Muskelkontraktionen zu unterbinden und sorgte für eine gute Durchblutung. Für jemanden, dessen Muskeltätigkeit seit dreieinhalb Jahren auf Schulter, Kopf und linken Ringfinger beschränkt war, war Lincoln Rhyme gar nicht so schlecht in Form.
Der junge Detective konnte sich nur mühsam von dem schwarzen Kasten losreißen, einem komplizierten elektronischen Steuerpult, das neben Rhymes Ringfinger stand und an ein weiteres Gerät angeschlossen war, von dem aus allerlei Kabel und Leitungen zu einem Computer und einer Schalttafel an der Wand führten.
Kabel, so hatte ein Therapeut Rhyme vor langer Zeit erklärt, sind für einen Querschnittsgelähmten der Inbegriff des Lebens. Jedenfalls bei den Reichen. Den Glücklichen.
»Heute Morgen gab es an der West Side einen Mord«, sagte Sellitto.
»Wir haben Hinweise erhalten, wonach letzten Monat einige obdachlose Männer und Frauen verschwunden sind«, sagte Banks. »Zuerst dachten wir, es handle sich möglicherweise um einen von ihnen. Aber dem war nicht so«, fügte er theatralisch hinzu. »Das Opfer ist einer dieser Leute von gestern Nacht.«
Mit ausdrucksloser Miene schaute Rhyme den jungen Mann mit dem verunstalteten Gesicht an. »Dieser Leute?«
»Er sieht sich keine Nachrichten an«, sagte Thom. »Falls Sie von der Entführung sprechen – er hat nichts davon mitbekommen.«
»Du schaust dir die Nachrichten nicht an?« Sellitto lachte. »Du warst doch der Spinner, der täglich vier Zeitungen gelesen und die Lokalnachrichten aufgezeichnet hat, damit er sie angucken kann, wenn er nach Hause kommt. Blaine hat mir erzählt, dass du sie eines Nachts mal mit irgendeiner Nachrichtentante verwechselt hast, als ihr miteinander geschlafen habt.«
»Ich lese jetzt nur noch Literatur«, sagte Rhyme großspurig. Was nicht stimmte.
»Literatur, das sind Nachrichten, die aktuell bleiben«, ergänzte Thom.
Rhyme beachtete ihn nicht.
»Ein Mann und eine Frau, die von einer Geschäftsreise an die Küste heimkamen«, sagte Sellitto. »Sind am JFK in ein Taxi gestiegen. Nie zu Hause angekommen.«
»Gegen halb zwölf ging eine Meldung ein. Das Taxi wurde in Queens auf der Stadtautobahn gesehen. Männlicher und weiblicher Fahrgast, beide weiß, auf dem Rücksitz. Sah so aus, als wollten sie das Fenster einschlagen. Haben an die Scheibe gehämmert. Keinerlei Hinweis auf Nummernschild oder Taxiplakette.«
»Dieser Zeuge – der das Taxi gesehen hat. Konnte der den Fahrer erkennen?«
»Nein.«
»Was ist mit dem weiblichen Fahrgast?«
»Keine Spur von ihr.«
Elf Uhr einundvierzig. Rhyme war stinksauer auf Dr. William Berger. »Scheußliche Geschichte«, murmelte er geistesabwesend.
Sellitto atmete lang und lautstark aus.
»Nur zu, nur zu«, sagte Rhyme.
»Er hatte ihren Ring an«, sagte Banks.
»Wer hatte was an?«
»Das Opfer. Man hat ihn heute Morgen gefunden. Er trug den Ring der Frau. Des anderen Fahrgasts.«
»Seid ihr sicher, dass es ihrer ist?«
»Ihre Initialen waren innen eingraviert.«
»Dann habt ihr es also mit einem UT zu tun«, fuhr Rhyme fort, »der euch mitteilen will, dass er die Frau hat und dass sie noch lebt.«
»Was ist ein UT?«, fragte Thom.
Als Rhyme ihn nicht beachtete, sagte Sellitto: »Ein unbekannter Täter.«
»Aber wissen Sie auch, wie er’s geschafft hat, dass er passt?«, fragte Banks, der für Rhymes Geschmack die Augen etwas zu weit aufriss. »Ihr Ring?«
»Keine Ahnung.«
»Er hat dem Typen das Fleisch vom Finger geschnitten. Ganz und gar. Bis auf den Knochen.«
Rhyme lächelte leicht. »Ah, er ist schlau, nicht wahr?«
»Wieso ist das schlau?«
»Weil er dafür gesorgt hat, dass niemand vorbeikommt und den Ring nimmt. Er war voller Blut, stimmt’s?«
»Total besudelt.«
»Dann ist der Ring also zunächst mal schwer zu sehen. Zudem läuft man Gefahr, sich Aids oder Hepatitis zu holen. Selbst wenn ihn jemand bemerkt haben sollte, hätten die meisten Menschen die Finger davon gelassen. Wie heißt sie, Lon?«
Der ältere Detective nickte seinem Partner zu, worauf dieser sein Notizbuch aufschlug.
»Tammie Jean Colfax. Hört auf die Kurzform T. J. Achtundzwanzig. Arbeitet bei Morgan Stanley.«
Rhyme stellte fest, dass Banks ebenfalls einen Ring trug. Eine Art Schulring. Der Junge war zu smart, der hatte nicht nur Highschool und Polizeiakademie hinter sich. Nichts deutete auf Militärdienst hin. Würde mich nicht wundern, wenn das Schmuckstück den Namen Yale trägt. Ein Detective der Mordkommission? Was sollte aus dieser Welt noch werden?
Der junge Cop hielt die Kaffeetasse mit beiden Händen, die ab und zu zitterten. Rhyme tippte mit dem Ringfinger kurz die elektronische Steuerkonsole von Everett & Jennings an, an der seine linke Hand festgeschnallt war, klickte etliche Befehle an und stellte die Klimaanlage niedriger. Für gewöhnlich benutzte er das Steuerpult nicht für Belanglosigkeiten wie Heizung und Klimaanlage; er sparte sie für die wirklich notwendigen Dinge auf, das Licht zum Beispiel, den Computer und sein Umblättergerät. Aber wenn es zu kalt im Zimmer wurde, lief seine Nase. Und das war eine elende Quälerei für einen Gelähmten.
»Lösegeldforderung?«, fragte Rhyme.
»Nichts.«
»Du bearbeitest den Fall?«, fragte Rhyme Sellitto.
»Unter der Leitung von Jim Polling. Ja. Und wir möchten, dass du dir den Tatortbefundbericht mal zu Gemüte führst.«
Wieder das Lachen. »Ich? Ich habe mir seit drei Jahren keinen Tatortbefundbericht mehr angesehen. Was könnte ich euch schon sagen?«
»Du könntest uns tausenderlei sagen, Linc.«
»Wer ist derzeit Chef der IRD?«
»Vince Peretti.«
»Das Abgeordnetensöhnchen.« Rhyme erinnerte sich. »Soll der ihn sich doch zu Gemüte führen.«
Ein kurzes Zögern. »Uns wär’s lieber, wenn du es machst.«
»Wer ist wir?«
»Der Chef. Meine Wenigkeit.«
»Und wie«, fragte Rhyme lächelnd wie ein Schulmädchen, »steht Captain Peretti zu diesem Misstrauensvotum?«
Sellitto stand auf und ging durch das Zimmer, blickte auf die Zeitschriftenstapel. Die Forensic Science Review. Der Katalog von Harding & Boyle, einer Firma für Laborausrüstung. The New Scotland Yard Forensic Investigation Annual. Das American College of Forensic Examiners Journal. Der Report of the American Society of Crime Lab Directors. Forensics von der CRC Press. Das Journal of the International Institute of Forensic Science. Lauter Fachliteratur über Forensik, Kriminalistik und neueste Ermittlungsmethoden.
»Schau sie dir an«, sagte Rhyme. »Die Abonnements sind seit Ewigkeiten abgelaufen. Und sie sind völlig eingestaubt.«
»Hier drin ist alles verdammt eingestaubt, Linc. Warum schwingst du deinen faulen Arsch nicht hoch und räumst den Saustall endlich auf?«
Banks war sichtlich erschrocken. Rhyme prustete laut los – ein befremdliches Gefühl. Er war weniger zugeknöpft. Seine Gereiztheit war Belustigung gewichen. Einen Moment lang bedauerte er sogar, dass er und Sellitto sich aus den Augen verloren hatten. Dann verkniff er sich die sentimentalen Anwandlungen. »Ich kann euch nicht helfen. Tut mir leid«, brummte er.
»Wir haben die Friedenskonferenz, die am Montag anfängt. Wir …«
»Was für eine Konferenz?«
»Von der UNO. Botschafter, Staatsoberhäupter. Zehntausend Würdenträger werden in der Stadt erwartet. Hast du von der Sache in London gehört, vor zwei Tagen?«
»Sache?«, wiederholte Rhyme in ätzendem Tonfall.
»Jemand hat versucht, eine Bombe in dem Hotel zu legen, in dem die UNESCO getagt hat. Der Bürgermeister hat einen Höllenschiss, dass jemand einen Anschlag auf die hiesige Konferenz verüben könnte. Er will keine bösen Schlagzeilen in der Post.«
»Und nun kommt auch noch erschwerend hinzu«, fuhr Rhyme unerbittlich fort, »dass Miss Tammie Jean ihre Heimkehr möglicherweise alles andere als angenehm fand.«
»Jerry, erzähl ihm ein paar Einzelheiten. Mach ihm den Mund wässrig.«
Banks wandte den Blick von Rhymes Beinen ab und musterte das Bett, das – wie Rhyme bereitwillig zugeben musste – auch weitaus interessanter war. Vor allem, was die Bedienung anging. Es sah aus wie ein Teil aus einer Raumfähre und kostete auch in etwa so viel. »Zehn Stunden nach dem Kidnapping finden wir den männlichen Fahrgast – John Ulbrecht – angeschossen und lebendig begraben auf dem Bahnkörper nahe der Siebenunddreißigsten Straße, Ecke Eleventh Avenue. Na ja, als wir ihn gefunden haben, war er tot. Er ist aber lebendig begraben worden. Eine .32er Kugel.« Banks blickte auf und fügte hinzu: »Der Honda Accord unter den Geschossen.«
Womit er ausdrücken wollte, dass spitzfindige Rückschlüsse auf den Täter aufgrund exotischer Waffen nicht möglich waren. Dieser Banks scheint mir ein fixer Kerl zu sein, dachte Rhyme, der lediglich unter seiner Jugend leidet, aber da wächst er noch raus. Lincoln Rhyme war der Ansicht, dass er selbst niemals jung gewesen war.
»Spuren am Geschoss?«, fragte Rhyme.
»Sechs Felder, Linksdrall.«
»Dann hat er also einen Colt«, sagte Rhyme und warf noch einmal einen Blick auf die schematische Darstellung des Tatorts.
»Sie haben ›er‹ gesagt«, fuhr der junge Detective fort. »Eigentlich müsste es ›sie‹ heißen.«
»Was?«
»Die Unbekannten. Sie sind zu zweit. Wir haben zweierlei Fußspuren zwischen dem Grab und dem Fuß der eisernen Leiter gefunden, die zur Straße hinaufführt«, sagte Banks und deutete auf das Tatortdiagramm.
»Fingerabdrücke an der Leiter?«
»Nein. Sie wurde abgewischt. Haben ganze Arbeit geleistet. Die Fußspuren führen zum Grab und wieder zurück zur Leiter. Jedenfalls müssen es zwei gewesen sein, sonst hätten sie das Opfer nicht schleppen können. Es war über zwei Zentner schwer. Einer allein hätte das nicht geschafft.«
»Fahren Sie fort.«
»Sie haben ihn zu dem Grab gebracht, reingeworfen, angeschossen und verbuddelt, sind zu der Leiter zurück, raufgeklettert und verschwunden.«
»Im Grab angeschossen?«, erkundigte sich Rhyme.
»Jawohl. Nirgendwo war eine Blutspur, weder in der Umgebung der Leiter noch auf dem Weg zum Grab.«
Rhyme stellte fest, dass ihn der Fall zumindest ein bisschen interessierte. Doch er sagte: »Und wozu braucht ihr mich?«
Grinsend bleckte Sellitto die gelben Zähne. »Wir stehen vor einem Rätsel, Linc. Jede Menge Spuren, die hinten und vorne keinen Sinn ergeben.«
»Na und?« Es kam höchst selten vor, dass sämtliche am Tatort aufgefundenen Spuren auf Anhieb einen Sinn ergaben.
»Nee, das ist eine ganz vertrackte Kiste. Lies den Bericht. Bitte. Ich lass’ ihn dir hier. Wie funktioniert das Ding?« Sellitto schaute zu Thom, der den Bericht in das Umblättergerät einlegte.
»Ich habe keine Zeit, Lon«, protestierte Rhyme.
»Das ist keine schlechte Vorrichtung«, warf Banks ein, während er auf das Gerät schaute. Rhyme antwortete nicht. Er warf einen Blick auf die erste Seite, dann las er sie genau durch. Bewegte den Ringfinger genau einen Millimeter weit nach links. Ein Gummistab blätterte die Seite um.
Er las. Dachte dabei: Na, das ist aber komisch.
»Wer war am Tatort zuständig?«
»Peretti persönlich. Als er hörte, dass es sich bei dem Opfer um einen der beiden Fahrgäste aus dem Taxi handelt, ist er hin und hat die Sache übernommen.«
Rhyme las weiter. Etwa eine Minute lang faszinierte ihn die nüchterne Sprache des Polizeiberichts. Dann schellte die Türglocke, und sein Herz schlug jählings einen Takt schneller. Er warf Thom einen Blick zu. Einen kalten Blick, mit dem er ihm klarmachte, dass er keine Zeit mehr für albernes Geplänkel hatte. Thom nickte und ging augenblicklich nach unten.
Lincoln Rhyme tilgte jeglichen Gedanken an Taxifahrer, Spuren und entführte Banker aus seinem Kopf.
»Es ist Dr. Berger«, meldete Thom über die Gegensprechanlage.
Endlich. Zu guter Letzt.
»Nun, tut mir leid, Lon. Ich muss dich jetzt bitten zu gehen. War schön, dich mal wieder zu sehen.« Ein Lächeln. »Interessanter Fall, diese Sache da.«
Sellitto zögerte einen Moment, dann erhob er sich. »Aber du liest dir doch den Bericht durch, Lincoln? Sagst uns, was du davon hältst?«
»Na klar«, sagte Rhyme und ließ den Kopf in das Kissen sinken. Querschnittsgelähmte wie Lincoln Rhyme, deren Kopf und Hals voll beweglich waren, konnten allein mit dem Kopf ein gutes Dutzend Steuerelemente bedienen. Doch Rhyme mochte sich keine Apparaturen umschnallen lassen. Ihm waren so wenige Sinnesfreuden verblieben, dass er nicht auf das Wohlgefühl verzichten wollte, das er jedes Mal genoss, wenn er den Kopf in sein Kissen kuscheln konnte, das immerhin stattliche zweihundert Dollar gekostet hatte. Der Besuch hatte ihn ermüdet. Noch nicht mal Mittag, und er wollte nichts weiter als schlafen. Seine Nackenmuskeln schmerzten.
Sellitto und Banks waren bereits an der Tür, als Rhyme sagte: »Einen Moment, Lon.«
Der Detective drehte sich um.
»Eins solltest du noch wissen. Bislang habt ihr nur den Fundort entdeckt. Aber es kommt auf den eigentlichen Tatort an – seinen Unterschlupf, den Ort, an dem er sich aufhält. Und den zu finden dürfte verdammt schwer werden.«
»Wie kommst du darauf, dass es noch einen anderen Tatort gibt?«
»Weil er das Opfer nicht im Grab angeschossen hat. Das hat er in seinem Unterschlupf getan – am eigentlichen Tatort. Und dort hält er wahrscheinlich auch die Frau fest. Vermutlich in einem unterirdischen Gelass oder in einer abgelegenen Gegend. Vielleicht auch beides … Weil er nämlich, mein lieber Banks« – Rhyme nahm dem jungen Detective das Wort aus dem Mund –, »nicht riskieren würde, auf jemand zu schießen, geschweige denn, eine Gefangene festzuhalten, wenn es sich nicht um einen verschwiegenen und abgelegenen Ort handelte.«
»Vielleicht hat er einen Schalldämpfer benutzt.«
»Auf dem Geschoss wurden keinerlei Spuren von Dämpfmaterialien festgestellt, weder Gummi noch Baumwolle«, versetzte Rhyme.
»Aber wie kann es denn angehen, dass der Mann dort angeschossen wurde?«, konterte Banks. «Ich meine, es gab keinerlei Blutspritzer am Fundort.«
»Ich vermute, dass er dem Opfer ins Gesicht geschossen hat«, erklärte Rhyme.
»Ach«, antwortete Banks, der ihn jetzt dämlich lächelnd angaffte. »Woher wissen Sie das?«
»Ein sehr schmerzhafter Schuss; man ist zu keiner Gegenwehr mehr fähig, und bei einem .32er fließt nur wenig Blut. Selten tödlich, wenn das Gehirn nicht getroffen wird. Und in diesem Zustand konnte der Unbekannte sein Opfer nach Belieben herumführen. Ich sagte der Unbekannte, Singular, weil es nämlich nur einer war.«
Eine kurze Pause. »Aber … wir haben zwei verschiedene Fußspuren.« Banks flüsterte beinahe, so als entschärfe er gerade den Zünder einer Landmine.
Rhyme seufzte. »Das Sohlenmuster ist identisch. Sie wurden von ein und demselben Mann hinterlassen, der die Strecke zweimal gegangen ist. Um uns zum Narren zu halten. Außerdem sind die nach Norden führenden Abdrücke genauso tief wie die in Richtung Süden. Was nicht sein kann, wenn er auf dem Hinweg eine zwei Zentner schwere Last getragen hat, nicht aber auf dem Rückweg. War das Opfer barfuß?«
Banks blätterte in seinen Notizen. »In Socken.«