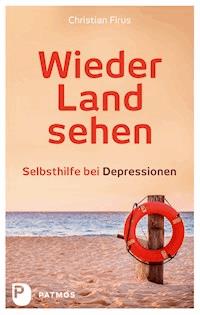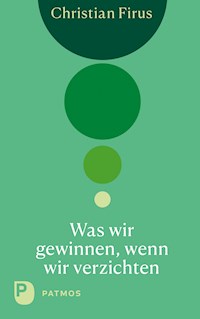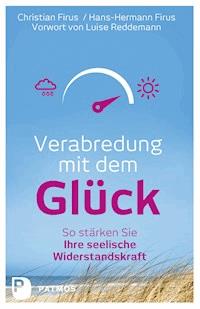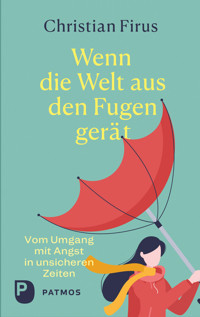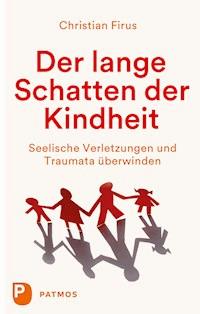
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Seelische Verletzungen und traumatische Erfahrungen in der Kindheit können sich auf das ganze Leben auswirken. Auch wenn das Leid lange zurückliegt, können Fühlen, Denken und Handeln beeinträchtigt sein. Christian Firus betrachtet die ganze Bandbreite traumatischer Erfahrungen: Es geht sowohl um körperliche und sexuelle Gewalt als auch um emotionale Verletzungen wie Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch und misslungene Bindungserfahrungen. Der Abspaltung traumatischer Erfahrungen, Dissoziation genannt, widmet Firus ein eigenes Kapitel, kommt dieses Phänomen doch viel häufiger vor, als bisher angenommen. Im zweiten Teil des Buches gibt der erfahrene Traumatherapeut Empfehlungen, wie Erwachsene ihre "schwere Kindheit" bewältigen und mehr Lebensfreude gewinnen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Firus
Der lange Schatten der Kindheit
Seelische Verletzungen und Traumata überwinden
Patmos Verlag
Inhalt
1. Einführung
2. Kindheit und ihre Spuren
a. Gewalt macht krank – die Folgen körperlicher und sexualisierter Gewalterfahrungen
b. Bindung und Bindungstraumata
c. Emotionale Vernachlässigung und emotionaler Missbrauch
3. Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen – transgenerationale Weitergabe von Traumata
4. Dissoziation – der Schleier des Vergessens und Übersehens. Was ist Dissoziation und wie kann man sie erkennen und bewältigen?
5. Verletzungen überwinden lernen
a. Das Schweigen brechen
b. Unrecht benennen und anerkennen
c. Verlust und Leid bedauern und betrauern
d. Die eigenen Kompetenzen erkennen und nutzen lernen
e. Die Opferrolle verlassen und Verantwortung für das eigene Leben übernehmen
6. Hilfreiche Instrumente – mehr als nur Reden
a. Achtsamkeit
b. Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl und Selbstberührung
c. Grenzen setzen lernen
d. Die Selbstberuhigungskompetenz stärken – Atem und Körper als Freunde und Begleiter
e. Das schlechte Gewissen als guter Ratgeber
f. Verbundenheit und In-Beziehung-Sein
7. Was ist Traumatherapie und was unterscheidet sie von anderen Psychotherapiemethoden?
8. Ausblick
9. Dank
10. Anmerkungen
11. Zitatnachweise
12. Literatur
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht – auch ein Moment der Achtsamkeit kommt unverhofft zu Besuch. Grüße und bewirte sie alle! … Behandle jeden Gast ehrenvoll … Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit – begegne ihnen lachend an der Tür, und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle wurden dir aus einer anderen Welt geschickt, um dich zu führen.
Rumi
Der Körper vergißt nicht. Wird die Erinnerung an ein Trauma im Körper in Form herzzerreißender und qualvoller Erinnerungen, Autoimmunkrankheiten und muskulo-skelettaler Probleme enkodiert, und ist andererseits die Kommunikation zwischen Geist, Gehirn und Körper der Königsweg zur Emotionsregulation, so müssen wir die Voraussetzungen unseres therapeutischen Handelns radikal überdenken und verändern.
Bessel van der Kolk
1. Einführung
Emotionale Verletzungen sind allgegenwärtig. Sie begegnen jedem von uns und sind nicht vermeidbar. Warum also darüber reden und schreiben?
In diesem Buch geht es, wie der Titel schon deutlich macht, um bedeutsame Verletzungen in den frühen Lebensjahren, die einen Schatten bis in die Gegenwart werfen. Diese Spuren gilt es näher zu betrachten, weil sie für unser heutiges Fühlen, Denken und Handeln immer noch von Bedeutung sind. So kennt vermutlich jeder emotionale Verletzungen in der Gegenwart, die sich tiefgreifender und schmerzhafter anfühlen, als es der aktuellen Situation oder dem momentanen Konflikt angemessen ist. Da trifft mich beispielsweise die Kritik eines Arbeitskollegen oder Vorgesetzten derart heftig, dass ich an mir selbst zu zweifeln beginne, mich wertlos oder tieftraurig fühle. Bei genauerer Betrachtung der Situation wird dann deutlich, dass solche Erlebnisse, die mich – wie in diesem Fall – an meinem Selbstwert zweifeln lassen, immer wieder auftauchen, sich sozusagen wie ein roter Faden durch die eigene Biographie ziehen. Der eigene »wunde Punkt«, das immer wieder auftauchende Thema, erweist sich häufig als Stolperfalle und kann Beziehungen erschweren oder zum Scheitern bringen. Genau darum soll es in diesem Buch gehen.
Meist denkt man bei gravierenden emotionalen Verletzungen an sexualisierte oder körperliche Gewalterfahrungen. Auch darum wird es in diesem Buch gehen. Weniger greifbar, aber nicht weniger folgenschwer sind hingegen subtile emotionale Verletzungen wie seelische und körperliche Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch und misslungene Bindungserfahrungen, die allerdings genauso gravierende seelische Wunden hinterlassen können wie die genannten »offensichtlicheren« Verletzungen. Auch hierbei handelt es sich um Formen von Gewalt.
Mittlerweile gibt es zahllose Erkenntnisse aus Psychotherapie und Beratungskontexten sowie aus der (neuro-)wissenschaftlichen Forschung darüber, dass all diese Erfahrungen auch an die nächste und gar übernächste Generation weitergegeben werden können, ohne dass diese direkten Kontakt mit den ursprünglich traumatischen Erfahrungen der Vorgenerationen hatten. Diese transgenerationale Weitergabe belastender Lebenserfahrungen wird uns eingehend beschäftigen. Es wird deutlich werden, dass der Zweite Weltkrieg auch nach mehr als 70 Jahren indirekt noch immer präsent ist und sich auf das persönliche Erleben und Verhalten auswirken kann.
Ein weiterer Schwerpunkt sind dissoziative Symptome infolge einer traumatischen Erfahrung. Diese treten viel häufiger auf, als man bisher dachte. Sie werden oftmals gar nicht bewusst wahrgenommen oder aber schamhaft versteckt. Dissoziation bedeutet eine Abspaltung von Wahrnehmungen, Gedächtnisinhalten, Gefühlsinhalten, Gedanken und Körpererleben. Die Beziehung zur Umwelt und zu sich selbst leidet darunter immens. Solche dissoziativen Symptome werden häufig ausgelöst durch emotional einschneidende Erlebnisse und Traumata, insbesondere durch emotionale Vernachlässigung und mangelnden Halt in den primären Beziehungen in der Kindheit und Jugend. Gerade wenn diese Muster früh gelernt sind, fühlen sie sich für die Betroffenen derart normal an, dass sie oft nicht mehr hinterfragt oder nicht einmal bemerkt werden. Sie stehen allerdings einer gesunden Lebensentfaltung sehr deutlich im Wege.
Der zweite Teil des Buches wird sich der Frage widmen, was helfen kann, die Verletzungen zu überwinden und Heilungsprozesse anzustoßen. Dabei gilt es immer wieder, die Ungerechtigkeit auszuhalten und dort aufzuräumen, wo andere Unordnung geschaffen haben. Es bleibt die Ungerechtigkeit, »die Suppe auslöffeln zu müssen, die andere einem eingebrockt haben«. Wenn allerdings Veränderung geschehen soll, das zeigt uns die Resilienzforschung, also die Forschung über die seelischen Widerstandskräfte, geht dies nur über das Verlassen der Opferrolle. Dabei hilft es, so schwer es auch fallen mag, das Geschehene zu akzeptieren. Es geht schließlich darum, Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens in der Gegenwart und Zukunft zu übernehmen.
Dies bedeutet nicht, das Geschehene auszublenden, zu vergessen oder nicht ernst zu nehmen. Im Gegenteil: Oftmals ist zunächst das genaue Hinsehen und Anerkennen des Erlittenen der erste notwendige Schritt zur Veränderung. Nicht selten beinhaltet dies dann auch Trauer- und Abschiedsprozesse. Anschließend gelingt der Blick in die Zukunft oft besser. Es ist wie mit einem schweren Rucksack, den man ablegen konnte. Der weitere Weg wird dadurch leichter.
In einem letzten Teil werden wir uns dann mit Strategien beschäftigen, die über das verbale Auseinandersetzen mit dem Trauma hinausgehen. Dabei wird es um unterschiedliche Aspekte von Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl und Selbstberührung gehen. Auch das schlechte Gewissen als Ratgeber wird zur Sprache kommen. Wir können uns bei all diesen unterstützenden Maßnahmen auf viele neue Erkenntnisse der modernen Hirnforschung berufen. Schließlich finden sich in den letzten Jahren mehr und mehr Hinweise darauf, wie Gehirn und Körper miteinander in Wechselwirkung stehen und wie sich das für unser Anliegen nutzen lässt. Die Aktivierung unseres »Beruhigungsnervs« (Parasympathikus) spielt dabei eine besondere Rolle, auf die wir zum Beispiel über die Atmung Einfluss nehmen können.
Ein erster Ansatz ist die bekannte Geschichte des Straßenkehrers Beppo aus Michael Endes Buch Momo.1 Dort erzählt der alte Straßenkehrer, dass er sich manchmal durch die schier unendlichen Länge einer Straße wie gelähmt fühle. Fange er dann an, sich zu beeilen, werde es nur schlimmer. Die Angst treibe ihn an, ohne dass er damit seinem Ziel näher kommt. Deswegen, so berichtet Beppo, habe er gelernt, die Straße in kleine Abschnitte zu zerlegen, ja, am besten nur an den nächsten Schritt und den nächsten Atemzug zu denken. Wenn ihm dies gelinge, bereite die Arbeit ihm sogar Freude. Und schließlich stelle er erstaunt fest, dass er auf diese Weise die ganze Straße gefegt hätte, ohne außer Atem zu kommen. Beppos Geheimnis entspricht einem weisen Satz aus der Traumatherapie: The slower you go, the faster you get there. Je langsamer und behutsamer du vorgehst, desto schneller kommst du an.
Ich wünsche Ihnen, dass dieses Buch Ihnen hilft, Schritt für Schritt Ihrem ganz persönlichen Ziel näher zu kommen. Lassen Sie sich von vermeintlichen Rückschlägen nicht entmutigen. Und berücksichtigen Sie immer, wo Sie gestartet sind. Nehmen Sie also sich selbst zum Bezugspunkt und vergleichen Sie sich nicht mit anderen, die oftmals ganz woanders starten konnten. Dann kann es Ihnen wie Beppo gehen: Plötzlich ist die ganze Straße gefegt!
2. Kindheit und ihre Spuren
a. Gewalt macht krank – die Folgen körperlicher und sexualisierter Gewalterfahrungen
Zu tiefreichenden Veränderungen unseres Körpers kann es nicht nur durch chemische Stoffe und Toxine kommen, sondern auch durch die Art, wie zwischen der sozialen Welt und der »fest vernetzten« Welt Kommunikation stattfindet.
Moshe Szyf
Hr. P. ist 37 Jahre alt und wurde in Deutschland als zweites Kind seiner Eltern geboren, die aus Ex-Jugoslawien stammen. Die Eltern sind muslimischen Glaubens. Dies gab Anlass zu einer Beschneidungszeremonie, die offenbar überfallsartig und ohne Narkose an dem damals sechs- oder siebenjährigen Jungen erfolgte. Erst nachdem Herr P. im Verlauf eines zehnwöchigen stationären psychosomatischen Klinikaufenthaltes genug Vertrauen aufgebaut hat, berichtet er mehr und mehr äußerst schamhaft von andauernder Gewalt durch die Schläge seiner Eltern über die gesamte Kindheit hinweg. Dies weist erstmals auf einen traumatischen Hintergrund der bis dahin äußerst leidvollen Krankengeschichte hin.
Diese beginnt mit einem Skiunfall, der zur Entwicklung chronischer Schmerzen des linken Kniegelenks führt. Und wie so häufig werden die Schmerzen im Laufe der Zeit stärker, breiten sich auf andere Bereiche des Körpers aus und chronifizieren. Kompensatorisch nimmt Herr P. Fehlhaltungen ein, die ihrerseits Schmerzen in unterschiedlichen Regionen des Körpers bis hin zu den Schultergelenken verursachen. Eine Operation führt zu keinerlei Verbesserung, eine erste orthopädische Rehabilitationsmaßnahme bricht Herr P. ab. Bei einer Umschulungsmaßnahme bricht er die Probezeit ab, da er nicht ausreichend belastbar ist. Schließlich gelingt ihm ein Ausbildungsabschluss trotz massivster Fehlzeiten sieben Jahre nach dem Unfall, eine Integration in den Arbeitsmarkt allerdings scheitert bis heute. Vielmehr schreitet die körperliche Invalidität fort, eine Fortbewegung ist nur noch an beidseitigen Unterarmgehstützen möglich, das Verlassen des Hauses wird zur Herausforderung und Qual, soziale Kontakte hat Herr P. kaum noch.
In der durchgeführten Testdiagnostik zeigt sich eindrucksvoll eine massive dissoziative Symptomatik auch im Sinne einer somatoformen Dissoziation, das meint das Eigenleben körperlicher Symptome mit oft ausgeprägten Schmerzen ohne eine organische Erklärung (mehr dazu im Kapitel 4 »Dissoziation«). Und es bedeutet, dass der Körper wesentliche Aspekte der traumatischen Belastung trägt, wie dies auch im Rahmen der Forschung über sozialen Schmerz eindrucksvoll belegt werden konnte. So wissen wir spätestens seit den Forschungen von Naomi Eisenberger2 von der Tatsache, dass Zurückweisung, Kränkung und auch seelische Verletzung in den gleichen Hirnregionen verarbeitet werden wie körperlicher Schmerz.
Beide Erlebnisse, unfallbedingte Schmerzen und verschiedene seelische Verletzungen, finden sich in der Biographie von Herrn P., so dass nachvollziehbar wird, warum ein eher kleinerer Skiunfall eine derartige Krankengeschichte bis hin zu Invalidität nach sich ziehen konnte. Die frühen Erfahrungen von Gewalt, Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein, wie sie insbesondere szenisch in der Beschneidung ohne Betäubung kumulieren, bilden den Nährboden für die hier beschriebene leidvolle Schmerzgeschichte. Vor dem Hintergrund von sicherlich auch kulturell bedingter Scham war die Dissoziation der traumatischen Erlebnisse ein Lösungsversuch, verbunden mit dem hohen Preis der »Verkörperung« des unsäglichen seelischen Leidens bis hin zur Invalidität.
Im Rahmen der nun erstmals erfolgten psychosomatischen Behandlung konnten vorsichtig erste Zusammenhänge der bisher unverbundenen Ereignisse in der Lebensgeschichte hergestellt werden. Die Integration in eine Traumatherapiegruppe ermöglichte Herrn P., zunächst sehr zaghaft die Schamschwelle zu übertreten. Herr P. erlebte es als hilfreich, das bisher unerklärliche körperliche Erleben als normale Reaktion auf abnormale Lebenserfahrungen verstehen zu lernen und in diesem Rahmen erstmals Wertschätzung und Toleranz sich selbst gegenüber zurückzugewinnen. Er lernte schrittweise, Auslöser (Trigger) zu erkennen und diese in Ansätzen auch besser zu kontrollieren. Er erlernte Imaginationsübungen, die ihm halfen, den inneren Schreckensbildern hilfreiche und konstruktive Gegenentwürfe gegenüberzustellen. Auch dies trug zu einer leichten Stabilisierung bei. Selbstverständlich erfolgte auch eine intensive Physiotherapie, die den körperlichen, insbesondere durch Fehlhaltung verursachten Einschränkungen entgegenwirkte.
Vor dem Hintergrund der erheblichen, über die gesamte Kindheit und Jugend fortgesetzten Traumatisierung blieb auch nach einem zehnwöchigen stationären Aufenthalt die Prognose vage und offen. Zum Entlassungszeitpunkt konnte im Hinblick auf die Erwerbsfähigkeit letztlich nur zu einer zeitlich befristeten Rente geraten werden, die es Herrn P. erlauben könnte, aus dem Kreislauf des hohen Leistungsanspruchs und des Sich-beweisen-Müssens auszusteigen, um sich im Rahmen intensivierter ambulanter traumaspezifischer Psychotherapie und fortgesetzter Physiotherapie langsam zu stabilisieren.
Diese Krankengeschichte zeigt eindrucksvoll: Gewalt macht krank, nicht nur die Seele, sondern genauso den Körper, der oft unbemerkt die Last der Erinnerung trägt.3 Hierfür gibt es mittlerweile gute wissenschaftliche Belege. Nicht selten treten Schmerzzustände genau an den Stellen auf, die während des Traumas verletzt wurden.4 Diese Patientengeschichte zeigt auch, dass es Behandlungswege gibt, die mitunter verschlungen und langwierig sind, und sie verweist drittens darauf, dass es gesellschaftlich immer wieder neu darum geht, jeglicher Form von Gewalt frühestmöglich entgegenzutreten.
Die Tatsache, dass Gewalt krank macht, scheint auf eigentümliche Weise tabuisiert, oder sollte ich besser sagen, dissoziiert zu sein. Denn wir sind von Gewalt umgeben, davon zeugt die tägliche Nachrichtenflut genauso wie die üblichen Fernsehprogramme mit brutalen Gewaltszenen im Abendprogramm.
Die Traumaforschung der letzten zwanzig Jahre hat sich viel mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges beschäftigt, nicht nur für die Generation der direkt Betroffenen, sondern auch für die Nachgeborenen (siehe Kapitel 3). Auch die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung wurde infolge eines Krieges, nämlich des Vietnamkrieges, eingeführt. Es hatte sich eine derart breite Protestbewegung im amerikanischen Mittelstand formiert, so dass man über die Folgen von Kriegstraumata nicht mehr hinwegsehen konnte.
Wir kennen Gewalt aus den Geschichtsbüchern, die von unzähligen Kriegen zeugen, und verbinden sie mit der gegenwärtigen Flüchtlingsthematik. Wir verfolgen sie meist emotional distanziert im Wohnzimmer am Fernsehbildschirm in unzähligen auch für Kinder zugelassenen Produktionen. Damit lenken wir jedoch davon ab, dass Gewalt jenseits kriegerischer Auseinandersetzungen und deren Folgen auch bei uns täglich stattfindet, nämlich in den Wohnzimmern selbst. Berichtet wird über diese häusliche Gewalt fast nie! Nur die Spitze des Eisbergs gelangt an die Oberfläche, meist erst dann, wenn ein Kind tot aufgefunden wurde oder prominente Persönlichkeiten sich »outen«.
Die Zahlen zur Gewalt an Kindern sind so erschütternd, dass man sie kaum glauben mag: Im Jahr 2015 schätzten deutsche Jugendämter in 45.000 Fällen das Wohl eines Kindes in Deutschland als akut oder latent gefährdet ein. Knapp ein Viertel dieser Kinder wies Zeichen körperlicher Misshandlung auf, etwa 64 Prozent Anzeichen von Vernachlässigung. Trauriger Höhepunkt sind 130 getötete Kinder im Jahr 2015.
In 12.500 Fällen berichtet die Kriminalstatistik der Polizei im selben Zeitraum von angezeigter sexualisierter Gewalt an Kindern und schätzt die Dunkelziffer viel höher ein. Dabei handelt es sich auch um Taten in der digitalen Welt, wie zum Beispiel Cybersex und das Ausnutzen von Nacktfotos zu pornographischen Zwecken.
Insgesamt kann man davon ausgehen, mehr als 10 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland sexualisierte Gewalt vor ihrer Volljährigkeit erleben und in jeder Schulklasse im Durchschnitt ein bis zwei Schülerinnen und Schüler betroffen sind. Der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Johannes-Wilhelm Rörig geht Anfang 2016 nach aktuellen Zahlen davon aus, dass aktuell rund eine Million Kinder in Deutschland von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Die Statistiker meinen damit die Lebensspanne von 0 bis 11 Jahren.
Seit Jahren ist bei sexualisierter Gewalt trotz aller Skandale im letzten Jahrzehnt leider kein Rückgang zu verzeichnen. Die Behörden wie Jugendämter schreiten nur bei wenigen Fällen sexuellen Missbrauchs ein, die größere Zahl der Fälle wird nicht zur Anzeige gebracht und bleibt unerkannt und ungeahndet. Das bedeutet, dass sexueller Missbrauch von der Häufigkeit her mit der Volkskrankheit Typ-2-Diabetes vergleichbar ist, um die man sich weit mehr kümmert als um die Eindämmung und die Folgen sexualisierter Gewalt. Dabei belaufen sich die daraus entstehenden geschätzten Kosten auf jährlich elf5 bis dreißig Milliarden Euro6, wenn man alle direkten Aufwendungen wie medizinische und psychotherapeutische Kosten sowie indirekten Kosten vom Einsatz von Behörden bis zur möglichen Frühberentung berücksichtigt.
Das Ausmaß sexualisierter Gewalt im Kindesalter ist und bleibt extrem hoch. Andere Autoren haben in einer repräsentativen Studie versucht, das gesamte Spektrum von Gewalt in Kindheit und Jugend in Deutschland zu erfassen, indem sie Menschen von 14 bis 90 Jahren über ihre Erfahrungen in dieser Zeit rückblickend befragt haben. Danach geben etwa 3 Prozent körperliche Misshandlung, 2 Prozent sexuellen Missbrauch, 7 Prozent schwere emotionale Vernachlässigung und 11 Prozent schwere körperliche Vernachlässigung an.7 Mehrfachnennungen waren möglich und müssen bei der Betrachtung der Zahlen berücksichtigt werden. Wer in Kindheit und Jugend Opfer von Gewalt wurde, hat ein deutlich höheres Risiko, auch im weiteren Leben wieder Gewalt zu erleben. Auch vor diesem Hintergrund sind die deutsche und europäische Frauenstudie zu Gewalterfahrungen zu sehen, die einen Teilaspekt des langen Schattens der Kindheit widerspiegelt.
Ich zitiere die Ergebnisse deswegen in diesem Zusammenhang, weil sie einerseits häufig frühere Gewalterfahrungen fortsetzen, andererseits in vielen Partnerschaften Kinder als Zeugen und auch direkt Betroffene von dieser Epidemie an Gewalt betroffen sind. Und alleine die Zeugenschaft vermag ähnlich verstörend und traumatisierend zu wirken wie direkte Gewalt. Insofern kann und muss man bei all den folgenden Zahlen die Millionen Kinder mitdenken, die mit Angst und Entsetzen Gewalt miterleben. Die meisten haben keinen Ort für diese Gefühle, mit denen sie oft über Jahre aufwachsen, und sie haben ihren äußeren sicheren Ort verloren. Aus Angst und Loyalität mit den Eltern resultiert Schweigen, innerer und äußerer Rückzug (Freunde können und dürfen in der Regel nicht mit nach Hause gebracht werden), Abspaltung von Gefühlen bis hin zur Resignation. Die im Jahre 2004 veröffentlichte großangelegte Bielefelder Frauenstudie an 10.000 Frauen kam zu folgendem erschreckenden Ergebnis: 25 Prozent der Frauen zwischen 16 und 65 Jahren waren von körperlicher oder sexueller Gewalt durch einen aktuellen oder ehemaligen Beziehungspartner betroffen. 40 Prozent der interviewten Frauen gaben an, mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt in irgendeiner Form erlebt zu haben. 13 Prozent aller Frauen gaben im Rahmen dieser Befragung, die mit hohem Aufwand in Form persönlicher Interviews betrieben wurde, sogar an, dass die Form der sexualisierten Gewalt eine strafrechtlich relevante Dimension erreicht hatte. Fast jede zweite Frau hat nach dieser Studie Gewalterfahrungen gemacht, etwa jede achte könnte dies anzeigen!
2014 veröffentliche die EU-Grundrechte-Agentur (FRA) eine ähnliche Studie8, die Gewalterfahrungen von Frauen in den 28 EU-Mitgliedsstaaten erfasste. Befragt wurden dazu Frauen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren, mit einem ähnlichen Ergebnis wie in der deutschen Studie. Jede dritte Frau in der EU hat seit ihrer Jugend demnach körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt – das sind etwa 62 Millionen. Fünf Prozent davon sind als Erwachsene vergewaltigt worden, heißt es in der Studie. 22 Prozent haben Gewalt in einer Partnerschaft erlebt. Unglaubliche 43 Prozent erfahren psychische Gewalt durch ihren aktuellen oder einen früheren Partner, beispielsweise durch Stalking. Und wiederum mehr als ein Drittel gibt an, in der Kindheit körperliche oder sexualisierte Gewalt durch Erwachsene erlitten zu haben, 12 Prozent waren von sexualisierter Gewalt betroffen, 27 Prozent erlebten eine Form von körperlichem Missbrauch. Und wie immer ist das Verschweigen groß: 67 Prozent meldeten die schwerwiegendsten Gewaltvorfälle innerhalb einer Partnerschaft nicht der Polizei.
Das Kinderhilfswerk Unicef veröffentliche im November 2017 eine internationale Studie zu Gewalt an Kindern und Jugendlichen, aus der unter anderem hervorgeht, dass alleine etwa 300 Millionen Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren weltweit körperliche und/oder emotionale Gewalt erleiden.9 Sucht man den internationalen Vergleich, so findet sich Deutschland im oberen Drittel der Häufigkeit von Gewalttaten.
In internationalen Studien wird die Lebenszeitprävalenz allein von körperlicher Gewalt durch den Partner, meist, aber nicht immer sind das die Männer, in Australien, USA und Großbritannien mit 23 bis 41 Prozent angegeben. In den USA gaben über 50 Prozent die Erfahrung von körperlicher oder sexualisierter Gewalt an. Hierbei sind auch Erfahrungen in Kindheit und Jugend gemeint, die beide Geschlechter treffen. In der nicht westlichen Welt sehen die Zahlen noch erschreckender aus. In der äthiopischen Provinz konnten Epidemiologien feststellen, dass 71 Prozent der Frauen Gewalterfahrungen gemacht haben.10 Und auch hier gilt: Das Leid der Kindheit setzt sich fort.
Das Erschreckende an all diesen Zahlen ist auch, dass der Täter zumeist der eigene Partner ist. Hierbei gibt es keinen Schichtunterschied. Meist bleibt die Gewalt verborgen, nur jede fünfte Frau sucht in Deutschland deswegen medizinische Behandlung auf.11 Selbst akute Verletzungen werden häufig aufgrund von Angst, Scham- und Schuldgefühlen vertuscht, der Täter bleibt verschont. Und auch hier spielen häufig frühe Kindheitserfahrungen mit einem ähnlichen Muster eine wichtige Rolle. Das bekannte und vertraute Verhalten wird fortgesetzt. Es ist tief verankert und eingespielt. Jede Veränderung benötigt eine bewusste Entscheidung und eine durchaus schmerzhafte Abkehr vom Vertrauten, so destruktiv es auch sein mag. Darauf werde ich später noch ausführlicher eingehen.
Nicht immer tritt Gewalt derart offensichtlich auf, dass sie auch von Außenstehenden wie zum Beispiel Nachbarn oder auch Ärzten gesehen werden kann. Oft ist sie verdeckt und subtil und geht dennoch mit erheblichen Folgen für Leib und Leben einher. Wieners und Hellbernd12 unterscheiden folgende Formen von Gewalt: Körperliche, sexualisierte, psychische, ökonomische und soziale Gewalt. Unter psychischer Gewalt beispielsweise verstehen sie die Androhung von Gewalt, Beleidigung und Demütigung, Essensentzug und Einschüchterungen. Unter ökonomischer Gewalt werden Arbeitsverbot oder Zwang zur Arbeit, aber auch alleinige finanzielle Verfügungsmacht durch den Partner, in der Regel durch den Mann, verstanden. Soziale Gewalt meint das Bestreben des Partners, ebenfalls leider in der Regel des Mannes, die Frau sozial durch Kontaktverbot und Kontrolle zu isolieren.
All diese Formen von Gewalt in den eigenen vier Wänden wurden lange Zeit als Privatsache behandelt. Erst im Jahr 2002 griff der Gesetzgeber mit dem Gewaltschutzgesetz endlich ein. Seither ist es Opfern möglich, zivilrechtliche Annäherungs- und Kontaktverbote beim Amtsgericht zu beantragen. Verstöße können mit Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr geahndet werden. So ist ein Opfer nun nicht mehr zum Auszug aus der eigenen Wohnung gezwungen. Die Angst bleibt oftmals dennoch bestehen.
Nach diesem Exkurs zu der Allgegenwart von Gewalt über die gesamte Lebensspanne möchte ich den Blick wieder auf die Kindheit und Jugend richten.
Konstantin Wecker hat Erfahrungen sexualisierter Gewalt in einen einfühlsamen Liedtext gekleidet, der sich dem anzunähern versucht, was oft unsagbar und unbeschreiblich bleibt, und der die Folgen bis in die Gegenwart ausführt, aber auch Mut zum Neuanfang und zur Veränderung macht:
Ein hartes Wort, ein scharfer Ton, ein strenger Blick verschließt Dein Herz, Du rennst davon in Dich zurück.
Dann bist Du unversöhnlich, nur mit Dir allein. Wie kommt man denen auf die Spur, die schweigend schrein.
Erst als Du ihn im Traum verfluchtest, wurde mir klar, daß Dir der Vater, den Du suchtest, nichts als der erste war.
Du warst sein Spielzeug, sein Vergnügen – Kind warst Du nicht. Er mag vielleicht die ganze Welt belügen – sich selber nicht.
Du müßtest ewig weiterschweigen, wenn Du entfliehst, jetzt soll er sich der Welt so zeigen, wie Du ihn siehst.
Du bist verstummt, er hat’s befohlen, Dein Herz läuft leer. Wenn Du Dich nackt siehst, ganz verstohlen, schämst Du Dich sehr.
Es fällt Dir schwer, Dich endlich wieder schön zu sehen. Wer fliegen will, muß sein Gefieder mit Schmerz erstehen.
Ich muß noch lernen zu verstehen: Ich bin nicht gemeint, wenn es in Dir wie aus Versehen und plötzlich weint.
Du warst nur Spielzeug, nur Vergnügen, Kind warst Du nicht. Man kann zur Not die ganze Welt belügen, sich selber nicht.
Du müßtest ewig weiterschweigen, wenn Du jetzt fliehst, kannst Dich der ganzen Welt doch zeigen, wie Du Dich siehst.13
Den Zirkel der Gewalt möglichst frühzeitig zu durchbrechen, ist auch deswegen so bedeutsam, weil Gewalt nicht folgenlos bleibt. Gewalt hinterlässt zahllose körperliche und seelische Narben, schwere, mitunter lebensbedrohliche körperliche Verletzungen wie Schädel-Hirn-Traumata genauso wie subtile seelische Veränderungen. Nicht selten vergehen Jahre oder Jahrzehnte, bis sich Symptome zeigen, die zunächst nicht mit den Gewalterfahrungen der Vergangenheit in Verbindung gebracht werden. Das gesamte Spektrum psychischer Erkrankungen kann damit in Zusammenhang stehen.
Dass die Folgen von Gewalt noch viel subtiler sind, zeigt die große prospektive Studie von Felitti, die 1995 begann und bis heute fortgesetzt wird. Mehr als 17.000 US-Amerikaner wurden in diese ACE-Studie (Adverse Childhood Experiences Study) einbezogen und seither regelmäßig standardisierten Nachuntersuchungen unterzogen. Dabei wurden sie nach ihren negativen Kindheitserfahrungen gefragt, wie zum Beispiel Gewalt, Vernachlässigung oder auch Aufwachsen mit suchtkranken Elternteilen. Insgesamt werden dabei zehn Kategorien traumatischer oder gewaltsamer Kindheitserfahrungen erfasst und mit dem aktuellen Gesundheitszustand im mittleren Erwachsenenalter etwa ein halbes Jahrhundert später in Beziehung gesetzt. Es zeigte sich eine klare Dosis-Wirkung-Beziehung: Je mehr frühe negative Erfahrungen, desto gravierender waren die psychosomatischen Folgen im Erwachsenenalter.
Überraschend an dieser Studie war vor allem, dass dieser Zusammenhang nicht nur im Hinblick auf psychische Folgen wie Depression, Selbstmordversuche, Suchterkrankungen oder Medikamentenmissbrauch zutraf, sondern genauso im Hinblick auf die großen Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus, Herzinfarkte, Lebererkrankungen, Fettleibigkeit und chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Somit erwiesen sich Kindheitstraumatisierungen als höchst bedeutsame Prädiktoren für jene schweren körperlichen Erkrankungen, die zu den häufigsten Todesursachen zählen und das Gesundheitswesen infolgedessen stark in Anspruch nehmen.14
Schließlich zeigt sich, dass ein erhöhter ACE-Wert auch mit einem niedrigeren Einkommen, finanziellen Schwierigkeiten und vermehrter Arbeitsunfähigkeit einhergeht. Die Folgen sind somit auf körperlicher, seelischer und gesellschaftlich-sozialer Ebene zu finden.
Diese Studie ist auch deswegen so besonders, weil sie, wie man vielleicht spontan annehmen würde, keine gesellschaftliche Randgruppe befragte. Vielmehr handelte es sich bei den Teilnehmern um mehrheitlich weiße, relativ gut ausgebildete Mittelschicht-Amerikaner, denen es finanziell so gut ging, dass sie sich eine Krankenversicherung (um deren Daten handelte es sich) leisten konnten. Dennoch berichtete nur ein Drittel über keine schädlichen Kindheitserlebnisse! Eine wahre Epidemie!
Die Auswirkungen von Gewalt gehen leider auch noch darüber hinaus. Wer in früher Kindheit Gewalt und Missbrauch erlebt hat, wird auch im Erwachsenenalter, wie schon erwähnt, überzufällig häufig erneut Opfer von Beziehungsgewalt. In der Psychologie spricht man vom Wiederholungszwang. Die Erkenntnisse der Hirnforschung zeigen, dass sich das auch erklären lässt. Klaus Grawe konnte in seiner Konsistenztheorie zeigen, dass unser Gehirn auf Bekanntes und Vertrautes positiv reagiert, selbst wenn es rational schädlich oder gar destruktiv erscheint.15 So resultiert ein Annäherungsverhalten in Bezug auf vertraute (Beziehungs-)Muster. Wer hier eine Veränderung erreichen möchte, muss wissen, dass sich diese aus genau diesem Grund zunächst fremd und unpassend anfühlt. Im Laufe der Zeit wird sich das ändern.
Leider wächst mit Gewalterfahrungen in der Kindheit nicht nur die Wahrscheinlichkeit, eine Posttraumatische Belastungsstörung oder auch alle anderen bisher geschilderten körperlichen und seelischen Langzeitfolgen zu entwickeln. Sondern insbesondere für Männer gilt, dass mit der eigenen Gewalterfahrung die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie ebenfalls gewalttätig werden. So werden aus Opfern häufig Täter, ein gefährlicher Kreislauf, der nur bewusst und entschieden beendet werden kann. Schweigen hilft nur dem Täter und setzt den Teufelskreis von Gewalt in der Regel fort.
Gewalterfahrungen in der Kindheit gehen einher mit dem Gefühl von Ausgeliefertsein, Hilflosigkeit, Kontrollverlust, Erniedrigung, Scham, Schuld und Ohnmacht. Die Folge ist nicht selten erlernte Hilflosigkeit – ich schaffe das sowieso nicht und deshalb lohnt sich Anstrengung auch nicht –, die im weiteren Leben die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, einer der wichtigsten Faktoren für seelische Gesundheit, nachhaltig schwächt. Mit den Auswirkungen auf die Bindungsfähigkeit beschäftigt sich das nächste Kapitel.
Die aus solchen Erfahrungen heraus entwickelten Persönlichkeitseigenschaften sind zunächst als Reaktion auf und als Schutz vor Demütigung und Verletzung zu verstehen, sie sind Überlebensstrategien. So erklärt sich auch ihr Fortbestehen bis ins Erwachsenenalter. Wenn wir in der Ursprungsfamilie Gewalt erlebt haben, tun wir zunächst gut daran, uns durch Rückzug und Misstrauen vor erneuter Verletzung zu schützen. Wenn wir dieses Muster allerdings beibehalten, verhindern wir gegenteilige Erfahrungen und Korrekturen im späteren Leben. So kann es passieren, dass wir weiterhin keine oder nur unzureichend unterstützende Beziehungen eingehen, aus Angst vor erneuter Enttäuschung.
Auch die Folgen für das Gefühlsleben sind bedeutsam. Häufig können traumatisierte Menschen ihre unangenehmen Gefühle nur als diffuse unerträgliche Spannung wahrnehmen, ohne dabei unterscheiden zu können, ob es sich um Angst, Wut, Traurigkeit, Verzweiflung oder anderes handelt. Sie wurden in den ersten Jahren ihres Lebens nicht dabei unterstützt, ihr eigenes Gefühlsleben besser zu verstehen, wie es in der frühen Zwiesprache zwischen Eltern und ihren Kindern normalerweise erlernt wird. Wenn ein Kind beispielsweise gestürzt ist und anschließend von einem Elternteil tröstend in die Arme geschlossen wird und dabei die Erklärung erhält, dass es jetzt wehtut, Tränen berechtigt sind, der Schmerz aber vergehen wird, dann kann hierdurch einerseits eine Gefühlsdifferenzierung und andererseits ein Vertrauen ins Leben entstehen, an dem es traumatisierten Menschen häufiger mangelt.
Sie werden vielmehr oft von intensiven Gefühlen überflutet, deren Intensität sie unter Umständen nur mit Gewalt an sich selbst oder anderen beantworten können oder mit Rückzug und Vermeidung von Kontakt, was erneut mit Gefühlen von Isolation und Wertlosigkeit einhergeht. »Besser nicht fühlen«, lautet die früh verinnerlichte Konsequenz, mit der fatalen Folge, dass auch die positiven Gefühle nicht wahrgenommen werden.