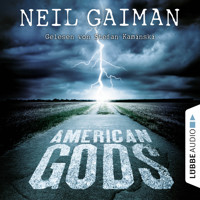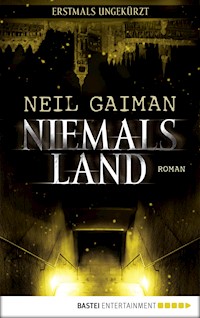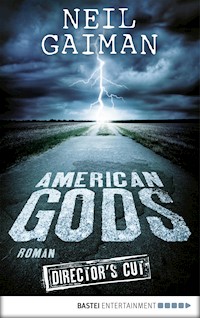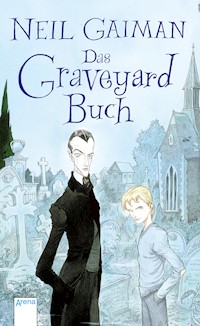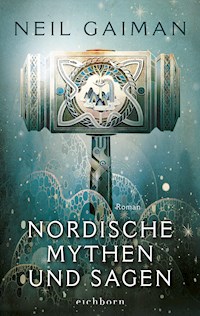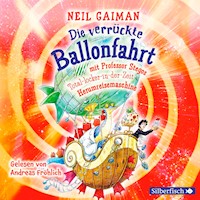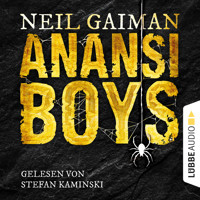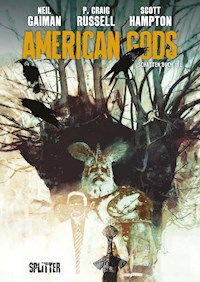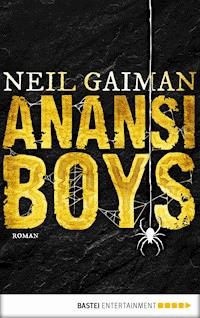Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
"Ich habe dieses Jahr nichts mit größerer Begeisterung gelesen!" Daniel Kehlmann
Es war nur ein Ententeich, ein Stück weit unterhalb des Bauernhofs. Und er war nicht besonders groß. Lettie Hempstock behauptete, es sei ein Ozean, aber ich wusste, das war Quatsch. Sie behauptete, man könne durch ihn in eine andere Welt gelangen. Und was dann geschah, hätte sich eigentlich niemals ereignen dürfen ...
Weise, wundersam und hochpoetisch erzählt Gaiman in seinem neuen Roman von der übergroßen Macht von Freundschaft und Vertrauen in einer Welt, in der nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:4 Std. 25 min
Sprecher:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Vorspann
Prolog
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Epilog
Danksagungen
Kurzgeschichte – Eine Abenteuergeschichte und Der Schwarze Hund
Über dieses Buch
Anlässlich einer Beerdigung kehrt ein Mann mittleren Alters in seinen Heimatort zurück. Das Haus, in dem er aufwuchs, steht längst nicht mehr, doch es zieht ihn zu der Farm am Ende der Straße. Hier lebte früher Lettie Hempstock mit ihrer Mutter und Großmutter. Der Mann hat seit Jahrzehnten nicht mehr an die außergewöhnliche Lettie gedacht. Doch nun kehren die Erinnerungen wieder zurück: an den Ententeich, der angeblich ein Ozean sein soll. An eine Vergangenheit, die zu seltsam, zu beängstigend und zu gefährlich ist, als dass sie jemandem hätte widerfahren dürfen, schon gar nicht einem kleinen Jungen. Weise, wundersam und hochpoetisch erzählt Gaiman in seinem neuen Roman von der übergroßen Macht von Freundschaft und Vertrauen in einer Welt, in der nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint.
Über den Autor
Neil Gaiman hat über 20 Bücher geschrieben (darunter American Gods, Sternwanderer und Niemalsland) und ist mit jedem großen Preis ausgezeichnet worden, der in der englischen und amerikanischen Buch- und Comicszene existiert. Geboren und aufgewachsen ist er in England. Inzwischen lebt er in Cambridge, Massachusetts, und träumt von einer unendlichen Bibliothek. Besuchen Sie den Autor unterwww.neilgaiman.com.
NEIL GAIMAN
DER OZEANAM ENDEDER STRASSE
Roman
ÜBERSETZUNG AUS DEMBRITISCHEN ENGLISCHENVON HANS RIFFEL
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Ocean at the End of the Lane«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Neil Gaiman
Published by arrangement with Neil Gaiman
This book was negotiated through Literary Agency Thomas Schlück
GmbH, 30827 Garbsen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln
Illustrationen: Jürgen Speh, Deckenpfronn
Textredaktion: Hanka Jobke, Berlin
Lektorat: Ruggero Leò
Umschlaggestaltung: © Guter Punkt, München/www.guter-punkt.de
Umschlagmotive: Anke Koopmann, Guter Punkt, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock und Thinkstock
Für die Originalausgaben:
»Adventure Story« copyright © 2012 by Neil Gaiman.
First published in McSweeney’s Issue #40.
»Black Dog« copyright © 2015 by Neil Gaiman.
First published in »Trigger Warning«, William Morrow, HarperCollins Publishers 2015.
Vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Textredaktion: Sabine Biskup
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-5832-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Amanda,
die es wissen wollte.
An meine Kindheit erinnere ich mich lebhaft … ich wusste schreckliche Dinge. Aber ich wusste auch, dass die Erwachsenen nicht wissen durften, was ich wusste. Es hätte sie in Angst versetzt.
Maurice Sendak
im Gespräch mit Art Spiegelman
The New Yorker, 27. September 1993
Es war nur ein Ententeich, ein Stück weit unterhalb des Bauernhofs. Und er war nicht besonders groß.
Lettie Hempstock behauptete, es sei ein Ozean, aber ich wusste, das war Quatsch. Sie behauptete, sie wären von jenseits des Ozeans hierhergekommen, aus der Heimat.
Ihre Mutter sagte, Lettie könne sich nicht mehr richtig daran erinnern, schließlich sei es schon lange her, und außerdem wäre ihre Heimat untergegangen.
Die alte Mrs. Hempstock – Letties Großmutter – behauptete, sie hätten beide unrecht, und das Land, das untergegangen sei, wäre gar nicht ihre Heimat gewesen. Sie sagte, an ihre wirkliche Heimat könne sie sich noch erinnern.
Sie behauptete, ihre wirkliche Heimat wäre in die Luft geflogen.
PROLOG
Ich trug einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und schwarze, auf Hochglanz polierte Schuhe: Kleider, in denen ich mich normalerweise höchst unwohl gefühlt hätte, wie in einer gestohlenen Uniform oder wie ein Kind, das vorgibt, erwachsen zu sein. Heute waren sie mir jedoch ein Trost. Ich trug die richtigen Kleider für einen schweren Tag.
Heute Morgen war ich meiner Pflicht nachgekommen; ich hatte Worte gefunden, die dem Anlass angemessen waren, und ich hatte sie ehrlich gemeint. Dann, nach dem Gottesdienst, war ich in mein Auto gestiegen und ziellos durch die Gegend gefahren, weil ich noch eine Stunde totschlagen musste, bevor ich mich wieder mit irgendwelchen Leuten traf, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, um Hände zu schütteln und aus dem Festtagsgeschirr zu viele Tassen Tee zu trinken. Ich fuhr kurvenreiche Landstraßen entlang, an die ich mich nur halb erinnerte, durch Sussex, bis ich mich, ohne mir dessen richtig bewusst zu sein, wieder auf dem Rückweg ins Stadtzentrum befand. Also bog ich ab, völlig wahllos, erst nach links, dann nach rechts. Erst da wurde mir bewusst, wohin ich fuhr, wohin ich schon die ganze Zeit über gefahren war, und ich schüttelte den Kopf über meine eigene Dummheit.
Mein Ziel war ein Haus, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gab.
Ich überlegte, ob es nicht besser wäre umzukehren. Und während ich einer breiten Straße folgte, die einmal ein Kiesweg gewesen war, der an einem Gerstenfeld entlanggeführt hatte, dachte ich, dass es noch immer nicht zu spät war, die Vergangenheit auf sich beruhen zu lassen. Aber ich war neugierig.
Das alte Haus, in dem ich sieben Jahre lang gewohnt hatte – von meinem fünften Lebensjahr bis zu meinem zwölften –, dieses Haus war längst abgerissen worden. Und das neue Haus, das meine Eltern weiter unten im Garten gebaut hatten, zwischen den Azaleenbüschen und dem grünen Kreis im Gras, den wir den »Feenreif« nannten, war vor dreißig Jahren verkauft worden.
Als ich das neue Haus sah, bremste ich ab. Für mich würde es immer »das neue Haus« bleiben. Ich bog in die Einfahrt ein und betrachtete das Gebäude. Ursprünglich im Stil der Siebzigerjahre errichtet, war es inzwischen mehrfach erweitert worden. Ich hatte vergessen, dass die Ziegelsteine schokoladenbraun waren. Die neuen Bewohner hatten den winzigen Balkon meiner Mutter zu einer zweistöckigen verglasten Veranda umgebaut. Ich starrte das Haus an und musste feststellen, dass ich weniger Erinnerungen an meine Jugendzeit hatte als erwartet: weder an gute noch an schlechte Zeiten. Als Teenager hatte ich eine Weile hier gewohnt. Aber mit dem Menschen, der ich jetzt war, schien das alles nichts mehr zu tun zu haben.
Ich fuhr rückwärts aus der Einfahrt.
Es war Zeit, sich zu meiner Schwester zu begeben. In ihrem Haus, das für den heutigen Tag bestimmt festlich herausgeputzt worden war, würde reges Treiben herrschen. Ich würde mich mit Leuten unterhalten, deren Existenz ich schon vor Jahren vergessen hatte, und sie würden mich nach meiner Frau fragen (von der ich mich vor einem Jahrzehnt getrennt hatte; eine Beziehung, die langsam zerfasert war, bis sie, wie es der Lauf der Dinge zu sein scheint, in die Brüche gegangen war) und ob ich eine Freundin hätte (nein, hatte ich nicht; und ich wusste noch nicht mal, ob ich dazu in der Lage war), und sie würden mich nach meinen Kindern fragen (die alle erwachsen waren und ihr eigenes Leben führten, und natürlich wären sie heute gern gekommen), nach der Arbeit (läuft alles wunderbar, vielen Dank, würde ich sagen. Ich wusste nie, wie ich über das reden sollte, was ich tat. Wenn ich darüber reden könnte, müsste ich es nicht tun. Ich schaffe Kunst, manchmal sogar richtige Kunst, und das füllt die Leerräume in meinem Leben aus. Ein paar davon. Nicht alle). Wir würden über die Verblichenen reden; wir würden der Toten gedenken.
Das kleine Landsträßchen meiner Kindheit war zu einer schwarzen Asphaltpiste geworden, die zwei weitläufige Wohnsiedlungen miteinander verband. Ich folgte ihr ein Stück weit hinaus aus der Stadt, was nicht die Richtung war, in die ich hätte fahren sollen, und es fühlte sich gut an.
Die glatte, schwarze Straße wurde schmaler, kurviger, wurde wieder zu dem einspurigen Fahrstreifen, an den ich mich aus meiner Kindheit erinnerte, aus festgestampfter Erde und knubbeligem, knochenartigem Kies.
Bald fuhr ich deutlich langsamer einen holprigen, schmalen Pfad entlang, der von Brombeergestrüpp und Hundsrosen gesäumt war oder von Haselnusssträuchern und anderen wilden Hecken. Ich hatte das Gefühl, in der Zeit zurückzureisen. Der Pfad war noch immer so, wie ich ihn in Erinnerung hatte, auch wenn sich sonst alles verändert hatte.
Ich fuhr an der Caraway-Farm vorbei. Als ich gerade sechzehn gewesen war, hatte ich Callie Anders geküsst, die dort gewohnt hatte, ein Mädchen mit roten Wangen und blondem Haar. Kurz darauf war ihre Familie nach Schottland gezogen, und ich hatte sie nie wieder geküsst und auch nie wieder gesehen. Schließlich erstreckten sich, fast eine Meile weit, beiderseits des Weges nichts als Felder: Flache Wiesen gingen nahtlos ineinander über. Aus dem Kiesweg wurde ein besserer Trampelpfad. Bald würde er zu Ende sein.
Ich erinnerte mich daran, bevor ich um die Kurve bog; und dann stand es da, in seiner ganzen verfallenen Pracht: ein rotes Backsteingebäude – das Gehöft der Hempstocks.
Obwohl der Weg hier immer schon geendet hatte, war ich doch überrascht. Weiter hätte ich nicht fahren können. Ich parkte den Wagen vor dem Haus. Etwas Bestimmtes hatte ich nicht vor. Ich fragte mich, ob hier nach all den Jahren noch jemand wohnte, oder, genauer gesagt, ob die Hempstocks noch hier wohnten. Das war eher unwahrscheinlich, allerdings waren die Hempstocks immer für eine Überraschung gut gewesen.
Als ich ausstieg, roch es durchdringend nach Kuhmist. Ich ging vorsichtig über den kleinen Hof zur Haustür hinüber, suchte vergebens nach einer Türklingel und klopfte dann. Die Tür war nicht richtig ins Schloss gedrückt worden und schwang langsam auf.
Hier war ich doch schon einmal gewesen, oder, vor langer Zeit? Eigentlich war ich mir sicher. Kindheitserinnerungen liegen manchmal unter den Dingen verborgen, die später passiert sind, wie Spielzeug, das vergessen auf dem Boden eines Kleiderschranks liegt, aber nie ganz verloren ist. Ich stand in der Diele und rief: »Hallo? Irgendjemand zu Hause?«
Ich hörte nichts. Es roch nach frisch gebackenem Brot und Möbelwachs und altem Holz. Meine Augen gewöhnten sich nur langsam an die Dunkelheit. Ich wollte gerade wieder gehen, als eine ältere Frau auf den Hausflur trat, in der Hand ein weißes Staubtuch. Ihre grauen Haare trug sie lang.
»Mrs. Hempstock?«, fragte ich.
Sie legte den Kopf leicht schräg und musterte mich. »Junger Mann, von irgendwoher kenne ich Sie«, sagte sie. Ich bin kein junger Mann. Schon lange nicht mehr. »Ich kenne Sie, aber in meinem Alter geht so manches durcheinander. Wer genau sind Sie?«
»Ich glaube, ich muss so sieben oder acht gewesen sein, als ich das letzte Mal hier war.«
Da lächelte sie. »Sie waren mit Lettie befreundet? Und haben oben an der Landstraße gewohnt?«
»Sie haben mir Milch zu trinken gegeben. Noch warm, von den Kühen.« Da wurde mir bewusst, wie viele Jahre vergangen waren, und ich sagte: »Nein, das waren nicht Sie, das muss Ihre Mutter gewesen sein. Tut mir leid.« Während wir altern, werden wir zu unseren Eltern; wenn man lange genug lebt, sieht man die Gesichter seiner Jugend wieder. Ich erinnerte mich an Mrs. Hempstock, Letties Mutter, als eine stämmige Frau. Diese Frau war dürr und zierlich. Sie sah aus wie ihre Mutter, die Frau, die ich als »die alte Mrs. Hempstock« gekannt hatte.
Manchmal, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich das Gesicht meines Vaters, nicht meines, und dann fällt mir ein, wie er manchmal seinem Spiegelbild zugelächelt hatte, bevor er aus dem Haus gegangen war. »Sieht gut aus«, hatte er dann beifällig gesagt. »Sieht gut aus.«
»Möchten Sie Lettie besuchen?«, fragte Mrs. Hempstock.
»Ist sie hier?« Damit hatte ich nicht gerechnet. Sie war doch bestimmt irgendwohin ausgewandert. Nach Amerika vielleicht?
Die alte Frau schüttelte den Kopf. »Ich wollte gerade Wasser aufsetzen. Möchten Sie eine Tasse Tee?«
Ich zögerte. Dann bat ich sie, mir, wenn es ihr nichts ausmache, den Weg zum Ententeich zu beschreiben.
»Ententeich?«
Ich wusste, dass Lettie einen seltsamen Namen dafür gehabt hatte. Und er fiel mir auch wieder ein. »Sie hat ihn ›das Meer‹ genannt. Irgendwas in der Art.«
Die alte Frau legte das Tuch auf die Kommode. »Das Wasser aus dem Meer kann man nicht trinken. Weil es zu salzig ist, hab ich recht? Das wäre, als würde man Blut trinken. Sie wissen nicht mehr, wie man dort hinkommt? Um das Haus herum, und dann den Pfad entlang.«
Hätte mich jemand noch vor einer Stunde gefragt, hätte ich gesagt, ich wüsste nicht mehr, wie man dort hinkommt. Wahrscheinlich hätte ich mich nicht einmal mehr an Lettie Hempstocks Namen erinnert. Aber wie ich da im Hausflur stand, fiel mir alles wieder ein. Erinnerungen lauerten hinter jeder Ecke, geradezu verlockend. Hätte mir jemand gesagt, ich wäre wieder sieben Jahre alt, hätte ich ihm vielleicht einen Moment lang geglaubt.
»Vielen Dank.«
Ich ging wieder auf den Hof hinaus, vorbei am Hühnerstall und an der alten Scheune. Während ich an den Feldern entlangschlenderte, fiel mir ein, wo ich mich befand und was als Nächstes kommen würde, und dieses Wissen ließ mich innerlich frohlocken. Haselsträucher säumten den Weg. Ich hob eine Handvoll grüner Nüsse auf und steckte sie ein.
Bis zum Teich ist es nicht mehr weit, dachte ich bei mir. Ich muss nur noch diesen Schuppen umrunden, und dann sehe ich ihn.
Ich sah ihn und war merkwürdig stolz auf mich, als hätte die Tatsache, dass ich diese eine Erinnerung hervorgekramt hatte, einen Teil der Spinnweben des heutigen Tages weggeblasen.
Der Teich war kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Am gegenüberliegenden Ufer stand ein Holzschuppen und, neben dem Pfad, eine uralte Bank aus Holz und Metall. Von den Brettern blätterte die grüne Farbe ab. Ich setzte mich auf die Bank und starrte in das Wasser, in dem sich der Himmel spiegelte, sah auf die Entengrütze am Ufer und das halbe Dutzend Lilienblätter. Hin und wieder warf ich eine Haselnuss in die Mitte des Teichs, in … wie hatte Lettie Hempstock ihn genannt?
Nein, »Meer« war es nicht gewesen.
Sie musste älter sein als ich, Lettie Hempstock. Damals war sie vielleicht fünf Jahre älter als ich, trotz ihres komischen Geredes. Sie war elf. Ich war … wie alt war ich gewesen? Das war nach dieser schrecklichen Geburtstagsfeier. Das wusste ich noch. Also war ich wohl sieben.
Ich fragte mich, ob wir jemals ins Wasser gefallen waren. Hatte ich sie in den Ententeich geschubst, dieses seltsame Mädchen, das auf dem Bauernhof am untersten Ende der Straße wohnte? Ich erinnere mich, sie im Wasser gesehen zu haben. Vielleicht hatte sie mich auch hineingestoßen.
Wohin war sie gegangen? Nach Amerika? Nein, nach Australien. Das war es. Irgendwo weit weg.
Und es hatte nicht »das Meer« geheißen. Sondern »der Ozean«.
Lettie Hempstocks Ozean.
Das fiel mir wieder ein, und als mir das einfiel, erinnerte ich mich auch wieder an alles andere.
I
Als ich sieben Jahre alt wurde, kam niemand zu meiner Geburtstagsfeier.
Auf einem Beistelltischchen standen Schüsseln mit Wackelpudding und Trifle, an jedem Platz lag ein Papphütchen, und in der Mitte des großen Tisches stand ein Geburtstagskuchen mit sieben Kerzen. Auf den Kuchen war mit Zuckerguss ein Buch gemalt. Meine Mutter, die die Feier organisiert hatte, erklärte mir, die Dame in der Bäckerei habe gesagt, dass sie noch nie einen Geburtstagskuchen mit einem Buch verziert hätte – bei den Jungs seien es meistens ein Football oder ein Raumschiff. Ich war ihr erstes Buch.
Als sich abzeichnete, dass niemand kommen würde, zündete meine Mutter die sieben Kerzen auf dem Kuchen an, und ich pustete sie aus. Ich aß ein Stück Kuchen, zusammen mit meiner Schwester und einer ihrer Freundinnen (die beide nur als Beobachter an der Feier teilnahmen, nicht als Gäste), bevor sie kichernd in den Garten flohen.
Meine Mutter hatte Partyspiele vorbereitet, aber da niemand da war, nicht einmal meine Schwester, wurde keins davon gespielt, und ich riss die Zeitung, mit der das Pass-the-Parcel-Geschenk verpackt war, selbst auf. Zum Vorschein kam ein blauer Plastik-Batman. Ich war traurig, dass niemand zu meiner Geburtstagsfeier gekommen war, freute mich aber, den Batman behalten zu dürfen; außerdem gab es noch ein Geburtstagsgeschenk, das gelesen werden wollte, einen Schuber mit den Narnia-Büchern, den ich mit nach oben nahm. Ich legte mich aufs Bett und tauchte in die Geschichten ein.
Mir gefiel das. Bücher waren sowieso weniger gefährlich als andere Menschen.
Außerdem hatten mir meine Eltern die LP Das Beste von Gilbert und Sullivan geschenkt, zu den beiden, die ich schon besaß. Ich schwärmte für Gilbert und Sullivan, seit ich drei Jahre alt war und die jüngere Schwester meines Vaters mich in Iolanthe mitgenommen hatte, eine Komödie mit Adelsherren und Feen. Ich verstand die Feen eher als die Adelsherren. Meine Tante starb kurz darauf im Krankenhaus an Leukämie.
Als mein Vater an jenem Abend von der Arbeit nach Hause kam, hatte er eine Pappschachtel dabei. In der Schachtel befand sich ein Kätzchen mit weichem Fell und unbestimmtem Geschlecht, das ich auf der Stelle »Fluffy« taufte und das ich von ganzem Herzen liebte.
Nachts schlief Fluffy bei mir im Bett. Manchmal, wenn meine Schwester nicht in der Nähe war, redete ich mit ihm, wobei ich fast schon erwartete, dass es mir mit menschlicher Stimme antworten würde. Aber das tat es nie. Was mir nichts ausmachte. Das Kätzchen war anhänglich und neugierig und ein guter Gefährte für jemanden, dessen siebter Geburtstag aus einem Tisch mit glasierten Keksen, Pudding, Kuchen und fünfzehn leeren Klappstühlen bestanden hatte.
Ich kann mich nicht erinnern, die anderen Kinder in meiner Klasse gefragt zu haben, warum sie nicht zu meiner Feier gekommen waren. Ich musste sie das nicht fragen. Schließlich waren sie nicht meine Freunde, sondern nur irgendwelche Leute, mit denen ich zur Schule ging.
Es fiel mir schwer, Freundschaften zu schließen. Wenn es mir denn überhaupt gelang.
Ich hatte Bücher, und jetzt hatte ich mein Kätzchen. Wir würden wie Dick Whittington und seine Katze sein, davon war ich überzeugt, oder, falls Fluffy sich als besonders schlau entpuppte, wie der Müllerssohn und der gestiefelte Kater. Das Kätzchen schlief auf meinem Kopfkissen, und wenn ich aus der Schule kam, wartete es in der Einfahrt vor dem Haus auf mich, am Zaun, bis es einen Monat später von dem Taxi überfahren wurde, mit dem der Opalschürfer zu uns kam.
Ich war nicht da, als es passierte.
Als ich an jenem Tag von der Schule nach Hause kam, wartete mein Kätzchen nicht auf mich. In der Küche saß ein hochgewachsener, schlanker Mann am Tisch. Er war braun gebrannt und trug ein kariertes Hemd. Ich konnte riechen, dass er Kaffee trank. Damals gab es nur löslichen Kaffee, ein bitteres dunkelbraunes Pulver, das in Gläsern verkauft wurde.
»Ich fürchte, ich hatte einen kleinen Unfall, als ich hier angekommen bin«, erklärte er mir gut gelaunt. »Aber kein Grund zur Sorge.« Er sprach mit einem deutlichen Akzent, der mir fremd war; das war das erste Mal, dass ich jemanden hörte, der aus Südafrika kam.
Auch er hatte eine Pappschachtel auf dem Tisch vor sich stehen.
»Das schwarze Kätzchen, das war deins?«, fragte er.
»Es heißt Fluffy«, sagte ich.
»Yeah. Mein ich doch. Ich hatte da einen kleinen Unfall. Aber keine Sorge. Ich hab den Kadaver gleich entsorgt. Darum musst du dich nicht kümmern, das ist erledigt. Mach die Schachtel auf.«
»Was?«
Er deutete auf die Schachtel. »Mach sie auf«, sagte er.
Der Opalschürfer war ein großer Mann. Immer, wenn ich ihm begegnete, hatte er Jeans und ein kariertes Hemd an, außer beim letzten Mal. Um den Hals trug er eine dicke Goldkette. Auch die war weg, als ich ihn das letzte Mal sah.
Ich wollte die Schachtel nicht aufmachen. Ich wollte allein sein, mich irgendwo verstecken. Ich wollte um mein Kätzchen weinen, aber das konnte ich nicht, solange mir jemand dabei zuschaute. Ich wollte trauern. Ich wollte meinen Freund ganz hinten im Garten vergraben, hinter dem Feenreif, in der Höhle aus Rhododendronbüschen, neben dem Komposthaufen, wo außer mir niemand hinging.
Die Schachtel bewegte sich.
»Hab ich für dich gekauft«, sagte der Mann. »Für meine Schulden komm ich immer auf.«
Ich streckte die Hand aus und hob den Deckel von der Schachtel, wobei ich mich fragte, ob mir da jemand einen Streich spielte und mein Kätzchen in der Schachtel sitzen würde. Stattdessen schaute ein fuchsrotes Gesicht trotzig zu mir auf.
Der Opalschürfer nahm die Katze aus der Schachtel.
Es war ein riesiger, rötlich gestreifter Kater, dem ein halbes Ohr fehlte. Er starrte mich wütend an. Diese Katze hatte sich in der Schachtel eindeutig nicht wohlgefühlt. Daran war sie nicht gewöhnt. Ich streckte die Hand nach ihr aus, um ihr über den Kopf zu streichen, wobei ich das Gefühl hatte, das Andenken meines Kätzchens zu verraten, aber sie wich zurück, sodass ich sie nicht berühren konnte, fauchte mich an und stolzierte in die hinterste Ecke des Zimmers, wo sie sich niederließ und mich hasserfüllt anstarrte.
»Bitte schön! Eine Katze für eine Katze«, sagte der Opalschürfer und fuhr mir mit seiner ledrigen Hand durchs Haar. Dann ging er hinaus in den Flur und ließ mich zusammen mit der Katze, die nicht mein Kätzchen war, in der Küche zurück.
Kurz darauf streckte der Mann noch einmal den Kopf zur Tür herein. »Er heißt Monster.«
Mir kam das alles vor wie ein schlechter Witz.
Ich ließ die Küchentür einen Spalt weit offen, damit die Katze hinauskonnte. Dann ging ich nach oben in mein Zimmer, warf mich aufs Bett und weinte um meinen toten Fluffy. Als meine Eltern an jenem Abend nach Hause kamen, wurde mein Kätzchen, glaube ich, mit keinem Wort erwähnt.
Monster blieb eine gute Woche bei uns. Morgens und abends stellte ich ihm eine Schüssel mit Futter in die Küche, wie ich das auch bei meinem Kätzchen getan hatte. Die meiste Zeit hockte er an der Hintertür und wartete, bis ich oder jemand anders ihn hinausließ. Wir sahen, wie er im Garten von einem Busch zum nächsten huschte, auf die Bäume und ins Unterholz. Anhand der toten Blaumeisen und Drosseln, die wir im Garten fanden, konnten wir verfolgen, wo er sich herumgetrieben hatte, aber wir sahen ihn nur selten.
Ich vermisste Fluffy. Ich wusste, dass man etwas Lebendiges nicht so einfach ersetzen konnte, aber ich traute mich nicht, mich bei meinen Eltern zu beschweren. Sie hätten nicht begriffen, warum ich so verärgert war. Natürlich, mein Kätzchen war verunglückt, aber ich hatte ja Ersatz bekommen. Der Schaden war wiedergutgemacht worden.
Das fiel mir alles wieder ein, und während es mir einfiel, wusste ich, dass es nicht von Dauer sein würde: all die Dinge, an die ich mich erinnerte, während ich auf der grünen Bank am Ufer des kleinen Teichs saß, der, wie Lettie Hempstock mich einst überzeugt hatte, ein Ozean war.
II
Ich war kein glückliches Kind, auch wenn ich hin und wieder ein zufriedenes war. Ich lebte mehr in meinen Büchern als irgendwo sonst.
Unser Haus war groß und hatte viele Zimmer, was gut war, als sie es kauften und mein Vater Geld hatte; später dann eher weniger.
Eines Nachmittags riefen mich meine Eltern sehr förmlich in ihr Schlafzimmer. Ich dachte schon, ich hätte irgendetwas verbrochen und sie würden mir eine Standpauke halten, aber nein: Sie erklärten mir lediglich, sie seien nicht mehr wohlhabend, wir müssten alle Opfer bringen, und ich würde mein Zimmer hergeben müssen, das kleine Zimmer am oberen Treppenabsatz. Mich stimmte das traurig. Mein Zimmer hatte ein kleines, gelbes Waschbecken, das extra für mich genau in der richtigen Höhe angebracht worden war; der Raum lag über der Küche, und direkt unten an der Treppe befand sich das Fernsehzimmer, sodass ich nachts durch meine halb geöffnete Tür das beruhigende Gewirr erwachsener Stimmen hören konnte und mich nicht so allein fühlte. Außerdem störte es niemanden, wenn ich meine Zimmertür halb offen ließ, damit etwas Licht hineinfiel und ich nicht so viel Angst vor der Dunkelheit hatte; und – was genauso wichtig war – damit ich, obwohl ich eigentlich schon schlafen sollte, im schummrigen Flurlicht noch lesen konnte, wenn es sein musste. Es musste immer sein.
Dass ich ins Zimmer meiner kleinen Schwester verbannt wurde, brach mir nicht unbedingt das Herz. Darin standen bereits drei Betten, und ich entschied mich für das, welches unter dem Fenster stand. Ich fand es großartig, dass ich aus dem Kinderzimmerfenster auf den langen, gemauerten Balkon klettern konnte, dass ich bei offenem Fenster schlafen und den Wind und den Regen im Gesicht spüren konnte. Aber wir stritten uns, meine Schwester und ich, buchstäblich über alles. Sie schlief lieber mit geschlossener Flurtür, und der daraus resultierende Streit, ob die Zimmertür nun offen bleiben oder geschlossen werden sollte, wurde von meiner Mutter kurzerhand geschlichtet, indem sie ein Diagramm an die Tür hängte, auf dem meine Nächte und die meiner Schwester abwechselnd eingezeichnet waren. Also war ich jede Nacht entweder zufrieden oder völlig verängstigt, je nachdem, ob die Tür offen oder geschlossen war.
Mein ehemaliges Kinderzimmer am oberen Treppenabsatz wurde vermietet, und die unterschiedlichsten Leute wohnten dort. Ich betrachtete sie alle mit Argwohn: Sie schliefen in meinem Zimmer und benutzten mein gelbes Waschbecken, das extra für mich angebracht worden war. Ich erinnere mich noch an die fette Australierin, die behauptete, sie könne ihren Kopf verlassen und an der Decke herumlaufen; an das amerikanische Paar, das meine Mutter zutiefst empört vor die Tür setzte, als sie herausfand, dass die beiden gar nicht verheiratet waren; und dann wohnte der Opalschürfer dort.
Er stammte aus Südafrika, obwohl er sein Geld damit verdient hatte, in Australien nach Opalen zu schürfen. Mir und meiner Schwester schenkte er je einen Opal, einen rauen schwarzen Stein mit einem grün-blau-roten Feuer darin. Meine Schwester freute sich darüber und war furchtbar stolz auf ihren Opal. Ich konnte dem Mann den Tod meines Kätzchens nicht verzeihen.
Es war der erste Ferientag im Frühling: Drei Wochen ohne Schule lagen vor mir. Ich wachte früh auf, ganz aufgeregt von der Aussicht auf endlose Tage, an denen ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Ich würde lesen. Ich würde die Gegend auskundschaften.
Ich zog meine Shorts an, mein T-Shirt, meine Sandalen und ging runter in die Küche. Mein Vater richtete gerade das Frühstück, während meine Mutter ausschlief. Über dem Schlafanzug trug er seinen Bademantel. Am Samstag richtete er immer das Frühstück. Ich sagte: »Dad! Wo ist mein Comic?« Normalerweise kaufte er mir immer das neue Smash!, bevor er freitags von der Arbeit nach Hause fuhr, und das las ich dann am Samstagmorgen.
»Hinten im Auto. Magst du Toast?«
»Ja«, erwiderte ich. »Aber nicht schwarz.«
Mein Vater mochte keine Toaster. Er toastete Brot unter dem Grill, und dabei wurde es oft schwarz.
Ich ging hinaus und schaute mich in der Einfahrt um. Dann ging ich wieder ins Haus und stapfte in die Küche. Die Küchentür fand ich klasse. Sie ließ sich in beide Richtungen öffnen, sodass die Dienstboten vor sechzig Jahren rein- und rauslaufen konnten, wenn sie die Hände voll hatten.
»Dad? Wo ist das Auto?«
»In der Einfahrt.«
»Nein, ist es nicht.«
»Was?«
Das Telefon klingelte, und mein Vater ging raus in den Flur, um abzunehmen. Ich hörte, wie er mit jemandem redete.
Der Toast unter dem Grill begann zu qualmen.
Ich stand auf und schaltete den Grill aus.
»Das war die Polizei«, sagte mein Vater. »Jemand hat gemeldet, dass unser Wagen am unteren Ende der Straße steht. Ich hab ihnen erklärt, dass ich ihn noch nicht mal als gestohlen gemeldet hab. Aber gut. Wir können gleich da runtergehen, sie warten auf uns. Toast!«
Er zog die Pfanne unter dem Grill hervor. Der Toast qualmte und war auf der einen Seite schwarz.
»Ist mein Comic noch da? Oder haben sie ihn geklaut?«
»Keine Ahnung. Von deinem Comic hat die Polizei nichts gesagt.«
Mein Vater strich Erdnussbutter auf die verbrannte Seite von jedem Toast, zog statt seines Bademantels einen richtigen Mantel über seinen Schlafanzug und schlüpfte in ein Paar Schuhe. Während wir gemeinsam die Straße hinabgingen, mampfte er seinen Toast. Ich hielt meinen in der Hand, ohne ihn zu essen.
Wir waren vielleicht fünf Minuten unterwegs, als ein Streifenwagen den schmalen Weg entlanggefahren kam, der zwischen den Feldern hindurchführte. Er bremste ab, und der Fahrer begrüßte meinen Vater mit Namen.
Während sich mein Vater mit dem Polizisten unterhielt, versteckte ich mein Stück Toast hinter dem Rücken. Ich wünschte mir, meine Familie würde, wie alle anderen Familien auch, normales weißes Schnittbrot kaufen, das man in einen Toaster stecken konnte. Mein Vater hingegen hatte ganz in der Nähe eine Bäckerei entdeckt, in der sie schweres, braunes Brot herstellten, und beharrte darauf, es zu kaufen. Er behauptete, es würde besser schmecken, was meiner Meinung nach Unfug war. Richtiges Brot war weiß, bereits aufgeschnitten und schmeckte nach fast gar nichts: Das war ja gerade das Entscheidende.
Der Polizist stieg aus, öffnete die hintere Tür und forderte mich auf einzusteigen. Mein Vater setzte sich vorn neben den Fahrer.
Dann rollte der Streifenwagen langsam die Straße entlang. Damals war hier noch nichts asphaltiert, und die Fahrspur war gerade mal breit genug für einen Wagen. Überall hatte sich das Wasser in Pfützen gesammelt, der Wagen schaukelte hin und her, und Gerstenhalme strichen über die Karosserie. So mancher Traktor und der Regen und die Zeit hatten tiefe Spurrillen hinterlassen.
»Diese jungen Leute«, sagte der Polizist. »Die machen sich einen Spaß daraus, einen Wagen zu stehlen, eine Weile damit herumzufahren und ihn dann irgendwo stehen zu lassen. Das waren bestimmt welche von hier.«
»Ich bin nur froh, dass er so schnell gefunden wurde«, sagte mein Vater.
Wir ruckelten an der Caraway-Farm vorbei, wo ein kleines Mädchen mit fast weißblonden Haaren und sehr roten Wangen uns anstarrte. Ich hielt mein verbranntes Stück Toast im Schoß.
»Schon komisch, dass sie ihn da unten stehen gelassen haben«, sagte der Polizist. »Von dort ist es zu Fuß schließlich ein weiter Weg zurück in die Zivilisation.«
Wir bogen um eine Kurve und sahen den weißen Mini am Wegrand stehen, direkt vor einem Tor, das auf ein Feld führte, die Reifen tief im Matsch eingesunken. Wir fuhren daran vorbei und parkten im Gras. Der Polizist ließ mich raus, und zu dritt stapften wir zu dem Mini hinüber, während der Polizist meinem Vater erzählte, was für Verbrechen in der Gegend begangen wurden und warum es offensichtlich war, dass die Diebe von hier stammten. Dann öffnete mein Dad mit seinem Ersatzschlüssel die Beifahrertür.
»Da hat jemand was auf dem Rücksitz liegen lassen«, sagte er, griff nach hinten und zog die blaue Decke beiseite, unter der sich irgendetwas verbarg, während der Polizist ihm erklärte, dass er das nicht tun solle, und während ich auf den Rücksitz starrte, denn dort lag sonst immer mein Comic. Also sah ich es als Erster.
Es war ein Es, was ich da sah, kein Er.
Obwohl ich ein phantasievolles Kind war, das zu Albträumen neigte, hatte ich, als ich sechs war, meine Eltern überreden können, mich in London in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett mitzunehmen. Ich wollte unbedingt die Schreckenskammer besuchen, in der Hoffnung, dort die Filmmonster aus Chamber of Horrors zu sehen. Ich freute mich auf Wachsfiguren von Dracula, Frankensteins Monster und dem Wolfsmenschen, aber stattdessen tapste ich durch eine schier endlose Abfolge von Dioramen mit unscheinbaren, finster dreinblickenden Männern und Frauen, die irgendwelche Leute ermordet hatten – für gewöhnlich Mieter oder Angehörige der eigenen Familie – und die dann selbst ermordet worden waren: am Strang, auf dem elektrischen Stuhl, in der Gaskammer. Die meisten waren zusammen mit ihren Opfern in verfänglichen Situationen dargestellt – am Esstisch zum Beispiel, während ihr vergiftetes Familienmitglied sein Leben aushauchte. Auf den Schildern, die erklärten, wer sie waren, stand auch, dass ein Großteil von ihnen ihre Familien ermordet und an die Anatomie verkauft hätten, und seither graute es mich vor diesem Begriff. Ich wusste nicht, was Anatomie war. Ich wusste lediglich, dass die Leute deswegen ihre Kinder umbrachten.
Ich war nur deshalb nicht schreiend aus der Schreckenskammer geflohen, weil keine der Wachsfiguren wirklich überzeugend wirkte. Sie sahen nicht richtig tot aus, weil sie nicht einmal lebendig aussahen.
Das Ding auf dem Rücksitz, das unter der blauen Decke verborgen gewesen war (ich kannte diese blaue Decke. Sie hatte früher in meinem Kinderzimmer gelegen, auf einem Regal, falls mir kalt wurde), wirkte auch nicht besonders überzeugend. Es sah dem Opalschürfer ein wenig ähnlich, aber es war in einen schwarzen Anzug gekleidet, mit einem rüschenbesetzten Hemd und einer schwarzen Fliege. Die Haare waren nach hinten gegelt und wirkten irgendwie unecht. Die Augen starrten ins Leere. Die Lippen waren bläulich, die Haut jedoch war ziemlich rot. Was da lag, sah aus wie die Parodie eines gesunden Menschen. Um den Hals hing keine Goldkette.
Darunter konnte ich, schon ziemlich zerknittert, mein Smash!-Heft entdecken, mit Batman auf dem Cover, der genauso aussah wie im Fernsehen.
Ich weiß nicht mehr, wer dann was gesagt hat, nur dass ich mich von dem Mini entfernen musste. Ich überquerte den Weg und stand eine Weile allein da, während der Polizist mit meinem Vater redete und etwas in sein Notizbuch schrieb.
Ich starrte den Mini an. Vom Auspuff führte ein Gartenschlauch zum Fenster auf der Fahrerseite. Der Auspuff war dick mit braunem Schlamm beschmiert, damit der Schlauch nicht rausrutschte.
Niemand achtete auf mich. Ich biss ein Stück von meinem Toast ab. Er war verbrannt und kalt.
Zu Hause aß mein Vater immer die Stücke Toastbrot, die am schwärzesten waren. »Lecker!«, sagte er dann. »Holzkohle! Gesund und nahrhaft!« oder »Verbrannter Toast! So mag ich ihn am liebsten!«, und dann aß er alles auf. Als ich viel älter war, gestand er mir, dass er verbrannten Toast nicht besonders mochte, aber er hätte ihn gegessen, um ihn nicht wegwerfen zu müssen, und für einen kurzen Augenblick war mir meine ganze Kindheit wie eine Lüge erschienen – als wäre eine der Säulen, auf denen mein Weltbild ruhte, in sich zusammengefallen.
Der Polizist sprach in das Funkgerät vorn in seinem Wagen.
Dann überquerte er die Straße und stiefelte zu mir herüber. »Tut mir leid, Kleiner«, sagte er. »In ein paar Minuten kommen noch ein paar Autos hierher. Besser, du wartest irgendwo, wo du nicht im Weg bist. Möchtest du wieder hinten im Streifenwagen sitzen?«
Ich schüttelte den Kopf. Nein, das wollte ich nicht.
Jemand, ein Mädchen, sagte: »Er kann mit zu mir auf den Hof kommen. Das ist kein Problem.«
Sie war viel älter als ich, mindestens elf. Das Haar trug sie, für ein Mädchen, vergleichsweise kurz, und sie hatte eine Stupsnase und Sommersprossen. Sie trug einen roten Rock – damals trugen Mädchen noch keine Jeans, jedenfalls nicht in dieser Gegend. Sie hatte einen leichten Sussex-Akzent und stechende graublaue Augen.
Das Mädchen ging, zusammen mit dem Polizisten, zu meinem Vater hinüber, sie erhielt die Erlaubnis, mich mitzunehmen, und dann schlenderte ich mit ihr den Weg entlang.
»In unserem Auto dort liegt ein toter Mann.«
»Deshalb ist er ja auch hier runtergekommen«, erklärte sie mir. »Ans Ende der Straße. Hier findet ihn niemand, und niemand hält ihn auf, jedenfalls nicht um drei Uhr morgens. Und der Schlamm dort ist nass und lässt sich leicht formen.«
»Glaubst du, er hat sich umgebracht?«
»Ja. Trinkst du gerne Milch? Gramma melkt gerade Bessie.«
Ich sagte: »Richtige Milch von einer Kuh?«, und kam mir sofort ziemlich albern vor, aber sie nickte nur.
Ich dachte darüber nach. Ich hatte noch nie Milch getrunken, die nicht aus der Flasche kam. »Ich glaube, das würde ich gerne probieren.«
Wir gingen in eine kleine Scheune, wo eine alte Frau, die weit älter war als meine Eltern, mit langen, grauen Haaren wie Spinnweben und einem schmalen Gesicht, neben einer Kuh stand. Lange, schwarze Schläuche waren an den Zitzen der Kuh befestigt. »Früher haben wir die Kühe von Hand gemolken«, erklärte sie mir. »Aber so geht es einfacher.«
Sie zeigte mir, wie die Milch aus den schwarzen Schläuchen in eine Maschine floss, durch ein Kühlgerät und in ein riesiges Metallfass. Die Fässer wurden auf die massive Holzrampe vor der Scheune gestellt, wo sie jeden Tag von einem Lastwagen eingesammelt wurden.
Die alte Frau reichte mir einen Becher sahnige Milch von der Kuh Bessie, ganz frische Milch, bevor sie durch das Kühlgerät geflossen war. Nichts, was ich getrunken hatte, hatte je so geschmeckt: köstlich und warm, das reine Glücksgefühl. An die Milch erinnerte ich mich noch, nachdem ich alles andere längst vergessen hatte.
»Da oben am Weg geht es drunter und drüber«, sagte die alte Frau. »Lauter Autos mit Blitzlichtern und so was. Ein schreckliches Palaver! Bring den Jungen besser in die Küche. Er hat Hunger, und ein Becher Milch ist für einen Jungen im Wachstum nicht genug.«
Das Mädchen fragte: »Hast du gegessen?«
»Nur ein Stück Toast. Und das war verbrannt.«
Sie sagte: »Ich heiße Lettie. Lettie Hempstock. Das hier ist die Hempstock-Farm. Los, komm!« Sie führte mich durch die Haustür in eine riesige Küche und setzte mich an einen großen Holztisch, der so voller Flecken und Muster war, dass es aussah, als würden mich aus dem alten Holz lauter Gesichter anstarren.
»Wir frühstücken immer ganz früh«, sagte sie. »Gemolken wird bei Sonnenaufgang. Aber im Kochtopf ist noch Haferbrei, und dort steht ein Glas Marmelade.«
Sie reichte mir eine Porzellanschüssel mit warmem Haferbrei von der Herdplatte, mittenrein klatschte sie einen Schlag selbst gemachte Brombeermarmelade – meine Lieblingssorte –, und dann goss sie Sahne darüber. Ich rührte gut um, bevor ich zulangte, und der Inhalt der Schüssel verwandelte sich in einen lilafarbenen Brei. Appetitlicher hätte es gar nicht aussehen können. Und es schmeckte großartig!
Eine untersetzte Frau kam herein. Ihr rotbraunes Haar war mit grauen Strähnen durchzogen und kurz geschnitten. Sie hatte rote Wangen, trug einen dunkelgrünen Rock, der ihr bis zu den Knien reichte, und Gummistiefel. »Du bist bestimmt der Junge von oben an der Straße«, sagte sie. »Was für ein Theater die um diesen Wagen machen! Bald stehen sie hier zu fünft auf der Matte und wollen Tee.«
Lettie füllte am Wasserhahn einen großen Kupferkessel. Mit einem Streichholz zündete sie eine Gasplatte an und stellte den Kessel auf die Flammen. Dann holte sie fünf angeschlagene Becher aus dem Regal, zögerte einen Moment und sah dann zu der Frau hinüber.
»Du hast recht«, sagte die Frau. »Sechs. Der Arzt kommt bestimmt auch.« Sie schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Den Brief haben sie noch nicht gefunden«, sagte sie. »Dabei hat er sich beim Schreiben solche Mühe gegeben, bevor er ihn zusammengefaltet und in seine Brusttasche gesteckt hat. Und sie haben noch nicht mal dort nachgeschaut.«
»Was steht denn drin?«, wollte Lettie wissen.
»Lies es doch selbst«, sagte die Frau. Ich hielt sie für Letties Mutter. Jedenfalls sah sie aus wie die Mutter von jemandem. Dann sagte sie: »Da steht, dass er sowohl alles Geld genommen hat, das seine Freunde ihm anvertraut haben, damit er es in England auf die Bank bringt, als auch das Geld, das er im Laufe der Jahre mit dem Opalschürfen verdient hat; er ist in Brighton ins Kasino gegangen, um zu spielen, aber er wollte nur sein eigenes Geld setzen. Und dann wollte er nur einen Teil des Geldes von seinen Freunden nehmen, um zurückzugewinnen, was er verloren hatte. Und dann hatte er gar nichts mehr. Und alles war finster.«
»Das hat er aber nicht geschrieben«, sagte Lettie und kniff die Augen zusammen. »Da steht:
An alle meine Freunde!
Es tut mir leid, das wollte ich nicht, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, denn ich kann es nicht.«
»Kommt aufs Gleiche raus«, sagte die ältere Frau und wandte sich zu mir um. »Ich bin Letties Mama«, sagte sie. »Meine Mutter hast du schon kennengelernt, drüben im Melkschuppen. Ich bin Mrs. Hempstock, aber sie war schon vor mir Mrs. Hempstock, also ist sie jetzt die alte Mrs. Hempstock. Das hier ist die Hempstock-Farm, der älteste Hof in der Gegend. Er steht im Domesday Book.«
Ich fragte mich, warum sie alle Hempstock hießen, diese Frauen, aber ich fragte nicht danach, ebenso wenig wie ich mich getraute zu fragen, woher sie wussten, was in dem Abschiedsbrief stand oder was der Opalschürfer gedacht hatte, als er gestorben war. Sie redeten darüber, als wäre das alles völlig normal.
Lettie sagte: »Ich hab ihm auf die Sprünge geholfen, dass er in der Brusttasche nachschaut. Er wird glauben, dass er selbst darauf gekommen ist.«
»Braves Mädchen«, sagte Mrs. Hempstock. »Wenn das Wasser kocht, kommen sie hierher, um zu fragen, ob wir irgendwas Ungewöhnliches gesehen haben, und um Tee zu trinken. Warum gehst du nicht mit dem Jungen runter zum Teich?«
»Das ist kein Teich«, sagte Lettie. »Das ist mein Ozean.« Sie drehte sich zu mir um und sagte: »Los, komm.« Wir verließen das Haus auf demselben Weg, auf dem wir es betreten hatten.
Der Himmel war noch immer grau.
Wir liefen um das Haus herum und einen Trampelpfad entlang.
»Ist das wirklich ein Ozean?«, fragte ich.
»O ja« sagte sie.
Es tauchte urplötzlich vor uns auf: ein Holzschuppen, eine alte Bank und dazwischen ein Ententeich, das dunkle Wasser von Entengrütze und Lilienblättern übersät. Tote Fische trieben auf der Oberfläche, so silbrig wie Münzen.
»Das ist nicht gut«, sagte Lettie.
»Hast du nicht gesagt, es sei ein Ozean?«, rief ich. »Das ist doch nur ein Teich.«
»Es ist ein Ozean!«, sagte sie. »Wir sind von jenseits des Ozeans gekommen, als ich noch ganz klein war, aus unserer Heimat.«
Lettie verschwand im Schuppen und kam mit einer langen Bambusstange wieder heraus. An ihrer Spitze hing etwas, das wie ein Krabbenkescher aussah. Sie beugte sich vor, schob das Netz vorsichtig unter die toten Fische und zog es heraus.
»Aber die Hempstock-Farm steht im Domesday Book«, sagte ich. »Behauptet jedenfalls deine Mutter. Und das stammt von Wilhelm dem Eroberer.«
»Ja«, sagte Lettie Hempstock.