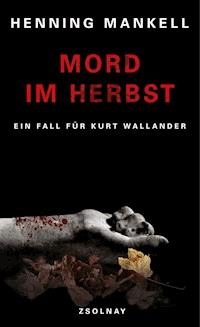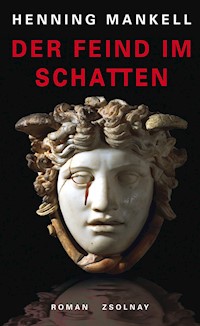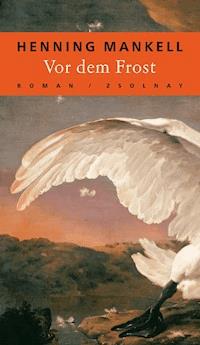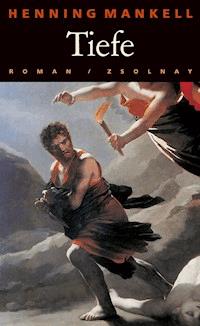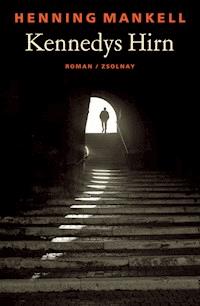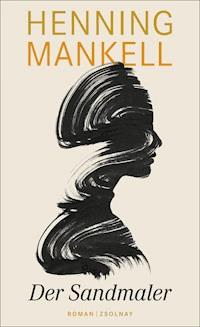
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Stefan und Elisabeth treffen sich auf dem Flug nach Afrika kurz nach dem Abitur wieder. Gegen Ende der Schulzeit hatten sie eine flüchtige Beziehung. Während Stefan das Strandleben genießt, will Elisabeth das fremde Land in Afrika verstehen. Sie freundet sich mit einem Lehrer an, der ihr die historischen Hintergründe erklärt, und der einheimische Guide Ndou führt sie durch die ärmsten Viertel. Elisabeth lernt, die Welt und ihr eigenes Leben mit anderen Augen zu sehen. Bereits in Mankells erstem Afrika-Roman sind seine späteren großen Themen versammelt: die Schönheit der Natur, die Überlebenskunst der Einheimischen, die Gedankenlosigkeit der weißen Touristen und die Nachwirkungen des Kolonialismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Stefan, Kind reicher Eltern, dem alles leichtfällt, und Elisabeth, vom Schicksal weniger begünstigt, haben im Sommer Abitur gemacht. Gegen Ende der Schulzeit hatten sie eine flüchtige Beziehung, jetzt treffen sie sich auf dem Flug nach Afrika zufällig wieder. Während Stefan das Strandleben genießt und in einer Bar ein einheimisches Mädchen aufreißt, will Elisabeth dieses fremde Land verstehen. Sie freundet sich mit einem Lehrer aus ihrer Reisegruppe an, der ihr die historischen Hintergründe erklärt. Ein kleiner Afrikaner, Ndou, den sie als Guide engagieren, führt sie durch die ärmsten Viertel mit ihren Souks und Wellblechhütten. Elisabeth lernt, die Welt und ihr eigenes Leben mit anderen Augen zu sehen.
Bereits in Henning Mankells erstem Afrikaroman sind seine späteren großen Themen versammelt: die Schönheitdes Landes, die Überlebenskunst der Einheimischen, die Gedankenlosigkeit der weißen Touristen und die Nachwirkungen des Kolonialismus.
Zsolnay E-Book
Henning Mankell
Der Sandmaler
Roman
Aus dem Schwedischen von Verena Reichel
Paul Zsolnay Verlag
»… es dämmert ein Tag für die Verdammten dieser Erde …«
Für das Dalateatern
Inhalt
Stefan und Elisabeth
Das Land, in das sie kamen
Das Land, in dem sie waren
Das Bild im Sand
Der letzte Tag
Der Flugplatz
Die Fotografien
Stefan und Elisabeth
Es begann in Kastrup, dem Flughafen außerhalb von Kopenhagen. Am Tag zuvor hatten sie gefeiert und dann am Sonntagmorgen die Fähre über den Sund genommen, um Elephant-Bier zu trinken und den Tag zu verbummeln.
Auf der Hinreise waren sie zu siebt, aber dann trennten sich ihre Wege, und nur Stefan und Elisabeth hatten die Idee, nach Kastrup hinauszufahren. Der Gedanke kam ihnen, während sie in einer dieser merkwürdig stillen Gassen gleich hinter der Flaniermeile Ströget standen und sich umarmten. Stefan sagte gerade etwas zu Elisabeth, als ein Jet über sie hinwegdonnerte und seine Worte übertönte.
Sie nahmen den Bus nach Kastrup.
Es wehte ein scharfer Wind, während sie zur Besucherterrasse des Flughafens gingen, und wenn die Flieger abhoben, schmerzte der Lärm in den Ohren mehr als das Dröhnen in einer Diskothek.
Sie schlenderten herum und redeten darüber, wie es wäre zu verreisen. Stefan wollte sofort nach dem Schulabschluss in gut einem Monat abhauen. Elisabeth sagte, dafür fehle ihr das Geld.
»Mein Vater hat genug«, entgegnete Stefan und beobachtete eine SAS-Maschine aus Paris, die gerade unterhalb der Besucherterrasse in Parkposition rollte.
»Meiner nicht«, erwiderte Elisabeth.
Viel mehr sprachen sie damals nicht. Sie trieben sich eine Stunde lang in Kastrup herum, zählten die Flugzeuge und stemmten sich gegen den Wind. Dann nahmen sie den Bus zurück zum Hafen und erreichten pünktlich die Fünf-Uhr-Fähre.
Aber im Jahr darauf, nachdem die Reise sechs Monate hinter ihnen lag, waren sie der Meinung, alles hätte wohl damals in Kastrup begonnen. Elisabeth besaß sogar noch ein Bild, das sie in einem Fotoautomaten gemacht hatten, eng aneinandergeschmiegt, und sie bestand darauf, dass es damals in Kastrup aufgenommen worden sei. Aber Stefan konnte sich nicht erinnern. Sie saßen an einem Schachtisch in der Bibliothek, in der Elisabeth Arbeit gefunden hatte, und es fiel ihnen merkwürdig schwer, sich miteinander zu unterhalten. Elisabeth drehte die weiße Königin zwischen den Fingern, während Stefan versuchte, einen schwarzen Springer auf den Kopf zu stellen. Schließlich verabredeten sie sich für den nächsten Tag, um sich die Fotos anzusehen, die Elisabeth auf der Reise mit ihrer Instamatic geknipst hatte. Stefan kannte sie noch nicht.
Das einzige Bild, das Stefan wie selbstverständlich in Erinnerung hatte, war jenes, das er heimlich von Elisabeth gemacht hatte. Damals, als sie im Sand lag, die Arme über den Kopf gelegt, und schlief.
Und das war das Bild, an das er dachte, als er mit Elisabeth die Bibliothek verließ.
Als sie zum ersten Mal nach Kastrup fuhren, ein Jahr vor der Reise, gingen sie auf dieselbe Schule und in dieselbe Klasse, die neunte. Es war ihr Abschlussjahr. Stefans Vater besaß mehrere Autowaschanlagen, er war wohlhabend. Stefans ältere Schwester war ein ziemlich bekanntes Model, das oft in der Femina oder in einer anderen Illustrierten zu sehen war, was Stefans Ansehen zusätzlich erhöhte.
Überhaupt schien Stefans Leben nicht besonders kompliziert zu sein, und die Dinge gingen ihm leicht von der Hand. Er redete gern mit Leuten, und wenn es nötig war, konnte er sich auch in der Schule richtig anstrengen. Da er immer genug Geld hatte, war er stets einer der Ersten, wenn es darum ging, etwas zu kaufen oder zu unternehmen. Obendrein war er großgewachsen und hatte fein gezeichnete Gesichtszüge und herrlich dichtes Haar.
Elisabeth hingegen hatte es immer etwas schwerer gehabt. Ihr Vater war Vertreter für bestimmte Schulbücher, die sich nicht besonders gut verkauften, und das hatte ihn im Lauf der Jahre nervös gemacht. An den Wochenenden wurde es zu Hause oft etwas lauter, und Elisabeths Mutter trank Wermut, um sich zu beruhigen. Aber das größte Problem war, dass Elisabeths jüngere Schwester behindert war. Sie hatte eine Muskelerkrankung, die sich mit jeder Woche verschlimmerte. Daher konnte sie nichts mehr selbständig machen. Ihre Muskeln hatten keine Kraft mehr, und sie saß schlaff in einem speziell angefertigten Stuhl. Jetzt war sie fünf Jahre alt, und allmählich konnte man sie nur noch sehr schwer tragen. Sie würde wohl nicht mehr lange leben, und die Familie hoffte darauf, sie bis zum Ende zu Hause pflegen zu können. Eigentlich war es Elisabeth, die sich das wünschte. Einmal hatte sie angefangen zu weinen und gesagt, sie werde sich selbst um sie kümmern, wenn die Eltern das nicht schafften. Sie hatte gehört, wie ihre Eltern über ein Heim für solche Menschen gesprochen hatten. Aber seitdem war darüber kein Wort mehr gefallen.
Elisabeth war immer eingetrichtert worden, wie wichtig es sei, die Schule abzuschließen, und sie hatte sich das auch immer fest vorgenommen. Aber im letzten Jahr hatte sie sich in den Zeitungen informiert, über die Berufswahl nachgedacht, und vor allem mit ihren Freundinnen darüber geredet, dass es schwierig sein würde, Arbeit zu finden, wie viel Mühe man sich auch gab.
Damals hatte sie Meteorologin werden wollen, sich mit Wind und Wetter beschäftigen, aber jetzt war sie nicht mehr sicher.
Und dazu kam natürlich die ganze Mühsal, die es bedeutete, ein Mädchen zu sein. All die Fragen, wie man mit den Jungen umging, mit Verhütungsmitteln, mit den Geheimnissen vor den Eltern, mit der eigenen Unsicherheit und mit einem hartnäckigen Pickel am Kinn.
Nachmittags nach der Schule lag sie oft stundenlang auf ihrem Bett und träumte. Das tat sie systematisch, und sie konnte sich beliebig lang in dem Traum bewegen. Eine Weile phantasierte sie sich in verschiedene Arbeitsstellen hinein. Dabei kam sie auf den Gedanken, Meteorologin zu werden, gerade weil es so schwer war, davon zu träumen. Darauf folgte eine Periode mit Heldinnen- und Opferträumen wild durcheinander. Mal stand sie vor einer Mauer, und es wurde aus allen Winkeln auf sie gefeuert, und sie dachte an die Gefühle der Hinterbliebenen, mal war sie die Chefin in einem großen Unternehmen, das sie souverän leitete.
Und dann war da natürlich der Gedanke an den Tod. Sie selbst, die Schwester, die Eltern, die Freunde würden sterben. Mit diesem Traum beschäftigte sie sich oft so lange, bis sie anfing zu weinen. Das geschah meistens kurz vor dem Abendessen.
Zwischen ihr und Stefan gab es damals keine engere Beziehung. Sie trafen sich, hatten zweimal miteinander geschlafen, es war nicht gerade fulminant gewesen, aber auch nicht unangenehm, kein heulendes Elend am Tag danach, und er gefiel ihr viel besser als die anderen Jungen. Das Ärgerliche an Stefan war nur, dass ihm alles zu leicht fiel. Er hatte keine Probleme, fand Elisabeth, und wie sollte sie da von ihren eigenen reden.
Später im Herbst sahen sie sich seltener. Stefan war in Stockholm und arbeitete für seinen Vater, und Elisabeth hatte enorme Schwierigkeiten, überhaupt einen Job zu finden. Im Oktober bekam sie eine Stelle als Vertretung in einem Kindergarten in Landskrona, und da beschloss sie, im November irgendwo hinzureisen, wenn sie wieder arbeitslos sein würde. Ein paar Wochen im Ausland könnten sie vielleicht auf Ideen bringen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte.
Im Bus nach Landskrona las sie Reisebroschüren. Und an einem Donnerstag auf dem Heimweg entschloss sie sich zu einer Reise nach Afrika. Zu dieser Jahreszeit war das nicht besonders teuer, und es kam ihr spannender vor als Spanien. Sofort begann sie, sich impfen zu lassen, und besorgte sich einen Reisepass. Überraschenderweise hatten ihre Eltern nichts einzuwenden. Offenbar lief das Geschäft mit den Schulbüchern besser. Der Vater war sogar ganz angetan und erzählte von seinen Reisen in Schweden. Die Mutter meinte lediglich, es könnte zu heiß werden, und schloss eine Krankenversicherung für sie ab. Sie hatte gerade in der Zeitung von einem Mädchen in Elisabeths Alter gelesen, das da unten in der Hitze in einem Hotel gestorben war, und zwar offenbar, weil es keine Auslandsversicherung hatte.
An einem Abend im November begleiteten die Eltern sie hinunter zur Fähre und winkten, als sie ablegte. Elisabeth setzte sich in die Bar. Sie fröstelte vor Reisefieber, und es fiel ihr schwer, an etwas Bestimmtes zu denken. Ihr gegenüber saß ein Typ, der so besoffen war, dass er sich kaum aufrecht halten konnte. Er saß da und zog am Tischtuch, um ein paar Falten zu glätten. Aber je mehr er zog, umso mehr Falten wurden es, und damit fuhr er fort, bis die Fähre angelegt hatte. Erst als sich Elisabeth erhob, schaute er mit trübem Blick zu ihr auf.
Im Bus zum Flughafen bekam sie ihre Tage, und sie musste sich erst eine Weile auf der Toilette frisch machen, ehe sie sich mit dem Einchecken und dem Drumherum befasste. Da kam die Durchsage, dass die Maschine vier Stunden verspätet sein würde, aber das machte ihr eigentlich nicht viel aus, denn sie hatte es nicht eilig und konnte so die Vorfreude auf die Reise auskosten. Aufgrund der Verspätung würde der Flieger erst mitten in der Nacht abheben, und sie stellte ihren Koffer in ein Gepäckfach und ging auf die Besucherterrasse. Dort spazierte sie eine Weile herum und genoss es einfach, ehe sie in einem der Cafés in der Wartehalle einen Imbiss bestellte.
Das Sonderbare geschah genau eine halbe Stunde vor Abflug der Maschine, als Elisabeth sich zu ihrem Gate aufmachte, das sie sich sorgfältig eingeprägt hatte. Dort hatten sich schon einige Leute versammelt, und sie begann, ziemlich nervös zu werden. Sie fürchtete, nicht mitgenommen zu werden, weil irgendetwas mit dem Ticket oder dem Pass nicht stimmte oder mit den Spritzen, deren Einstiche noch immer im linken Arm brannten. Der Wartesaal lag zu dieser späten Stunde verlassen da, und die Neonleuchten an der Decke tauchten ihn in ein zu grelles Licht.
Zuvor hatte sie noch dort gestanden und das Gesicht an eines der großen Fenster gedrückt, die auf den betonierten Flugplatz hinausgingen, wo die Maschinen warteten. Sie hatte sich in der dunklen Fensterscheibe gespiegelt und auf die Startbahnen geschaut. Draußen war es pechschwarz, und die gelben Lampen schwangen im Wind. Sie sah einen Mann mit einem Gepäckwagen, der abrupt stoppte und zurücksetzte, um einen Schraubenschlüssel aufzuheben, der ihm heruntergefallen war. Mit dem Blick suchte sie nach der Maschine, mit der sie fliegen würde, aber sie konnte nicht entdecken, welche wohl die richtige war. Es wehte ein starker Novembersturm, und sie spürte die Kälte durch die Scheibe.
Schließlich sah sie auf ihrer Uhr, dass sie in genau einer halben Stunde fliegen würde, und als sie zu ihrer Reisetasche ging, entdeckte sie Stefan.
Zuerst standen sie nur da und starrten einander an, fünfzehn Meter voneinander entfernt. Sie hatten sich genau gleichzeitig erblickt. Stefan war gerade dabei, den Reißverschluss seiner Umhängetasche zu öffnen, Elisabeth hielt mitten im Schritt inne.
»Na so was! Hallo!«, rief Stefan als Erster.
»Hallo.«
»Was machst du denn hier?«
Und dann standen sie voreinander, mitten in der Wartehalle.
»Fliegst du irgendwo hin?«, fragte Stefan.
»Ja. Nach Afrika.«
»Ich auch. Schön. Jetzt? Heute?«
»Ja. In fünfundzwanzig Minuten.«
»Dann fliegen wir zusammen. So ein Zufall. Wann bist du hergekommen?«
»Gegen sieben.«
»Ich hab im City-Terminal in der Stadt von der Verspätung gehört. Da war noch Zeit für ein paar Bier.«
»So, so.«
Sie wussten beide nicht so recht, ob sie den Zufall komisch oder großartig finden sollten. Oder ob er sich vielleicht als eine Enttäuschung entpuppen würde.
Wieder sprach Stefan als Erster.
»Dann unternehmen wir die gleiche Reise. Wie lange wirst du weg sein?«
»Vierzehn Tage.«
»Ich auch. Das ist ja toll!«
Letzteres klang aufrichtig, und Elisabeth entspannte sich. Sie gingen zusammen zu ihrem Handgepäck und stellten sich in die Warteschlange, die sich in Bewegung gesetzt hatte. Dabei sprachen sie nicht viel. Jetzt nahmen die Dinge ihren Lauf, und es reichte, manchmal ein wenig zu lächeln.
In der Schlange, dicht nebeneinander in wachsender Spannung, dann die Treppe hinunter, und draußen nahm ihnen der Novembersturm den Atem, kurz bevor sie das Flugzeug betraten. Mit hundertfünfunddreißig Personen war die Maschine voll besetzt. Eine Menge Gesichter und Mäntel, Taschen und Gedränge. Als sie ihre Sitzplätze eingenommen hatten, sagten sie fast gleichzeitig, dass es hier verdammt eng werden würde.
Doch schon kurz darauf begann die Maschine zu rollen, bis sie mit irrsinniger Energie in die Dunkelheit hineinraste. Im Novembersturm schaukelte und schlingerte sie durch die Wolken, und Stefan lag halb über Elisabeth, nur um festzustellen, dass durch die Scheibe nichts mehr zu sehen war. Elisabeth hatte einen Fensterplatz, Stefan den mittleren. Auf dem Gangplatz saß ein voluminöser Däne, der anfing zu singen, als die Maschine abhob.
Elisabeth versuchte, die Eindrücke zu sortieren, und ihr schoss ein Bild durch den Kopf: Sie stand mit Stefan auf der Besucherterrasse und sah ihnen beiden dabei zu, wie sie durch die Nacht davonflogen.
Stefan zündete sich als Erster eine Zigarette an, als das Verbotsschild erlosch.
Dann begannen sie sich zu unterhalten. Zuerst wollte Stefan erzählen, was er nach der Schule gemacht hatte. Elisabeth beobachtete unterdessen die Mitpassagiere, die Stewardessen und Stewards, die durch den Gang glitten, lauschte dem Gemurmel und blickte aus dem Fenster, obwohl draußen alles schwarz war. Sie fühlte sich Stefan gegenüber unsicher. Dabei hatte sie nicht besonders viel an ihn gedacht, seit sie sich das letzte Mal getroffen hatten, ein paar Tage nach dem Abitur, als er gesagt hatte, er wolle nach Stockholm, und sie geschwiegen hatte, weil sie noch nicht wusste, was sie selbst machen würde. An diesem letzten Schultag herrschte eine gewisse Unsicherheit. Was man auch von der Schule gehalten haben mochte, sie hatte doch eine Art Geborgenheit geboten. Eine Routine, zu der man Tag für Tag zurückkehren konnte. Jetzt gab es die nicht mehr, und das ganze Gerede davon, wie schön der letzte Tag sein würde, klang plötzlich ein wenig hohl.
In der ersten Woche war es ja noch erträglich. In den Nächten unterwegs sein, bis um halb zwei schlafen, keine Zeiten einhalten müssen. Aber dann überkam einen eine Leere und man begann, nach etwas zu suchen, was einem Halt bieten konnte. Aber Stefan hatte es wieder so leicht wie üblich. Er haute einfach nach Stockholm ab, um für seinen Vater zu arbeiten.
Also war Elisabeth sich jetzt nicht ganz sicher, was sie von dem Wiedersehen mit Stefan halten sollte. Vielleicht wäre es spannender, allein zu reisen. Aber andererseits konnte es ja auch ganz nett werden.
Elisabeth schaute ihn von der Seite an, wie er da auf dem Mittelsitz saß und rauchte. Er war wie immer. Sichere Blicke, sichere Bewegungen, die Zigarette auf seine spezielle Art zwischen Ringfinger und kleinem Finger eingeklemmt. Niemand würde glauben, dass er erst siebzehn war. Er wirkte mindestens wie zweiundzwanzig. Elisabeth aber, von der man sagte, sie sehe aus wie neunzehn, war auf dieser Reise zweifellos die Jüngste.
Der Däne neben Stefan war fast glatzköpfig und ein Koloss. Elisabeth und Stefan kicherten vielsagend, als sie sahen, wie er in dem Sitz klemmte. Er hatte sein Jackett ausgezogen und saß in Hemdsärmeln da, obendrein mit diesen lächerlichen Ärmelhaltern. Und er summte ständig irgendwelche Lieder. Ungefähr nach einer halben Stunde, als die Leute es sich auf ihren Sitzen bequem gemacht hatten und der Service gerade in Gang gekommen war, wandte er sich Stefan und Elisabeth zu, bot ihnen Süßigkeiten aus einer Plastiktüte an und begann sie auszufragen, woher sie kämen und lauter solche Dinge. Elisabeth verstand kaum, was er sagte, und vermutlich begriff auch Stefan nicht besonders viel, obwohl er auf seine selbstsichere Art antwortete. Dann wollte der Däne, der Jørgensen hieß, ihnen ein Foto zeigen, und es kostete ihn einige Mühe, bis er die Brieftasche aus der Gesäßtasche gezogen und ein abgegriffenes und zerkratztes Bild herausgeholt hatte. Darauf waren verschwommen vier Männer vor einer Feuerwache zu erkennen. Vier Männer mit Brandhelmen, und ganz rechts stand Jørgensen. Soweit es Elisabeth verstand, war er Mitglied in einer Art Klub für Liebhaber von Feuerwehrautos.
Allmählich begann er ein wenig lästig zu werden, und als die Stewardess kam, nahmen Stefan und Elisabeth die Gelegenheit wahr, sich von dem Feuerwehrmann abzuwenden und ihre Getränke zu bestellen. Stefan wusste sofort, was er wollte. Typisch für ihn, dachte Elisabeth. Immer so bemüht, nonchalant zu wirken, dass er es nicht wagt, etwas anderes auszuprobieren. Sie selbst bestellte Saft, damit ihr nicht übel wurde, was ihr nach Schnaps und Bier oft passierte. Stefan hingegen nahm ein Bier und einen dänischen Schnaps. Wenn er jetzt bloß nicht betrunken wird, dachte Elisabeth. Sonst wird er unangenehm geschwätzig.
Schon jetzt fühlte sie, dass sich diese Reise nicht so entwickelte, wie sie es sich vorgestellt hatte. Als sie in den letzten Wochen davon geträumt hatte, war alles ganz anders gewesen. Das Flugzeug hatte andere Farben gehabt, die Mitreisenden hatten anders ausgesehen, es hatte anders gerochen, und vor allem war sie allein gewesen, war gereist, ohne einen einzigen Menschen zu kennen. Und jetzt saß Stefan hier. Nichts kommt so, wie man es sich vorgestellt hat. Hoffentlich wird es später besser, dachte sie, und in diesem Moment wurden sie schon bedient.
Es war fürchterlich eng in den Sitzreihen, und sie mussten sich beim Essen abwechseln, während sie die Sandwiches mit Garnelen und sonstigem Belag aus der Plastikfolie schälten. Aber der Däne sang die ganze Zeit weiter, obwohl er in seinem Sitz feststeckte.
Nach etwa einer Stunde bekam Elisabeth allmählich einen Überblick über die anderen Passagiere. Viele wollten jetzt auf die Toilette im hinteren Teil gehen, und sie musterte jeden genau. Es waren ziemlich viele alte Menschen im Flugzeug, und ausnehmend viele lachten. Einige fingen wohl auch an zu trinken. Besonders zwei junge Typen schwankten mehrmals auf die Toilette und blieben unterwegs immer wieder stehen und begrüßten alle, an denen sie vorbeikamen. Der Däne gab ihnen jedes Mal die Hand. Sie grüßten auch Stefan und Elisabeth, aber Stefan antwortete ihnen ziemlich ruppig.
Es gab so viel zu sehen, dass Elisabeth kaum dazu kam, sich bewusst zu machen, dass sie gerade nach Afrika unterwegs war. Erst als der Flugkapitän ins Mikrophon sprach und erklärte, sie hätten gerade die deutsch-französische Grenze überflogen, wurde ihr mulmig und fast ein wenig unheimlich zumute. Stefan, der inzwischen ordentlich getankt hatte, meinte, jetzt gehe es ja endlich voran, und das sei gut so, damit sie auch mal ans Ziel kämen. Dann fing er an, auf diese verdammten Billigflieger zu schimpfen, in denen man zwischen halb vertrottelten Beamten wie in Sardinenbüchsen eingeklemmt hockte, und schwor, nie wieder wolle er sich auf diese Weise eingeengt fühlen. Auf einem Linienflug müsse man sich sicher nicht mit solchen Idioten aus Dänemark herumschlagen.
Letzteres sagte er zu Elisabeth gebeugt, damit Jørgensen es nicht hörte. Elisabeth kicherte und nickte, obwohl sie fand, dass Stefan gemein war und auf seine unerträgliche Art übertrieb. Aber sie wollte keinen Streit. Sie wusste, Stefan würde sie rasch mit seiner Beredtheit übertrumpfen, in der er sehr ausdauernd war. Elisabeth dachte eine Weile darüber nach, wie oft sie ihm eigentlich schon zugestimmt hatte, obwohl sie nicht seiner Meinung gewesen war. Das lag daran, dass es ihr schwerfiel, einfach so drauflos zu reden. Das war in der Schule schon so gewesen. Im Kreis der Mädchen hatte sie keine Probleme, aber sobald Erwachsene oder Jungen dazukamen, wurde es schwierig. So ging es den meisten Mädchen.