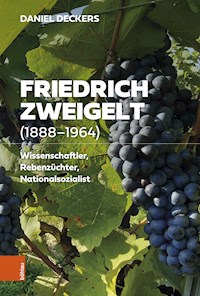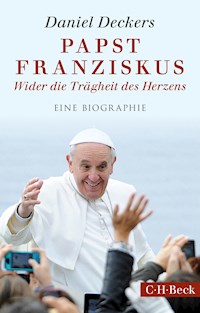Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Köln
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Im Jahr 2020 konnte das Weingut St. Antony in Nierstein (Rheinhessen) auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken: 1920 war am Sitz der "Gutehoffnungshütte" in Oberhausen per Schiff die erste Lieferung "unseres Niersteiners" eingetroffen – Wein aus Randflächen eines Kalksteinbruchs, den die GHH vor dem Ersten Weltkrieg gepachtet hatte, ausgebaut und abgefüllt in einer ersten eigenen, notdürftig errichteten Kellerei. Zunächst dienten die eigenen Weine dem Vorstand eines der größten Montanunternehmen als Statusobjekte sowie zur Pflege unternehmerischer und persönliche Netzwerke. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbesserte sich die Qualität der Weine nicht nur derart, dass sie auf der Vorstandsebene als Menübegleiter eingesetzt wurden. Nach einer erheblichen Ausdehnung der Rebfläche wurden die GHH-Weine auch der Belegschaft des weitverzweigten Konzerns angeboten und fanden sogar den Weg bis nach Brasilien. In den achtziger Jahren avancierte das nunmehr St. Antony genannte Weingut, das zusammen mit der GHH auf die MAN übergegangen war, zu einem der besten Riesling-Weingüter in ganz Deutschland. Daniel Deckers hat die Geschichte des Weinguts St. Antony auf der Basis aller verfügbaren schriftlichen Quellen und vieler mündlichen überlieferungen rekonstruiert. Weinbaugeschichte verbindet sich dabei mit Industrie-, Gesellschafts- und Mentalitätsgeschichte. Diese Verflechtungen machen das Weingut St. Antony zu einem einzigartigen Erinnerungsort womöglich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das Archiv des Unternehmens Gutehoffnungshütte Aktienverein (GHH), Oberhausen, wird in der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA) aufbewahrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte Band 49
Herausgegeben von Ulrich S. Soénius
Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln
Daniel Deckers
Der Wein der »Gutehoffnungshütte«
100 Jahre Weingut St. Antony
Böhlau Verlag Wien Köln
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung durch den Landschaftsverband Rheinland
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2021 Böhlau, Lindenstraße 14, D-50674 Köln, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei,
Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Weinfässer in St. Antony (© Weingut St. Antony)/ Belegschaft vor dem Weingut, 1920er Jahre (© Ute Michalsky, Nierstein)
Korrektorat: Christoph Landgraf, St. Leon-RotEinbandgestaltung: Guido Klütsch, KölnSatz: büro mn, BielefeldEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-412-52318-3
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1Mit dem Eigenbau einverstanden
Wann, warum und wie ein Montankonzern aus dem Ruhrgebiet an ein Weingut am Rhein kam
2Mit recht kräftigen Bemerkungen beanstandet
Wie und warum sich in den beiden ersten Jahren die Schwierigkeiten häuften
3In sparsamster Weise
Wie sich das Weingut Nierstein in Zeiten anhaltender Wirtschaftsnot schlug
4Naturrein eingelegt
Warum und wie in den 1930er Jahren viele auf den Geschmack der Niersteiner Weine kommen sollten
5Wein und Krieg
Warum die Nachfrage nach GHH-Wein stetig stieg und dieser dem Unternehmen gute Dienste leistete
6Gegebenenfalls eine gute Lage unseres Niersteiners
Wie es nach dem Krieg aufwärts ging und warum Niersteiner Wein auf einmal in Oberhausen auf den Tisch kam
7Zum größten Teil allerbeste Lagen Rheinhessens
Warum es in Nierstein nicht mehr so weitergehen konnte wie bisher und wie das Weingut endlich profitabel wurde
8Von Cabinet zu Kabinett
Warum in Nierstein eine Himmelsleiter getrunken wurde und welche Fortschritte das Weingut gemacht hat
9Wein für die Wirtschaft
Wie aus großen Lagen Großlagen wurden und warum der Keller nach Weihnachten zumeist leer war
10 Auf sehr hohes Niveau gebracht
Warum ein Wein aus Nierstein zu den hundert besten Rieslingen der Welt gezählt wurde und wie die MAN sich dennoch von dem Weingut St. Antony trennte
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsnachweis
Register
Abb. 1 Erntedank: Feierlicher Abschluss der Traubenlese vor dem Weinkeller der GHH in Nierstein (undatiert, vermutlich 1920er Jahre).
Vorwort
Eine eigenständige Publikation zur Weingeschichte hat es in der Schriftenreihe der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA) noch nicht gegeben, weder in der „Alten Folge“ von 1910 bis 1931 noch in der „Neuen Folge“, die 1959 begann und bis heute 48 Bände vorgelegt hat. Mit diesem, dem 49. Band, wird nun ein Kapitel deutscher Wirtschaftsgeschichte aufgeschlagen, das die Verbindung zwischen Großindustrie und der Herstellung von Wein aufzeigt.
Quellen zur Weingeschichte sind im RWWA zahlreich vorhanden. So gibt es kleinere Bestände von Weinhandlungen, Informationen über einzelne Unternehmen in den bestandsergänzenden Dokumentationen und Archivalien mit Bezug zu Wein in anderen Beständen. Letztere reichen von den Weinbestellungen im Haushalt von Unternehmerfamilien über Speisekarten anlässlich privater und geschäftlicher Feiern bis hin zu den Sach- und Firmenakten der Industrie- und Handelskammern des Rheinlands. Dabei findet sich Weingeschichte nicht nur in Akten, sondern auch in Drucksachen, Fotos und Filmen, wie in einem Film über die Verwendung von Maschinen in der Landwirtschaft. Die Quellen zur Geschichte von Weinanbau und Weinhandel geben Antworten auf Fragen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Kulturgeschichte und der Technikgeschichte. Viele interessante und erzählenswerte Hinweise bietet das RWWA also zur Weingeschichte. Zu den Aufgaben eines Archivs, auch des RWWA, gehört neben der Sicherung, Bewertung und Aufbereitung der Quellen auch die Vermittlung von historischem Wissen. Daher lag es nahe, die Forschungen von Daniel Deckers zu dem Weingut St. Antony in Nierstein als Band 49 in die Schriftenreihe des RWWA aufzunehmen. Anhand der Quellen eines der umfangreichsten Bestände des RWWA, dem Bestand Abt. 130 Gutehoffnungshütte Aktienverein (GHH), Oberhausen, kann über die Geschichte des Weingutes lebendig und informativ berichtet werden. Zudem bietet diese seltene Symbiose von Eisen- und Stahlindustrie mit der Herstellung eines Nahrungsmittels bisher nicht bekannte Einblicke in die Arbeitsweise eines Großkonzerns. Der Aufbereitung dieser Thematik hat sich Daniel Deckers gewidmet, der im Hauptberuf verantwortlicher Redakteur bei der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ist und im Nebenberuf Geschichte des Weinbaus und des Weinhandels an der Hochschule Geisenheim lehrt. Ihm gebührt der Dank, über diesen spannenden Aspekt deutscher Geschichte recherchiert und dieses Buch verfasst zu haben. Zu danken gilt auch der St. Antony Weingut GmbH & Co. KG; vertreten durch den Geschäftsführer Dirk Würtz, und dem Landschaftsverband Rheinland für die Unterstützung sowie dem Böhlau-Verlag, der in sehr guter Zusammenarbeit in zweiter Folge einen weiteren Band der Schriftenreihe des RWWA ermöglicht hat.
Dr. Ulrich S. SoéniusDirektor
Einleitung
Im Sommer 2019 wurde der Verfasser von dem geschäftsführenden Gesellschafter des Weingutes St. Antony (Nierstein) Dirk Würtz gebeten, einer offenkundig ungewöhnlichen Geschichte so umfassend wie möglich auf den Grund zu gehen: In den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs erdacht, war das „Weingut Nierstein“ allen politischen und wirtschaftlichen Zäsuren zum Trotz fast sieben Jahrzehnte im Besitz der in Oberhausen (Rheinland) ansässigen „Gutehoffnungshütte“ (GHH) geblieben. Weitere zwanzig Jahre gehörte es unter dem Namen „St. Antony“ zum MAN-Konzern, in dem die Gutehoffnungshütte Mitte der 1980er Jahre aufgegangen war. Obwohl die Weine dieses Gutes zur Weltspitze gezählt wurden, wurde das Weingut 2005 im Zuge der Konzentration der MAN auf ihr Kerngeschäft veräußert.
Nun stand das Jahr bevor, in dem sich die eigentliche Gründung des Weingutes zum hundertsten Mal jähren würde, waren doch im Herbst 1920 die ersten „unserer Niersteiner Weine“ am Sitz des Montanunternehmens in Oberhausen eingetroffen. Was lag da näher, als diesen in Deutschland, wenn nicht in der Weinwelt überhaupt einmaligen Verflechtungen von Weinbau-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte auf den Grund zu gehen?
Das Unterfangen war mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. In dem Weingut in Nierstein hatten sich keine Artefakte erhalten, die herangezogen hätten werden können. Umso reichere Aktenbestände konnten in dem Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA) lokalisiert werden. Auch in dem Historischen Archiv der MAN SE in Augsburg hatte das Weingut Spuren hinterlassen. Den Mitarbeitern beider Häuser sei für ihr stetes Entgegenkommen und ihre Hilfsbereitschaft herzlich gedankt.
Unentbehrlich für die Rekonstruktion der jüngeren Vergangenheit waren die Auskünfte und die Unterlagen des langjährigen Betriebsleiters Dr. Alexander Michalsky und seiner Frau Ute (Nierstein/Hangelsberg). Agnes Hasselbach (Weingut Gunderloch) und Georg Mauer (vormals Wein & Glas, Berlin) trugen mit ihren Erinnerungen ebenfalls dazu bei, dass die wichtigsten Ereignisse und Personen aus den vielen Jahrzehnten nicht der Vergessenheit anheimfielen, in denen die Gutehoffnungshütte und die MAN Weinbaugeschichte schrieben. Ihnen allen ebenfalls von Herzen gedankt.
Erste Einblicke in die Geschichtswerkstatt erhielten die Freunde des Weingutes St. Antony im Herbst 2020. Woche für Woche wurden in einem von Lisa Kechel (Weingut St. Antony) kuratierten Newsletter Episoden aus der nunmehr hundertjährigen Geschichte des Weinguts geschildert. Was gedacht war, um die Wartezeit bis zu den für den 13. November geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten zu verkürzen, wurde nach der coronabedingten Absage aller Aktivitäten im November zu einer Brücke, die von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft führt. In Heft 3 des Jahrgangs 2020 der Zeitschrift „Fine. Das Weinmagazin“ erschien derweil in der Kolumne „Wein und Zeit“ ein Essay unter dem Titel „Hochöfen und Spitzenweine“. In ihm wurde die Weinkultur im Ruhrgebiet der 1950er Jahre ausgeleuchtet, soweit sie sich mit den Namen Nierstein und Gutehoffnungshütte verbindet.
Dieses Buch, das dank der Initiative des Direktors des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs, Dr. Ulrich Soénius, in der traditionsreichen Schriftenreihe des RWWA erscheint, vereinigt nun alle Vorarbeiten. Es möchte seinen Lesern eine einmalige Geschichte erzählen, in der wie unter einem Brennglas die Größe wie auch manches Elend des Weinbaus im Deutschland des 20. Jahrhunderts sichtbar werden. „Germany however, with its unreliable climate, has the possibility in a good year to produce white wines of a quality quite unlike those made elsewhere in the world”, schrieb Ian Jamieson 1981 in der 2. Auflage von André Simons “Wines of the World”. So ist es noch immer.
Limburg, im August 2021
1 Mit dem Eigenbau einverstanden
Wann, warum und wie ein Montankonzern aus dem Ruhrgebiet an ein Weingut am Rhein kam
Man schrieb das Jahr 1911. In den Weinbergen am Rhein und seinen Nebenflüssen wuchs über den Sommer ein Wein heran, von dem man noch lange sprechen sollte: ein Jahrhundertwein.1 Unerwartet kam dieses Ereignis nicht – im Gegenteil. Denn nach genau hundert Jahren war der Halley’sche Komet wieder einmal mit bloßem Auge zu sehen, und wie von magischen Kräften erzeugt, war der 1811er ein Jahrgang geworden, der Kenner noch lange ins Schwärmen brachte. Doch nicht alleine die Qualität der „Eilfers“, wie Johann Wolfgang von Goethe sich ausdrückte,2 war legendär, sondern auch seine Symbolik. Die einzigartige Gabe des Vaterlandes beflügelte die patriotischen Gefühle all jener, die sich aufmachten, nach dem Ende der Befreiungskriege im Sommer des Jahres 1814 das linke Rheinufer von den Spuren der mehr als zwanzig Jahre währenden Herrschaft der Franzosen zu befreien.3
1911 und damit genau hundert Jahre später stand das Leben in Deutschland wieder im Zeichen von Kriegen – allerdings nicht um das linke Rheinufer. Vierzig Jahre zuvor, nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, waren die Grenzen im Westen neu gezogen worden. Nicht nur das Elsass war seither Teil des Deutschen Reiches und der Rebfläche nach das größte Weinbaugebiet. Die Deutschen hatten auch darauf geachtet, dass ihnen ein Großteil des luxemburgisch-lothringischen Montanreviers zufallen würde. Kohle hatte man in Deutschland genug, Eisenerz nicht. Beides, Kohle und Erz, brauchte es aber, um immer größere Kriegsschiffe zu bauen, immer mächtigere Brücken und immer stärkere Maschinen.
Schon bald nach der Annexion Lothringens hatte sich die in Oberhausen-Sterkrade ansässige Gutehoffnungshütte für die Erzvorkommen in dieser Region zu interessieren begonnen.4 Das luxemburgisch-lothringische Minette-Erz war zwar weitaus weniger eisenhaltig als das schwedische oder das spanische. Aber das älteste Montanunternehmen des Ruhrgebiets namens Gutehoffnungshütte (GHH), das aus der Mitte des 18. Jahrhunderts gegründeten Eisenhütte namens St. Antony in (Oberhausen-)Osterfeld hervorgegangen war und seit 1810 als „Hüttengewerkschaft und Handlung Jacobi, Haniel und Huyssen“ nationale Bedeutung erlangt hatte, war auf eigene Erzvorkommen dringend angewiesen.5
Abb. 2 Der Patriarch: Paul Reusch (1868 – 1956).
Weil aber der Transport des Erzes in das Ruhrgebiet auf lange Sicht unrentabel erschien, sollte in der Nähe der Minette-Region ein Hochofen errichtet werden. Das Schlossgut Scheuern (heute: La Grange) bei Monhofen (Manom) kam das gerade recht: Die Hüttenverwaltung sollte ihren Sitz in der nahegelegenen Stadt Diedenhofen (Thionville) nehmen, die ausgedehnten Waldungen würden der Hütte weichen und das aus dem 18. Jahrhundert stammende Schloss, eines der schönsten weit und breit, als eine Art Werksgasthaus für die Belegschaft dienen. Und dann gab es noch einige Hektar Weingärten in der Nähe des Schlosses, die der Reblauskrise zum Trotz noch oder vielleicht auch schon wieder bewirtschaftet waren (genau wussten es die Mitarbeiter des Historischen Archivs der Gutehoffnungshütte nicht, als sie 1969 eine maschinenschriftliche Chronik der Entstehungsgeschichte des Weingutes verfassten).6 1909 wurde das Schloss gekauft. Was aber aus den der Gutehoffnungshütte zustehenden Weinen aus Lothringen wurde, etwa aus dem 1911er, wissen wir ebenso wenig, wie welche Rebsorten in den fraglichen Parzellen standen.
Schlossverwalter Eduard Friedrich schien einiges vom Weinbau zu verstehen. Anfang 1918 sollte er dem Vorstandsvorsitzenden Paul Reusch,7 der den Ankauf von Schloss Scheuern forciert hatte, stolz nach Oberhausen berichten, dass „bei uns“ eine Baumkelter stehe, deren Erhaltungszustand viel besser sei als der einer sehr ähnlichen Kelter, die er im Historischen Museum der Pfalz in Speyer gesehen habe. Diese stamme immerhin aus dem Jahr 1727.8 Reusch hatte für Nachrichten dieser Art offenbar einen Sinn, obwohl er Anfang 1918 als einer der zentralen Figuren der Kriegswirtschaft mit vielen anderen Dingen beschäftigt gewesen sein dürfte. Friedrich solle das Alter der Kelter feststellen und Photographien anfertigen. Vielleicht, so Reusch in einer seiner typischen handschriftlichen Marginalien, könne man die Kelter dem Deutschen Museum in München überlassen. So viel Mäzenatentum musste auch im fünften Kriegsjahr sein, war Reusch doch ein früher Förderer des 1903 gegründeten naturwissenschaftlich-technisch ausgerichteten Museums.9
Ächter Nierensteiner
Doch warum war Friedrich in Speyer gewesen? Um Erz zu verhütten, brauchte es auch Kalkstein, und das ebenfalls in großen Mengen. Um die steigende Nachfrage nach Roheisen und Stahl zu befriedigen, musste die Gutehoffnungshütte, in der seit 1909 der Schwabe Paul Reusch als Vorstandsvorsitzender den Ton angab, über die bestehenden Kalksteinbrüche in Wuppertal-Dornap („Hanielsfeld“), Wuppertal-Lüntenbeck und Nierstein hinaus nach neuen Abbaustätten Ausschau halten. Je verkehrsgünstiger sie zum Ruhrgebiet lägen, wo die GHH in Duisburg-Walsum einen werkseigenen Hafen betrieb, desto besser. Noch besser, wenn es auch nach Lothringen nicht allzu weit wäre, auch wenn der regelmäßige Transport per Schiff die Mosel hinaus noch nicht möglich war.
Fündig wurde die GHH im jenem legendären Herbst 1911 in Nierstein, etwa auf halbem Weg zwischen Mainz und Worms am Rhein gelegen. Nicht, dass dieser Ort für Kalkstein bekannt gewesen wäre. Es war der Wein, der diesen Ort im Rheinhessischen berühmt gemacht hatte. Wie Rüdesheimer, Steinberger oder Johannisberger war Niersteiner oder auch Nierensteiner ein Inbegriff für besten Wein vom Rhein – so etwa in der frühen, 1776 niedergeschriebenen Version des „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe. Auf Fausts Frage in Auerbachs Keller „Was für ein Gläsgen mögtet ihr trinken? Ich schaff euch!“ antwortet Frosch: „He! He! So ein Glas Reinwein ächten Nierensteiner“.10 In späteren Fassungen hat Goethe indes nicht nur die gesamte Szene stark verändert, sondern auch den Nierensteiner eliminiert. 1790 lautete der Vers in „Faust. Ein Fragment“, in dem Goethe den Stoff der frühen Fassung vor dem Hintergrund der revolutionären Ereignisse in Frankreich neu sortiert hatte: „Gut! Wenn ich wählen soll, so will ich Rheinwein haben. Das Vaterland verleiht die allerbesten Gaben.“ 11
Jüngeren Datums war der Weinbau am Rhein nicht. Zahlreiche archäologische Zeugnisse, allen voran Winzergeräte, ließen den Schluss zu, dass spätestens die Römer im Niersteiner Tal sowie entlang der Rheinfront Weinbau betrieben hätten, hieß es kurz und bündig in dem 1910 erschienen Buch „Die Rheinweine Hessens“.12 Sodann seien die Karolinger sowie alle nachfolgenden Kaiser „eifrige Förderer des Weinbaues“ gewesen. Große Teile des Niersteiner Berges seien kaiserlicher Besitz gewesen, der zusammen mit dem karolingischen Palast ein Weingut gebildet habe. Auch Adel wie von der Leyen oder Metternich, Klöster und Kirchen wie das Kölner Stift St. Gereon hätten in und um Nierstein Weinberge besessen – was den Verfasser zu der für diese Art von Literatur typischen, alle Krisenphänomene im Mittelalter und in der Neuzeit ausblendenden Feststellung veranlasste: „Im Niersteiner Wein verkörpern sich alle die charakteristischen edlen Eigenschaften des Rheinweins in höchstem Maße; sie sind ihm geblieben von den Römern und der Tafelrunde Kaiser Karls des Großen an bis zum heutigen Tage.“ 13
Abb. 3 Die größte weinbautreibende Gemeinde des Großherzogtums Hessens: Nierstein, Kreis Oppenheim.
Nicht zu bestreiten ist aber, dass „Niersteiner“ im 17. und 18. Jahrhundert eine der ersten spezifischen Herkunftsbezeichnungen für Rheinwein geworden war. Ermöglicht wurde diese Art der Markenbildung durch die Kombination zweier natürlicher Gegebenheiten. Zum einen verfügte der Ort über die größte Rebfläche weit und breit, zum anderen bot der unmittelbar am Rhein gelegene Ort die Gelegenheit, Wein aus nah und fern in großen Mengen umzuschlagen.
Das Angebot, Niersteiner oder einen anderen Wein aus Rheinhessen zu liefern, war also etwa so plausibel wie das Ansinnen, es mit Rüdesheimer oder Hochheimer zu versuchen – in einer Zeit, in der unter wohlklingenden Namen viel mehr Wein verkauft wurde, als an den betreffenden Orten jemals hat wachsen können, kein ganz unerheblicher Vorzug. Und noch 1903 wusste man in Rheinhessen diese Gunst der Natur mit den Worten zu kapitalisieren, Nierstein zeichne sich „nicht allein durch die Qualität seines Produktes aus. Besonders in der Neuzeit ist die Rebfläche noch bedeutend angewachsen. Nach den Erhebungen der Großherzoglich Hessischen Zentralstelle für die Landesstatistik hatte die Gemarkung Nierstein 625 Hektar Rebfläche im Jahre 1900, 712 Hektar im Jahre 1901 und 855 Hektar im Jahre 1902. Mit einem solchen Umfange steht wahrscheinlich Nierstein an der Spitze aller deutschen Weinbaugemarkungen.“ 14
Für den Niersteiner sprach auch, dass er sich kostengünstig über große Distanzen transportieren ließ. Von den ausgedehnten Kellern unter der Stadt war es bis zum Ufer des Rheins nicht weit. Dort wurden die Fässer mit Niersteiner oder anderem rheinhessischen Wein mit Hilfe eines Kranes auf Rheinschiffe verladen und über Mainz und Köln, die „Weinstadt“ der Hanse, in den gesamten nordwesteuropäischen Raum transportiert.15
Den meisten Weinorten am Rhein weit voraus war Nierstein aber nicht nur, was die Gunst der Lage im eigentlichen Sinn anging. Mehr als sehen lassen konnte sich auch das Potenzial vieler Weinbergslagen. In dieser Gemarkung lag der größte Teil des (heute sogenannten) Roten Hangs, eines Höhenzugs aus rotem, von einem hohen Anteil an Eisenoxid durchsetzten Tonschiefer, der sich auf einer Länge von fast fünf Kilometern nach Norden erstreckte.16 Der Hang drehte, sobald er nicht mehr parallel zum Fluss verlief, direkt nach Süd, wie es Johann Philipp Bronner, der Apotheker aus Wiesloch, der zum Begründer der wissenschaftlichen Weinbauliteratur in Deutschland werden sollte, schon 1834 in seinem Standardwerk „Der Weinbau in Süddeutschland“ festgehalten hatte: „Das Weinbaugelände Niersteins bildet an seiner Abdachungsfläche einen stumpfen Winkel, dessen einer Schenkel gegen Nackenheim eine östliche Exposition mit einer Neigung nach Süden, der andere Schenkel gegen Schwabsburg eine südliche hat. Den Vereinigungspunkt bildet der Kranzberg, ein Vorhügel, an welchen sich Nierstein anlehnt.“ 17 Südlich des Ortes wiederum befindet sich nach der politisch stets bedeutenderen alten Reichsstadt Oppenheim zu ein Höhenrücken, der sich ebenfalls für Weinbau eignet. Wegen des gegenüber der windgeschützten Rheinfront raueren Mikroklimas und des vorwiegend aus Kalkmergel bestehenden Bodens ist er jedoch für Rebsorten wie Riesling und Burgunder nicht ideal, da sie hohe Ansprüche an den Standort stellen.
In den geschützten Hanglagen der Rheinfront und des von Südost nach Südwest drehenden Seitentals, in dem der Ort Nierstein liegt, hingegen waren die Bedingungen für den Anbau von Riesling, der Königin der weißen Rebsorten, nachgerade ideal – was allerdings nicht heißt, dass erhebliche Teile, wenn nicht gar die meisten Teile der aus rotem Tonschieferverwitterungsboden bestehenden Abbruchkante schon im 19. Jahrhundert mit Riesling im reinen Satz bepflanzt worden seien. Tatsächlich waren viele Parzellen noch bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit Silvaner bestockt. Ebenso lange wurden Riesling und Silvaner mit dem Ziel miteinander verschnitten, Spitzenweine auf die Flasche zu bringen.18 Für den Rebsatz in den besseren Lagen dürften eher die Weine charakteristisch sein, die der Landwirtschaftliche Verein für die Provinz Rheinhessen anlässlich einer „Kostprobe Rheinhessischer 1893er Wein“ zusammengestellt hatte. Diese fand am 4. September 1894 anlässlich des 13. Deutschen Weinbau-Kongresses in Mainz in den Räumen der dortigen „Liedertafel“ statt. Damals wurden aus dem Vereinsbezirk Oppenheim etwa gleich viele „Riesling“-Weine gezeigt wie „Riesling und Oesterreicher“. Unter den Rebsorten – so die Weine überhaupt unter Angabe der Rebsorte und nicht mit Hilfe der Lage charakterisiert wurden – wurden für Nierstein, Nackenheim und Oppenheim überdies noch Orléans und Traminer erwähnt.19
Abb. 4 Mit preußischer Gründlichkeit: Niersteiner Weine des Jahrgangs 1911 in der Amtlichen Weinstatistik.
Die mit großem Abstand dominierende Rebsorte war indes Silvaner, damals zumeist Sylvaner geschrieben beziehungsweise auch Österreicher genannt.20 So wurden aus dem Jahrgang 1909 im Chemischen Untersuchungsamt für die Provinz Rheinhessen insgesamt 27 Moste aus der Gemarkung Nierstein untersucht, und zwar sowohl aus den Spitzenlagen Rehbach und Auflangen, aber auch aus den auf der Höhe nach Westen hin gelegenen Lage Schmitt sowie den südlich des Ortes gelegenen Lagen mit ihren Kalkmergelböden.
Einzig in der Rehbach stand Riesling, in allen anderen Sylvaner beziehungsweise Österreicher.21 Und wohl nur in den weiteren Spitzenjahren wie 1911 und 1921 wurden in den wenigen Weingütern, die sich im Besitz vermögender Privatpersonen wie dem Mainzer Bankier Carl Gunderloch befanden, jene Auslese-Weine erzeugt, die die Rheinfront als dem Rheingau ebenbürtig erscheinen ließen.22 Tatsächlich sollten auch die 1911er aus den Niersteiner Spitzenlagen wie Rehbach, Auflangen, Hipping, Fuchsloch, Orbel, Pettenthal, Oelberg oder der Glöck 23 sowie aus dem weiter nördlich gelegenen Nackenheim mit seiner schon im Mittelalter begehrten Spitzenlage Rothenberg zu den größten Weinen des 20. Jahrhunderts zählen.
Ein Kalksteinbruch am Rhein
Die Gutehoffnungshütte hatte von dem exzellenten Ruf des Niersteiners jedoch nichts, obwohl sie seit 1911 außer den Rebflächen in Lothringen auch einige mit Reben bestockte Parzellen in Nierstein besaß. Am 8. August jenes Jahres hatte sie von einem gewissen Georg Senfter einen Kalksteinbruch sowie ein Gebäude zur Unterbringung von Arbeitskräften gekauft. „Zur Abrundung“, wie es später hieß, wurden zwischen 1911 und 1913 von weiteren Eigentümern Grundstücke erworben.24 Die Vorbesitzer waren zumeist Ortsansässige, die in mehr oder weniger großem Umfang auch Weinbau betrieben – und würden dies noch so lange auf den nunmehr der Gutehoffnungshütte gehörenden Flurstücken tun können, wie diese als Reserveflächen für den Steinbruch vorgehalten wurden. Um diese Parzellen, die 1914 zusammengenommen eine Fläche von zwölf Hektar bedeckten, würde es dereinst nicht schade sein. Der Steinbruch, der zum größten Teil einem Bruder des renommierten Weingutsbesitzers Reinhold Senfters gehört hatte, lag nämlich nicht an der Rheinfront nördlich des Ortskerns, sondern im Süden, nach Oppenheim hin.
Was dort einst die Stunde geschlagen hatte, ließ sich an dem Namen der Erhebung ablesen, die beide Orte voneinander trennte: Galgenberg. Schon das war kein gutes Omen für einen guten Wein. Überdies war das Kleinklima südlich der Stadt rauer als an den windgeschützten, wärmespeichernden Hangflächen mit ihrem charakteristischen roten Tonschiefer nach Norden zu. Auf den kühleren Kalkboden pflanzte man damals bestenfalls Silvaner,25 wenn nicht ein Sammelsurium von weißen Rebsorten, von denen mindestens eine frühreif war, eine andere genügend Most brachte und wiederum eine andere ein wenig Bukett. Gemischter Satz war keine Marotte, sondern schiere Notwendigkeit.
Dem Ertrag „ihrer“ Weinberge nachzutrauern kam in der Hauptverwaltung der GHH in Oberhausen daher vor dem Ersten Weltkrieg wohl niemandem in Sinn. Vielmehr wurden sie gegen eine zeitlich befristete Pacht von 0,25 Mark je hessischer Klafter oder 400 Mark je Hektar den vormaligen Besitzern oder anderen Bürgern überlassen, die sie entweder in ihrer Freizeit oder mit Hilfe von Tagelöhnern bearbeiteten. Früher oder später würden die Flächen ohnehin für die Erweiterung des Steinbruchs in Anspruch genommen.
Wein und Krieg I
Drei Jahre nach dem Erwerb des Kalksteinbruchs brach Krieg aus. Diedenhofen (Thionville) wurde Aufmarschgebiet, die Pläne für die Errichtung eines Hochofens waren erst einmal hinfällig. In Oberhausen und den anderen Werken, die zu dem Konzern gehörten, fehlte es bald an Arbeitskräften. Tausende Arbeiter waren an der Front, obwohl die Produktion von Rüstungsgütern wie Granatstahl und Geschützen stetig gesteigert werden musste. Bald wurden belgische Zivilisten und Kriegsgefangene angefordert, um die Lücken an der Heimatfront zu füllen. Die Rückführung von Facharbeitern im Rahmen des Hindenburg-Programms, das nach dem Fiasko vor Verdun 1916 zwecks Steigerung der Rüstungsproduktion aufgelegt worden war, reichte nicht aus.26
In Nierstein lagen die Verhältnisse etwas einfacher. Dort war der 1911 erworbene Steinbruch zunächst nicht in Betrieb genommen worden. Die Gründe dafür gehen aus den Akten, in denen von Weinbau die Rede ist, nicht hervor. Erst 1917 war es so weit. Ein Mann namens Werner Kalbitzer wurde als Betriebsführer nach Nierstein geschickt, wo er mehrere Männer aus der näheren Umgebung für die Arbeit im Steinbruch anwerben konnte.27 Dass sie alle mit dem Weinbau vertraut waren, spielte zunächst keine Rolle. Das sollte sich 1918 ändern.
Mit Schreiben vom 30. Oktober 1917 hatte der Niersteiner Weingutsbesitzer Reinhold Senfter, der das elterliche Weingut Joseph Senfter übernommen hatte, den Chef der Forstabteilung der Gutehoffnungshütte kurz und bündig wissen lassen, dass er große Teile der von der GHH gepachteten Flurstücke über den 30. November hinaus nicht mehr bewirtschaften wollte. Die Begründung für diesen Vorgang – die Pachtverhältnisse wurden immer um Martini (11. November) herum geregelt – klang plausibel: Weil die Weinpreise infolge der kriegsbedingten Knappheit enorm gestiegen seien, gäbe es keine „kleinen“ Weinbergsbesitzer mehr, die sich andernorts verdingten, um ein Zubrot zu verdienen. Vielmehr würde jeder zusehen, in den eigenen Parzellen möglichst viel Wein zu erzeugen und selbst zu vermarkten.28
Abb. 5 Folgenreiche Kündigung: Der Niersteiner Weingutsbesitzer Reinhold Senfter will die Parzellen der GHH nicht weiter bearbeiten.
Diese Diagnose traf auf Senfter selbst zu, da er in Nierstein über erheblichen Besitz in den – wie man damals sagte – „besseren und besten Lagen“ verfügte. Seine von der GGH gepachteten Flächen waren hingegen nicht nur in einer Lage, deren Namen nicht der Rede wert war, sondern auch in unmittelbarer Nähe des Bruchs gelegen. Weil die aber, so Senfter, dereinst dem Abbau von Kalkstein würden weichen müssen, lohne es nicht mehr, in Weinbergsarbeiten wie etwa Düngung zu investieren. Die nicht ganz uneigennützige Botschaft aus Nierstein lautete daher: Die Lage derjenigen Weinbergsbesitzer, die mit fremden Leuten arbeiten müssten, sei „geradezu trostlos“, wie er Prokurist Strässer am 17. Dezember 1917 in einem Gespräch in Nierstein wissen ließ. Und: „Der Wein ist noch immer in der Preissteigerung begriffen.“ 29
Auf eigene Rechnung
Wein war im vierten Kriegsjahr wie viele andere Güter auch ein äußerst knappes Gut geworden. Dessen Preise bewegten sich aber mittlerweile in solchen Höhen, dass sie das Kriegswucheramt auf den Plan riefen und 1918 ein Kriegssteuergesetz sowie 1919 den Plan einer allgemeinen Kriegsabgabe auf den Vermögenszuwachs reifen ließen.30 Den Oberhausener Konzernlenkern war all das nicht verborgen geblieben. Mindestens einer von ihnen, der Vorstandsvorsitzende Paul Reusch, war aber auf Wein so bedacht, dass er beziehungsweise seine engsten Mitarbeiter selbst dafür Sorge tragen wollten, welche Weine und welche Spirituosen ihren Weg in den Weinkeller des Werksgästehauses finden sollten. Und das kam so:
1913/14 hatte das Unternehmen am Sitz der Konzernverwaltung in (Alt-)Oberhausen ein sogenanntes Werksgästehaus, betriebsintern auch Werksgasthaus genannt, errichten lassen.31 Hinter diesem unscheinbaren Namen verbarg sich ein repräsentativer, von einem Park eingefasster Bau nach Plänen des Stuttgarter Architektenbüros Oberbaurat Weigle und Söhne. Die Einrichtung diente sowohl der täglichen Verköstigung der „Beamtenschaft“, wie man damals die Verwaltungsangestellten bezeichnete, als auch als Ort, an dem allerlei illustre Runden zusammenkamen. Dem Aufsichtsrat der GHH stand ebenso ein eigener Raum zur Verfügung wie Gästen des Unternehmens Logierzimmer für die Übernachtung. Eine große Halle diente überdies der Abhaltung von öffentlichen Veranstaltungen bis hin zu Bällen und anderen Lustbarkeiten.
Die Bewirtschaftung des Werksgästehauses oblag einem Ökonom genannten Pächter, der den Küchen- und Restaurationsbetrieb „auf eigene Rechnung“ führte. Die Bestückung des Weinkellers gehörte jedoch ausdrücklich nicht dazu. „Die Gutehoffnungshütte beschafft den Wein, Cognac und Rum auf eigene Rechnung und setzt die Preise dafür an“, hieß es in Paragraph 10 des Vertrages, der am 2. April 1914 zwischen der GGH und einem gewissen Friedrich Austen als dem Ökonomen geschlossen wurde.32
Über die Hintergründe dieser seltsam anmutenden Einschränkung geben die fraglichen Akten keine Auskunft. Doch liegt es nahe, hinter dem direkten Zugriff des Unternehmens auf den Weinkeller des Werksgasthauses niemand Geringeren als den Vorstandsvorsitzenden Paul Reusch zu vermuten. Dieser Mann hielt, wie später sein Sohn Hermann auch, in der GHH eine Ess- und damit auch Weinkultur in Ehren, die – wie seine politischen, tendenziell antidemokratischen Einstellungen auch – ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert hatten.33
Zwar stammte Paul Reusch aus der Nähe von Stuttgart, wohin er sich 1942 nach seiner Absetzung durch die Nazis zurückziehen und (angeblich) das Ruhrgebiet bis zu seinem Tod im Jahr 1956 nie wieder betreten sollte. Doch alle Sparsamkeit und Strenge gegen sich und andere hielten weder ihn noch seinen 1896 geborenen Sohn Hermann davon ab, noch lange im 20. Jahrhundert einer Tischkultur zu frönen, wie sie in der Kaiserzeit in Adelskreisen und bald auch in den Residenzen des Wirtschafts- und Bildungsbürgertums sowie in den Grandhotels üblich gewesen war.34 Aus Anlässen wie Aufsichtsratssitzungen, dem Ausklang von Jagdgesellschaften, Besuchen von Delegationen anderer Unternehmen oder hochgestellten Persönlichkeiten wurde um die Mittagszeit ein (Gabel) Frühstück beziehungsweise abends ein Menü mit mehreren Gängen und einer ebenso opulenten Weinbegleitung serviert. Bordeauxweine namhafter Châteaux aus großen Jahrgängen waren ebenso unabdingbar wie deutsche Spitzenweine vom Rhein und von der Mosel, nicht zu vergessen französischer Champagner (selten deutsche Schaumweine) sowie Süß- und Südweine von Port und Malaga bis Tokajer.35
Abb. 6 Nicht nur ein Ort der Geselligkeit: Das Werksgästehaus der GHH in Oberhausen.
Diese auszusuchen und anzukaufen scheint sich Reusch womöglich nicht nur in Einzelfällen selbst vorbehalten zu haben. Schließt man von Reuschs Verhalten während des Zweiten Weltkriegs 36 auf sein Agieren in Sachen Wein vor und während des Ersten Weltkrieges zurück, dann scheint er bis ins Detail über die Bestände des Weinkellers im Werksgasthaus im Bilde gewesen sein.
So dürfte sich die Teuerung und die Weinknappheit, die schon im Oktober 1916 die volkswirtschaftliche Abteilung des erst im Mai des Jahres gegründeten Kriegsernährungsamts auf den Plan gerufen hatte, auch ihm, der zahllose Berichte und Bilanzen las, nicht verborgen geblieben sein. Die Preissteigerung „ist seit einem Jahr zu beobachten und hat besonders stark seit dem Frühjahr dieses Jahres eingesetzt“, hieß es noch im selben Monat in einem Bericht der Preisprüfungsstelle für den Kreis Mainz. „Bei den Konsumweinen – also den kleinen Verbrauchsweinen – sind die Preise auf das dreifache der vorjährigen Höhe, teilweise bis zum Fünffachen regelmäßiger Jahre gestiegen.“ 37
Doch war diese Beobachtung an sich kein Grund zur Sorge. Im Wesentlichen führten die Mainzer die Preissteigerung zurück auf eine bei verringertem Vorrat erhöhte Nachfrage: Kaum noch ausländische Weine, eine schlechte Ernte 1916, wegen Zuckermangels kaum Möglichkeiten, geringe Weine zu „verbessern“ und somit halbwegs trinkbar zu machen, hoher Verbrauch der Kognakbrennereien und Schaumweinfabriken, gesteigerter Heeresbedarf. In Köln war eine Antwort auf die Anfrage aus dem Kriegswucheramt Berlin am 2. November verfasst worden. Eine übermäßige Steigerung der Weinpreise durch den Weinhandel sei im Allgemeinen „nicht als vorliegend zu erachten“, hieß es kurz und bündig. Als Ursachen der Steigerung der Weinpreise wurden auch in Köln die üblichen Mangelumstände geltend gemacht, zudem der enorme Bedarf des Heeres an Spirituosen, für die als Rohprodukt nur noch Weindestillat in Frage komme, da Brotgetreide nicht mehr zu Kornsprit verarbeitet werden dürfe und Kartoffelsprit nicht mehr zu Trinkzwecken freigegeben werde. Der Unterzeichnete zog daraufhin das Fazit: „Da die Aussichten für die diesjährige Ernte nicht günstig sind, so ist mit weiterer Steigerung der Weinpreise zu rechnen. Höchstpreise bei den verschiedenen Lagen und Qualitäten sind praktisch undurchführbar.“ Die Stellungnahme trug die Unterschrift des Ersten Beigeordneten der Stadt Köln, Konrad Adenauer.38
Selbstbewirtschaftung – Pro und Contra
Ein Jahr später hatte sich die Lage nochmals verschärft, war doch die Ernte des Jahres 1916 (wie von Adenauer befürchtet) schlecht ausgefallen. Der 1917er wiederum war zwar qualitativ herausragend, aber noch lange nicht auf dem Markt. In dieser Lage kam das Angebot Senfters auf den ersten Blick gerade recht: Die Gutehoffnungshütte könne die etwa zehn Morgen oder 2,5 Hektar umfassenden Parzellen rings um den Steinbruch doch selbst bewirtschaften und somit selbst unter die Weinerzeuger gehen. Nicht nur habe die GHH mindestens sechs Weinbergsleute zur Verfügung, sondern auch ein Pferd, mit dem sich die Hauptumbrucharbeit, das Hacken, viel leichter erledigen lasse. So könne man in mittleren Jahren etwa 7,5 Stück oder 7500 Liter Wein erzeugen, während die Kosten insofern gedrückt werden könnten, als man diejenigen Parzellen, die in absehbarer Zeit „in den Bruch fallen“ sollten, schon nicht einmal mehr düngen müsse.39
Überhaupt stellte Senfter die Lage so dar, als sei nichts einfacher, als die außer Pacht befindlichen Weinberge selbst zu bewirtschaften: „Die zur Weingewinnung erforderlichen Gefäße werden sich besorgen lassen. Neue Spritzen sind nicht mehr zu haben; ich könnte indes eine alte Spritze, die wieder brauchbar zu machen wäre, zur Verfügung stellen. Als Keller ist im Steinbruch ein vorzüglicher Raum vorhanden, der mit mäßigen Kosten hergerichtet werden soll“ – so ein Prokurist namens Strässer in seinem Bericht über eine Reise nach Nierstein am 21. Dezember 1917.40 Ob Kommerzienrat Paul Reusch die Lage anders einschätzte? Unter dem maschinenschriftlichen Bericht, der auch von dem Leiter der Forstabteilung, Oberförster Müller, abgezeichnet worden war, hielt der Prokurist am 29. Dezember fest: „Herr Kommerzienrat Reusch lehnt die eigene Bewirtschaftung der Weinberge entschieden ab.“ 41
Was Reusch, der bekanntermaßen viel auf gute Weine und gutes Essen gab, zu dieser Entscheidung bewog, ist den Akten nicht zu entnehmen. War ihm vielleicht die Aussicht auf bestenfalls mittelmäßigen Wein allen Zeitumständen zum Trotz einfach nicht gut genug? Oder scheute er in Anbetracht der allgemeinen Kriegsanstrengungen die personellen und finanziellen Investitionen in ein eigenes Weingut, zu dem ja mehr gehören musste als einige Rebzeilen? Woher die Arbeiter nehmen (auch wenn in Oberhausen wegen allgemeinen Rohstoffmangels mehrere Hochöfen stillgelegt worden waren und womöglich auch der Kalksteinbruch nicht ausgelastet war)? Woher den Keller nehmen? Was mit dem Wein anfangen?
Die ablehnende Entscheidung des Konzernchefs wurde umgehend auch Reinhold Senfter mitgeteilt. Doch der ließ nicht locker. Eine neuerliche Intervention vom 4. Januar verfehlte ihre Wirkung nicht. Reusch verfügte aus welchen Gründen auch immer, dass man ihm „bestimmte Vorschläge“ dahingehend machen solle, ob eine Eigenbewirtschaftung in Nierstein ratsam sei oder nicht.42 Am 1. Februar fanden sich daraufhin gleich zwei Beamte der GHH in Nierstein ein: Oberförster Müller war aus Oberhausen angereist, Eduard Friedrich aus Lothringen. Die Ergebnisse der Besichtigung der Weinberge und der anschließenden Unterredung mit Senfter sandte Friedrich unter dem Datum des 5. Februar von Schloss Scheuern in die Konzernzentrale nach Oberhausen.
Die Reben seien „sehr gut imstande“, die Bodenarbeiten in den Weinbergen könnten ob des weiten Zeilenabstands mit dem Pflug ausgeführt werden und nicht – wie in Lothringen – mit Spaten und Hacke, so Friedrich. Gleichwohl müsse im Blick auf eine Selbstbewirtschaftung der pachtfreien beziehungsweise pachtfrei werdenden Parzellen bedacht werden, dass man alle Gerätschaften für die Weinbergsarbeiten sowie für die Kellerwirtschaft würde beschaffen müssen, allen voran eine Kelter sowie Gär-, Lager- und Versandfässer. Außerdem müsse man sich darüber im Klaren sein, dass die Moste wohl gezuckert werden müssten, um sich zu „trinkbaren Flaschenweinen“ zu entwickeln, und dass sie bis zur Flaschenreife der Pflege bedürften – ohne Sorgfalt und Sachkenntnis, so Friedrichs Mahnung, sei das Unterfangen sinnlos, zumal auch am Rhein „mit Fehljahren gerechnet werden muss“.43
Abb. 7 Gute Argumente: Der Bericht des Prokuristen Strässer über seine Reise nach Nierstein.
Gleichwohl brach Friedrich eine Lanze für die Selbstbewirtschaftung. Ein Stollen im Steinbruch ließe sich mit geringen Mitteln zum Arbeits- und Lagerkeller herrichten, die Verwaltung des Steinbruchs dürfte entweder von benachbarten Winzern Rat erhalten oder sich direkt auf die Männer verlassen können, die im Steinbruch arbeiteten. „Zweifellos hat die Selbstbewirtschaftung den Vorzug, dass dem Werke verhältnismäßig billige Weine sicher gestellt werden“, so die Quintessenz seiner Beobachtungen.44
Friedrich war nicht der Einzige, von dem Reusch Anfang Februar 1918 einen Rat bezüglich des Fortgangs des Weinbaus in Nierstein erbeten hatte. Am 11. Februar legte auch Oberförster Müller seine Ansichten dar. Der Beamte hielt sich erst gar nicht mit einem ausführlichen Pro und Contra auf, sondern führte nur die Gründe an, die „für den Eigenbau“ sprächen: Die „enorm hohen Weinpreise“ wären in doppelter Weise zu bedenken: Zum einen könne sich die GHH aus eigenen Weinbergen die „Kreszenz“ sichern, zum anderen müsse man keine Winzer mit hohen Summen entschädigen, würden die von ihnen gepachteten Flächen dereinst für den Steinbruch benötigt.45
Um vieles andere müsse man sich ebenfalls keine Gedanken machen: Kelter, Fässer etc. wären zu beschaffen, der Stollen als Lager- und Arbeitskeller zu gebrauchen, zudem sei ein Pferd für die Weinbergsarbeit vorhanden. Das Thema Arbeitskräfte, so Müller, stelle sich ebenfalls nicht. Der Betriebsführer könne zwar den Weinbau nicht beaufsichtigen, doch arbeiteten im Bruch sechs Winzer, die zu den einschlägigen Arbeiten herangezogen werden könnten. Die fachmännische Aufsicht liege im Fall des Falles bei Reinhold Senfter, der diese Arbeit auf Bitten der GHH gerne übernehmen werde.
Wie Friedrich, so verschwieg auch Müller nicht, dass der Eigenbau auch Risiken berge. Der Oberförster erwähnte nicht nur Fehljahre. Ebenso realistisch schilderte er die Aufgabe, vor der die GHH stünde: Erfolge seien „nur bei ausreichender sorgfältigster Pflege, sowohl im Rebgelände wie im Keller“ zu erwarten. „Nach meinem Dafürhalten“, so schloss der Beamte seine Darlegungen, „und auf Grund der diesbezüglichen Schreiben des Herrn Senfter überwiegen die Gründe, die für den Eigenbau sprechen.“ 46 Reusch reagierte zunächst nicht. Am 18. Februar 1918 wandte sich der Leiter der Abteilung F der Hauptverwaltung Oberhausen an die Bergwerks-Abteilung III: „Wir bitten dringend die Angelegenheit bezgl. der Weinberge in Nierstein endlich zur Entscheidung zu bringen.“ 47 Zwei Tage später nahm Paul Reusch handschriftlich Stellung: „Ich bin mit dem Eigenbau einverstanden“.48
Ende der sechziger Jahre hielt der Jurist Hans Vygen, der 1953 als Leiter der Rechts- und Grundstücksabteilung der GHH für das Weingut Nierstein zuständig war, eine Ausarbeitung des Historischen Archivs des Unternehmens in den Händen, in der Prokurist Strässer als treibende Kraft hinter dem Weingutsprojekt ausgemacht wurde: Nach Angaben seines Neffen sei dieser ein „Weinzahn“ gewesen.49 Das klingt plausibel. Allerdings gilt es auch zu bedenken, dass alle Berichte, auf deren Basis der ebenfalls weinaffine Reusch seine Entscheidung fällte, in einem leichtfüßigen Ton derart gehalten waren, dass auf dem Weg zur Eigenbewirtschaftung kaum größere Hindernisse zu überwinden seien. Doch diese Einschätzungen sollten bald von der Wirklichkeit Lügen gestraft werden, und das nicht alleine wegen des Krieges.
Abb. 8 Mit dem Eigenbau einverstanden: Paul Reusch lenkt ein.
2 Mit recht kräftigen Bemerkungen beanstandet
Wie und warum sich in den beiden ersten Jahren die Schwierigkeiten häuften
Keine Zeit zu verlieren
In Nierstein galt es keine Zeit verlieren. Die Reben mussten geschnitten werden, der Boden gedüngt, und die erforderlichen Arbeitsgeräte angeschafft. Am 25. Februar 1918 reiste Oberförster Müller abermals von Oberhausen nach Nierstein, um dort alle notwendigen Schritte zu veranlassen. Aus seinem drei Tage später auf dem Formular „Reisebericht“ verfassten Einschätzungen sprach purer Optimismus. Senfter, Kalbitzer und Müller hätten die Weinberge nochmals zu Dritt begangen, war unter der Unterschrift „Kurzer Bericht über den Zweck und den Erfolg des Besuches“ zu lesen. Nun sei auch der Umfang der Parzellen festgelegt, die für den Eigenbau in Frage kämen – insgesamt 150 Morgen oder 3,7150 ha. Auf weiteren 0,693 hl sollten künftig Kartoffeln und Gemüse angebaut werden.1
Senfter hatte sich abermals anheischig gemacht, das Eigenbau-Projekt zu unterstützen und sich nötigenfalls nach einem Keller umzusehen, in dem die Moste „unter seiner Aufsicht“ ausgebaut werden könnten.2 Für die Bewirtschaftung der Weinberge schien Senfters Rat nicht erforderlich zu sein. Ein Winzer namens Karl Hock, der im Steinbruch angestellt war, wurde kurzerhand als Vorarbeiter angestellt,3 und der Betriebsführer Kalbitzer ermahnt, alle erforderlichen Arbeiten „schleunigst“ in Angriff zu nehmen. Selbst die Versorgung mit Dünger, die zu Kriegszeiten nur schwer sicherzustellen war, bereitete den Herren kein Kopfzerbrechen. Kuhdung müsse wohl in Nierstein beschafft werden,4 Ammoniak – was ebenfalls während des Krieges immer knapper geworden war –5 und Thomasschlacke würden von Oberhausen aus auf den Weg gebracht.
Wie alle Berichte trug auch dieser den Stempel „Herrn Kommerzienrat Reusch vorlegen“ – offenbar verfolgte der Vorstandsvorsitzende die Entwicklung in Nierstein mit großem Interesse. Denn was immer er sich an Wein für sein Unternehmen und wohl auch sich erhoffte – zunächst musste seitens der GHH erheblich investiert werden. Im März 1918 wurden 6000 Mark an Betriebskosten angefordert, von denen Arbeitslöhne bestritten wurden sowie die Anschaffungskosten für allerlei Gerätschaften wie einen Weinbergspflug, eine Saug- und Druckpumpe, Rückenspritzen, Hacken, Karste, Traubenscheren und Schläuche. Hinzu kamen nochmals 5000 Mark für 2000 Zentner Kuhdünger.6 Den Usancen des Unternehmens entsprechend scheint Kalbitzer wohl auch bald damit begonnen zu haben, Wochenberichte über die Weinbergsarbeiten zu verfassen, ganz so, als stehe die neue Unternehmung auf einer Stufe mit der Herstellung von Rüstungsgütern oder Brückenteilen.7
Abb. 9 Lederbeerenkrankheit, Blattfallkrankheit, Falscher Mehltau, Peronospora: Viele Namen für den Befall mit dem Pilz Plasmopara viticola.
Leider haben sich Kalbitzers Berichte nur fragmentarisch erhalten. Doch auch die wenigen Schreiben, die ihren Weg in die Akten gefunden haben, lassen erkennen, mit welchem Ernst man im Frühjahr und Sommer zu Wege ging, um der GHH erstmals einen eigenen Wein zu sichern (von Wein aus Schloss Scheuern war nie die Rede). So hieß es etwa über die Woche vom 21. bis zum 25. Mai 1918, man habe in den Weinbergen gepflügt, gehackt und damit begonnen, das neu ausgetriebene, unfruchtbare Holz auszubrechen. Über den Vorarbeiter wurde nach Oberhausen berichtet, dieser sei „ein fleißiger und zuverlässiger Arbeiter, und sind unserer Weinberge im Verhältnis mit anderen gut in Stand, im Hinblick, dass wir in diesem Jahr so spät anfingen“.8
Sicher schrieb Kalbitzer das, was seine Vorgesetzten in Oberhausen lesen wollte. Aber seine Darstellung entsprach mutmaßlich der Realität. Doch der optimistische Ausblick sollte wohl dahingehend relativiert werden, dass andere Weinberge wohl vor allem deswegen weniger gut dastanden, weil es mehr denn je an Arbeitskräften fehlte und es im fünften Kriegsjahr nicht nur an Dünger mangelte. Schwer erhältlich waren auch Spritzmittel gegen echten und falschen Mehltau sowie gegen den Heu- und Sauerwurm. Dass in dieser Hinsicht auch in den GHH-Weinbergen noch etwas geschehen müsse, wusste man auch in Oberhausen. Müller notierte handschriftlich: „Spritzen der Weinberge!“ 9
Die Niersteiner Kollegen ließen sich das nicht zweimal sagen. Am 9. Juni wurde erstmals Kupferkalkbrühe (gegen Peronospora) gespritzt, am 12. Juni waren Eduard Friedrich und Oberförster Müller abermals in Nierstein und besprachen mit Senfter den Fortgang der Dinge, darunter auch die genaue Zusammensetzung der Spritzmittel.10 Kalbitzer war nicht wenig stolz, in das Ruhrgebiet berichten zu können, dass in den GHH-Weinbergen früher gespritzt werde als überall ringsum.11 Im Jahr 1918 keimte sogar die Hoffnung auf, dass mit einer guten Ernte gerechnet werden könne, wozu auch die regelmäßige Schädlingsbekämpfung – nun auch mit Schwefel gegen Echten Mehltau (Oidium) – beizutragen schien.12
Wohin mit dem Wein?
An anderer Stelle hakte es umso mehr. Schon am 6. Juni war Kalbitzer brieflich in Oberhausen mit der Nachricht vorstellig geworden, dass aus dem Plan, den im Steinbruch vorhandenen Stollen als Weinkeller zu benutzen, bis zum Herbst nichts werden würde. Denn für den Bau eines Kelterhauses (von dem bislang in den Darstellungen zu Jahresbeginn nicht die Rede war) sei es wohl vier Monate vor dem Beginn der Lese zu spät. Also müsse man wohl einen Keller mieten – was aber auch mit Hilfe Senfters noch nicht gelungen sei. Keine guten Nachrichten hatte der Betriebsführer auch hinsichtlich der notwenigen Gär- und Lagerfässer. Viele seien beschlagnahmt worden, und die übriggebliebenen Fässer würden in der Erwartung weiterer Preissteigerungen nicht verkauft.13
Die Suche nach einem Keller zog sich hin, wobei Senfter eine undurchsichtige Rolle spielte. Mal riet er von der Miete eines bestimmten Kellers ab, obwohl dieser bestens ausgestattet und die Mietvereinbarung aufs Wort abgeschlossen war, mal erweckte er den Eindruck, dass die GHH seinen Keller zunächst mitbenutzen könne, mal wieder nicht.14 Als Mitte September in den Weinbergen der Gutehoffnungshütte für die Erzeugung von Qualitätswein die eher ungeeigneten Portugiesertrauben 15 gelesen werden mussten, um sie vor Wespenfraß zu retten, gab es noch immer keine Kelter und auch keine Fässer.16
Nun war Senfter doch zur Stelle und übernahm die Rotweintrauben.17 Im Oktober, mitten während der Hauptlese, wurde schließlich ein Keller im benachbarten Oppenheim gefunden und auf zwei Jahre angemietet.18 Gleichzeitig schienen die Aussichten gut, Holzfässer zu beziehen.19 Diese waren wie alle hölzernen oder eisernen Fässer 1917 durch Beschlagnahmung von staatlicher Seite von der seit 1917 dem Reichskommissar für die Fassbewirtschaftung unterstehende „Reichsfaßstelle“ zwangsbewirtschaftet worden und auch nach Auflösung dieser Stelle noch nicht wieder frei handelbar.20 Doch in letzter Minute wurden Kalbitzer in Nierstein 24 gebrauchte ovale Stückfässer angeboten, zu 300 Mark das Stück à etwa 1200 Liter. Kalbitzer griff zu, zumal Reinhold Senfter diesmal zum Kauf riet.21
In der letzten Oktobertagen des Jahres 1918 ging die erste Lese in den Weinbergen der GHH am Rhein zu Ende. Aus den Akten über das Weingut erfahren wir leider nichts Näheres über die Rebsorten, die Erträge oder auch die Art des Kelterns. Dabei dürfte unstreitig sein, dass es sich bei den Weinen bestenfalls um Silvaner handelte, wenn nicht um solche aus Trauben aus gemischtem Satz. Ebenfalls nicht die geringsten Spuren hinterlassen haben in diesen Akten auch die Geschehnisse ringsum. Dabei fiel in diesen Tagen die vertraute Welt um die Niersteiner Weinberge, den Kalksteinbruch, ja die Gutehoffnungshütte in Stücke.
Bei der Entscheidung der Konzernleitung, die pachtfreien Weinberge rings um den Steinbruch selbst zu bewirtschaften, hatte im Februar 1918 die nicht unbegründete Hoffnung Pate gestanden, nach dem Ausscheiden Russlands mit dem Frieden von Brest-Litowsk das Kriegsglück im Westen endlich wenden zu können. Tatsächlich machte sich im Frühjahr 1918 unter dem Eindruck großangelegter und teilweise erfolgreicher Offensiven an der Westfront überall in Deutschland die Hoffnung breit, die kriegsentscheidende Wende sei da.22 Doch über den Sommer sollte sich herausstellen, dass der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im Jahr 1917 das Kräftegleichgewicht unwiderruflich zugunsten der Alliierten verschoben hatte. Am 29. September 1918 drang die Oberste Heeresleitung auf Verhandlungen über einen Waffenstillstand – der Krieg war verloren. In einem Keller in Oppenheim vergor derweil der letzte Most des Kaiserreiches zum ersten Wein der Weimarer Republik.
Im besetzten Gebiet
Bis der 1918er getrunken werden konnte, war es aber noch ein weiter Weg. Nicht, dass es mit dem Wein aus den eher bescheidenen Parzellen im Besitz der Gutehoffnungshütte etwas anderes auf sich gehabt hätte als mit anderen Weinen aus klimatisch begünstigteren Lagen – im Gegenteil. Selbst wenn man den Mosten die damals bereits vorhandenen Reinzuchthefen zur Beschleunigung des Gärprozesses zugesetzt hätte, anstatt sie „spontan“ vergären zu lassen, so wären die Weine noch viele Monate über die erste Gärung hinaus im Fass geblieben, um auch nur „füllfertig“ zu werden. Trinkreif waren sie in der Regel auch dann nicht.
„Die 1918er erhalten jetzt allgemein den ersten Abstich“, hieß es Anfang Januar 1919 in einer kurzen Notiz in der Zeitschrift „Weinbau und Weinhandel“. Doch viel Gutes war wohl nicht zu erwarten: „Sie sind zu einem großen Teil noch recht unfertige Weine, welche alle viel Säure aufweisen, die sich aber jedenfalls noch abbauen wird“.23 Doch selbst wenn die Weine weniger Säure gehabt hätten, wäre an eine baldige Füllung nicht zu denken gewesen.
Denn noch war es nicht möglich, Weine kaltsteril zu füllen, um sie auf diesem Weg mikrobiologisch zu stabilisieren und damit haltbar zu machen,24 wartete man eine zweite Gärung im Frühjahr ab und hoffte, dass sich der Wein danach langsam, aber sicher selbst klären würde. Nach weiteren Monaten sollten sich dann die im Wein noch immer vorhandenen Säuren, vor allem die Äpfelsäure, soweit abgebaut haben, dass die Weine als „Naturweine“, also ohne in Wasser gelösten oder schon vor der Gärung zugesetzten Zucker, gefallen würden. Daher lagerten damals in dem Keller eines jeden Produzenten in der Regel zwei Jahrgänge gleichzeitig – und die Investition in gleich 24 Fässer und damit in einen Fassraum von etwa 30.000 Litern war für den Anfang durchaus vernünftig. Zwar wurden im Herbst 1918 nur einige Fässer belegt und die anderen geschwefelt und anschließend mit Wasser gefüllt, auf dass sie nicht austrockneten und rissen. Aber wer konnte schon wissen, was das Jahr 1919 bringen würde und wann der 1918er in Flaschen abgefüllt werden könnte?
In Oberhausen erwartete daher niemand, dass schon wenige Monate nach der Lese in dem werkseigenen, 1905 in Betrieb genommenen Rheinhafen in Duisburg-Walsum Lastkähne mit Kalkstein und den ersten Kisten eigenen Niersteiner Weins als Beiladung festmachen würden.25 Ohnehin hatte die Konzernleitung andere Sorgen. Die Investitionen in Lothringen waren verloren, die einzelnen Werke mussten von der Kriegs- auf Friedenswirtschaft umgestellt werden, in der Arbeiterschaft gärte es, die Geldentwertung ließ sich nicht bremsen.26 Zugleich nutzen die Franzosen die Besetzung des Rheinlands dazu, ihren alten Traum von dem Rhein als einem gottgegebenen Teil seiner natürlichen Grenzen 27 wenigstens ein Stück weit Wirklichkeit werden zu lassen: Zu dem „besetzten Gebiet“, wie es nüchtern hieß, zählten (im Sprachgebrauch des Jahres 1919) ein „Teil der preußischen Rheinprovinz und etwas rechtsrheinisches Gebiet, die gesamte bayerische Rheinpfalz und die hessische Provinz Rheinhessen“ – also auch Nierstein.28
Auf Deutschland in den Grenzen von 1914 bezogen bedeutete dies bei einer im Ertrag stehenden Rebfläche von insgesamt etwa 91.000 Hektar (1916), dass knapp die Hälfte, nämlich etwa 37.800 Hektar, dem Besatzungsregime der Franzosen unterlagen.29 Zieht man die rund 23.600 Hektar Rebfläche (1916) des nunmehr wieder französischen Reichslandes Elsass-Lothringen ab, so machte die im Ertrag stehende Rebfläche in dem besetzten Gebiet weit mehr als die Hälfte der Rebfläche der jungen Weimarer Republik aus – ohne dass es einstweilen möglich gewesen wäre, Weine aus dem französischen Rheinland in die unbesetzten Gebiete zu transportieren. Die Interalliierte Kommission als oberste Besatzungsbehörde, die fest in französischer Hand war, hatte eine Gütersperre verhängt, die erst im Frühjahr 1919 gelockert wurde. Doch auch nach der Aufhebung der Blockade für Rheinhessen am 13. Juni 1919 dauerte es noch bis zum 5. Juli 1920, ehe die „Rheinkontrolle“ für Wein gänzlich beendet wurde.30
Inwieweit das französische Grenzregime und die Gütersperre die Ausbeutung des Kalksteinbruchs in Nierstein oder auch die Kommunikation zwischen Oberhausen und dem Betriebsführer beeinträchtigten, ist den für die Geschichte des Weinguts relevanten Akten nicht zu entnehmen.
Nochmals gut davongekommen
Doch Franzosen hin, Blockade her, die Arbeit in den Weinbergen und im Keller musste weitergehen. Am 6. Februar 1919 wandte sich Betriebsführer Kalbitzer mit dem Anliegen an seine Vorgesetzen in der Abteilung F, man benötige 800 bis 1000 neue Weinbergspfähle, um abgängige Stickel zu ersetzen 31 – was zusammen mit dem Hinweis auf Spanndrähte so zu lesen wäre, dass die GHH es mit Parzellen zu tun bekommen hatte, in denen die Reben nicht mehr wie an der Mosel oder in den Steillagen an der Rheinfront an einzelnen Pfählen erzogen wurden, sondern aufgrund der günstigeren topographischen Bedingungen in einer „neuzeitlichen“, einfacher zu bearbeitenden Drahtrahmenanlage.
Umso mehr war Kalbitzer in seinem Element. Als „alter Bergmann“, der die Grubenhölzer kenne, schlug er vor, T-Stempel aus Tannenholz zu ordern und diese nach Nierstein zu transportieren, am besten gleich waggonweise. Womöglich könne man aber auch Grubenholz, das in den Zechen an der Ruhr momentan nicht verwendet werde, nach Rheinhessen verschiffen. Auch wenn diese Stempel in Nierstein angespitzt werden müssten (von imprägnieren war nicht die Rede), sei dies billiger, als Pfähle in Nierstein zu erwerben. Ob Kalbitzers Wunsch je in Erfüllung ging oder an den Zeitumständen scheiterte, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Mitte Mai ließ er Oberförster Müller wissen, man habe schon Pfähle in Nierstein kaufen müssen, um die allernötigsten Reparaturarbeiten erledigen zu können.32
Der Aufbau der „Eigenwirtschaft“ stockte auch auf anderen Feldern. Anfang Februar hatte Kalbitzer von einem nächtlichen Einbruch in den Oppenheimer Keller berichtet, bei dem aus einem Stückfass etwa 70 Liter Wein entwendet worden seien.33 Der Betriebsführer hatte auch einen Verdacht, jedoch war er klug genug, diesen unter den Augen der französischen Besatzungsmacht nicht direkt zu formulieren.
Abb. 10 Über-Blick: Nierstein vom Galgenberg aus betrachtet, im Hintergrund die Weinberge entlang der Rheinfront.
Das Haus, zu dem der Weinkeller gehöre, stehe seit dem 1. Oktober 1918 leer und sei in den zurückliegenden Monaten dazu benutzt worden, französische Soldaten einzuquartieren. Diese aber seien just an dem Tag abgerückt, als auch der Diebstahl bemerkt worden sei.34 An Zufall, so war diese Chronologie zwischen den Zeilen zu lesen, scheint es sich bei dem Einbruch nicht gehandelt zu haben. Im Klartext: Die abrückenden Franzosen hatten sich wohl mit Wein verproviantiert. Ob der gärende Most ihnen gemundet haben könnte, steht freilich auf einem anderen Blatt.
Kalbitzer dramatisierte die Angelegenheit nicht. Die GHH sei noch gut weggekommen, ließ er Oberförster Müller wissen, denn in Oppenheim und Nierstein seien Diebstähle auch größerer Mengen Weins an der Tagesordnung – was sich ebenfalls als Hinweis darauf lesen lässt, dass sich die französischen Besatzer gegenüber den Einheimischen keine Rücksichten auferlegten. Freilich hatte der Betriebsführer pflichtgemäß bei der französischen Kommandantur Anzeige erstattet. Am Ort des Diebstahls hatte sich denn auch zwei Tage später ein französischer Offizier eingefunden, doch dieser konnte nach Kalbitzers Darstellung nichts ausrichten. „Über die Täter ist noch nichts bekannt“, berichtete der Betriebsführer am 25. Februar.35
Der Einbruch in den Keller in Oppenheim kam Kalbitzer nicht gänzlich ungelegen. Denn wie sich nach der Lese herausgestellt hatte, taugte dieser selbst als Provisorium nur bedingt. Also stellte der Betriebsführer sogleich wieder die Frage in den Raum, wie es in Nierstein weitergehen solle. Der in Oppenheim angemietete Keller liege zu weit vom Steinbruch entfernt und sei außerdem zu klein, um zwei Ernten aufzunehmen, so gab er dem für die Abteilung Forstwirtschaft zuständigen Oberförster Müller zu bedenken – ganz abgesehen davon, dass man nicht Fässer mit altem und neuem Wein in ein- und demselben Raum zusammen aufbewahren könne. Ob man nicht neben einem Stollen in der Nähe des Steinbruchs an der nach Worms führenden Straße einen Keller bauen könne, der die 1919er Ernte aufnehmen könne? Dieser würde sich über die Jahre hinweg amortisieren und überdies immer im Blick sein.36 Ob Kalbitzer auf seine Anregung Antwort erhielt, ist nicht überliefert. Ein neuer Keller wurde einstweilen jedoch nicht errichtet. Und von einem Kelterhaus war erst gar nicht die Rede.
Ganz gut gebaut
Der Betriebsführer hatte aber auch eine gute Nachricht. „Der Wein hat sich in diesem Keller ganz gut gebaut“, schrieb er am 22. Februar 1919 stolz. Und auch mit der Menge schien er recht zufrieden zu sein: 9463 Liter Weißwein und ungefähr 1200 Liter Rotwein seien nach dem ersten Abstich übrig. Das entspreche am Ende etwa 7 ½ Stück Weiß- und einem Stück Rotwein – und das zum geschätzten Preis von etwa 6000 Mark je Stück Weißwein.37 Anders gesagt: Die Investitionen und der Wegfall der Pachteinkünfte hatten sich anscheinend schon im ersten Jahr rentiert – und das, obwohl der geschätzte Preis für den GHH-Wein ein Bruchteil dessen betrug, was 1919 bei der Frühjahrsversteigerung von Weinen aus den Niersteiner Spitzenlagen an Erlösen erzielt werden sollte.
Gleich 47 Stück sollte Reinhold Senfter am 6. Juni 1919 im Rheinhotel in Nierstein zur Versteigerung bringen – und annähernd 685.000 Mark erlösen.38 Dies entsprach einem Durchschnittspreis von gut 14.500 Mark – wobei in Rechnung zu stellen ist, dass der 1917er Jahrgang nach dem 1911er der beste Jahrgang seit 1893 war. Außerdem bewirtschaftete Senfter weitaus bessere Lagen als die GHH, und die Weinpreise hatten sich schon seit 1916 in ungeahnten Höhen bewegt. Ein Rückgang war auch in der kurzen Friedenszeit noch nicht in Sicht. Wer damals Wein zu Geld machen konnte und anschließend immer noch Schulden hatte, dem war wirklich nicht mehr zu helfen. Denn auch die Winzer, die ihren Wein „freihändig“ verkaufen mussten, standen sich wegen der hohen Nachfrage nach Wein nicht schlecht. So gingen nach einem Bericht der Kölnischen Volkszeitung vom 12. Juni 1919 in diesen Wochen erste 1918er Weine im Fass von Winzern auf den Handel über.39
Gemessen an den Preisen für einfache Weine des Jahrgangs 1918 schlugen sich Kalbitzer und seine Mannen nicht schlecht. Für diese wurden im Mittel etwa 7500 Mark je Stück angelegt, war der 1918er doch nicht nur qualitativ und auch der Menge nach hinter dem Wein des Vorjahres zurückgeblieben: Hatte der Durchschnittsertrag pro Hektar in Rheinhessen im Jahr 1917 34,2 Hektoliter je Hektar erreicht und damit das langjährige Mittel deutlich übertroffen, so war der Durchschnittsertrag des Jahres 1918 mit 31,5 Hektolitern immer noch überdurchschnittlich hoch, aber eben doch quantitativ um einiges geringer. Keinen Vergleich mit dem 1917er hielten die 1918er hinsichtlich der Güte aus: Das durchschnittliche Mostgewicht betrug in Rheinhessen im Jahr 1917 90,63 Grad Oechsle bei durchschnittlich 8,67 Promille Säure. 1918 waren es 66,62 Grad Oechsle bei 11, 43 Promille. 1919 sollte der Durchschnittsertrag sogar auf 25,1 Hektoliter sinken – und das bei einer ähnlich schlechten Qualität der Weine wie im Vorjahr: Bei durchschnittlich 69,22 Grad Oechsle und 10,2 Promille Säure waren viele Weine kaum genießbar.40
Gleichzeitig stieg aber die Größe der Flächen, welche die GHH aus Pachtverhältnissen in Eigenbau übernahm: Zu den 15 Morgen des Jahres 1917 und weiteren 15 Morgen des Jahres 1918 kamen 1919 24 Morgen hinzu. Das eigenbewirtschaftete Ackerland der GHH in Nierstein hatte demnach schon 1919 mit etwas mehr als fünf Hektar eine Betriebsgröße erreicht, mit der es schon zu den größeren Betrieben nicht nur in Rheinhessen, sondern in Deutschland zählte.41
Auch eine hohe Spitze?
Wäre es nach Kalbitzer gegangen, dann wäre es nicht bei diesen Flächen geblieben – und vor allem nicht bei der Beschränkung der weinbaulichen Ambitionen der GHH auf Flächen, die bestenfalls einen passablen Naturwein hervorbringen konnten. Auch wenn er in erster Linie für den Betrieb des Steinbruchs zu sorgen hatte, so schien ihm auch der Sinn nach Weinen zu stehen, wie sie Nierstein als Weinort berühmt gemacht hatten und weiterhin berühmt machen sollten. Denn wie die Versteigerung der Senfterschen Weine eindrucksvoll dokumentiert hatte, wurden die Niersteiner Spitzenweine auch nach dem Krieg, buchstäblich mit Gold aufgewogen.
Im August 1919 wurde der Betriebsführer in Oberhausen mit einem ambitionierten Vorschlag vorstellig. Wenige Tage zuvor waren in Nierstein Parzellen aus mehreren namhaften Weinbergslagen versteigert worden, von denen sich ein in Mainz ansässiger Privatmann hatte trennen wollen.42 Die meisten Parzellen waren zu exorbitanten Preisen zugeschlagen worden, in der Regel an namhafte Weinhandlungen mit eigenem Weingut wie die 1881 gegründete Firma Carl Sittmann aus dem benachbarten Oppenheim,43 sowie Louis Guntrum, der die größte Weinhandlung Niersteins betrieb. Beide, so war diese Information zu lesen, hatten die Gelegenheit beim Schopf gepackt, ihr Weinbergs-Portfolio um Parzellen in Niersteiner Spitzenlagen vergrößern zu können. Nach den ebenfalls exorbitanten Erlösen für die Weine des Jahrgangs 1917 dürften sie mehr als genügend Liquidität besessen haben.
Kalbitzer rechnete nun dem Leiter der Abteilung Forstwirtschaft am 21. August 1919 vor, dass die Preise für Spitzenwein in den vergangenen Jahren noch stärker gestiegen seien als die Bodenpreise in besseren und besten Lagen. Daher würde sich eine Investition in eine „hohe Spitze“ schon betriebswirtschaftlich betrachtet innerhalb weniger Jahre amortisiert haben. Zudem gehörten zu einem Weingut von einer Größe, wie man sie sich in Oberhausen vorstelle, auch Parzellen in besseren Lagen als dem Galgenberg. Diese Flächen, so Kalbitzer schließlich, seien für ein Unternehmen wie der GHH auf dem Versteigerungsweg wohl kaum zu erwerben, da sich Transaktionen dieser Art oft sehr schnell vollzögen. Ob er stattdessen nach Parzellen Ausschau halten könne, die die Gutehoffnungshütte vielleicht käuflich erwerben könne?44
Eine Antwort auf die Initiative des Betriebsführers hat sich in den einschlägigen Akten leider nicht erhalten. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass man in Oberhausen auch nur halbwegs ernsthaft erwogen hätte, den Rat Kalbitzers zu beherzigen. Mit dieser Entscheidung waren die Entwicklungsmöglichkeiten des Weingutes auf Jahrzehnte hin beschränkt. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg sollten in den Parzellen der GHH allenfalls in sehr guten Jahren Weine entstehen, die es qualitativ mit den besseren Gewächsen aus Nierstein wenigstens annähernd aufnehmen konnten. An eine ernsthafte Konkurrenz mit den Weinen aus den an der Rheinfront gelegenen Spitzenlagen Niersteins war einstweilen nicht zu denken.
Betriebswirtschaftlich war die Entscheidung gegen eine Erweiterung des Lagenportfolios im Jahr 1919 womöglich klug. Das Preisniveau, das sich unter den Bedingungen des Krieges gebildet hatte, sollte im Zuge einer Serie geringer oder noch schlechterer Jahrgänge von 1922 an erheblich sinken. Die Geldentwertung, die im Herbst 1923 ihren Höhepunkt erreichte, tat ihr Übriges, um jede Spekulation auf hohe Weinpreise rückblickend als Hasardspiel erscheinen zu lassen. Zudem sollte der Niersteiner Wein bis auf Weiteres nur zur Verwendung des Vorstandes und leitender Mitarbeiter der GGH und anderer Konzernwerke dienen und war damit von den Preisbewegungen des Marktes nicht weiter betroffen.