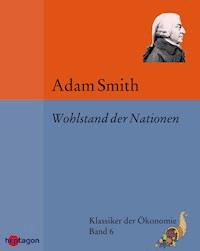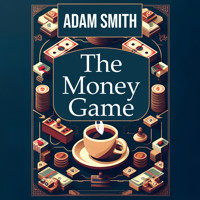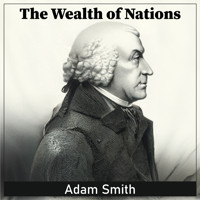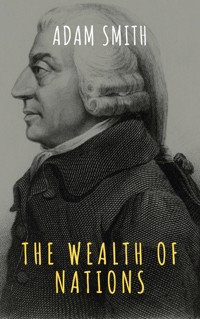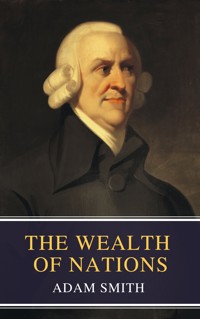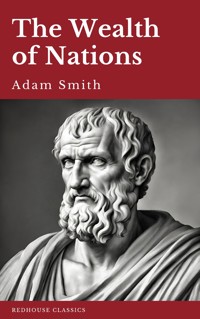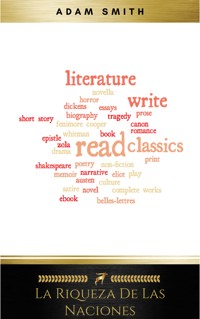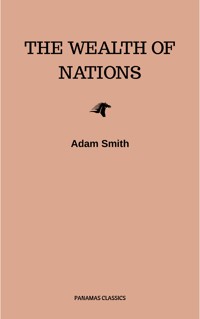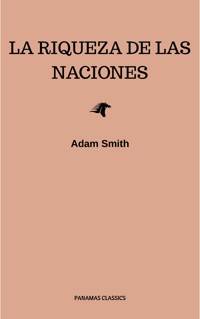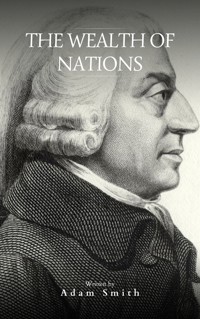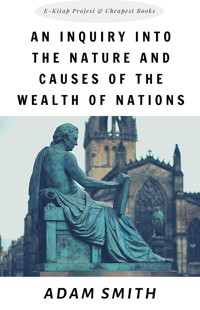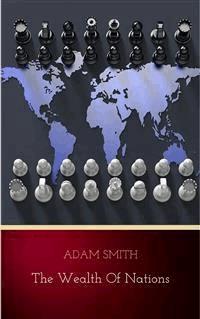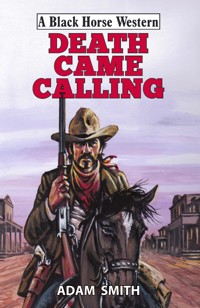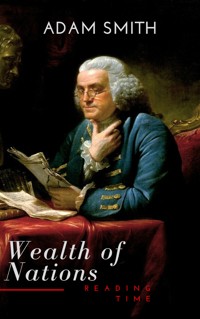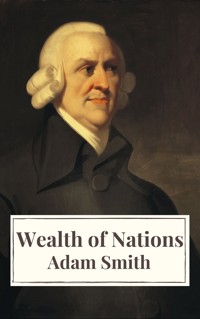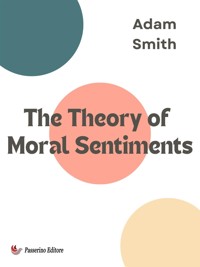Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Wohlstand der Nationen ist das am 9. März 1776 erschienene Werk des schottischen Ökonomen Adam Smith. Es entstand als Kontrapunkt zum bis dahin wirtschaftspolitisch vorherrschenden Merkantilismus, wie er von den damaligen europäischen Großmächten praktiziert wurde. Smiths Werk gilt als das grundlegende Werk der Wirtschaftswissenschaft, die sich erst in der Folgezeit als eigenständige Wissenschaftsdisziplin etablierte, und markiert sowohl den Beginn der klassischen Nationalökonomie als auch parallel des Wirtschaftsliberalismus. Smith entwickelt in seinem Werk keine eigene geschlossene Theorie. Dieser Ausgabe liegt die in den Jahren 1905-1906 im Verlag R. L. Prager erschienene zweibändige Edition Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes zugrunde. Diese Ausgabe wurde leicht gekürzt, auf Tabellen verzichtet. Satzfehler und Falschschreibungen wurden korrigiert, die Orthografie gemäß den Regeln der alten Rechtschreibung verändert. Hinsichtlich der Orts- und Personennamen erfolgte eine Anpassung und Vereinheitlichung an den heute üblichen Sprachgebrauch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 875
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adam Smith
Der Wohlstand der Nationen, 2. Teil
Der Wohlstand der Nationen, 2. Teil
Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes
Adam Smith
Impressum
Texte: © Copyright by Adam Smith
Umschlag:© Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Max Stirner
Verlag:Das historische Buch, 2023
Mail: [email protected]
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhalt
VIERTES BUCH Die Systeme der politischen Ökonomie
FÜNFTES BUCH Die Staatsfinanzen
VIERTES BUCH Die Systeme der politischen Ökonomie
EINLEITUNG
Die politische Ökonomie, als ein Zweig des Wissens eines Staatsmanns oder Gesetzgebers betrachtet, verfolgt zwei verschiedene Ziele: erstens, wie dem Volke reichliches Einkommen oder Unterhalt zu verschaffen, oder, richtiger, wie es in den Stand zu setzen sei, sich selbst ein reichliches Einkommen oder Unterhalt zu verschaffen; und zweitens, wie dem Staat oder Gemeinwesen ein zur Bestreitung der öffentlichen Dienste hinreichendes Einkommen zu sichern sei. Sie hat den Zweck, sowohl die Staatsbürger als auch den Herrscher zu bereichern.
Die verschiedene Entwicklung des Reichtums in verschiedenen Zeitaltern und bei verschiedenen Völkern hat zwei verschiedene Systeme der politischen Ökonomie in Hinsicht auf das Ziel, das Volk zu bereichern, hervorgerufen. Das eine von ihnen kann das Handels-, das andere das Landwirtschaftssystem genannt werden. Ich werde beide so vollständig und deutlich, wie ich kann, darzulegen suchen, und werde mit dem Handelssystem beginnen. Es ist das neuere System und unser Land wie unsere Zeit sind am besten damit vertraut.
ERSTES KAPITEL Grundsätze des Handels- oder Merkantilsystems
Dass der Reichtum in Geld oder in Gold und Silber bestehe, ist eine vulgäre Vorstellung, die ihren natürlichen Entstehungsgrund in der doppelten Funktion des Geldes als Verkehrswerkzeug und als Wertmesser hat. Infolge seiner Eigenschaft als Verkehrswerkzeug können wir, wenn wir Geld haben, uns alles, was wir brauchen, leichter verschaffen, als mittelst jeder andern Ware. Das Wichtigste ist immer, Geld zu haben. Wenn wir das haben, hält es nicht schwer, jeden andern Kauf zu machen. Infolge seiner Eigenschaft als Wertmesser schätzen wir den Wert aller anderen Waren nach der Menge Geldes, für die sie zu haben sind. Wir sagen von einem reichen Manne, er sei viel, und von einem armen, er sei wenig Geld „wert". Von einem sparsamen Manne, d. h. einem Manne, der gern reich sein möchte, sagt man, er liebe das Geld; und von einem sorglosen, freigebigen oder verschwenderischen Menschen, er achte 'das Geld nicht. Reich werden heißt Geld erwerben; kurz, Vermögen und Geld werden in der gewöhnlichen Sprachweise als durchaus gleichbedeutend angesehen.
Ein reiches Land, meint man, müsste ebenso wie ein reicher Mann Überfluss an Geld haben; und Gold und Silber in einem Lande anzuhäufen, sei der leichteste Weg, zu bereichern. Nach der Entdeckung Amerikas pflegte die erste Frage der Spanier, wenn sie an einer unbekannten Küste landeten, dahin zu lauten, ob Gold oder Silber in der Gegend zu finden sei. Nach den Nachrichten, die sie darüber einzogen, beurteilten sie, ob es der Mühe lohne, sich daselbst niederzulassen, bzw. ob das Land der Eroberung wert sei. Plano Carpino, ein Mönch, der vom König von Frankreich als Gesandter zu einem der Söhne des berühmten Dschingis Khan gesandt war, erzählt, die Tataren hätten ihn oft gefragt, ob es in Frankreich viele Schafe und Ochsen gebe. Ihre Frage hatte denselben Zweck, wie die der Spanier, sie wollten wissen, ob das Land reich genug sei, um die Eroberung zu verlohnen. Unter den Tataren, wie unter allen andern Hirtenvölkern, die gewöhnlich mit dem Gebrauche des Geldes nicht bekannt sind, ist Vieh das Verkehrswerkzeug und der Maßstab des Wertes. Nach ihrer Ansicht bestand daher der Reichtum in Vieh, wie er nach der Ansicht der Spanier in Gold und Silber bestand. Von beiden Ansichten kam vielleicht die tatarische der Wahrheit näher.
Locke findet folgenden Unterschied zwischen Geld und anderen beweglichen Gütern. Alle anderen beweglichen Güter, sagt er, sind so leicht zu verbrauchen, dass man sich auf den in ihnen bestehenden Reichtum nicht verlassen kann, und dass eine Nation, die in dem einen Jahre einen Überfluss daran hat, im nächsten Jahre, ohne alle Ausfuhr, sondern lediglich durch Verschwendung, großen Mangel daran haben kann. Geld hingegen sei ein beständiger Freund, der zwar von Hand zu Hand wandere, aber wenn man verhindern kann, dass er aus dem Lande geht, nicht leicht der Vergeudung und dem Verbrauch ausgesetzt sei. Daher sei Gold und Silber der solideste und wichtigste Teil des beweglichen Reichtums einer Nation, und die Vermehrung dieser Metalle sollte deshalb, wie er meint, das Hauptziel der Staatswirtschaft sein.
Andere räumen ein, dass wenn ein Volk sich von aller Welt isolieren könnte, wenig darauf ankommen würde, wie viel oder wie wenig Geld bei ihm umlaufe. Die Verbrauchsgegenstände, die mittelst dieses Geldes in Umlauf kämen, würden nur für eine größere oder kleinere Anzahl Geldstücke vertauscht werden; aber die tatsächliche Wohlhabenheit oder Armut des Landes würde, das geben sie zu, nur von dem Überfluss oder dem Mangel dieser Verbrauchsgegenstände abhängen. Anders hingegen, meinen sie, verhalte es sich mit Ländern, die mit fremden Völkern Verbindungen haben, auswärtige Kriege zu führen genötigt sind und Flotten und Heere in fernen Gegenden unterhalten müssen. Dies könne, sagen sie, nur dadurch geschehen, dass zu ihrer Bezahlung Geld außer Landes geschickt werde, und ein Volk könne nicht viel wegschicken, wenn es nicht viel habe. Mithin müsse jedes Volk in Friedenszeiten Gold und Silber aufhäufen, um eintretendenfalls die Mittel zur Führung auswärtiger Kriege zu besitzen.
Infolge dieser vulgären Vorstellungen haben alle europäischen Völker, freilich ohne sonderlichen Erfolg, auf alle möglichen Mittel gesonnen, Gold und Silber in ihren Ländern aufzuhäufen. Spanien und Portugal, die die bedeutendsten Minen besitzen, aus denen Europa mit diesen Metallen versorgt wird, haben ihre Ausfuhr entweder unter den härtesten Strafen verboten oder sie mit einer hohen Abgabe belegt. Ähnliche Verbote scheinen früher bei den meisten anderen europäischen Völkern gang und gäbe gewesen zu sein und finden sich sogar, wo man es am wenigsten erwarten sollte, in einigen alten schottischen Parlamentsakten, die die Ausfuhr von Gold und Silber aus dem Königreiche bei schwerer Strafe untersagen. Die gleiche Politik befolgten früher Frankreich und England.
Als diese Länder Handelsstaaten wurden, fanden die Kaufleute dies Verbot in vielen Fällen äußerst lästig. Sie konnten oft die fremden Waren, die sie nach ihrem Land einführen oder in andere fremde Länder bringen wollten, vorteilhafter mit Gold oder Silber, als mit jeder andern Ware kaufen. Sie machten daher gegen das Verbot, als für den Handel schädlich, Vorstellungen. Sie machten geltend, dass erstlich die Ausfuhr von Gold und Silber zum Ankauf fremder Waren nicht immer die Menge dieser Metalle im Reiche vermindere. Im Gegenteil könne sie sie oft vergrößern, weil jene Waren, wenn sich ihr Verbrauch im Lande nicht vermehre, nach fremden Ländern zurück exportiert werden könnten, und dann, mit großem Gewinn verkauft, mehr Geld zurückbrächten, als zu ihrem Ankauf fortgesendet war. Mun vergleicht diese Tätigkeit des auswärtigen Handels mit dem Säen und Ernten beim Ackerbau: „Betrachten wir die Tätigkeit des Landwirts nur zur Saatzeit, wo er viel gutes Korn in die Erde hineinwirft, so werden wir ihn eher für einen Narren als für einen Landwirt halten; sehen wir aber auf das Ziel seiner Arbeiten in der Ernte, so werden wir den Wert und reichen Erfolg seines Handels entdecken."
Zweitens machten sie geltend, dass das Verbot die Ausfuhr von Gold und Silber nicht verhindern könne, die wegen ihres im Verhältnis zum Werte kleinen Umfangs leicht hinaus zu schmuggeln seien. Die Ausfuhr könne nur durch gehörige Beachtung dessen, was sie die Handelsbilanz nannten, verhütet werden. Wenn das Land Waren in einem höheren Betrag ausführe als einführe, so würden ihm fremde Völker einen Saldo schuldig bleiben, der notwendig in Gold und Silber bezahlt werden müsse und dadurch die Menge dieser Metalle im Reich vergrößere. Wenn hingegen das Land Waren im höheren Betrag einführe als ausführe, so würde es fremden Nationen einen Saldo schuldig bleiben, der diesen auf dieselbe Weise gezahlt werden müsse und jene Menge verringern würde. In diesem Falle könne das Verbot die Ausfuhr nicht verhüten, sondern sie nur kostspieliger, weil gefahrvoller, machen. Der Wechselkurs werde dadurch noch ungünstiger für das schuldende Land, weil der Geschäftsmann, der einen Wechsel auf das Ausland kaufe, dem Bankier, der ihn verkauft, nicht nur das in der Natur der Sache liegende Risiko, sowie die Mühe und Kosten der Versendung des Geldes, sondern auch noch die aus dem Verbote entstehende Gefahr vergüten müsse. Je mehr aber der Wechselkurs gegen ein Land stehe, desto ungünstiger werde auch die Handelsbilanz für es, weil das Geld dieses Landes im Vergleich zu dem des Landes, das die Bilanz für sich habe, notwendig um ebenso viel im Werte sinken müsse. Sei z. B. der Wechselkurs zwischen England und Holland 5 % gegen England, so würden in England 105 Unzen Silber nötig sein, um einen Wechsel von 100 Unzen Silber auf England zu kaufen; 105 Unzen Silber wären also in England nur so viel wert, wie 100 Unzen in Holland, und würden auch nur eine verhältnismäßige Menge holländischer Waren kaufen; 100 Unzen Silber in Holland würden dagegen so viel wert sein, wie 105 Unzen in England und eine verhältnismäßige Menge englischer Waren kaufen. Die englischen Waren, die man nach Holland verkaufe, würden um die Differenz des Wechselkurses wohlfeiler, und die holländischen Waren, die man nach England verkaufe, um soviel teurer verkauft; das eine würde um die Differenz des Wechselkurses weniger holländisches Geld nach England, und das andere um soviel mehr englisches Geld nach Holland ziehen; und die Handelsbilanz stehe mithin notwendig um soviel ungünstiger für England und erfordere die Ausfuhr eines größeren Saldo an Gold und Silber nach Holland.
Diese Argumente waren teils richtig und teils sophistisch. Sie waren richtig, soweit sie anführten, dass die Ausfuhr des Goldes und Silbers im Handel dem Lande oft vorteilhaft sein könne und dass kein Verbot ihre Ausfuhr zu verhüten vermöge, wenn Privatleute bei dieser Ausfuhr Vorteil fänden. Sophistisch aber waren sie in der Annahme, dass die Erhaltung oder Vermehrung jener Metalle die Beachtung der Regierung mehr verdiene, als die Erhaltung oder Vermehrung jeder anderen nützlichen Ware, die bei der Freiheit des Handels ohne jede Bedachtung von selbst in der nötigen Menge vorhanden sein wird. Sophistisch war auch vielleicht die Behauptung, der hohe Preis der Wechsel vermehre notwendig die sogenannte ungünstige Handelsbilanz, oder veranlasse die Ausfuhr einer größeren Menge Goldes und Silbers. Dieser hohe Preis war allerdings den Kaufleuten, die Geld ins Ausland zu schicken hatten, sehr nachteilig, denn sie mussten die Wechsel, welche sie von ihren Bankiers auf ausländische Plätze erhielten, um so teurer bezahlen. Allein das aus dem Verbot entspringende Risiko verursachte zwar den Bankiers außergewöhnliche Kosten, aber deshalb wurde nicht notwendig mehr Geld aus dem Lande geführt. Diese Kosten wurden vielmehr gewöhnlich alle im Lande verauslagt, um das Geld aus dem Lande zu schmuggeln, und konnten kaum einen Sixpence mehr als die gezogene Summe hinaustreiben. Auch musste der hohe Preis der Wechsel die Kaufleute bewegen, die Ausfuhr mit der Einfuhr womöglich ins Gleichgewicht zu bringen, um den hohen Wechselkurs auf eine möglichst kleine Summe zu bezahlen. Überdies musste der hohe Preis der Wechsel wie eine Steuer wirken, den Preis der fremden Waren erhöhen und dadurch ihren Verbrauch vermindern. Er konnte daher die sogenannte ungünstige Handelsbilanz und folglich die Ausfuhr des Goldes und Silbers nicht vermehren, sondern nur vermindern.
Doch wie dem auch sei, diese Argumente überzeugten die Leute, an die sie gerichtet waren. Sie waren von Kaufleuten an Parlamente und Ministerien, an den Adel und die Gentry gerichtet, d. h. von Leuten, die man in Handelsangelegenheiten für sachverständig hielt, an Leute, die recht wohl wussten, dass sie nichts davon verständen. Dass der auswärtige Handel das Land bereichere, zeigte die Erfahrung dem Adel und der Gentry so gut wie den Kaufleuten; aber in welcher Weise, das wusste keiner von ihnen recht. Die Kaufleute wussten vollkommen, in welcher Weise er sie bereicherte; es war ihre Sache, das zu wissen; aber auf welche Art er das Land bereichere, ging sie nichts an. Daran dachten sie nur, wenn sich eine Gelegenheit bot, vom Lande eine Veränderung in den Gesetzen über den auswärtigen Handel zu verlangen. Dann wurde es nötig, etwas von den wohltätigen Wirkungen des auswärtigen Handels zu reden und über die Art, wie diese Wirkungen durch die bestehenden Gesetze gehemmt würden. Den Richtern, die in der Sache zu entscheiden hatten, schien es sehr einleuchtend, wenn man ihnen sagte, dass der auswärtige Handel Geld ins Land bringe, dass aber die fraglichen Gesetze ihn verhinderten, es in dem Umfange zu tun, wie er es sonst könnte. Jene Argumente hatten daher den gewünschten Erfolg. Das Verbot der Gold- und Silberausfuhr war in Frankreich und England auf die Landesmünzen beschränkt, ausländische Münzen aber und Barren waren freigegeben. In Holland und an einigen anderen Orten war diese Freiheit sogar auf die Landesmünze ausgedehnt. Die Aufmerksamkeit der Regierung wurde von der Verhütung der Gold- und Silberausfuhr abgezogen und auf die Überwachung der Handelsbilanz als der einzigen Ursache, die eine Vermehrung oder Verminderung jener Metalle bewirken könne, hingelenkt. Von einer fruchtlosen Sorge wurde sie auf eine noch weit verwickeltere schwierigere und doch ebenso fruchtlose gelenkt.
Der Titel von Muns Buche: „Englands Schatz im auswärtigen Handel" wurde ein Grundsatz in der politischen Ökonomie nicht allein Englands, sondern auch aller anderen Handelsstaaten. Der inländische oder Binnenhandel, der wichtigste von allen, der Handel in dem ein gleich großes Kapital das größte Einkommen liefert und dem Volke die ausgebreitete Beschäftigung verschafft, wurde nur als nebensächlich gegenüber dem auswärtigen Handel betrachtet. Der Binnenhandel, hieß es, bringe weder Geld ins Land, noch führe er etwas hinaus. Das Land könne also durch ihn weder reicher noch ärmer werden, außer insofern seine Blüte oder sein Verfall indirekt auf den Zustand des auswärtigen Handels Einfluss übe.
Ein Land, das keine eignen Bergwerke hat, muss ohne Zweifel sein Gold und Silber aus fremden Ländern beziehen, gerade wie ein Land, das keine eignen Weinberge hat, seine Weine anderswoher beziehen muss. Es scheint jedoch nicht nötig zu sein, dass der Staat seine Aufmerksamkeit mehr auf den einen als auf den andern Gegenstand verwende. Ein Land, das die Mittel hat, Wein zu kaufen, wird immer soviel Wein erhalten, wie es braucht; und ein Land, das die Mittel hat, Gold und Silber zu kaufen, wird niemals um diese Metalle in Verlegenheit sein. Sie sind gleich allen anderen Waren für einen gewissen Preis zu kaufen, und wie sie der Preis aller anderen Waren sind, so sind diese wieder der Preis jener Metalle. Wir können mit vollkommener Sicherheit darauf rechnen, dass die Freiheit des Handels uns ohne alle Fürsorge der Regierung stets mit soviel Wein versorgen wird, wie wir brauchen, und können mit ebenso großer Sicherheit darauf rechnen, dadurch stets auch mit allem Golde und Silber versorgt zu werden, das wir zu kaufen und, sei es zum Umlauf unsrer Waren oder zu andern Zwecken, zu verwenden imstande sind.
Die Menge jeder Ware, die. menschliche Betriebsamkeit entweder zu kaufen oder zu produzieren vermag, richtet sich in jedem Lande nach der wirksamen Nachfrage, d. h. nach der Nachfrage derjenigen, die bereit sind, die gesamte Rente, Arbeit und Gewinn zu zahlen, die für die Herstellung der Sache und für ihre Versendung nach dem Markte zu zahlen sind. Keine Ware aber richtet sich leichter oder genauer nach dieser wirksamen Nachfrage, als Gold und Silber, weil wegen ihres geringen Volumens und großen Wertes keine leichter als diese Metalle von einem Orte nach dem anderen, von. Orten, wo sie wohlfeil, nach anderen, wo sie teuer sind, von Orten, wo sie die wirksame Nachfrage überschreiten, nach anderen, wo sie hinter ihr zurückbleiben; gebracht werden kann. Ist z. B. in England eine Nachfrage nach einer größeren Menge Goldes, so kann ein Paketboot fünfzig Tonnen Gold von Lissabon, oder wo es sonst zu haben ist, hierherbringen, woraus mehr als fünf Millionen Guineen geprägt werden. Ist dagegen eine wirksame Nachfrage nach Getreide in ebenso hohem Betrag vorhanden, so würden, die Tonne zu fünf Guineen gerechnet, eine Million Schiffstonnen oder tausend Schiffe von je tausend Tonnen Gehalt dazu nötig sein. Die ganze englische Flotte reichte dazu nicht aus.
Wenn die in ein Land eingeführte Menge Goldes und Silbers die wirksame Nachfrage übersteigt, so kann keine Wachsamkeit der Regierung die Ausfuhr verhüten. All die harten Gesetze Spaniens und Portugals sind nicht imstande, ihr Gold und Silber im Lande zu halten. Die fortwährenden Einfuhren aus Peru und Brasilien übersteigen die wirksame Nachfrage jener Länder und drücken dort den Preis der Metalle unter das Niveau, auf dem er in den benachbarten Ländern steht. Wenn hingegen in einem Lande ihre Menge hinter der wirksamen Nachfrage zurückbleibt, so dass ihr Preis über sein Niveau in den benachbarten Ländern steigt, so hat die Regierung nicht nötig, sich um ihre Einfuhr besondere Mühe zu geben. Selbst wenn sie die Einfuhr zu verhindern strebte, würde sie nicht imstande sein, dies durchzusetzen. Als die Spartaner die Mittel gewonnen hatten, Gold und Silber zu kaufen, durchbrachen diese Metalle alle Dämme, die die Lykurgischen Gesetze ihrem Eingange nach Lakedämon entgegengesetzt hatten. Alle harten Zollgesetze vermögen die Einfuhr des Tees der Ostindischen Gesellschaften Hollands und Göteborgs nicht zu verhindern, weil ihr Tee etwas wohlfeiler ist, als der der britischen Gesellschaft. Und doch ist ein Pfund Tee von der besten Qualität, das mit £ 16 sh. bezahlt wird, ungefähr hundertmal so groß wie die bez. Menge Silbers und zweitausendmal so groß wie die bez. Menge Gold, und folglich um soviel schwerer einzuschmuggeln.
Dem leichten Transport von Gold und Silber, von Orten, wo sie im Überfluss vorhanden sind, nach anderen, wo sie fehlen, ist es teilweise zuzuschreiben, dass der Preis dieser Metalle nicht fortwährend ebenso schwankt, wie der der meisten anderen Waren, die durch ihren Umfang gehindert sind, ihren Platz bei Überfüllung oder Entleerung des Marktes leicht zu verändern. Zwar ist auch der Preis dieser Metalle nicht ganz von Schwankungen frei, aber sie sind in der Regel langsam, allmählich und gleichmäßig. Man nimmt z. B., vielleicht ohne rechten Grund, an, dass in Europa diese Metalle im gegenwärtigen und vorigen Jahrhundert wegen der beständigen Einfuhren aus dem spanischen Westindien ununterbrochen aber allmählich im Preise gesunken seien. Um jedoch eine plötzliche Veränderung im Preise von Gold und Silber hervorzubringen, so dass der Geldpreis aller anderen Waren dadurch auf einmal auffallend gesteigert oder gedrückt würde, dazu würde eine ähnliche Revolution im Handel erforderlich sein, wie die, welche durch die Entdeckung Amerikas veranlasst worden ist.
Wenn trotz alle dem einmal Gold und Silber in einem Lande, das sie zu kaufen imstande ist, fehlen sollten, so gibt es dafür mehr Ersatzmittel, als für jede andere Ware. Wenn die Rohstoffe für die Industrie fehlen, so muss diese in Stockung geraten. Fehlt es an Lebensmitteln, so müssen die Leute darben. Doch wenn Geld fehlt, wird der Tausch an seine Stelle treten, wenn er auch mit großen Unbequemlichkeiten verknüpft ist. Kaufen und verkaufen auf Kredit und monatliche oder halbjährige Abrechnung der Kaufleute würde das Geld schon viel leichter ersetzen. Ein gut eingerichtetes Papiergeld aber wird seine Stelle nicht nur ohne Unbequemlichkeit, sondern oft sogar mit Vorteil ersetzen. Die Fürsorge der Regierung wäre daher in keiner Hinsicht so unnütz angewandt, als in der Überwachung der Goldmenge im Lande.
Gleichwohl ist keine Klage häufiger, als die über Geldmangel. Geld, wie Wein, ist stets selten bei Leuten, die keine Mittel haben, sie zu kaufen, noch Kredit, sie zu borgen. Wer eines oder das andere hat, wird selten um das Geld oder den Wein, die er braucht, verlegen sein. Die Klage über Geldmangel wird jedoch nicht bloß von leichtsinnigen Verschwendern erhoben. Man hört sie zuweilen allgemein in einer Handelsstadt und ihrer Umgegend. Ihre gewöhnliche Ursache ist Überspekulation. Nüchterne Männer, deren Unternehmungen nicht im richtigen Verhältnis zu ihren Kapitalien stehen, haben oft ebenso wenig Mittel, Geld zu kaufen, oder Kredit, es zu borgen, wie Verschwender, deren Aufwand in keinem richtigen Verhältnisse zu ihrem Einkommen steht. Ehe ihre Unternehmungen etwas einbringen, ist ihr Kapital dahin, und mit ihm ihr Kredit. Sie laufen überall umher, um Geld zu borgen, und jedermann antwortet ihnen, er habe keines zu verleihen. Aber auch solche allgemeinen Klagen über Geldmangel beweisen nicht immer, dass nicht die gewöhnliche Zahl von Gold- und Silberstücken im Lande umlaufe, sondern nur, dass sie vielen Leuten fehlen, die nichts dafür zu geben haben. Wenn die Handelsgewinne einmal größer sind, als gewöhnlich, so verfallen in der Regel große wie kleine Geschäftsleute in den Fehler einer zu großen Ausdehnung der Geschäfte. Sie senden nicht immer mehr Geld als gewöhnlich aus dem Lande, aber sie kaufen im Lande selbst und auswärts eine ungewöhnliche Menge von Waren auf Kredit, die sie in der Hoffnung, dass die Rimessen vor dem Zahltage eingehen werden, auf entfernte Märkte senden. Die Zahltage erscheinen jedoch vor dem Eingang der Rimessen, und sie haben nichts in Händen, womit sie entweder Geld kaufen oder gute Sicherheit für Darlehen geben könnten. Es ist also nicht ein Mangel an Gold und Silber, sondern die Schwierigkeit, die es solchen Leuten macht, zu borgen, und die, welche ihre Gläubiger haben, Zahlung zu erhalten, was jene allgemeine Klage über Geldmangel verursacht.
Es würde zu lächerlich sein, allen Ernstes beweisen zu wollen, dass Reichtum nicht in Geld oder in Gold und Silber, sondern in dem besteht, was das Geld kauft und dieser Kaufkraft wegen wert ist. Das Geld macht ohne Zweifel immer einen Teil des Nationalkapitals aus, aber es ist schon gezeigt worden, dass es nur einen kleinen und immer den am wenigsten einträglichen Teil von ihm ausmacht.
Nicht deshalb findet es der Kaufmann im allgemeinen leichter, Waren mit Geld, als Geld mit Waren zu kaufen, weil der Reichtum wesentlicher in Geld als Waren besteht, sondern deshalb, weil das Geld das bekannte und feststehende Verkehrswerkzeug ist, wofür alle Dinge leicht in Umtausch gegeben werden, das aber nicht immer mit gleicher Leichtigkeit für jedes Ding in Tausch zu erhalten ist. Überdies sind die meisten Waren dem Verderben mehr ausgesetzt als Geld, und der Kaufmann kann oft einen weit größeren Verlust durch das Behalten der Ware als lediglich den des Geldes erleiden. Wenn seine Waren ihm auf Lager bleiben, ist er auch Geldforderungen, denen er nicht nachzukommen vermag, mehr ausgesetzt, als wenn er ihren Preis in seiner Kasse hat. Vor allem entspringt sein Gewinn unmittelbarer aus dem Verkauf, als aus dem Kauf, und aus all diesen Gründen ist er gewöhnlich viel mehr darauf bedacht, seine Waren gegen Geld, als sein Geld gegen Waren zu vertauschen. Ein Kaufmann kann bei einem noch so reichlich gefüllten Warenlager zuweilen ruiniert sein, weil er nicht zur rechten Zeit verkaufen kann; ein Volk oder Land dagegen ist solchen Unfällen nicht ausgesetzt. Das ganze Kapital eines Kaufmanns besteht oft in leicht verderblichen Waren, die Geld kaufen sollen; dagegen ist es immer nur ein sehr kleiner Teil der jährlichen Boden- und Arbeitsprodukte eines Landes, der von den Nachbarn Gold und Silber einkaufen soll. Der bei weitem größere Teil läuft unter ihnen selbst um und wird von ihnen verbraucht, und selbst von dem Überschusse, der nach anderen Ländern gesandt wird, hat das meiste gewöhnlich die Bestimmung, andere ausländische Waren zu erkaufen. Wäre daher Gold und Silber auch nicht für die zum Ankauf dieser Metalle bestimmten Waren zu haben, so ginge die Nation deshalb doch nicht zugrunde. Sie könnte allerdings dadurch Verlust und Unbequemlichkeit erleiden und gezwungen sein, zu dem einen oder andern der Ersatzmittel des Geldes zu greifen; allein das jährliche Boden- und Arbeitsprodukt würde das nämliche oder beinahe das nämliche bleiben, weil ein gleiches oder beinahe gleiches verzehrbares Kapital aufgewendet werden würde, es zu erzielen. Obschon Waren nicht immer ebensoleicht Geld verschaffen, wie Geld Waren, so verschaffen sie es auf die Länge doch gewisser, als dieses jene. Waren können zu manchen anderen Zwecken dienen, als zum Kaufe von Geld; Geld aber dient zu keinem anderen, als zum Kaufe von Waren. Das Geld sucht also notwendig Waren auf, aber Waren suchen nicht immer oder nicht notwendig das Geld auf. Wer kauft, ist nicht stets gewillt, wieder zu verkaufen, sondern will oft nur brauchen oder verzehren, wogegen derjenige, der verkauft, immer wieder zu kaufen beabsichtigt. Der eine kann oft mit dem Kauf sein Geschäft beendet haben, der andere dagegen hat immer nur die Hälfte der Arbeit getan. Nicht um seiner selbst willen lieben die Menschen das Geld, sondern um dessen willen, was sie damit kaufen können.
Verbrauchbare Waren, sagt man, gehen bald zugrunde, während Gold und Silber dauerhafterer Natur sind und ohne fortwährende Ausfuhr leicht Menschenalter hindurch aufgehäuft werden könnten, zur unglaublichen Vermehrung des wahren Reichtums des Landes. Nichts könne daher für ein Land so schädlich sein, als derjenige Handel, der im Vertauschen so dauerhafter Waren gegen so vergängliche bestehe. Den Handel aber, der im Tausch englischer Eisenwaren gegen französische Weine besteht, sehen wir nicht für nachteilig an, obgleich Eisenwaren sehr dauerhaft sind und ohne die fortwährende Ausfuhr leicht Jahrhunderte hindurch aufgehäuft werden könnten, zur unglaublichen Vermehrung der Töpfe und Pfannen des Landes. Allein es leuchtet ein, dass die Zahl solcher Utensilien in jedem Lande notwendig durch den Gebrauch begrenzt ist, den man davon machen kann, dass es albern sein würde, mehr Töpfe und Pfannen zu haben, als zum Kochen der Lebensmittel, die gewöhnlich verbraucht werden, nötig sind; und dass, wenn die Menge der Lebensmittel zunimmt, zugleich mit ihr die Zahl der Töpfe und Pfannen leicht vermehrt werden kann, indem ein Teil des Zuwachses an Lebensmitteln dazu verwendet würde, sie zu kaufen, oder mit andern Worten, eine weitere Anzahl Arbeiter damit ernährt würde, deren Geschäft es ist, sie zu verfertigen. Ebenso leicht sollte es einleuchten, dass in jedem Lande die Menge Gold und Silber durch den Bedarf an diesen Metallen begrenzt ist; dass man ihrer bedarf, um als Münzen Waren in Umlauf zu setzen oder als Geschirr eine Sorte Hausgerät zu liefern; dass die Menge gemünzten Geldes sich in jedem Lande nach dem Betrage der damit in Umlauf gesetzten Waren richtet, so dass, wenn sich dieser Betrag vermehrt, sofort ein Teil der Waren ins Ausland gesendet wird, um die frische Menge Geldes zu kaufen, die nötig ist, um sie in Umlauf zu setzen; dass die Menge des Gold- und Silbergerätes sich nach der Zahl und dem Reichtum der Familien richtet, die sich einen solchen Luxus erlauben können, so dass, wenn sich die Zahl und der Reichtum solcher Familien vermehrt, höchstwahrscheinlich ein Teil des vermehrten Reichtums dazu verwendet werden wird, eine neue Menge goldener und silberner Geräte da zu kaufen, wo man sie eben findet; und dass es endlich ebenso töricht wäre, den Reichtum eines Landes durch Einfuhr oder Zurückhalten einer unnötigen Menge Goldes und Silbers vermehren zu wollen, wie es töricht wäre, einer Familie dadurch zu einer besseren Mahlzeit verhelfen zu wollen, dass man sie zwänge, eine unnötige Menge Küchengerät zu halten.
Wie die Kosten dieses unnötigen Gerätes die Menge oder die Güte der für den Haushalt erforderlichen Lebensmittel vermindern, aber nicht vermehren würden, so würden auch in einem Lande die Kosten des Ankaufs einer unnötigen Menge Goldes und Silbers notwendig das Vermögen schmälern, das dem Volke Nahrung, Kleidung, Wohnung, Unterhalt und Arbeit verschafft. Gold und Silber sind, wie man festhalten muss, sei es als Münze oder als Geschirr, genau ebenso Geräte, wie das Küchengeschirr. Vermehrt sich der Bedarf an ihnen, vermehren sich die verzehrbaren Waren, die damit in Umlauf gesetzt oder daraus verfertigt werden, so wird sich unfehlbar auch die Menge jener Metalle vermehren. Versuchte man hingegen, diese Menge durch außerordentliche Mittel zu vermehren, so würde sich ebenso unfehlbar der Bedarf und damit zugleich die Menge vermindern, die niemals den Bedarf übersteigen kann. Sollten sie jemals über dies Maß hinaus zunehmen, so ist ihre Versendung so leicht und der Verlust, wenn sie müßig und unbenutzt liegen, so groß, dass kein Gesetz ihre sofortige Ausfuhr aus dem Lande verhindern könnte.
Es ist nicht immer notwendig, Gold und Silber aufzuhäufen, um ein Land in den Stand zu setzen, auswärtige Kriege zu führen und in entfernten Gegenden Flotten und Heere zu unterhalten. Flotten und Heere unterhält man nicht mit Gold und Silber, sondern mit verzehrbaren Waren. Ein Volk, das durch das Jahresprodukt seines heimischen Fleißes, durch das jährliche Einkommen aus seinem Grund und Boden, seiner Arbeit und seinem verzehrbaren Vorrat die Mittel gewinnt, jene verbrauchbaren Waren in entfernten Gegenden zu kaufen, kann dort auch Kriege führen.
Der Sold und die Lebensmittel für ein Heer in einem entfernten Lande lassen sich auf dreierlei Art beschaffen, erstens durch Hinsendung eines Teils des angesammelten Gold- und Silbervorrats, zweitens eines Teils vom Jahresprodukt der Industrie, oder endlich eines Teils der landwirtschaftlichen Produkte.
Das in einem Lande vorhandene oder angesammelte Gold und Silber kann man in drei Gattungen einteilen: erstens das umlaufende Geld, zweitens die Geräte der Familien und drittens das Geld, welches durch langjährige Sparsamkeit gesammelt und im Schatz des Fürsten niedergelegt ist.
Von dem umlaufenden Gelde des Landes kann nur selten viel entbehrt werden, weil selten ein Überfluss davon vorhanden sein kann. Der Betrag der in einem Lande jährlich gekauften und verkauften Waren erfordert eine gewisse Menge Geldes, um die Waren in Umlauf zu setzen und an ihre eigentlichen Verbraucher zu verteilen: mehr aber ist nicht verwendbar. Der Umlaufkanal zieht eine zu seiner Füllung hinreichende Summe an sich, und lässt niemals mehr zu. Doch wird gewöhnlich bei einem auswärtigen Kriege diesem Kanal etwas entzogen. Da eine große Zahl von Menschen außerhalb unterhalten wird, so werden weniger im Lande selbst unterhalten. Es sind daselbst weniger Waren im Umlaufe und es ist weniger Geld dazu nötig, sie in Umlauf zu setzen. Auch wird bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich eine größere Menge Papiergeld dieser oder jener Art, wie Schatzkammerscheine, Admiralitätswechsel und in England Banknoten, ausgegeben, und da dasselbe die Stelle des umlaufenden Goldes und Silbers vertritt, so wird dadurch die Ausfuhr einer größeren Menge des letzteren ermöglicht. Alles dies wäre jedoch nur eine dürftige Hilfsquelle zur Führung eines kostspieligen und mehrere Jahre lang dauernden Krieges.
Das Einschmelzen des Gold- und Silbergeräts der Privatleute hat sich auf alle Fälle als noch unwirksamer erwiesen. Die Franzosen hatten beim Beginn des letzten Kriegs von diesem Mittel nicht so viel Nutzen um den Verlust der Fasson zu ersetzen.
Die angesammelten Schätze des Fürsten boten in früheren Zeiten eine weit größere und dauernde Hilfsquelle dar. Gegenwärtig scheint mit Ausnahme des Königs von Preußen kein europäischer Fürst einen Staatsschatz anzusammeln.
Die Fonds, aus denen die auswärtigen Kriege dieses Jahrhunderts, die kostspieligsten vielleicht, die je dagewesen sind, bestritten wurden, scheinen die Ausfuhr des umlaufenden Geldes oder der Gold- und Silbergeräte der Privaten oder des fürstlichen Schatzes wenig berührt zu haben. Der letzte französische Krieg kostete Großbritannien mehr als 90 Millionen, mit Einschluss nicht nur der £ 75 Millionen neu hinzugekommener Staatsschulden, sondern auch der zwei Zuschlags-Schillinge auf jedes £ Grundsteuer und der jährlichen Darlehen aus dem Tilgungsfonds. Mehr als zwei Drittel dieser Summe wurde in fernen Ländern ausgegeben: in Deutschland, Portugal, Amerika, in den Häfen des Mittelländischen Meeres, in Ost- und Westindien. Die Könige von England hatten keinen Staatsschatz. Nie hat man davon gehört, dass eine außergewöhnliche Menge von Geräten eingeschmolzen worden wäre. Das im Lande umlaufende Gold und Silber wird auf nicht mehr als achtzehn Millionen geschätzt, doch gilt diese Schätzung nach der letzten Umprägung des Goldes als zu gering. Nehmen wir daher nach der übertriebensten Berechnung, von der ich je gesehen oder gehört habe, an, dass der Umlauf in Gold und Silber zusammen 30 Millionen £ betrug. Wäre der Krieg mittelst unseres Geldes geführt worden, so würde auch nach dieser höchsten Berechnung das ganze Geld in einem Zeitraum von sechs bis sieben Jahren zweimal hin und her geschickt worden sein. Dies angenommen, würde es den sprechendsten Beweis liefern, wie unnötig die Überwachung des Geldumlaufs durch die Regierung ist, da nach jener Voraussetzung das ganze Geld des Landes in einer kurzen Zeit zweimal hin und her gegangen sein muss, ohne dass irgendein Mensch etwas davon gemerkt hat. Der Umlaufkanal war anscheinend keinen Augenblick leerer, als er sonst zu sein pflegte. Es fehlte wenig Leuten an Geld, wenn sie nur Mittel hatten, es zu kaufen. Die Gewinne des Außenhandels sind während des ganzen Krieges, namentlich aber gegen sein Ende, größer als gewöhnlich. Dies verursachte, wie gewöhnlich, eine allgemeine Überspekulation in allen großbritannischen Häfen, und daraus entstand wieder die gewöhnliche auf jede Überspekulation folgende Klage über Geldmangel. Nun fehlte es vielen Leuten an Geld, da sie weder Mittel hatten, es zu kaufen, noch Kredit, es zu borgen; und weil die Schuldner es schwer fanden zu borgen, war es auch für die Gläubiger schwer, Bezahlung zu erhalten. Für die jedoch, die den Wert des Goldes und Silbers bezahlen konnten, war es auch für diesen Wert zu haben.
Die ungeheuren Kosten des letzten Krieges müssen also nicht durch die Ausfuhr von Gold und Silber, sondern durch die britischer Waren dieser oder jener Art bestritten worden sein. Wenn die Regierung, oder wer in ihrem Namen handelte, mit einem Kaufmann Rimessen nach dem Auslande verabredete, so suchte dieser natürlich seinen auswärtigen Korrespondenten, auf den er einen Wechsel zog, lieber durch Waren als durch Geld zu bezahlen. War für britische Waren dort kein Begehr, so suchte er sie in ein anderes Land zu senden, wo er einen Wechsel auf das erstere kaufen konnte. Die Versendung von Waren auf einen geeigneten Markt wirft stets erheblichen Gewinn ab, die Versendung von Gold und Silber selten irgendeinen. Werden diese Metalle behufs Ankaufs fremder Waren weggesendet, so entspringt der Gewinn des Kaufmanns nicht aus dem Kaufe, sondern aus dem Verkaufe der Rückladung. Werden sie aber bloß zur Bezahlung einer Schuld fortgeschickt, so erhält er nichts dafür zurück und macht folglich keinen Gewinn. Darum sinnt er auf Mittel, seine auswärtigen Schulden durch Ausfuhr von Waren und nicht von Gold und Silber zu bezahlen. Daher ist von dem Verfasser des Buches: „The present state of the nation" mit Recht auf die große Ausfuhr britischer Waren während des letzten Kriegs, ohne entsprechende Einfuhr, aufmerksam gemacht worden.
Außer den oben erwähnten drei Sorten von Gold und Silber gibt es in allen großen Handelsstaaten eine ganze Anzahl Barren, die zum Behuf des auswärtigen Handels abwechselnd ein- und ausgeführt werden. Da diese Barren unter den verschiedenen Handelsstaaten auf gleiche Weise umlaufen, wie die Landesmünze in jedem einzelnen Lande, so kann man sie als das Geld der großen Handelsrepublik ansehen. Die Landesmünze erhält ihre Bewegung und Richtung von den Waren, die innerhalb eines einzelnen Gebietes umlaufen; das Geld der Handelsrepublik erhält sie von denen, die zwischen verschiedenen Ländern in Umlauf sind. Beide dienen zur Erleichterung der Tausche: jene zwischen verschiedenen Individuen desselben Volks, diese zwischen den Individuen verschiedener Völker. Etwas von diesem Gelde der großen Handelsrepublik kann wohl zur Führung des letzten Krieges verwendet worden sein und ist wahrscheinlich in der Tat so verwendet worden. Natürlich wird es in der Zeit eines allgemeinen Krieges eine andere Bewegung und Richtung erhalten, als die, welche es mitten im tiefsten Frieden einhält; es wird mehr auf dem Schauplatze des Krieges umlaufen und mehr dazu dienen, dort und in benachbarten Gegenden den Sold und Unterhalt der verschiedenen Armeen zu bezahlen. Wieviel aber auch Großbritannien von diesem Gelde der Handelsrepublik jährlich gebraucht haben mag, so muss das Land es doch alle Jahre entweder mit britischen Waren oder mit sonst etwas, das mittelst dieser Waren gekauft worden war, angeschafft haben, und dies führt uns doch wieder zu dem jährlichen Boden- und Arbeitsertrage des Landes als der schließlichen Hilfsquelle der Kriegsführung zurück. Natürlich muss ein so großer jährlicher Aufwand mit einem großen jährlichen Ertrag bestritten worden sein. So beliefen sich z. B. die Ausgaben 1761 auf mehr als neunzehn Millionen. Keine Ansammlung hätte eine so große jährliche Verschwendung ertragen können. Keine Produktion, selbst nicht die Gold- und Silberproduktion, hätte dazu hingereicht. Alles Gold und Silber, das in einem Jahre nach Spanien und Portugal eingeführt wird, beläuft sich nach den besten Quellen gewöhnlich nicht auf viel über 6 Millionen £, was in gewissen Jahren kaum hingereicht hätte, die Kriegskosten für vier Monate zu decken.
Die Waren, die sich am besten zur Ausfuhr in ferne Länder eignen, um daselbst entweder den Sold und Unterhalt eines Heeres oder einen Teil des hierzu bestimmten Geldes der Handelsrepublik zu kaufen, scheinen die feineren und künstlichen Fabrikate zu sein, die bei kleinem Umfang großen Wert haben und deshalb mit wenigen Kosten weit versandt werden können. Ein Land, dessen Industrie einen großen jährlichen Überschuss an solchen Fabrikaten, die im Ausland Absatz finden, hervorbringt, kann jahrelang einen kostspieligen Krieg aushalten, ohne viel Gold und Silber auszuführen, oder überhaupt viel zur Ausfuhr übrigzuhaben. Allerdings muss in diesem Falle ein beträchtlicher Teil des jährlichen Überschusses seiner Fabrikate ausgeführt werden, ohne dem Lande einen Ersatz zurückzubringen, wiewohl ihn der Kaufmann erhält; denn die Regierung kauft letzterem seine Wechsel aufs Ausland ab, um dort den Sold und Unterhalt einer Armee damit zu bezahlen. Ein Teil jenes Überschusses kann auch dem Lande noch etwas zurückbringen. Im Kriege pflegt an die Fabrikanten eine doppelte Nachfrage heranzutreten, und sie finden sich berufen, erstens Waren zur Ausfuhr herzustellen, mit denen die aufs Ausland behufs Bezahlung des Soldes und Unterhalts der Armee gezogenen Wechsel gezahlt werden können, und zweitens diejenigen Waren, die zum Ankauf der gewöhnlichen Rückladungen dienen sollen, die im Lande selbst verbraucht zu werden pflegen. Daher können oft mitten im verheerendsten auswärtigen Kriege die meisten Fabriken in großem Flor stehen und umgekehrt bei Wiederkehr des Friedens zurückgehen. Sie können mitten im Ruin ihres Landes blühen und mit der Wiederkehr seines Wohlstandes verfallen. Die Verschiedenheit der Lage vieler britischer Industriezweige während des letzten Krieges und einige Zeit nach dem Frieden können zur Erläuterung des eben Gesagten dienen.
Kein sehr kostspieliger oder lange dauernder auswärtiger Krieg kann füglich durch Ausfuhr von Rohprodukten bestritten werden. Die Transportkosten einer so großen Menge davon, dass der Sold und Unterhalt eines Heeres damit bezahlt werden könnte, wären zu groß. Auch bringen nur wenige Länder viel mehr Rohprodukte hervor, als zum Unterhalt der eigenen Bewohner hinreicht. Eine große Menge von ihnen hinaus senden, hieße also einen Teil der dem Volke unentbehrlichen Unterhaltsmittel wegsenden. Anders verhält es sich mit der Ausfuhr von Fabrikaten. Der Unterhalt der mit ihrer Verfertigung beschäftigten Leute bleibt im Lande, und nur der Überschuss ihrer Arbeiten wird ausgeführt. Hume macht wiederholt auf die Unfähigkeit der alten Könige von England aufmerksam, ohne Unterbrechung einen langwierigen auswärtigen Krieg zu führen. Die Engländer jener Zeit hatten, um den Sold und Unterhalt ihrer Heere im Auslande zu kaufen, nichts weiter, als entweder die Rohprodukte ihres Bodens, von denen dem heimischen Verbrauch nicht viel entzogen werden konnte, oder einige wenige Fabrikate der gröbsten Art, deren Versendung gleich der der Rohprodukte zu kostspielig war. Jene Unfähigkeit entsprang nicht aus dem Geldmangel, sondern dem Mangel an feineren und künstlicheren Fabrikwaren. Kaufen und Verkaufen wurde in England damals wie jetzt mittelst des Geldes bewirkt. Die Summe des umlaufenden Geldes muss sich damals zu der Zahl und dem Werte der durchschnittlichen Käufe und Verkäufe ebenso verhalten haben, wie jetzt, oder muss vielmehr größer gewesen sein, weil es damals kein Papiergeld gab, welches jetzt zum großen Teil die Stelle des Goldes und Silbers vertritt. Unter Völkern, die wenig Handel und Industrie kennen, kann aus Gründen, die wir später entwickeln werden, der Landesherr bei außerordentlichen Gelegenheiten nur selten viel Beistand von seinen Untertanen erhalten. In solchen Ländern sucht er daher in der Regel einen Schatz zu sammeln, der in Fällen der Not seine einzige Zuflucht ist. Aber auch abgesehen von dieser Notwendigkeit ist er in einer Lage, welche der zur Sammlung eines Schatzes erforderlichen Sparsamkeit günstig ist. In einfachen Verhältnissen ist der Aufwand selbst des Landesherrn nicht von der eitlen Lust an einer glänzenden Hofhaltung bestimmt, sondern wird zu Gnadenbezeugungen für die Lehnsleute und zur Gastfreiheit gegen das Gefolge verwendet. Freigebigkeit und Gastlichkeit arten aber sehr selten in Verschwendung aus, wie es die Eitelkeit fast immer tut. Jeder Tatarenfürst hat demzufolge einen Schatz. Die Schätze des Mazeppa, des Kosakenhäuptlings in der Ukraine und berühmten Bundesgenossen Karls XII., sollen sehr groß gewesen sein. Die merowingischen Könige von Frankreich hatten jeder einen Schatz, und wenn sie ihr Reich unter ihre Kinder teilten, teilten sie auch den Schatz. Die sächsischen Fürsten und die ersten Könige nach der Eroberung scheinen ebenfalls einen Schatz angesammelt zu haben. Der erste Schritt jedes neuen Regenten war, sich des Schatzes des vorigen Königs zu bemächtigen, denn dies sicherte die Nachfolge am besten. Die Fürsten zivilisierter und handeltreibender Staaten haben es nicht in dem Grade nötig, einen Schatz aufzuhäufen, weil sie in außerordentlichen Fällen gewöhnlich außerordentliche Beihilfe von ihren Untertanen erhalten können, und sind deshalb auch weniger darauf bedacht. Sie folgen naturgemäß oder vielleicht notgedrungen der Mode der Zeit, und ihr Aufwand richtet sich nach derselben übertriebenen Eitelkeit, die den Aufwand aller übrigen großen Eigentümer in ihren Staaten leitet. Der bedeutungslose Prunk ihres Hofes wird von Tag zu Tag glänzender, und die Ausgaben für ihn verhindern nicht nur die Ansammlung, sondern greifen auch oft den zu nötigeren Ausgaben bestimmten Fonds an. Was Dercyllidas vom persischen Hofe sagte, dass er dort viel Glanz, aber wenig Kraft, viele Diener, aber wenig Krieger gesehen habe, lässt sich auch auf den Hof mancher europäischen Fürsten anwenden.
Die Einfuhr von Gold und Silber ist nicht der wichtigste, und noch weit weniger der einzige Gewinn, den eine Nation aus ihrem auswärtigen Handel zieht. Zwischen welchen Plätzen auch der auswärtige Handel getrieben worden mag: sie haben alle zwei verschiedenartige Vorteile von ihm. Er führt den Überschuss ihrer Boden- und Arbeitsprodukte, wonach im Lande keine Nachfrage ist, aus, und bringt dafür etwas anderes zurück, was im Lande begehrt wird. So gibt er dem, was für sie Überfluss ist, durch Austausch gegen etwas anderes, das einen Teil ihrer Bedürfnisse befriedigen und ihre Genüsse vermehren kann, einen Wert. Die Schranken des heimischen Marktes werden durch seine Dazwischenkunft kein Hindernis, die Teilung der Arbeit in jedem Industriezweige bis zur höchsten Vollkommenheit zu entwickeln. Indem er einen ausgedehnteren Markt für den Überschuss der Arbeitserzeugnisse eröffnet, ermutigt er zur Vervollkommnung der hervorbringenden Kräfte, zur äußersten Vermehrung der Jahresproduktion und dadurch zur Vergrößerung des wahren Einkommens und Reichtums des Volkes. Diese großen und wichtigen Dienste leistet der auswärtige Handel unausgesetzt allen Ländern, zwischen denen er getrieben wird. Sie alle haben großen Vorteil von ihm, den größten aber dasjenige, in dem der Kaufmann seinen Sitz hat, da dieser sich gewöhnlich die Befriedigung des Bedarfs seines eignen Landes und die Ausfuhr von seinem Überfluss am meisten angelegen sein lässt. Die Einfuhr des nötigen Goldes und Silbers in Länder, die keine Bergwerke haben, ist ohne Zweifel ein Gegenstand des auswärtigen Handels, aber jedenfalls nur ein höchst unbedeutender. Ein Land, das lediglich in dieser Absicht auswärtigen Handel triebe, würde kaum in einem Jahrhundert ein Schiff zu befrachten haben.
Nicht durch die Einfuhr von Gold und Silber hat die Entdeckung Amerikas Europa reicher gemacht. Durch den Reichtum der amerikanischen Minen sind diese Metalle wohlfeiler geworden. Silbergerät kann jetzt für etwa den dritten Teil des Getreides oder der Arbeit gekauft werden, die es im fünfzehnten Jahrhundert gekostet haben würde. Mit dem nämlichen Aufwande von Arbeit und Waren kann Europa jährlich etwa dreimal soviel Silbergeschirr kaufen, als zu jener Zeit. Wenn aber eine Ware für den dritten Teil des bisherigen Preises verkauft wird, so können nicht nur die früheren Käufer dreimal soviel davon kaufen, sondern sie ist nun auch für eine weit größere Zahl von Käufern, vielleicht für zehn- oder zwanzigmal mehr als früher, erreichbar geworden, so dass jetzt nicht dreimal, sondern zwanzig- oder dreißigmal soviel Silbergeschirr in Europa sein kann, als selbst bei dem jetzigen Kulturzustande vorhanden sein würde, wenn die amerikanischen Minen nicht entdeckt worden wären. Insofern hat Europa allerdings einen wirklichen, wenn auch sehr unbedeutenden Vorteil gewonnen. Die Wohlfeilheit des Goldes und Silbers macht diese Metalle eher weniger zu Münzen geeignet, als sie es früher waren. Um die nämlichen Käufe zu machen, müssen wir uns jetzt mit einer größeren Menge dieser Münzen beladen und einen Schilling bei uns tragen, wo vorher ein Grot genügte. Es ist schwer zu sagen, was geringfügiger ist, dieser Nachteil oder jener Vorteil. Keins von beiden konnte im Zustand Europas eine wesentliche Veränderung hervorbringen. Dennoch hat die Entdeckung Amerikas gewiss eine sehr wichtige Veränderung hervorgebracht. Indem sie allen Waren Europas einen neuen und unerschöpflichen Markt öffnete, gab sie zu neuen Arbeitsteilungen und technischen Verbesserungen Anlass, die in dem engen Kreise des früheren Handels aus Mangel an einem für den größten Teil seiner Erzeugnisse hinreichend aufnahmefähigen Markte nie hätten Platz greifen können. Die produktiven Kräfte der Arbeit entwickelten sich, und ihr Erzeugnis und mit ihm das wahre Einkommen und der wahre Reichtum der Einwohner nahm in allen Ländern Europas zu. Fast alle europäischen Waren waren für Amerika neu und viele waren es für Europa. So entstand eine neue Reihe von Tauschen, an die man vorher nie gedacht hatte, und die für den neuen Erdteil ebenso vorteilhaft hätten werden können, wie sie es für den alten unstreitig waren. Allein die barbarische Ungerechtigkeit der Europäer machte ein Ereignis, das für alle wohltätig sein konnte, für manche dieser unglücklichen Länder verderblich und zerstörend.
Die ziemlich gleichzeitige Entdeckung eines Weges nach Ostindien um das Vorgebirge der Guten Hoffnung eröffnete trotz der größeren Entfernung dem auswärtigen Handel vielleicht einen noch größeren Spielraum, als selbst die Entdeckung Amerikas. In Amerika gab es nur zwei Völkerschaften, die höher als die Wilden standen, und diese wurden fast zu gleicher Zeit vertilgt wie entdeckt. Die übrigen waren vollständig wild. Dagegen waren China, Hindustan, Japan, sowie mehrere andere ostindische Reiche, ohne ergiebige Gold- und Silberminen zu besitzen, in jeder anderen Beziehung weit reicher, kultivierter und in Künsten und Gewerben vorgeschrittener, als Mexiko oder Peru, selbst wenn wir den übertriebenen durchaus unglaubwürdigen Berichten spanischer Schriftsteller über den alten Zustand jener Reiche Glauben schenken wollten. Reiche und zivilisierte Nationen können aber stets miteinander viel größere Werte austauschen als mit Wilden und Barbaren. Gleichwohl hat Europa bisher von seinem Handel mit Ostindien viel weniger Vorteil gezogen, als von dem mit Amerika. Die Portugiesen monopolisierten den ostindischen Handel fast ein Jahrhundert lang für sich, und die übrigen europäischen Nationen konnten nur mittelbar durch die Portugiesen Waren nach jenem Lande senden oder von dorther empfangen. Als die Holländer im Anfange des vorigen Jahrhunderts die Portugiesen zu verdrängen anfingen, überließen sie ihren ganzen Ostindien-Handel einer privilegierten Gesellschaft. Engländer, Franzosen, Schweden und Dänen folgten diesem Beispiel, so dass bis jetzt keine einzige große europäische Nation den Vorteil freien Verkehrs nach Ostindien gehabt hat. Dies erklärt hinreichend, warum dieser Verkehr niemals so vorteilhaft gewesen ist, wie der nach Amerika, der zwischen fast allen europäischen Nationen und ihren Kolonien für alle Staatsbürger frei war. Die ausschließenden Privilegien jener ostindischen Gesellschaften, ihre großen Reichtümer, die hohe Begünstigung und Schutz, die diese ihnen seitens der Regierungen verschafften, haben viel Neid gegen sie erregt. Dieser Neid hat oft ihren Handel als durchaus verderblich geschildert, weil er alle Jahre so große Mengen Silbers aus dem Lande führe. Die Gegenpartei hat erwidert, ihr Handel könne wohl durch die stete Silberausfuhr Europa im allgemeinen ärmer machen, aber nicht das einzelne Land, von dem der Handel getrieben werde: denn durch die Ausfuhr eines Teils der Rückladungen nach anderen europäischen Ländern komme jährlich eine weit größere Summe jenes Metalls ins Land, als ausgeführt worden sei. Sowohl jener Vorwurf, als diese Antwort gründen sich auf die populäre Vorstellung, die ich eben geprüft habe; es ist daher unnötig, mehr darüber zu sagen. Wegen der jährlichen Silberausfuhr nach Ostindien ist wahrscheinlich das Silbergeschirr in Europa etwas teurer, als es sonst sein würde, und das gemünzte Silber verschafft wahrscheinlich eine größere Menge Arbeit und Waren. Die erste dieser beiden Wirkungen ist ein sehr geringfügiger Verlust, die letztere ein sehr kleiner Vorteil; beide sind zu unbedeutend, um irgendwie von seiten des Staates Aufmerksamkeit zu verdienen. Dadurch dass der Handel nach Ostindien den europäischen Waren, oder, was so ziemlich dasselbe ist, dem mit diesen Waren gekauften Gold und Silber einen Markt eröffnet, muss er notwendig die jährliche Produktion europäischer Waren, und folglich den wahren Reichtum und das wahre Einkommen Europas vermehren. Dass er es bis heute so wenig getan hat, ist wahrscheinlich den Einschränkungen zu danken, mit denen er überall zu kämpfen hat.
Ich hielt es selbst auf die Gefahr hin, ermüdend zu werden, für nötig, die populäre Vorstellung, dass der Reichtum in Geld oder in Gold und Silber bestehe, ausführlich zu untersuchen. Geld bedeutet, wie bereits bemerkt, nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch oft soviel wie Reichtum, und diese Zweideutigkeit des Ausdrucks hat uns jene volkstümliche Vorstellung so geläufig gemacht, dass selbst diejenigen, welche von ihrer Ungereimtheit überzeugt sind, sehr leicht ihre Grundsätze vergessen und sie im Verlauf ihres Räsonnements als eine ausgemachte und unleugbare Wahrheit annehmen. Einige der besten englischen Schriftsteller über den Handel fangen mit der Bemerkung an, dass der Reichtum eines Landes nicht bloß in seinem Gold und Silber, sondern auch in seinen Ländereien, Häusern und verbrauchbaren Waren aller Art bestehe. Im Laufe ihrer Darlegungen scheinen aber die Ländereien, Häuser und Waren ihrem Gedächtnisse zu entschwinden, und die Kraft ihrer Gründe beruht oft auf der Voraussetzung, dass aller Reichtum in Gold und Silber bestehe, und dass sie zu vermehren die große Aufgabe der nationalen Industrie und des Handels sei.
Die beiden Grundsätze einmal aufgestellt, dass der Reichtum in Gold und Silber bestehe, und dass diese Metalle in ein Land, das keine Bergwerke habe, nur mittelst der Handelsbilanz oder mittelst einer die Einfuhr überwiegenden Ausfuhr gebracht werden können, — wurde es notwendig die Hauptaufgabe der politischen Ökonomie, die Hinfuhr fremder Waren zum inneren Verbrauch möglichst zu vermindern, und die Ausfuhr der Erzeugnisse einheimischen Fleißes möglichst zu vermehren. Die beiden großen Hebel, das Land zu bereichern, waren daher Beschränkungen der Einfuhr und Ermunterungen der Ausfuhr.
Die Einfuhrbeschränkungen waren doppelter Art: Erstens Beschränkungen der Einfuhr solcher zum inneren Verbrauch bestimmter fremder Waren, die im Lande selbst erzeugt werden konnten: gleichviel aus welchem Lande sie kamen. Zweitens, Beschränkungen der Einfuhr fast aller Arten von Waren aus Ländern, denen gegen-über eine nachteilige Handelsbilanz vorausgesetzt wurde. Diese Beschränkungen bestanden bald in hohen Zöllen und bald in gänzlichen Verboten.
Die Ausfuhr wurde bald durch Rückzölle, bald durch Prämien, bald durch vorteilhafte Handelsverträge mit fremden Staaten und bald durch Begründung von Kolonien in entfernten Ländern begünstigt.
Rückzölle gab man in zweierlei Fällen. Wenn die heimischen Fabrikate einem Zoll oder einer Akzise unterworfen waren, wurde bei der Ausfuhr oft das Ganze oder ein Teil davon zurückgegeben; und wenn ausländische einem Zoll unterworfene Waren eingeführt wurden, um wieder ausgeführt zu werden, wurde bei der Ausfuhr entweder der ganze Zoll, oder ein Teil davon zurückerstattet.
Ausfuhrprämien gab man zur Ermunterung mancher erst beginnender oder solcher Industrien, denen man eine besondere Begünstigung glaubte angedeihen lassen zu müssen.
Durch vorteilhafte Handelsverträge verschaffte man den Waren und Kaufleuten des eignen Landes in fremden Staaten gewisse Vorrechte vor den Waren und Kaufleuten anderer Staaten.
Durch die Begründung von Kolonien in entfernten Ländern wurden den Waren und Kaufleuten des die Kolonie gründenden Landes nicht nur besondere Vorrechte, sondern oft auch ein Monopol erteilt.
Die beiden oben erwähnten Einfuhrbeschränkungen zusammen mit diesen vier Ausfuhrbegünstigungen bilden die sechs Hauptmittel, durch die das Handelssystem die Menge des Goldes und Silbers in einem Lande zu vermehren gedenkt, indem es die Handelsbilanz zu seinen Gunsten wendet. Ich werde jedes dieser Mittel in einem besonderen Kapitel erörtern, und ohne auf ihre angebliche Wirkung, Geld ins Land, zu bringen, weiter Rücksicht zu nehmen, hauptsächlich untersuchen, welchen Einfluss ein jedes auf das jährliche Produkt seines Fleißes haben muss. Je nachdem sie dazu dienen, den Wert dieses Jahresprodukts zu vermehren oder zu vermindern, müssen sie offenbar den wahren Reichtum und das Einkommen des Landes vermehren oder vermindern.
ZWEITES KAPITEL Beschränkungen der Einfuhr ausländischer Waren, die im Lande selbst hervorgebracht werden können
Schränkt man die Einfuhr solcher Waren, die im Lande selbst hervorgebracht werden können, entweder durch hohe Zölle ein oder verhindert sie durch gänzliche Verbote, so wird dadurch der einheimischen mit ihrer Erzeugung beschäftigten Industrie mehr oder weniger das Monopol auf dem inländischen Markte gesichert. So sichert das Verbot, Vieh oder gesalzenes Fleisch aus fremden Ländern einzuführen, den britischen Viehzüchtern das Monopol auf dem inländischen Fleischmarkte. Die hohen Getreidezölle, die in Zeiten mäßiger Ernten prohibitiv wirken, verschaffen den Getreideproduzenten einen gleichen Vorteil. Das Verbot der Einfuhr fremder Wollwaren begünstigt ebenso die Wollwarenfabrikanten. Die Seidenindustrie hat neuerdings, obwohl sie nur ausländische Materialien verarbeitet, denselben Vorteil erhalten. Die Leinenindustrie hat ihn zwar noch nicht, ist aber auf dem besten Wege dazu. Ebenso haben auch manche andere Industrielle ganze oder partielle Monopole gegen ihre Landsleute erlangt. Die Menge der Waren, deren Einfuhr in Großbritannien ganz oder teilweise verboten ist, ist viel größer, als man sich in der Regel denkt, wenn man mit den Zollgesetzen nicht vertraut ist.
Dass dieses Monopol des inländischen Marktes die Industriezweige, denen es zuteil wird, oft sehr fördert und ihnen einen größeren Teil der Arbeitskräfte und des Kapitals zuwendet, als es sonst der Fall gewesen sein würde, unterliegt keinem Zweifel. Ob es aber den allgemeinen Gewerbefleiß des Volkes vermehrt oder ihm die vorteilhafteste Richtung gibt, ist wohl nicht ganz ebenso ausgemacht.
Der allgemeine Gewerbefleiß des Volkes kann niemals die Grenzen überschreiten, die ihm das Nationalkapital setzt. Wie die Zahl der Arbeiter, die ein Privatmann beschäftigen kann, in bestimmtem Verhältnis zu seinem Kapital stehen muss, so muss auch die Zahl derjenigen, die von sämtlichen Gliedern eines großen Volks fortwährend beschäftigt werden, im Verhältnis zum Gesamtkapital dieses Volkes stehen, und kann dieses Verhältnis niemals überschreiten. Keine Handelsregelungen können den Gewerbefleiß eines Volkes höher entwickeln, als sein Kapital es erlaubt. Sie können nur einen Teil von ihm in eine Richtung lenken, die er sonst nicht genommen haben würde, und es ist keineswegs sicher, dass diese künstliche Richtung für das Volk vorteilhafter sei, als die, welche er von selbst genommen haben würde.
Jeder einzelne ist stets darauf bedacht, die vorteilhafteste Anlage für das Kapital, über das er zu gebieten hat, ausfindig zu machen. Er hat allerdings nur seinen eignen Vorteil und nicht den des Volkes im Auge; aber gerade die Bedachtnahme auf seinen eignen Vorteil führt ganz von selbst dazu, dass er diejenige Anlage bevorzugt, welche zugleich für die Gesellschaft die vorteilhafteste ist.
Erstens sucht jeder sein Kapital möglichst bei seinem Wohnsitz, und folglich möglichst im heimischen Gewerbefleiß anzulegen, falls er dabei den üblichen Kapitalgewinn oder doch nicht viel weniger zu erzielen vermag.
So zieht jeder Großhändler bei gleichem oder annähernd gleichem Gewinn den inneren dem auswärtigen Handel, und wiederum den auswärtigen Handel zum Konsum dem Zwischenhandel vor. Im Binnenhandel kommt ihm sein Kapital niemals so weit aus dem Gesicht, wie gewöhnlich bei dem auswärtigen. Er wird den Charakter und die Lage der Leute, denen er Kredit gibt, besser kennenlernen, und wenn er getäuscht werden sollte, so kennt er die Landesgesetze besser, die Abhilfe schaffen können. Im Zwischenhandel ist das Kapital des Kaufmanns sozusagen auf zwei fremde Länder verteilt, und kein Teil kehrt notwendig unter seine unmittelbare Aufsicht und Verfügung zurück. Das Kapital, das ein Amsterdamer Kaufmann verwendet, um Getreide von Königsberg nach Lissabon und Früchte und Wein von Lissabon nach Königsberg zu schaffen, ist in der Regel zur Hälfte in Königsberg und zur Hälfte in Lissabon und braucht niemals nach Amsterdam zu kommen. Der natürliche Wohnsitz eines solchen Kaufmanns müsste Königsberg oder Lissabon sein, und nur ganz besondere Umstände können ihn bestimmen, den Aufenthalt in Amsterdam vorzuziehen. Das Unbehagen, von seinem Kapital so weit getrennt zu sein, bestimmt ihn aber gewöhnlich, einen Teil der Königsberger Waren, die für den Lissaboner Markt, und einen Teil der Lissaboner Waren, die für Königsberg bestimmt waren, nach Amsterdam kommen zu lassen; und obwohl er sich dadurch den doppelten Kosten des Ein- und Ausladens, sowie der Bezahlung einiger Abgaben und Zölle unterwirft, so lässt er sich doch diesen Übelstand gern gefallen, um nur einen Teil seines Kapitals immer unter seiner Aufsicht und zur Verfügung zu haben; und so kommt es, dass jedes Land, das bedeutenden Zwischenhandel treibt, stets das Emporium oder der Hauptmarkt für die Waren all der Länder wird, deren Handel es betreibt. Der Kaufmann sucht stets, um ein zweites Ein- und Ausladen zu ersparen, möglichst viele Waren dieser Länder auf dem heimischen Markte zu verkaufen und dadurch, soviel an ihm liegt, den Zwischenhandel in einen auswärtigen Handel zu verwandeln. Ebenso wird ein Kaufmann, der auswärtigen Handel treibt, immer froh sein, möglichst viel der für auswärtige Märkte aufgehäuften Waren mit gleichem oder annähernd gleichem Gewinn im Lande selbst verkaufen zu können. Durch tunlichste Verwandlung des auswärtigen Handels in einen Binnenhandel erspart er sich die Gefahr und Mühe der Ausfuhr. Die Heimat ist auf diese Weise sozusagen der Mittelpunkt, um welchen die Kapitalien der Einwohner fortwährend umlaufen und nach welchem sie beständig streben, obgleich sie manchmal durch besondere Ursachen abgestoßen und nach entfernteren Anlagen . hingetrieben werden können. Ein im Binnenhandel angelegtes Kapital setzt aber, wie bereits gezeigt wurde, notwendig eine größere Menge heimischen Fleißes in Bewegung und schafft einer größeren Anzahl von Einwohnern Einkommen und Beschäftigung, als ein gleich großes Kapital, das im ,auswärtigen Handel angelegt ist, und ein in dem auswärtigen Handel angelegtes hat den gleichen Vorzug vor einem ebenso großen im Zwischenhandel angelegten Kapital. Bei gleichem oder auch nur annähernd gleichem Gewinn ist mithin jeder von selbst geneigt, sein Kapital in der Weise anzulegen, wie es dem heimischen Fleiße wahrscheinlich die meiste Unterstützung gewährt und der größten Anzahl von Menschen in seinem Lande Einkommen und Beschäftigung verschafft.
Zweitens sucht jeder, der sein Kapital zur Unterstützung des heimischen Gewerbefleißes verwendet, diesen Gewerbefleiß natürlich so zu lenken, dass der Ertrag einen möglichst großen Wert darstellt.
Der Ertrag des Gewerbefleißes besteht in dem, was er dem zu bearbeitenden Gegenstande oder Stoffe an Wert zusetzt. Je nachdem dieser Ertrag groß oder gering ist, sind es auch die Gewinne des Kapitalisten. Kapitalien werden aber nur des Gewinns halber auf die Gewerbe verwendet, und man wird sie daher stets demjenigen Gewerbe zuzuwenden suchen, deren Produkte den größten Wert hoffen lassen, d. h. die größte Menge Geldes oder anderer Waren einzutauschen versprechen.
Nun ist das Jahreseinkommen jedes Volkes immer gerade so groß, wie der Tauschwert der gesamten Jahresergebnisse seines Fleißes oder vielmehr das Einkommen ist nichts anderes, als dieser Tauschwert selber. Da aber jeder sein Kapital möglichst zur Unterstützung des inländischen Gewerbefleißes zu verwenden und diesen Gewerbefleiß so zu leiten sucht, dass sein Produkt den größten Wert erhält, so arbeitet auch jeder notwendig dahin, das Jahreseinkommen des Volks so 'groß zu machen, als er kann. Allerdings beabsichtigt er in der Regel weder, das allgemeine Wohl zu fördern, noch weiß er, in welchem Maß er es befördert. Wenn er dem heimischen Gewerbefleiß vor dem fremden den Vorzug gibt, so hat er nur seine eigene Sicherheit vor Augen, und wenn er diesen Gewerbefleiß so lenkt, dass sein Produkt den größten Wert erhält, so bezweckt er lediglich seinen eignen Gewinn und wird in diesem wie in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, einen Zweck zu befördern, der ihm keineswegs vorschwebte. Das Volk hat davon keinen Schaden, dass jenes seine Absicht nicht war. Oft fördert er durch die Verfolgung seines eignen Interesses das der Gesellschaft weit wirksamer, als wenn er es zu befördern wirklich beabsichtigte. Ich habe niemals gesehen, dass Leute, die zum allgemeinen Besten Handel zu treiben vorgaben, viel Gutes ausgerichtet hätten. In der Tat geben es die Kaufleute auch nur selten vor und es bedarf nur weniger Worte, es ihnen auszureden.
Auf welche Gattungen des heimischen Gewerbefleißes jemand sein Kapital verwenden soll, und bei welcher das Produkt den größten Wert verspricht, kann offenbar jeder einzelne nach seinen örtlichen Verhältnissen weit besser beurteilen, als es ein Staatsmann oder Gesetzgeber für ihn tun könnte. Der Staatsmann, der sich versucht fühlte, Privatleuten Anleitung zu geben, wie sie ihre Kapitalien anlegen sollen, würde sich nicht allein eine höchst unnötige Fürsorge aufladen, sondern sich eine Autorität anmaßen, die nicht einmal einem Ministerium oder einem Senat, geschweige denn einem einzelnen Manne getrost überlassen werden könnte, und die nirgends so gefährlich sein würde, als in der Hand eines Mannes, der töricht und dünkelhaft genug wäre, sich dazu fähig zu erachten.