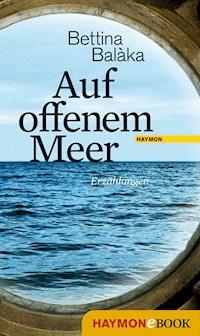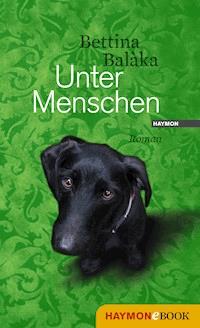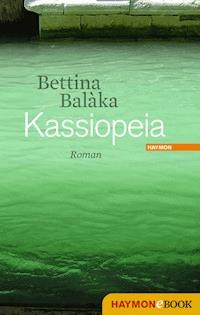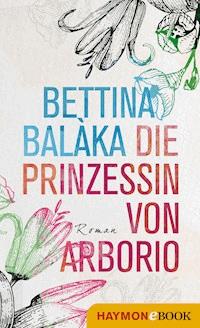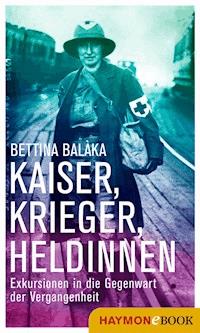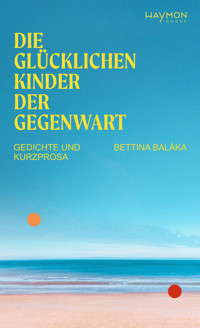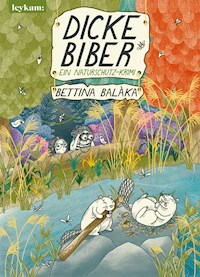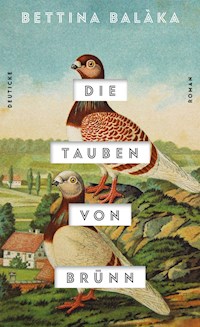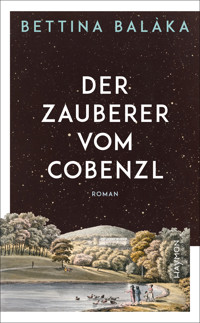
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Zwei Frauen, eine spricht die Sprache der Musik, die andere die der Wissenschaft. Reichenbach zwischen Aufstieg und Fall: ein Imperium erbaut auf Licht, der Mann, dem es gehört, gestrickt aus Hunger. Es ist das Jahr 1844 und in Carl Ludwig Freiherr von Reichenbach brennt der Wissensdrang so nah an der Oberfläche wie Kometen kurz vor dem Einschlag. Er sucht unerbittlich nach der Bestätigung seiner These: der Existenz von "Od". Jene wie ein Feuerschein aus allen Dingen und Lebewesen strömende Kraft, die zu sehen nur wenigen vergönnt ist. Reichenbach ist ein Emporkömmling der ersten Klasse, klammert an der Leiter, die Ruhm verspricht. Adelstitel, Renommee und Schloss hat er sich hart erarbeitet. Von Rückschlägen geprägt, ist er es gewohnt, dass die Gerüste seiner Existenz stets zu bröckeln drohen. Von Stuttgart und Tübingen über Blansko in Mähren hat das Schicksal ihn und seine zwei Töchter Hermine und Ottone nach Wien, zum Schloss Cobenzl, verschlagen. Dort ist Reichenbach dem "Od" auf der Spur, unterstützt durch Hermine, die sich wie der Vater der Forschung verschrieben hat. Experimente mit "Sensitiven" sollen beweisen, was Reichenbach bereits weiß. Welche Möglichkeiten hat man als Frau des 19. Jahrhunderts wirklich? Es sind die Zeiten, die Hermine und Ottone im Wege stehen, aber auch neue Wege für sie aufschlagen denn die Revolution rüttelt nicht nur Europa wach – sondern auch die Töchter Reichenbachs. Sie stehen dem Patriarchen entgegen: beide voller Wut und Ambitionen, beide verliebt in Männer, die ihnen nahestehen und doch ferngehalten werden. Beide über zwanzig und unverheiratet. Und dennoch: jedes einzelne "Nein", jede Ablehnung, den Wünschen und Bedürfnissen der Töchter Raum zu geben, jede Missachtung und Missbilligung des Vaters hallt tief bis in die Knochen. Und errichtet gleichzeitig ein Schloss, das nicht von Mauern und Zauber aufrecht gehalten wird, sondern durch Säulen aus Resilienz und Widerstand. Wer wird die erste sein, die ausbricht? Bettina Balàka spielt mit allen Arten von Feuer Beim Zauberer am Cobenzl spitzt sich die Lage immer weiter zu. Wird er die ewigen Zweifler überzeugen können? Wird er seine Töchter, die sich nicht mehr dem neigen, was der Vater sich wünscht, versöhnlich stimmen? Wird ihm der Aufstieg ein letztes Mal gelingen? Ist das "Od" – dem er so gänzlich verfallen scheint – sein Untergang? Oder sind es seine Töchter? Mit "Der Zauberer vom Cobenzl" schnürt Bettina Balàka eine Geschichte aus Magie und Wissenschaft, Feuer und Forschung und der Befreiung einer Frau, die ihrem Vater in nichts nachsteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Ähnliche
Bettina Balàka
Der Zauberer vom Cobenzl Roman
Roman
Inhaltsverzeichnis
Od
Baba Jaga
Kerf
Kreosot
Mimese
Kamacit
Lurch
Otaheiti
Isis
Stärke
Revolution
Frau
Eisenbahn
Über die Autorin
Impressum
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
„Es schien, als lebte jedes Blatt und jeder Grashalm sein eigenes, volles und glückliches Leben.“
Leo N. Tolstoi
Od, das. Substantiv, Neutrum:
Alles in der gesamten Natur durchdringendes Dynamid.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1844 zogen wir hinaus zum Grinzinger Friedhof, um das Auftreten von Erscheinungen zu notieren.
„Hermine“, sagte Vater, „es wird so finster sein, dass wir nicht schreiben können. Du musst daher mein Aufzeichnungsapparat sein. Alles, was geschieht, alles, was du hörst, riechst, empfindest oder trotz der Allschwärze siehst, musst du dir einprägen, um es gleich nach unserer Rückkehr niederschreiben zu können.“
Eine halbe Stunde vor Mitternacht brachen wir auf. In seinem langen schwarzen Radmantel sah Vater selbst wie eine Erscheinung aus. Groß, hager, mit hoher Stirn und einem noch höheren Zylinder musste er von der Ferne unheimlich wirken. Zumindest war es das, was die Leute von ihm sagten, dass er ihnen nicht geheuer war, dass er womöglich mit finsteren Mächten im Bunde stand und dass man sich besser drei Mal bekreuzigte, wenn man am Schloss Cobenzl vorbeikam.
Ganz und gar nicht gespenstisch sah Fräulein Leopoldine Reichel aus, jene hochsensitive Person, die sich bereit erklärt hatte, Vater für seine Untersuchung zur Verfügung zu stehen, und die wir bis jetzt mit Kaffee und Konversation munter gehalten hatten. Fräulein Reichel, die Tochter eines Französischlehrers, war im Zuge einer schweren Erkrankung immer wieder von Katalepsien geplagt worden, die zu einer außerordentlich erhöhten Reizbarkeit führten. Die Krankheit legte sich zum Glück, die Sensitivität blieb. Dass sie besondere Fähigkeiten hatte, sah man der jungen Frau nicht an. Sie wirkte fröhlich und naiv und an ihren Toiletten fanden sich immer kleine Ungeschicklichkeiten.
Der Wagen wartete schon vor dem Schloss, und unsere Haushälterin Ida Zitterer – Fräulein Ida, wie wir sie nannten – geleitete uns zu ihm, um sicherzustellen, dass wir gut in die pelzgefütterten Fußsäcke verstaut wurden.
„Viel, viel Glück“, sagte sie.
„Sie brauchen keine Angst um uns zu haben, meine Gute“, erwiderte Vater.
„Gehörte Ängstlichkeit zu meinen Eigenschaften, Herr Baron, wäre ich für dieses Haus gänzlich ungeeignet“, gab sie zurück.
Der Kutscher schnalzte mit der Peitsche, die beiden Bediensteten sprangen hinten hinauf. Sie hielten Fackeln in den Händen, auf beiden Seiten des Kutschbocks brannten Laternen. In dieser mondlosen und bewölkten Nacht bot unser Gefährt einen flammenden Anblick. Die Pferde schnaubten, ihre Hufe fielen dumpf auf den Kies, die Räder knirschten. Fräulein Reichel seufzte und kicherte abwechselnd vor Aufregung. Vater, der neben ihr saß, war über die Maßen gut gelaunt und ließ seine Stimme erdröhnen: „Vergessen Sie nicht, Fräulein Reichel: Fassen Sie alles in Worte, was Ihnen geschieht, was Sie wahrnehmen, was Ihnen durch den Kopf geht. Wollen Sie nach links gehen, sagen Sie: Ich werde jetzt nach links gehen. Führen Sie laut Protokoll, damit Hermine und ich – wie heißt es doch so schön! – nicht im Dunkeln gelassen werden!“
Mir war ein wenig übel, aber das lag wohl daran, dass ich den beiden gegenüber und damit gegen die Fahrtrichtung saß, was mir vor allem beim Bergabsausen auf den Magen schlug. Ich hatte das Gefühl, mit dem Rücken voran in die Tiefe zu fallen.
Zum Glück war die Fahrt nicht weit, Vater hatte für sein Experiment jenen Friedhof ausgewählt, der Schloss Cobenzl am nächsten lag und überdies den Vorteil bot, eine große Zahl an frischen und frischesten Gräbern aufzuweisen. Seiner Theorie zufolge, für die es den Beweis zu erbringen galt, waren die Erscheinungen nämlich auf diesen am deutlichsten zu sehen, da sie mit der Zeit gewissermaßen verdampften. Nach etlichen Jahren war das Odlicht aus den Gräbern vermutlich ausgeraucht wie Parfum aus einem offenen Flakon.
Der Grinzinger Friedhof war damals noch nicht alt, erst vierzehn Jahre zuvor war er geweiht worden. 1829 hatte der Leinwandhändler Franz Huschka Ritter von Raschitzburg das Grundstück gestiftet, im Jänner darauf war er schon tot und fand seine Grabstätte dort, wo er so vorsorglich für die Verstorbenen Platz geschaffen hatte. Die Leute meinten, dass er den Todesfluch auf sich geladen hatte, als er den Grund den Feen und Elfen entzogen und durch die christliche Weihe für sie unbewohnbar gemacht hatte. Vater hingegen sagte, der Leinwandhändler sei wohl schon sehr krank gewesen, als er sich entschloss, den Ort zu seiner letzten Ruhestätte zu bestimmen und dies mit einem großzügigen Geschenk an das Dorf Grinzing zu verbinden. Ich hatte sein Grabmal gesehen, es war aus poliertem grauem Stein, trug eine goldene Inschrift und war gekrönt von einem Relief mit einem hingesunkenen Engel darauf. Ob ich es nun, im Finstern, tastend wiedererkennen würde?
Das letzte Stück mussten wir zu Fuß gehen. Der Wagen hielt in einem kleinen Wäldchen, von dem der Weg die Anhöhe zum Friedhof hinaufführte, sodass nach Vaters Plan die Laternen- und Fackellichter hinter der Hügelkuppe und unter den Baumkronen verschwinden mussten. Er sollte recht behalten. Nachdem wir eine Weile gegangen waren, war kein Schein mehr zu sehen. Leichter Schnee fiel und sammelte sich schimmernd am Wegrand, in der kalten Luft ging es mir schnell besser und ich steckte meine Hände tief in den Muff. Es war ein Bärenfellmuff, angeblich von dem letzten Bären, der in den Wäldern um Blansko gelebt hatte. Blansko in Mähren, wo auch wir gelebt hatten, bevor Vater dort nicht mehr willkommen war und wir hierher in die Nähe von Wien ziehen mussten.
Mit großen Schritten ging Vater voran, hinter ihm trippelte Fräulein Reichel mit hochgerafften Röcken und ihr heller Mantel bot meinem Auge Halt, denn ich bildete den Abschluss, um zu verhindern, dass sie, die Wichtigste, uns abhandenkam. Obwohl wir Frauen deutlich jünger waren als Vater, gerieten wir schnell außer Atem, denn mit einem vom Forscherdrang Getriebenen Schritt zu halten war bildlich wie wörtlich nicht leicht.
„Wenn wir bis Sonnenaufgang nicht zurück sind, sucht nach uns!“, hatte er zu dem Kutscher gesagt und ihm in das erschrockene Gesicht gelacht. „Keine Sorge, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir alle drei in eine frisch ausgehobene Grube fallen – die Toten fressen uns schon nicht!“
Bald hatten wir das Friedhofstor erreicht, das unversperrt war, so wie Vater es angeordnet hatte. Mir schien es, als ob es innerhalb der Mauern dieses Totengartens noch stiller, kälter und finsterer war als draußen, aber das war wohl nur ein Gedankenschatten, der sich um mich schloss. Vater bot Fräulein Reichel und mir nun jeweils einen Arm, und uns aneinander festhaltend stiegen wir weiter hinauf.
Die Anhöhe, auf der der Grinzinger Friedhof lag, bot bei Tageslicht eine herrliche Rundumsicht. Gegen Norden hin lagen Weinberge, üppige Kuhweiden und die bewaldeten Kuppen des (ganz und gar nicht kahlen) Kahlengebirges, sogar ein kleines Eck unseres baumumrauschten Schlosses war zu sehen. Östlich davon leuchtete das weiße Kirchlein des Leopoldsberges, dessen felsige Flanke steil zur Donau abfiel. Im Süden, in der Ebene, versammelten sich Dörfer und verdichteten sich zu Vororten und Vorstädten um Wien. In diese Richtung deutete nun Vater und erklärte: „Nicht finster genug für meinen Geschmack!“
Die Stadt innerhalb der Basteien glitzerte wie ein Diamant in seiner Fassung. Manche der kleinen Lichter hatten einen Puls wie Sterne, andere bewegten sich wie Kometen. Da waren noch Gesellschaften im Gange, Bälle, Redouten, man vergnügte sich nach dem Theater oder der Oper, nahm ein Mitternachtssouper ein, fuhr mit dem Wagen von einer Lustbarkeit zur anderen. In den Vorstädten war es schon dünkler, in den Vororten jenseits des Linienwalles schlief man zumeist. Vielleicht wachte irgendwo eine Mutter bei ihrem kranken Kind.
„Da!“, flüsterte Fräulein Reichel plötzlich und deutete in die Schwärze vor uns. „Lichter! Rötliche Flammen! Ich glaube, sie bewegen sich. Oder doch nicht?“
„Ich habe Ihnen doch gesagt, meine Liebe, dass Sie nicht zu flüstern brauchen!“, rief Vater. „Wir haben es hier nicht mit scheuen Waldtieren zu tun, die von unseren Stimmen vertrieben werden könnten. Gehen Sie nur hin! Das könnte das Grab der Frau Plaha sein, der Schmalzhändlersgattin, die im Kindbett gestorben ist – sie ist erst vorgestern unter die Erde gekommen.“
Fräulein Reichel streckte die Handflächen vor sich aus und stolperte ins Dunkel hinein. Ich sah nichts. Keine Lichter, keine rötlichen Flammen. Aber das war auch nicht zu erwarten, denn genauso wie Vater war ich nicht einmal niedrigsensitiv. Wir waren auf das angewiesen, was Fräulein Reichel uns erzählte. Sie sah wie eine Schlafwandlerin aus, was sie wohl auch war. Von ihrer schweren Krankheit war sie sehend und somnambul zurückgeblieben.
„Hier sind sie“, sagte Fräulein Reichel. „Ich stehe jetzt direkt vor ihnen. Wunderschön. Sie bewegen sich tatsächlich. Sie sehen aus wie Tänzer. Oder Soldaten. Sie schwanken und schreiten, alles synchron.“
„Nein nein, es sind keine Geister, sie bewegen sich nicht aus eigenem Antrieb. Es ist der Wind, der mit ihnen spielt“, sagte Vater.
„Ich weiß, keine Geister …“ Ihre Stimme klang merkwürdig, als wäre sie in Trance. „Jetzt zerfließen sie zu einem Dunst und – oh, da drüben sind auch welche!“
Wir stolperten weiter. Die unsichtbaren Feuermassen emanierten aus den Gräbern, tanzten, krochen, exerzierten, zerwehten. Ich prägte mir alles ein, was Fräulein Reichel sagte. Um es mir besser merken zu können, stellte ich es mir bildlich vor. In einem gewissen Sinne sah daher auch ich den Feuerdunst, der manchmal flammenartig wurde, klein wie ein Kobold am Boden oder groß wie ein Mensch. Und genau wie Vater es verlangt hatte und wie es auch mir selbst am besten gefiel, verhielt ich mich wie ein Apparat: Ich notierte in Gedanken, ohne einen Standpunkt zu beziehen.
Von Grab zu Grab gingen wir und Vater, der sich die Anlage bei Tag gut eingeprägt hatte, wusste, wem jedes einzelne gehörte.
„Hier muss die Rosa Matschek liegen, die Vergoldertochter, die letzten Winter das Fieber hinweggerafft hat – sehen Sie hier etwas, Fräulein Reichel? Fast ein Jahr ist das Grab alt.“ „Hier ruhen Seine Exzellenz, der Freiherr von Treumuth – ja, da ist ein ganz hoher Stein mit Giebel, das muss es sein …“ Er stellte Fragen über Fragen: „Wie hoch sind die Flammen? Wie breit? Wie dicht? Wie viele? Das Licht hier – würden Sie es mehr als Nebel oder als Dunst beschreiben? Spüren Sie etwas? Kälte? Lauwärme? Hitze? Finden Sie Worte, meine Liebe, denken Sie nach!“
Plötzlich ertönte ein gellender, lang gezogener Schrei. Er war so laut in dieser stillen Nacht, dass ich dachte, unsere Leute, die beim Wagen warteten, müssten ihn gehört haben und sich sogleich auf die Suche nach uns machen. Fräulein Reichel war gestolpert und auf einen frischen Grabhügel gefallen. Sie wimmerte, als wäre sie in eine Jauchegrube gestürzt. Ließ sich von Vater aufhelfen und klopfte sich immer wieder ab.
„Ich bin mitten in die Geister hineingefallen! Es sind doch Geister, sie leben, sie reagieren auf mich – Herr Baron! Bitte lassen Sie uns nach Hause gehen. Es ist zu furchtbar!“
„Natürlich reagieren die Odlichter auf Sie“, sagte Vater beruhigend. „Sie verursachen Luftströmungen mit Ihren Bewegungen, es ist ganz so, wie eine normale Kerzenflamme sich neigt, wenn Sie schnell mit der Hand darüber hinstreichen.“
Schluchzend schüttelte Fräulein Reichel ihren Kopf und ihre Röcke, aus denen sie die vermeintlichen Geister wohl wie Flöhe zu beuteln hoffte.
„Sehen Sie hin!“, rief Vater. „Genau an die Stelle, wo Sie hingefallen sind – was ist dort jetzt?“
„Die feurigen Wächter stehen da wie zuvor.“
„Also! Feurige Wächter! Geister könnten sich doch wohl wegbewegen von ihren Gräbern, nicht wahr? Sie könnten herumfliegen, wandern, mit uns gehen? Aber dieses Licht steht immer nur über den Gräbern, weil es von ihnen verdunstet! Es ist das Ergebnis der Putrefaktion, hunderte Male habe ich Ihnen das erklärt …“
„Aber hier am Friedhof ist es doch etwas anderes …“ „Hier am Friedhof sind es kohlensaures Ammoniak, Phosphorwasserstoff und andere Verwesungsprodukte, die im Zuge eines chemischen Prozesses Odlicht entwickeln. Da hinten, was sehen Sie dort?“
„Nichts.“
„Dort sind die ältesten Gräber. Alle mindestens zehn Jahre alt. Dort ist die Fäulnis schon beendet, der Gärungsprozess abgeschlossen, die Phosphoreszenz erloschen. Alles verdampft. Sehen Sie?“
„Ich will Ihnen ja glauben, Herr Baron, aber es fühlte sich doch so schrecklich an, in das Odlicht hineinzufallen! Als könnte es in mich eindringen und etwas Schlimmes anrichten.“
Vom Friedhofstor her erklangen Rufe. Man hatte tatsächlich Fräulein Reichels Schrei beim Wagen gehört und die beiden Diener mit den Fackeln waren losgegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie uns erreicht und wir sie hinsichtlich unserer Unversehrtheit beruhigt hatten, nahm Vater einem von ihnen die Fackel aus der Hand. Er wollte nachprüfen, ob er mit der Bestimmung der Gräber Recht gehabt hatte. „Korrekt!“, hörte man ihn jubeln. „Der Professor Seidenglanz – in der Tat!“
Ich legte einen Arm um Fräulein Reichel, sie zitterte. Ich gab ihr meinen Muff. „Es ist nur das Odlicht“, sagte ich, „Sie haben es doch schon oft gesehen.“
„Ja, aber an Kristallen und Magneten“, erwiderte sie, „nicht auf Gräbern.“
„Es ist dasselbe Licht. Nichts Besonderes. Eine natürliche Reaktion.“
„Die Lebensfackeln der Menschen werden niedergetaucht, doch ehe sie ganz erlöschen, strömt aus ihrem materiellen Leib noch eine Weile die Geisterfackel heraus.“ So hatte es Vater vor unserer Abfahrt erklärt, und das war vielleicht doch zu blumig gewesen. Im fantastischen Rausch der Erkenntnis vergaß er manchmal darauf, dass ein Wort wie „Phosphorwasserstoff“ dem Zuhörer mehr Sicherheit gab als eine „Geisterfackel“, auch wenn es genau dasselbe beschrieb. So geschah es ihm, dass er das Natürliche vermeintlich in die Nähe des Übernatürlichen schob, obwohl ihm nichts ferner lag als das. Mit den Tischerückern und Astralleibbeschwörern und Séancenabhaltern der Gegenwart hatte er nichts gemein. Er war ein Mann des Fortschritts, nicht der Moden.
In jener Nacht war er glücklich. Die Exkursion war ein voller Erfolg – hohe Odlichtaktivität auf den frischen Gräbern, graduell weniger auf den älteren bis zu ihrem völligen Verschwinden auf den ganz alten. Wie er es vorhergesagt hatte. Wie es aus wissenschaftlicher Sicht zu erwarten gewesen war.
Im Schloss erwartete uns schon Fräulein Ida mit heißem Tee und Likör und bald gewann Fräulein Reichel ihr robustes Aussehen zurück. Mit zunehmender Beruhigung wuchs ihr Stolz darauf, an einer so bedeutenden Untersuchung mitgewirkt zu haben, und sie entschuldigte sich für ihren Anfall von Aberglauben. Ammenmärchen säßen tief, meinte sie.
Nachdem sie zu Bett gegangen war, setzte ich mich hin und schrieb alles auf: Länge, Breite, Farben, Intensität und Bewegungsmuster der Flammen, Lichtnebel und Feuermassen, die Namen der Toten, deren Körper vergoren, ihre Geburts- und Todesjahre.
Ich war Vaters Stütze in all seinen Unternehmungen. Im Alter von fünfundzwanzig Jahren war ich noch unverheiratet, die vielfältigen Verpflichtungen als seine Assistentin und meine eigenen Forschungen in der Pflanzenphysiologie hatten zu viel Zeit in Anspruch genommen, um auf den Debütantinnenbällen erfolgreich meine Netze auszuwerfen. Auch fehlte wohl die Mutter, die sich um solche Dinge kümmerte. Sie war gestorben, als ich gerade sechzehn Jahre alt gewesen war. Nein, da hatte ich kein Herz für galante Soiréen gehabt, die Trauer war zu groß gewesen und gemeinsam mit Vater hatte ich mich in die Arbeit gestürzt. Zumindest war es das, was alle Welt dachte, ich unterstützte diese Fantasie und bewahrte meine Geheimnisse.
Vater hat nie wieder geheiratet, ob aus Liebe zu Mutter oder zu seiner Arbeit, weiß ich nicht.
Auch meine Schwester Ottone, drei Jahre jünger als ich, war noch unverheiratet und lebte mit uns im Schloss. Nach dem Abendessen hatte sie für uns Klavier gespielt und Fräulein Reichels gar nicht üblen Gesang begleitet. Als die Uhren elf schlugen, war sie zu Bett gegangen, es war ihre übliche Zeit. Zur Teilnahme an Vaters Experimenten war sie ohnehin gänzlich ungeeignet. Sie hasste und fürchtete die Dunkelheit und schlief mit mehr als nur einem Nachtlicht im Zimmer. Das Odlicht aber war selbst für die Höchstsensitiven nur bei absoluter Dunkelheit zu sehen. Ursprünglich hatte Vater vermutet, Ottones Abneigung gegen das Finstere wäre darin begründet, dass sie sensitiv wäre, dass sie aus Angst vor der verschiedentlich ausströmenden Odlohe die Dunkelheit mied. Doch sie bestritt das. Würde sie Odlicht sehen, sagte sie, hätte sie keinen Bedarf an Wachskerzen- und Öllampenlicht.
Nur unser Bruder Reinhold Limoleon, sieben Jahre älter als ich und zehn Jahre älter als Ottone, hatte geheiratet. Von Jugend an war er in Vaters Fußstapfen getreten, hatte in Berlin Chemie studiert und in den Eisenwerken in Blansko, als diese noch unter Vaters Leitung standen, als Hüttenchemiker gearbeitet. 1839 hatte er Antonia Isabella von Hauer, die Tochter des Hofvizekammerpräsidenten Ritter von Hauer, geheiratet. Es war ein großes Jahr, das Jahr vor der Vertreibung aus Blansko: Vater war vom König von Württemberg in den Freiherrenstand erhoben worden und auf der Pariser Weltausstellung hatte man die von ihm entwickelten Paraffinkerzen zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Mittlerweile lebte Reinhold mit seiner Gattin in Chur, wo er sich geologischen und ökonomischen Studien zugewandt hatte. Auch nach fünf Jahren war die Ehe noch kinderlos. „Od“ war eines der Wörter, die Vater erfunden hatte. Er hoffte, dass es weltberühmt und für alle Ewigkeit in Gebrauch sein würde, so wie das Paraffin, das ebenfalls von ihm entdeckt und benannt worden war. Der altgermanische Gott Odin hatte Pate gestanden, so wie auch die „Lohe“, also jene feurige Emanation, die das Od bisweilen aussandte, von der Waberlohe kam, aber weniger, weil Vater die Nibelungen so sehr liebte, als weil ihm alles Heidnische recht war, um die Pfaffen zu irritieren. Der Name „Odin“, erklärte er, leite sich ab von „Wodan“ und dies bedeute „das Alldurchdringende“, bezeichne somit in der Personifikation eine alldurchdringende Gottheit. „Wodan“ wiederum sei zurückzuverfolgen zu dem SanskritWort „Va“ für wehen, aushauchen, ausdünsten. So fand er über die Zeiten hinweg das Wort für die Quelle, die alles durchströmte. Denn das Od, so Vater, war nichts weniger als die Lebenskraft, die die materielle Welt durchdrang. Es war wie der Magnetismus polar, verbunden mit Links und Rechts, Bläue und Röte, Nordpol und Südpol, angenehmer Kühle und Lauwidrigkeit (auch eine von Vaters Wortschöpfungen), verwandt mit Wärme und Elektrizität, ein Dynamid wie diese und doch ganz eigen und unmessbar.
Wenn Körper verwesten, strömte das Od aus wie der Gestank, doch anders als die göttlich gedachte Seele hatte es keine Individualität und fuhr weder auf zu den Gerechten noch hinab zu den Sündern, sondern schloss sich wieder der allgemeinen Materie an, wie andere Stoffe auch. Das Berückende an Vaters These war: Er hatte eine vollkommen einleuchtende Erklärung für alle Geistergeschichten gefunden. Und nicht allein für die, die auf Friedhöfen spielten, denn das Odlicht war für die Sensitiven an vielen Dingen zu sehen.
Die Wiederholbarkeit des Experiments war Vater wichtig, und so gingen wir in den folgenden Wochen mit anderen Sensitiven zu anderen Friedhöfen. Er bereitete sie nun besser vor, verwendete von Anfang an Begriffe wie kohlensaures Ammoniak, Phosphoreszenz, Putrefaktion, Efferveszenz. Die Sensitiven fürchteten sich daher auch nicht vor den Erscheinungen, traten absichtlich in sie hinein und zerwehten sie mit der Hand. Die Ergebnisse der Untersuchung vom 9./10. November wurden bestätigt und präzisiert. Einmal gingen wir gar mit vier Sensitiven gleichzeitig los, sie waren sich in allen Beobachtungen einig, was für die Akkuratesse derselben sprach. Vater war überzeugt davon, mit jeglicher Spukgeschichte ein für alle Mal aufräumen zu können, sobald er die Ergebnisse veröffentlichte. Er konnte sie auf sicheren Boden stellen, ohne die Erfahrungen jener sprichwörtlichen Einzelpersonen („Ammen“ und „alte Weiber“), die Geister aus Gräbern schweben gesehen hatten, zu diskreditieren.
Doch wurden diese nächtlichen Friedhofsbesuche vollkommen missverstanden. Das Gemunkel und Geraune rund um Vater schwoll an, er, der einst hochgeachtete Freiherr Carl Ludwig von Reichenbach sank im Volksglauben selbst auf die Stufe der Spukseher hinab. Und auch mir juckte ein Floh im Ohr, den ein junger Mann beiläufig hineingesetzt hatte. Carl Schuh, ein aus München stammender Physiker, der sich mit Daguerreotypie befasste und gelegentlich bei uns zu Gast war, hatte einmal zu mir gesagt: „Was, wenn Ihr Herr Vater nur den einen Aberglauben durch einen anderen ersetzt?“
Baba Jaga, die. Substantiv, Eigenname:
Alte Hexe mit Eisenzähnen, die in einer auf Hühnerbeinen stehenden Hütte lebt.
Wenn sie verschwinden, bleiben sie in uns, und wenn sie bleiben, verändern sie sich: die geheimnisvollen Orte der Kindheit, die uns hinübergeleiten durch den Strom und Strudel des Aufwachsens, an die wir später nur mehr ganz selten denken und die uns doch verbunden haben mit der Welt. Orte, die wir mehr eingeatmet haben als gesehen, da an ihnen eine Luft wirkte, die Geborgenheit gab und das Gefühl, sie seien von wohlwollenden, heiteren Mächten beherrscht. Für manche ist es die Kinderstube mit ihren sonnenbeschienenen Dielen, oder das veilchenduftende Boudoir der Mama, oder die Küche, in der man sitzen und alles beobachten durfte und wo man von der Köchin heiße Schokolade bekam. Am häufigsten jedoch liegen diese Orte in der Natur.
Für meine kleine Schwester Ottone und mich war es eine wilde Wiese mit Pilzen, auf der heute eine Fabrikshalle steht.
In der Natur handelt es sich bei den guten Mächten hauptsächlich um Feen, für sehr religiös erzogene Kinder um Engel. Im Dunklen beginnen die Pilze zu leuchten, die Gesichter, die in den Baumknollen schlafen, wachen auf. Aus der Stille schält sich Gekicher, ein leiser Gesang. Das Allerkleinste wird groß, das Große winzig, das menschliche Maß ein Sonderfall.
Manchmal war auch unser Bruder Reinhold dabei und versuchte, uns mit Koboldgeschichten zu erschrecken, aber er war so viel älter als wir, er stand schon über den Dingen und ließ sich nicht auf sie ein.
Die Kavaliere der Feen sind versunkene Ritter, die Engel hingegen sind geschlechtslos und spielen mit Tieren. Die Libelle schrumpft und erklärt sich bereit, auf der Zwergenhochzeit einer Dame als Schmuck auf dem Hut zu dienen, doch schon vor der Agape wird es ihr langweilig, sie fliegt weiter und wird wieder größer dabei.
Für mich waren das Wichtigste die Ärmchen und Knötchen der Wiesenkräuter, für Ottone war es die Musik. Vielleicht war es ja sie selbst, die summte, vielleicht waren es wir beide, zweistimmig. Der alte Musikmeister Sykora hatte uns auf Harmonien getrimmt. Wir glitten auf den Tönen hin und her wie auf Eis, suchten, suchten, und plötzlich kamen wir in die richtige Spur, alles fiel ins Lot, es war, als würde Lavendelgefrorenes auf der Zunge zergehen.
Ich wusste, dass Ottone schwindelte. Dass sie ihre Stimme absichtlich zu einem Nachbarton hinüberschlittern ließ, um sie dann erst wieder genüsslich im Abstand von einer Terz oder Quint zu meiner zu festigen. Ihr absolutes Gehör war damals noch nicht entdeckt worden, man hielt sie, wie alle Kinder, für dumm. Wir waren nicht wie gewöhnliche Schwestern, sondern wie Zwillinge, verbunden in einem gemeinsamen Gedankenstrom, auch wenn wir uns später fremd wurden. Ottone wurde eine bewunderte Pianistin, irgendwann sah sie älter aus, als sie war, und älter als ich. Eine für Uneingeweihte kaum sichtbare Narbe auf ihrer Wange erinnerte mich stets daran, wie wir uns voneinander gelöst hatten.
Dass Menschen, die Musik lieben, bei allem Freiheitsdurst oft einen Hang zum Ordentlichen haben, liegt vielleicht auch an der Strenge der Strukturen, die den rauschhaften Melodien zugrunde liegen. Die schwarzen Locken der erwachsenen Ottone waren mit der Brennschere gekräuselt, ihre matronenhaften Kleider mit dem heißen Eisen geplättet, es war, als wäre sie durch die ständige Anwendung von Hitze zu etwas sehr Kaltem gefroren. Wie ein Gemälde saß sie da, die Ärmel würdig gebauscht, die Falten des Kleides malerisch geordnet, die Gesten, das Lächeln, das Neigen des Kopfes wohlabgemessen, ihre Form mit jeder Bewegung dem Auge gefällig wie die einer Katze. Wenn sie ging, tanzte, ritt, sprach, aß oder las, war sie die perfekte Dame, nur wenn sie am Klavier saß, geriet sie aus der Fassung, wurde eine andere, ein wildes, in seinen Plänen unbeirrbares Geschöpf. Im Spielen kam eine tiefe Leidenschaft aus ihr, eine Kenntnis der Ekstase. Diese musste wohl gebändigt werden in der Monotonie der Fingerübungen und der Rigidität des Tagesablaufs. Wer atemlose Spannung erzeugen kann, indem er einen winzigen Sekundenbruchteil zögert, bevor er den erwarteten Ton anschlägt, muss mit den Zeiteinteilungen vertraut sein wie ein Uhrwerk. Doch welcher wilde Geist tatsächlich in Ottone schlief wie eine Blumenzwiebel im gekämmten Beet, sollte uns alle noch zum Staunen bringen.
Der Grund, weshalb wir an jenem einsamen Ort spielen konnten, war der, dass unsere Kinderfrau Agathe dort einen geheimnisvollen Herrn traf, über den wir nichts wussten und der bis auf Grußworte auch kaum mit uns sprach. Sie ließ anspannen, denn: „Die Kinder müssen an die frische Luft!“ Durch das Städtchen Blansko hindurch fuhren wir hinunter zum Fluss Zwittawa. Eigentlich war auch der Fluss nur ein Flüsschen, wild, aber nicht reißend, kräftig, aber ungefährlich, überhangen von Blüten im Frühjahr und von Beeren im Herbst. Flussaufwärts ragten Kalkfelsen auf, die mein Kinderauge zu einer alten Burg ergänzte. An den vermeintlichen Ruinen glaubte ich die einstige Form exakt zu erkennen. Über eine rohe Holzbrücke, über die auch die Ziegen zum Grasen getrieben wurden, erreichten wir unsere Wiese.
Unter einer großen Eiche breitete Agathe die Picknickdecke aus und gab uns Kuchen, frische oder kandierte Früchte, Limonade oder süße Milch.
„Geht, Kinder“, sagte sie dann, „pflückt Blumen, fangt Schmetterlinge, erkundet die Natur!“ Und wir liefen davon. Wenn wir zwischendurch zur Decke zurückkamen, um uns zu stärken, lagerten Agathe und der Herr darauf, unterhielten sich mit viel Gelächter und tranken Wein. Immer spielten ihre Hände mit etwas, die Agathes mit den Bändern ihrer Schute, einer Locke, einem Ring oder Kirschenzwillingen, die des Herrn mit einem Grashalm, seinem Halstuch oder dem geschnitzten Elfenbeinknauf seines Spazierstockes, der den Kopf eines Ebers darstellte. Manchmal näherten sich seine Hände beiläufig denen Agathes, doch immer zog sie die ihren kurz vor einer Berührung zurück. Zumindest, wenn wir Kinder anwesend waren. Auf der Heimfahrt sagte sie manchmal, dass vielleicht bald eine Hochzeit ins Haus stünde.
„Oh, und dann werde ich euch verlassen müssen, ihr lieben Kinder!“, rief sie, drückte uns an sich und weinte schon fast. Es kam aber nie zu einer Hochzeit, weder mit diesem Herrn noch mit einem anderen, wir wurden erwachsen, Agathe ging zu einer anderen Herrschaft und blieb Kinderfrau.
Vater selbst hatte unseren Feenkreis roden lassen, um die neue Gießerei der Eisenwerke Blansko mit einem Kupolofen darauf zu erbauen, es war die Zeit des beständigen Fortschritts, seine glücklichste Zeit, als seine Erfindungen den Eisenguss revolutionierten und schon bald das ganze Reich Säulen, Geländer und Statuen aus Blansko bezog. Die Zwittawa, an deren Ufer sich unser Spielplatz befand, brauchte man zum Flößen, für Antrieb, Kühlung und Dampf, sodass an ihrer ganzen Länge bis tief in die Karstschluchten hinein eine Kette von Werken stand und entstand.
Vater wusste nichts davon, dass wir weinten, als Männer mit Spitzhacken den Grund aufwühlten und mit Äxten die knorrigen Zerreichen fällten und mit Fuhrwerken breite, kahle Linien in die Blumenwiese hineinfuhren. Als schließlich alles staubiges Geröll war, eine plane Halde, auf die die Sonne herabbrannte. Als sie das Fundament errichteten und Ziegel um Ziegel aufzuschlichten begannen, dabei den herausquellenden Mörtel mit der Kelle in ewiggleicher Geste verstreichend. Das Handgelenk des stärksten Mannes bewegte sich dabei elegant wie das eines Juweliers. Es war August und die Arbeiter wischten sich mit schmutzigen Taschentüchern den Schweiß von den Gesichtern. Sie nahmen ihre Kappen ab, rieben sich über die Köpfe, setzten die Kappen wieder auf. Die Pfeife nahmen sie dabei nicht aus dem Mund. Immerzu sogen die Arbeiter an ihren Pfeifen, selbst wenn sie direkt neben den Öfen und dem flüssigen Eisen standen. Egal, wie heiß es rundherum war, sie sogen an ihrer kleinen Glut. Aus ihr kam Zauberrauch, ein Lebenselixier, das die nötigen Kräfte spendete, so musste es sein. Auch Frauen und Kinder arbeiteten in den Fabriken, sie hatten kein Lebenselixier.
Während die Mauern wuchsen und ein hoher Schlot aufschoss, wurden die Köpfe und Arme der Arbeiter erst rot und dann braun. Manchmal durften wir ihnen eine Erfrischung bringen, mit eiskaltem Quellwasser verdünnten Wein. Obwohl der Herr mit dem Eberstock nicht mehr dort wartete, war Agathe bereit, mit uns diese Ausfahrt zu machen. Es gab nun eine breitere, festere Brücke über den Fluss. Gemeinsam trugen Ottone und ich den Korb mit dem Krug und den irdenen Bechern, er war schwer und kein Tropfen durfte verschüttet werden. Nun nahmen die Männer die Pfeifen aus dem Mund. Während sie das Getränk hinunterstürzten, versuchte ich zu erfühlen, wo die Feen und versunkenen Ritter, die Grillenorchester und leuchtenden Pilze, die Schnepfennester und Zwergendörfer, die Druden und Kobolde, die wandernden Büsche, moosgesichtigen Felsen, Schneckenkutschen und Heckenrosenlabyrinthe sich nun befanden. Ich war mir sicher, dass sie in den Boden versunken waren, tief, tief hinunter, wo sie in kühlen, glitzernden Höhlen weiter existierten und dabei die Sonne vermissten, die Sterne und den Mond. Später konnte ich diese geheimnisvolle Welt, die damals durch die Notwendigkeiten des Fortschritts aus der Gegenwart gedrängt wurde, oft jahrelang vergessen, aber ich bin mir sicher, im Moment meines Todes werde ich sie aufleuchten sehen.