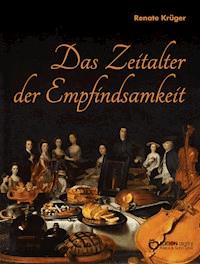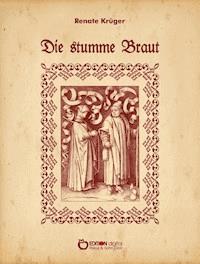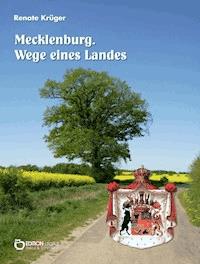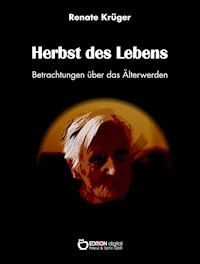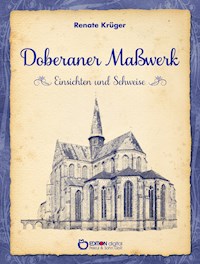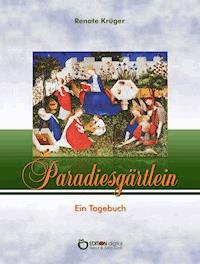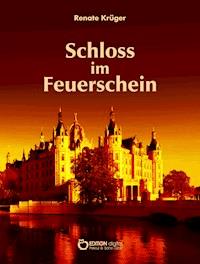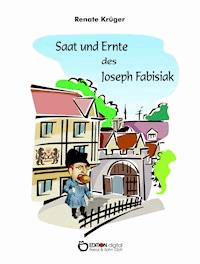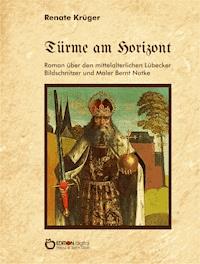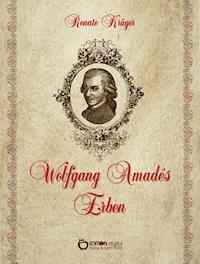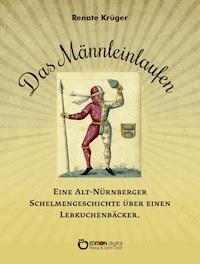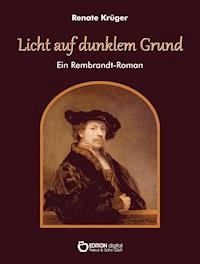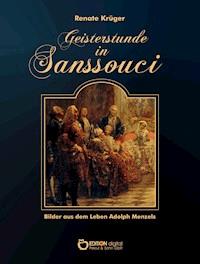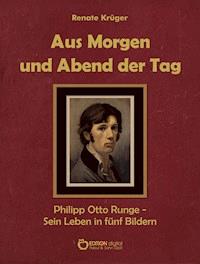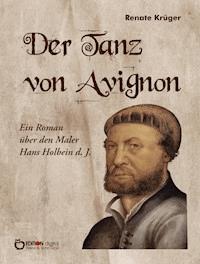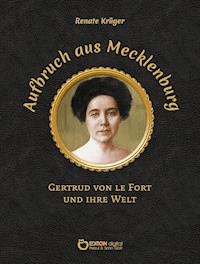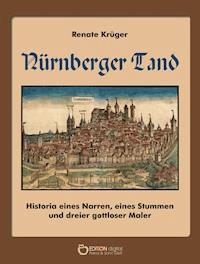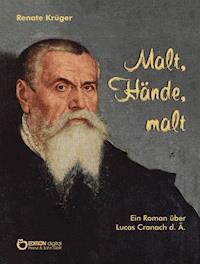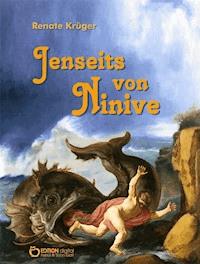Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) gilt als der berühmteste unter den Söhnen von Johann Sebastian Bach. Er war Schüler der Thomasschule zu Leipzig, Student der Rechte in Frankfurt/Oder, stand 28 Jahre als Kammercembalist im Dienst König Friedrichs II. von Preußen und versah schließlich das Amt des Musikdirektors und Kantors am Johanneum in Hamburg. Carl Philipp Emanuel Bach war zu seinen Lebzeiten berühmter als sein Vater Johann Sebastian und gilt als einer der bedeutendsten Komponisten zwischen Barock und Wiener Klassik im sogenannten Zeitalter der Empfindsamkeit. Der fiktive Erzähler François de La Chevallerie, Historiker und Bibliothekar in Berlin, beschreibt zwei Lebensläufe, den des Kapellbedienten Carl Philipp Emanuel Bach und den der zwielichtigen fiktiven Gestalt von Friedrich Wilhelm Gemshorn, Sohn eines Schafrichters und Henkers aus Brandenburg an der Havel. Beide begegnen sich auf Schloss Rheinsberg, der Residenz des Kronprinzen Friedrich von Preußen und Tummelplatz abenteuerlicher Existenzen. Gemshorn wird Handlanger eines sächsischen Spions, der Sohn von Johann Sebastian Bach hofft auf Aufstiegsmöglichkeiten am Hof des Kronprinzen – aber er bringt es nur bis zum Ersten Kammercembalisten. Gemshorn tritt bald als wandernder Schauspieler, bald als bürgerlicher Unternehmer auf, zwischen Sachsen und Preußen findet ein Krieg statt, und Herr von La Chevallerie begegnet dem jungen Lessing, der es später verschmäht, unter dem Schutz des Philosophen Voltaire Einlass in das königliche Opernhaus zu finden. Er wird Zeuge einer Bücherverbrennung auf dem Gendarmenmarkt: der König lässt eine Schrift von Voltaire den Flammen übergeben. Auch in Carl Philipp Emanuel Bach verbrennt etwas: das Vertrauen auf König Friedrich. Ein Konzert am Rheinsberger Hof des Prinzen Heinrich entfremdet ihn gänzlich der höfischen Kunst und Welt, und er beginnt trotz vorgerückten Alters eine neue musikalische Karriere im bürgerlichen Hamburg. INHALT: Entree – Eingangsmarsch Sarabande – Königliches Flötensolo Courante - Der Arlecchino Gigue – Zwischen Sachsen und Preußen Menuett – Königliches Operntheater Rondeau – Verschlungene Wege
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Renate Krüger
Des Königs Musikant
Geschichten aus dem Leben des Carl Philipp Emanuel Bach
ISBN 978-3-86394-297-7 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung des Gemäldes „Flötenkonzert“ von Adolph Menzel
Das Buch erschien erstmals 1985 in Der Kinderbuchverlag Berlin
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Entree – Eingangsmarsch
Mein Leben ist bis in seine feinsten Verästelungen davon geprägt, dass ich am gleichen Tag geboren wurde wie der neue preußische Staat. Mein Vater, Oberst der Reiterei aus der französischen Kolonie, begleitete mit Tausenden anderer Untertanen seinen Landesherrn, der als Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg, nach Königsberg, in das weit entfernte Preußen, aufbrach und als König Friedrich I. mit Glanz und Gloria nach Berlin zurückkehrte.
Meiner Mutter war es nicht erspart worden, sich gleichfalls auf den beschwerlichen Weg in den Norden zu machen, und nach diesen Anstrengungen und Aufregungen brachte sie mich zu früh auf die Welt, fast auf die Stunde genau, als sich unter dem Jubel der Menge der Kurfürst selbst die preußische Königskrone aufs Haupt setzte. So vermehrte ich das königliche Gefolge und zog schreiend und hungrig in Berlin ein, die Residenz von Brandenburg und die Hauptstadt Preußens, eines Landes, das weit entfernt im Norden lag. Aber solche Entfernungen spielten in unserer Familie keine Rolle. Meine Eltern waren in Paris geboren, hatten aber aus Glaubensgründen ihre französische Heimat verlassen müssen und Aufnahme im Kurfürstentum Brandenburg gefunden.
Ich wurde nicht Reiteroffizier wie mein Vater, obgleich jedermann sagte, unser Name La Chevallerie verpflichte nun einmal zum Militärdienst, sondern wandte mich den Künsten und Wissenschaften zu und brachte es zum anerkannten Geschichtsschreiber und Bibliothekar. Solange ich mich zurückerinnern kann, erlebte und erfuhr ich, was in Preußen geschah, ich stand immer inmitten preußischer Geschichte. Manchmal meine ich, ich sei selbst ein Stück von ihr, obwohl ich noch immer besser französisch als deutsch spreche und meine Schriften in die deutsche Sprache übersetzen lassen muss. Und obwohl ich mit den preußischen Verhältnissen nicht immer einverstanden bin und manchmal mit Faust und Säbel dazwischenfahren möchte. Aber was würde sich damit ändern? Preußens Hauptstadt Berlin ist nun einmal meine Heimat, ich gehöre zu ihr, im Guten wie im Bösen ...
Zu meiner frühesten Kindheitserinnerung zählt das Reiterstandbild des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, den man jetzt den Großen Kurfürsten nennt. Immer wieder spazierte mein Vater mit mir zur Schlossbrücke und ließ mich das Denkmal anstaunen.
»Ja, das ist ein Pferd, Francois«, versicherte er, »aber gerade gut genug für einen solchen Reiter!« Und er zog den Hut vor dem Kurfürsten, der vor einem Menschenalter den französischen Flüchtlingen die Tore seines Landes geöffnet hatte.
Auch jetzt noch finde ich mich manchmal vor dem Großen Kurfürsten ein und sinne über den Weg nach, den Brandenburg-Preußen gegangen ist. Stärker aber noch zieht es mich in den Innenhof des Zeughauses, der mit ungewöhnlichem Schmuck versehen ist: den Masken sterbender Krieger. Der leiderfüllte, schmerzliche Ausdruck ihrer Gesichter passt oft am besten zu meinen Gedanken. Ich will mich jedoch vor Grübelei und Selbstquälerei hüten und lieber scharf darüber nachdenken, was geschehen ist und wie aus dem Geschehenen Geschichte wurde. Ich habe vieles erfahren, vieles aufgeschrieben, ich besitze eine Bibliothek, die in Berlin ihresgleichen sucht, und möchte nun eine Geschichte aus mir herauslocken, die auch Erfundenes und trotzdem nur Wahres enthält.
Nicht nur eine Geschichte, es sind Lebensläufe, pralle, runde Menschenschicksale, die meine Straßen und Wege kreuzten, manchmal in vollem Lauf, dann wieder holpernd und mühsam. Ich will sie erzählen, nicht nur wie ein Dokument festhalten, obgleich mir das als Geschichtsschreiber ja zustünde.
Doch nicht nur die Tatsachen will ich darstellen und somit der Nachwelt überliefern, sondern auch das, was zwischen ihnen wirkt, das eigentliche Leben, das sich so schwer in Zahlen und Berichte fassen lässt, weil Zahlen und Berichte nicht das ganze Herz des Schreibers fordern.
Ich möchte mit allen meinen Gefühlen und Sinnen dabei sein, als hätte ich mit diesen Menschen gelebt. So erzähle ich dies nicht als nüchterner Beobachter und Archivar, der alles gründlich ausgeforscht hat, sondern ich stecke selbst in meinen Geschichten mit drin. Wozu wäre mir sonst wohl meine Fantasie gegeben?
Wenn ich etwas nicht genau weiß, werde ich meine Vorstellungskraft zu Hilfe nehmen und so die Wahrheit finden und darstellen.
Warum ich es erzähle?
Auch deshalb, um herauszufinden, wo ich selbst stehe, welchen Weg ich gegangen bin. Und auch, um das andere Preußen zu finden, welches hinter dem allenthalben vorgezeigten Bild der Harmonie sichtbar wird, das auch mich sehr lange begleitet hat. Wer sollte es wohl entdecken können, wenn nicht ich, der Geschichtsschreiber, der Bibliothekar, der Archivar?
Die Weggefährten, die mich vor allem beschäftigen, sind der Musiker Carl Philipp Emanuel Bach und der Notendrucker und Schauspieler Friedrich Wilhelm Gemshorn.
Herr Bach wird ebenso in die große Geschichte eingehen wie sein Vater, der Leipziger Thomaskantor, obgleich er keine »Geschichte« gemacht hat, wie man so sagt. Ich erlebte ihn als strebsamen, fleißigen Mann, der alle seine Kräfte in die Arbeit, in seine Musik steckte.
Jetzt ist Bach Musikdirektor in Hamburg; alle Welt drängt sich nach seinen Kompositionen und seiner Bekanntschaft. Zu Beginn meiner Geschichte ist er ein noch junger Cembalospieler, der gerade seine Studien in Leipzig und Frankfurt hinter sich gebracht und seinen Platz in der Rheinsberger Kapelle des Kronprinzen Friedrich gefunden hat.
Ob die Namen des Notenstechers Gemshorn einer ferneren Nachwelt erhalten bleiben werden, wage ich zu bezweifeln; für mich ist sein Leben jedoch ebenso wichtig wie das des Musikers Bach.
Auch diese beiden Menschen lehrten mich preußische Lebenswege kennen und mit meinem eigenen zu vergleichen, mich selbst besser zu verstehen.
Es hat mich ziemlich viel Mühe gekostet, bis ich herausfand, dass Friedrich Wilhelm Gemshorn der Sohn eines Scharfrichters und Henkers aus der Stadt Brandenburg an der Havel war.
Mit ihm also beginnt meine Geschichte.
Ich möchte sie anbieten wie eine Suite, wie eine Folge französischer Tänze, den Vergnügungen, am preußischen Hof zur Zeit der aufgezeichneten Geschichten angemessen. Daher wählte ich als Überschriften für meine Kapitel französische Tanzbezeichnungen, Entree ... Sarabande ... Courante ...
Gemshorns Vater hatte das schreckliche Amt schon vom Großvater übernommen; auch dessen Vater musste die zum Tode Verurteilten hinrichten, mit dem Schwert, in der Seilschlinge, auch durch Ertränken in der Havel. Ein grässlicher Beruf. Er wurde zwar im Vergleich zu manch anderem Amt gut bezahlt, aber an diesem Geld klebte immer Blut.
Scharfrichter und ihre Angehörigen wurden zu den unehrlichen Leuten gezählt. Niemand wollte mit ihnen zu tun haben, in ihrer Nähe wohnen, mit ihnen sprechen. Der Henker musste mit seiner Familie am Rande der Stadt leben, möglichst außerhalb der Mauern. Man sagte, er stehe mit Teufel und Hexen im Bunde. Das Amt musste vom Vater auf den Sohn vererbt werden, war keiner vorhanden, auf ein anderes männliches Mitglied der Familie. So blieb die Sippe immer unehrenhaft.
Friedrich Wilhelm Gemshorn wollte um keinen Preis Scharfrichter und Henker werden, er setzte seine Hoffnung auf die Soldaten. Die preußische Armee war unersättlich, dort fand jeder Eintritt. Der Werbefeldwebel, bei dem er sich meldete, war begeistert von dem großen kräftigen Kerl, als er aber hörte, aus welcher Familie Gemshorn kam, sagte er nein, drehte sich um und ging fort.
Natürlich erfuhr der Vater davon und rieb sich die Hände.
»Komm mit!«, sagte er, und widerstrebend folgte ihm der Sohn in die Kammer, in der das Richtschwert hing.
»Schau es dir genau an!«, befahl der Vater. »Auch du sollst es in beide Hände nehmen und damit Verbrecher, die nichts Besseres verdient haben, vom Leben zum Tode befördern. Im nächsten Monat wirst du zwanzig Jahre alt, dann sollst du es zum ersten Mal tun!«
»Nein, ich will nicht!«, sagte der Sohn, schlug die Tür hinter sich zu und verschwand kurze Zeit danach aus der Stadt Brandenburg.
Als die Flucht bemerkt wurde, sagten die Leute: »Der kann nicht weit kommen, hat ja einen roten Streifen um den Hals wie alle aus seiner Sippe. Der lässt sich nicht wegwischen, der sitzt unter der Haut. Ein Schandmal fürs Leben!«
Das stimmte natürlich nicht, doch Leutegerede zählt oft mehr als die Wahrheit.
Friedrich Wilhelm Gemshorn aber brachte die preußische Grenze hinter sich. Er durchschwamm einen Fluss und wurde erst am Tor einer kleinen sächsischen Stadt von den Wächtern aufgehalten.
»Heda, Geselle, woher? Wohin?«
Der Flüchtling ließ den Kopf hängen und erfand eine Geschichte.
»Ich bin ein Mecklenburger, den man zu den preußischen Truppen gepresst hat. Denen konnte ich entlaufen, wusste aber die Richtung nicht. Statt nach Norden rannte ich gen Süden, daher bin ich nun hier. Ich möchte so schnell wie möglich in meine Heimat zurück, durch Brandenburg traue ich mich natürlich nicht ...«
Die Torwächter nickten verständnisvoll. Es kam öfter vor, dass sie entlaufene brandenburgisch-preußische Soldaten aufgriffen, manche von ihnen waren schrecklich zugerichtet. Ganz so schlimm ging es bei den Sachsen nicht zu.
»Ach, da hat Ihn ja ein schweres Schicksal getroffen! Nun sehe Er nur zu, dass Er so schnell wie möglich wieder in die Heimat kommt«, sagte der ältere Torwächter.
Friedrich Wilhelm Gemshorn traute seinen Augen nicht, als ihm der gemütliche Sachse sogar noch einen Zehrpfennig reichte. Er hob seinen Kopf, fasste Mut, trat in die Stadt ein und fragte den ersten besten Mann: »Habt Ihr eine kleine Arbeit für mich?«
Dann erzählte er wieder seine Soldatengeschichte und dass er hier nur ein paar Pfennige verdienen und in seine Heimat zurückkehren wolle. Auch dieser Mann war mitleidig. Er kratzte sich hinterm Ohr und fragte: »Kann Er wohl die Blasebälge meiner Orgel zu Boden kriegen? Ich bin hier Organist, muss Er wissen, und manchmal fehlt es mir an einem Bälgetreter.«
Mit einer solchen Arbeit hatte Gemshorn zwar noch nie etwas zu tun gehabt, aber warum nicht? So willigte er ein, und der Organist nahm ihn mit.
In den ersten Tagen war alles neu für Friedrich Wilhelm Gemshorn. Er konnte sich nicht daran gewöhnen, dass er niemandem aus dem Wege zu gehen brauchte, dass nicht jedermann ihm den Rücken zeigte oder an ihm vorbei sah, als gäbe es ihn nicht, wie er es von daheim gewohnt war. Dass ihm die Leute Geld und Leckerbissen zusteckten und nach seinen Erlebnissen bei den Preußen fragten, die hier unbeliebt waren. Gemshorn wunderte sich selbst darüber, wie gut er Geschichten erfinden konnte, die er erlebt haben wollte und die Eindruck auf die Leute machten. Zum Beispiel diese: »Ich führte die Schafherde meines Vaters über das Weideland, das zwischen der mecklenburgischen Heide und der Prignitz liegt. In den kühlen Nächten kroch ich in meinen Schäferkarren, darin konnte ich lang ausgestreckt liegen und schlafen; die Schafe lagerten ringsum. Am Tage schob ich den Wagen ein Stück weiter, dorthin, wo die Schafe etwas zu fressen fanden.
Und bei diesem friedlichen Geschäft haben mich preußische Werber erwischt, die wieder einmal auf Soldatenfang waren. Dem Hütehund warfen sie eine halbe Wurst vor, da gab der keinen Blaff mehr von sich. Es war nachts, ich schlief. Sie nagelten meine Wagentür zu und schoben mich einfach über die Grenze ins Brandenburgische. Ich schrie und schlug mit den Fäusten gegen die Bretter, aber was half mir das?
Bis heute weiß ich nicht, was aus meinen Schafen geworden ist. Die Preußen pressten mich zu den Langen Kerls, zur Leibgarde des Königs. Es ist eben nicht immer gut, wenn man so groß ist! Als ich nicht wollte, prügelten sie mich halbtot.
»Gut«, sagten sie, »wenn du nicht Soldat werden willst, machen wir dich zum Henker und Scharfrichter, uns fehlt gerade einer, um die vielen Fahnenflüchtigen und Aufsässigen zu bestrafen!«
Das aber wollte ich natürlich erst recht nicht. So ließ ich mich in die bunte Montur stecken und lernte marschieren und das Gewehr schultern. Dann setzte ich alles auf eine Karte und floh. Fragt nicht, auf welch abenteuerlichen Schleichwegen ich hierher gekommen bin!
Schrecklich ist das Leben drüben im Preußischen! Die Mütter schlagen ihre kleinen Söhne jeden Tag zehnmal auf den Kopf, damit sie nicht wachsen und in die Höhe schießen, denn sonst müssten sie auch zu den Langen Kerls ...«
Gemshorn genoss es, dass seine Geschichte so gut ankam, dass die Leute nicht nur Augen und Mund aufrissen, sondern auch noch auf die Preußen schimpften. Ihr Mitleid kam ihm ja nur zugute! Der Organist aber schüttelte den Kopf.
„Nun vergesse Er Seine schwarzen Erinnerungen und folge Er mir an die Arbeit!«
Dagegen sträubte sich Gemshorn nicht, denn er war ein fleißiger Mensch. Dass er aber so gut und schnell Geschichten erfinden und erzählen konnte und dass man ihm jedes Wort glaubte, da er sie mit großer Überzeugungskraft vortrug, das war neu für ihn. Er fühlte sich wohl dabei.
Zeit zum Nachdenken hatte er genug. Der Organist saß viele Stunden täglich an der Orgel und übte, und Gemshorn musste die Fußhebel vom Blasebalg treten. Das war etwas! Gemshorn gefiel die Musik und vor allem die Stimmung in der hohen spitzbogigen Kirche so gut, dass ihm das eintönige und anstrengende Bälgetreten nicht zu viel wurde.
»Will Er bald weiter, oder ist Er auch an anderer Arbeit interessiert?«, fragte der Organist, der einen Hof- und Ackerknecht brauchte. Vom Orgelspiel allein konnte niemand leben, und so betrieb er nebenher eine kleine Landwirtschaft, wie die meisten Bürger des Städtchens. Nun kam die Erntezeit heran, jede Hand wurde gebraucht.
Gemshorn blieb. Das Essen war gut, bald klimperten auch ein paar überzählige Münzen im Hosensack. Zu Beginn des Winters fragte der Organist: »Traut Er sich zu, für mich Noten abzuschreiben?«
Noch niemals hatte Gemshorn etwas mit Noten zu tun gehabt, er konnte ja nicht einmal schreiben und lesen. Sein Wohltäter legte ihm ein beschriebenes Notenblatt vor, ein leeres daneben und sagte: »Nun versuche Er sich einmal daran. Es ist, als ob Er etwas abzeichnet. Wenn Er sich verschreibt – hier sind neue Blätter.«
Schon beim zweiten Anlauf brachte Gemshorn eine richtige Abschrift fertig, und der Organist meinte: »Er ist ein Tausendsassa! Die Preußen hätten an Ihm einen rechten Fang getan, aber schade um einen so begabten Menschen bei den Soldaten! Ich habe noch viele Blätter, die Er abschreiben und sich damit ein gutes Stück Geld verdienen kann.«
Gemshorn wagte daraufhin zu sagen: »Ich möchte kein Geld, sondern Noten lernen. Und auf Eurem Instrument spielen.«
Der Organist war noch erstaunter: »Was ist Er für ein Mensch! Doch warum nicht? Wollen sehen, wie Er sich anstellt.«
Gemshorn trat die Blasebälge, schrieb Noten ab, arbeitete auf dem Acker, und in jeder freien Minute versuchte er sich an der Orgel, lernte schnell und verlor Schüchternheit und Zurückhaltung. Der Organist bedauerte es sehr, dass der junge Mann nach einem Jahr zum Aufbruch rüstete, um sich, wie er sagte, noch ein größeres Stück von der Welt anzusehen, ehe er nach Hause zurückkehrte.
Sein Ehrgeiz war erwacht. Es genügte ihm nicht mehr, am Amt des Scharfrichters vorbeigekommen zu sein. Das kleine Städtchen schien ihm plötzlich zu eng, und jemand, der so anstellig und gelehrig war wie er, musste es doch zu etwas Großem bringen, etwas Besonderes werden. So dachte Gemshorn.
Da er keine Angst kannte und sich auf jedes Risiko einließ, kam er rasch vorwärts, lernte fremde Sprachen, parlierte italienisch wie ein wandernder Scherenschleifer oder Mausefallenhändler und französisch wie ein Tanzmeister. Zum Vergnügen seiner Zuhörer verstand er sich darauf, die Sprachen zu einem drolligen Kauderwelsch zu vermengen.
Das hatte er sich als Komödiant angewöhnt. Zwei Jahre lang war er mit einer Schauspielertruppe durch Böhmen, Österreich und Italien gezogen, spielte heute mit in einem prächtigen Schloss, morgen in einem Wirtshaus oder einer Scheune und übermorgen unter freiem Himmel in Stücken, die nicht immer zu den edelsten Blüten der Schauspielkunst zählten. Er wusste bald nicht nur mit Orgel und Cembalo, sondern auch mit Dudelsack und Flöte, ja auch mit Drehleier und Brummscheit umzugehen.
Doch er entdeckte in sich auch etwas anderes, und auch das macht ihn für unsere Geschichte interessant, obgleich es nichts Gutes ist: Er wurde nicht nur ein ausgezeichneter Notenkopist, sondern lernte auch mit großem Erfolg Unterschriften fälschen und mit einer unsichtbaren Tinte schreiben. Erst wenn das beschriebene Blatt ein Weilchen in einer nach geheimen Rezepten zubereiteten Flüssigkeit gelegen hatte, wurde die Schrift wieder lesbar. Außerdem lernte er auch Feuer aus Stein schlagen, sogar aus nassem, Pferde kurieren, Zähne ziehen und galt als geschickt bei allen, die ihn kennen lernten.
Gemshorn ritt, schoss und focht mit dem Florett und Säbel wie ein alter Haudegen, er wurde mehrmals von vornehmen ängstlichen Herren als Doppelgänger angeheuert. Als er einem von ihnen wirklich das Leben rettete, unter Einsatz des eigenen, dankte der ihm mit einer Summe harter Taler. Ein paar falsche Unterschriften auf Wechseln und kleine Diebereien schließlich ließen das Guthaben noch anschwellen, er schadete keinen Armen damit.
Nach zehn Jahren wagte er es, in seine Heimat zurückzukehren, ein stattlicher hoch gewachsener Mann von dreißig Jahren. Was er dort beginnen wollte, wusste er nicht genau, war aber überzeugt, dass es etwas ganz Außergewöhnliches sein werde. Preußen war der richtige Boden für ihn, ein Land mit Zukunft, davon hatte er in Wien und in Dresden erzählen hören.
Gemshorns Vater war inzwischen verstorben, das Amt des Brandenburger Scharfrichters an einen Verwandten gefallen. Niemand kannte oder erkannte den jungen Mann. Also ließ er sich in Berlin nieder. Erst hier legte er sich den Namen Gemshorn zu.
Ich habe übrigens nicht herausfinden können, wie er mit ursprünglichem Familiennamen hieß. Es war damals nicht gerade schwer, in Berlin unter falschem Namen zu leben, denn in jenen Tagen strömten von allen Seiten Fremde ein.
Hier in der Residenz kaufte Gemshorn sich ein stattliches Haus für billiges Geld. Es war in der Nähe des Schlosses gelegen, und düstere Geschichten rankten sich darum, weshalb es lange leer stand und billig zu haben war. Es kam mir immer wieder zu Ohren, dass man zwar ehedem, als es bewohnt, viele Leute in dieses Haus gehen sah, dass aber nie etwas herausdrang, was sich nach geselliger Lustbarkeit anhörte. Und nie schien Licht durch die Fenster, sie seien immer dunkel gewesen.
Gemshorn fürchtete sich nicht, er bezog das Haus und richtete sich eine Werkstatt für den Notendruck ein, obgleich er zunächst ungern an den Abschied vom Wanderleben dachte. Doch er hatte sich entschieden. Alles auf die Karte eines bürgerlichen Gewerbes wollte er setzen, sesshaft werden, Ansehen gewinnen, wie es die Druckherren in Leipzig und Nürnberg, deren Werkstätten er besichtigt hatte, schon längst besaßen.
Mit seinem geschärften Blick hatte er sich bald ein Urteil über Preußen und das Berliner Leben gebildet. Ihm konnte man nichts vormachen! Preußen war ein Staat, in dem es vor allem Emporkömmlinge zu etwas bringen konnten. Und Gemshorn wollte es zu etwas bringen.
Aus dem Haus konnte er zunächst nicht so recht schlau werden. Die Haustür führte sogleich in die große Stube, eine Diele gab es nicht. Ins Dachgeschoss gelangte man über eine wacklige Leiter. Dort musste Gemshorn sogleich zwei Grenadiere einquartieren und von seinem Geld verpflegen, wie es damals in Berlin üblich war. Fast alle Bürgerhäuser mussten Soldaten des Königs beherbergen und für billiges Geld beköstigen. Die meisten Wirtsleute stöhnten über diese Belastung und wollten ihre uniformierten Mieter lieber heute als morgen los sein. Aber was konnten die armen Soldaten dafür? Nicht einmal ich, der angesehene Gelehrte, konnte mich von dieser Belastung freikaufen.
Die Einrichtung in Gemshorns Haus war karg, ein paar alte Stühle ohne Polster, ein Tisch mit zerkratzter Platte, kein Schrank, nur zwei Truhen. Ein paar Gläser, ein Topf, etwas Geschirr. Eines Tages fiel Friedrich Wilhelm Gemshorn eine Münze hinunter, rollte über den Fußboden und verschwand in einem Spalt. Er bückte sich schnell danach, es handelte sich schließlich um ein Talerstück! Doch so sehr er auch suchte, das Geld war verschwunden. Er holte sich ein langes spitzes Messer und stocherte damit zwischen den Fußbodenbrettern herum. Das Messer fuhr in ganzer Länge in einen Hohlraum.
Da sah Gemshorn genauer nach und entdeckte im Fußboden eine Falltür, die sich hochziehen ließ, es ging allerdings schwer. Schließlich kam er darauf, dass an der Decke ein Flaschenzug befestigt war, durch den ein Seil gezogen werden konnte. Damit ließ sich die Falltür ganz leicht bewegen. Sie knarrte und ächzte. Eine Leiter mit bequemen Stufen führte in den Keller. Gemshorn suchte sich eine Laterne und stieg hinab.
Zu seinem Erstaunen fand er unten eine Wohnung von mehreren Räumen. Hier lagen die eigentlichen Gemächer des Hauses! Die Räume oben waren nur Vorzimmer! Dort unten herrschte ein wüstes Durcheinander. Zerbrochenes Geschirr lag herum, Kartenspiele, Gläser, von Motten und Mäusen zerfressene abgetragene Kleidungsstücke, unansehnliche Schränke und Truhen standen herum. In den Ecken hingen Spinnweben. Über den Fußboden huschte Getier, das mochte durch die Lüftungsschächte von draußen eingedrungen sein. Auch Öfen waren vorhanden. Und hier unten lag das Talerstück.
Nachdem sich Gemshorn von seiner Überraschung erholt hatte, machte er sich an die Schränke und Truhen. Er wühlte und wühlte, förderte aber nur alte Kleidungsstücke, zerbrochenes Gerät, Kartenspiele und Gläser zu Tage. Davon ließ sich nichts mehr beim Trödler absetzen. Gemshorn hatte auf seinen vielen Reisen vieles Ungewöhnliche kennen gelernt, Tapetentüren, Geheimfächer, Schalltrichter, in Schornsteinen versteckte Treppen, daher fühlte er sich durch diese Entdeckung nicht lange verblüfft, sondern überlegte, was sich mit diesen geheimen Räumen wohl anfangen ließe ... Abwarten! Er rieb sich die Hände. Das war etwas! Es hatte sich also doch gelohnt, nach Berlin zurückzukehren. Ein Haus mit einer geheimen Wohnung ...
Wie ich nach vielen Bemühungen erfuhr, war es ein Maimorgen des Jahres 1740, als sich der Notenschreiber Friedrich Wilhelm Gemshorn auf den Weg von Berlin nach Rheinsberg machte. Obwohl er sich nur die allernötigste Ruhe gönnte, brauchte er mehrere Tage, bis endlich das Städtchen Rheinsberg in der blauen Abenddämmerung auftauchte. Dem Notenschreiber brannten die Füße, er konnte kaum noch einen Schritt vor den anderen setzen, und sein Magen knurrte schon seit Stunden. Zum Glück grüßte gleich neben dem Stadttor ein messingnes Wirtshausschild, in dem eine schief geratene Krone abgebildet war. Nur schnell hinein, die Füße von sich strecken, ein Abendbrot und einen Humpen Bier bestellen.
»Nun, Monsieur, müde von der Reise?«, fragte der Wirt, während er den Tisch mit einem Lappen blankrieb. Er war ein zierlicher dunkeläugiger Mann mit raschen Bewegungen. Auf dem Kopf trug er ein Lederkäppchen. Wie viele andere seiner Rheinsberger Mitbürger stammte er aus Frankreich.
Gemshorn nickte nur. Der Wirt ließ nicht locker, und als der Gast seine Abendmahlzeit verzehrt und einen zweiten Bierhumpen geleert hatte, wusste der Franzose alles, was er wollte, nämlich dass dieser Neuankömmling im Auftrage des kronprinzlichen Kammerdieners Fredersdorff Noten abschreiben sollte, dass der Kronprinz noch immer in Potsdam bei seinem schwerkranken Vater, dem König, weilte und von seiner Rückkehr in das Rheinsberger Schloss nichts bekannt war, dass man in Berlin täglich mit dem Tod des Königs rechnete. Auch ich kann mich noch deutlich an die Spannung jener Tage erinnern.
Letztere Nachrichten hörte der Wirt allerdings gar nicht gern, denn sie bedeuteten das Ende der Rheinsberger Zeit des Kronprinzen, der dann mit seinem kleinen Hofstaat nach Berlin und Potsdam. übersiedeln würde. Ob es sich dann noch lohnte, ein Wirtshaus neben der Stadtmauer zu betreiben?
»Nun, Monsieur, wo wird Er wohnen? Will Er nicht Quartier in meiner Maison nehmen?« Donnerwetter, dachte Gemshorn, »Maison« nennt dieser Wirt sein Häuschen, das bedeutet so viel wie vornehmes Absteigequartier. Diese Franzosen nehmen den Mund ja ziemlich voll!
Aber er nickte und ließ sich in eine Schlafkammer führen. Gleich früh am Morgen wollte er sich, gut ausgeschlafen, gesäubert und frisiert, ins Schloss aufmachen und bei dem Kammerdiener Fredersdorff melden.
Und so geschah es. Dem neugierigen Gemshorn bot sich am anderen Tage ein vergnüglicher Anblick. Über den See grüßte ihn das Schloss mit seinen beiden dicken Türmen, von denen der rechte das Arbeitskabinett des Kronprinzen beherbergte. Die in Sonne getauchten Figuren auf dem Dach hoben sich lebendig gegen den Morgenhimmel ab. Schlank und zierlich standen Säulenpaare auf den Stufen zum See hin und trugen eine Balustrade mit steinernen Blumenvasen und Kindergruppen.
Was hatte nun Gemshorn nach Rheinsberg geführt?
Einige der Kapellbedienten, der Musikanten des Kronprinzen, hatten sich beklagt, sie könnten ihre Noten nicht mehr lesen, denn die Blätter seien vom ständigen Gebrauch zerfleddert. Es war nicht ausgeblieben, dass beim Spielen Fehler vorkamen. Sie könnten das Schimpfen des Flötenmeisters Quantz einfach nicht mehr ertragen..
Mit ihrer Beschwerde hatten sie sogar Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen in den Ohren gelegen, und der befahl, man möge sich nach einem Notenschreiber umsehen, der gründlich Ordnung schaffen solle. Nach einigem Suchen war der Kammerdiener Fredersdorff in Berlin auf Friedrich Wilhelm Gemshorn gestoßen, der sich mit einer schön leserlichen Notenschrift empfahl.
Fredersdorff hatte mir erzählt, dass er zwar froh wäre, diesen Mann gefunden zu haben, aber nicht wisse, wovon er ihn bezahlen solle. Der Kronprinz hatte kein Geld dagelassen!
So hielt der Kammerdiener den Notenschreiber erst einmal hin, als es um Geld ging. Gemshorn werde ganz bestimmt auf seine Kosten kommen und solle sich gedulden. Er wurde zu Tisch gebeten und mit dem Besten und Feinsten bedacht, was Küche und Keller des Schlosses Rheinsberg bieten konnten. Im Glas perlte grüngoldener Wein. Die mit gewürztem Fleisch gefüllten Pasteten ließen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Die kandierten Früchte galten weit und breit als besondere Spezialität des Hauses. Gemshorn ließ sich alles schmecken, aber es missfiel ihm, dass er nicht sogleich ein Handgeld erhielt, und er wollte genau wissen, wie viel ihm diese Arbeit insgesamt eintragen werde.
»Ich möchte mein Berliner Haus ausbauen und standesgemäß einrichten. Die Pressen für meine Druckerwerkstatt bekomme ich auch nicht umsonst.«
Fredersdorff beschwichtigte ihn immer wieder: »Sei Er mir nicht so ängstlich. Er wird schon sehen ...«
Dann breitete der Kammerdiener geschäftig die Notenblätter zum Abschreiben aus. Die meisten enthielten Kompositionen des Kronprinzen, aber Gemshorn begegnete auch den Namen Quantz, Graun, Benda und Bach.
»Das ist gute Musik«, sagte er, »die solltet Ihr Euch etwas kosten lassen.«
Fredersdorff fühlte sich wieder einmal unsicher und unbehaglich, er verstand nämlich nichts von Musik. Auch nicht von anderen Künsten. Er war ja nur ein einfacher Soldat, aber während der schwersten Monate des Kronprinzen, während der Haft in Küstrin war er zu dessen zuverlässigstem Freund und Vertrauten geworden. Ohne Fredersdorffs Hilfe und Pflege hätte der Kronprinz die Auseinandersetzungen mit dem Vater wohl nicht überlebt. Als es endlich zur Versöhnung kam und der Vater dem Sohn das Schloss Rheinsberg gewissermaßen als Entschädigung erlaubte, setzte der Kronprinz seinen Fredersdorff an die erste Stelle der Dienerschaft. Aber er tat dem ehemaligen Soldaten damit keinen Gefallen, denn wenn der den Kronprinzen nicht hinter sich wusste, fühlte er sich verlacht und verachtet. Oft suchte er bei mir – dem Schreiber dieser Geschichten – Hilfe und Stärke in seiner Unsicherheit. Und nun dieser selbstbewusste Notenschreiber!
Gemshorn ließ sich im Grünen Musiksalon nieder – in diesem Raum waren Polster und Wandbespannungen von dunkelgrüner Farbe – und begann mit dem Kopieren der Notenblätter. Das sprach sich schnell bei den Kapellbedienten herum, und einer nach dem anderen fand sich ein, um Neuigkeiten zu erfahren und sich Abwechslung zu verschaffen. Die Musikanten langweilten sich, da der Kronprinz schon so lange von Rheinsberg abwesend war. Gemshorn wurde neugierig auf diesen kleinen Hof und fragte die Kapellbedienten ganz unverblümt aus. Er erbat und erhielt auch die Erlaubnis, sich in den unteren Räumen und der Umgebung des Schlosses nach Herzenslust umzusehen.
Rheinsberg war auch damals schon bei uns in aller Munde. Ich habe das alte, einer Burg gleichende Haus vor dem Umbau nicht gesehen; es wurde mir jedoch immer wieder versichert, dass es damit nicht weit her gewesen sei. Von einem Schloss hätte keine Rede sein können; erst der Baumeister Knobelsdorff habe aus dem halbverfallenen Gemäuer diesen Prachtbau gemacht. Es gab jedoch bei uns auch Stimmen der Entrüstung. Man warf dem Kronprinzen Verschwendung vor. Preußen sei ein armes, karges Land. und könne sich solche prächtigen Schlösser nicht leisten. Diese sonderbaren Höflinge und Künstler seien Schmarotzer und Verschwender. Ich schließe mich dieser Meinung nicht an, denn ich kam oft in den Genuss der Rheinsberger Musik-, Theater- und Literaturabende und kann nur rühmende Worte finden, von einigen Verirrungen freilich abgesehen.
Allerdings bewegten mich nach solchen Abenden auch oft recht eigenartige und kritische Gedanken.
Damals zählte die Porzellankunst zu den großen aufregenden Neuheiten, über die man viel sprach, gerade auch in Rheinsberg. Auf die Glasur allein käme es an, rief jemand mit Nachdruck; ich weiß heute wirklich nicht mehr, wer es war. Seither sind ja mehrere Jahrzehnte vergangen. Weiß müsse die Glasur sein, regelmäßig und glänzend, an den gebrannten Ton darunter dürfe man nicht denken.
Nun, ich verstehe auch jetzt noch nichts von der Technik des Porzellanbrennens und kann daher noch immer nicht die Unhaltbarkeit jener Behauptung am eigentlichen Gegenstand beweisen, aber ich nahm sie damals schon als Gleichnis dafür, dass es der neuen Hofgesellschaft und vor allem dem Kronprinzen auf den glänzenden Überzug ankam, auf die Glasur des Lebens, nicht auf den soliden festen Kern.
Oder ein anderer Vergleich.
Damals waren die chinesischen und japanischen Lackmöbel bei uns im Schwange, wurden bestaunt, teuer bezahlt und nachgemacht, all die Schränkchen auf krummen Beinen, Tischchen und Kästchen, weniger zum Gebrauch als nur zur Verzierung des vornehmen Lebens bestimmt. Ich habe einmal einem Berliner Lackierer bei der Arbeit zugesehen, wie er bedächtig und vorsichtig Lackschicht um Lackschicht auftrug, jeden Lufthauch abschirmend, damit sich kein Stäubchen in der noch klebrigen Schicht festsetzte. Immer wieder beteuerte er: »Auf das feste Holz darunter kommt es an, Monsieur de La Chevallerie, sonst wäre alle diese Mühe vergebens.« Noch immer kommt mir unser höfisches Leben vor wie eine dünne, allzu dünne Lackschicht über schlechtem, unausgereiftem Holz, und immer wieder formen sich in mir die Worte vom Königslack und der Preußenglasur. Viele meiner Freunde verstehen mich und teilen meine kritische Meinung.
Doch zurück zur Rheinsberger Gesellschaft. Sie hatte in den deutschen Fürstentümern nicht ihresgleichen, war bunt zusammengewürfelt und doch auf gemeinsame Ziele ausgerichtet: Vergnügen bei gebildeter, witziger Unterhaltung, bei Kunst und Philosophie. Dergleichen suchte man in Berlin vergeblich. In Rheinsberg konnten sich Genies, Schmarotzer und Scharlatane entfalten, vorausgesetzt, der Kronprinz fand sie interessant.
Seit einigen Wochen lebte auch ein sächsischer Hofmann im Rheinsberger Schloss, Johann Nepomuk Reichsfreiherr von Nostitz. Es gab Gespräche über ihn und manches Kopfzerbrechen, denn man konnte sich nicht vorstellen, was er eigentlich im Rheinsberger Schloss trieb. Er war weder ein Genie, noch ein Scharlatan, noch ein Künstler oder Literat, sondern ein trockener, pedantischer, zurückhaltender unscheinbarer Mann, der weder ein Instrument spielte, noch die neuesten französischen Romane gelesen hatte und sich auch im Trinken nicht sonderlich hervortat. Man munkelte, er habe geheime Aufträge und sei Verbindungsmann zwischen dem sächsischen Hof und dem Kronprinzen, und man täte schon besser daran, nicht weiter zu fragen. Und so verhielt es sich tatsächlich.