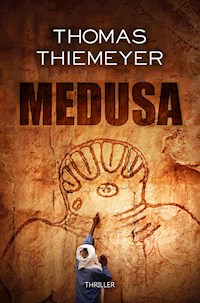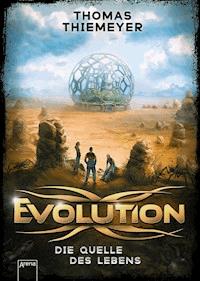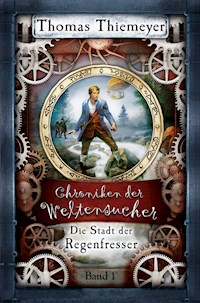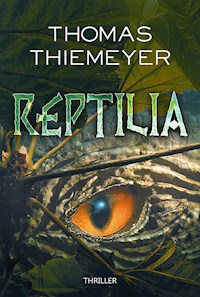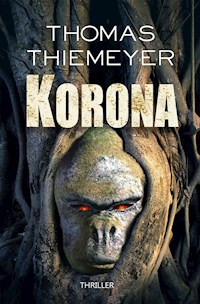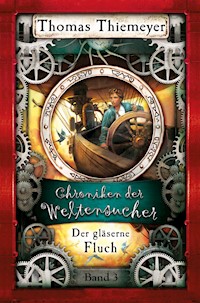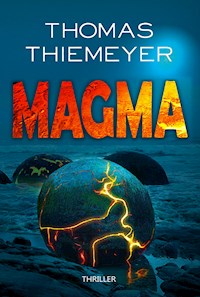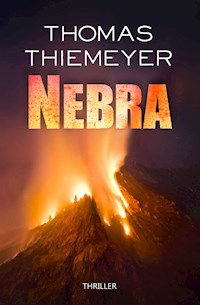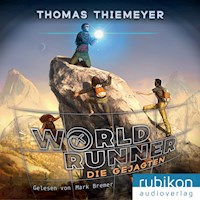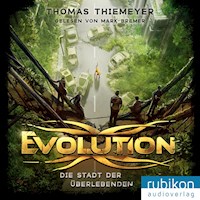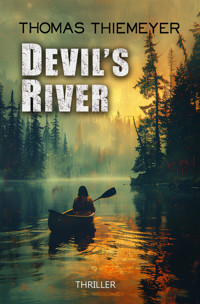
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Thomas Thiemeyer
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Es bedarf eines Ungeheuers um ein Ungeheuer zu töten. Kanada 1878. River, eine junge Frau vom Stamm der Ojibwe, muss miterleben, wie ihr Dorf von etwas heimgesucht wird, das kein Mensch sein kann. Die Hütten von einer gewaltigen Kraft zerstört, Männer und Frauen grausam ermordet, scheint eine uralte Legende zum Leben erwacht zu sein. River schwört Rache – und verbündet sich mit einem gesuchten Mörder. England 2015. Durch den Tod ihrer Großmutter aufgerüttelt, begibt sich die Studentin Eve auf die Spur eines Familiengeheimnisses, das in der kanadischen Wildnis wurzelt. Vergangenheit und Gegenwart, Mythos und Wirklichkeit, Abenteuer und rätselhafte Natur
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Thiemeyer
Devil’s River
Roman
Impressum
Copyright: Thomas Thiemeyer 2014.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Autors wiedergegeben werden.
Umschlaggestaltung: Thomas Thiemeyer / Midjourney
eISBN: 9783948093242
»Dem schlecht´sten Ding an Art und Gehalt,
leiht Liebe dennoch Ansehen und Gestalt.«
William Shakespeare, Ein Mittsommernachtstraum
»Welcome Beauty, banish fear,
You are queen and mistress here.
Speak your wishes, speak your will,
Swift obedience meets them still.«
The Beauty and the Beast
Inhalt
THE GAZETTE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Danksagung
Die Totentrommeln des Mont TremblantVon unserem Sonderkorrespondenten Fréderic Clement
Ziemlich genau vor fünfzig Jahren ereigneten sich in der Bergregion nördlich der Kleinstadt Sainte-Agathe-des-Monts eine Reihe mysteriöser Vorfälle. Der Kurort, gelegen am Ufer des Lac des Sables, am Oberlauf des Rivière du Nord, entstand 1892 im Zuge des Baus der Canadian Pacific Railroad. Die Ortschaft war ursprünglich eine Niederlassung katholischer Frankokanadier und erhielt 1915 ihren Stadtstatus. Seither ist sie ein beliebtes Ausflugsziel der Montrealer. Im Zuge der Errichtung verschiedener Sanatorien sowie einer Klinik für Tuberkulosekranke entstanden etliche prächtige Villen, die der Stadt noch heute ihr unverwechselbares Aussehen verleihen.
Doch wer hierher kommt, spürt schnell, dass ein düsteres Geheimnis auf der Region lastet. Es ist, als könnten die umliegenden Berge, die wilden Flüsse und dichten Wälder nicht vergessen, was hier vor so langer Zeit geschehen ist.
Mont Tremblant, der Zitternde Berg, liegt inmitten einer Wildnis, die jahrhundertelang ausschließlich von Indianern bevölkert wurde. Heute ein beliebtes Ausflugsziel, war er viele Jahrhunderte lang das spirituelle Zentrum der ortsansässigen Algonkinstämme. Er war ihr heiliger Versammlungsplatz und Heimstatt einer der bösartigsten Geister, die in den alten Erzählungen Erwähnung finden. Das Ungeheuer, das der Legende nach auf der Spitze des Berges haust, soll seinen Opfern das Herz bei lebendigem Leib aus der Brust gerissen und durch einen Stein ersetzt haben. Die Betroffenen irrten noch tage- oder wochenlang durch die Landschaft, wurden sich und ihren Angehörigen fremd und starben schließlich unter schrecklichen Qualen.
Immer wieder brachen in den folgenden Jahrzehnten Abenteurer auf, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, doch niemand konnte auch nur den kleinsten Hinweis für die Existenz einer solchen Kreatur finden. Doch dann stieß das Suchkommando der Royal Canadian Mounted Police in diesen letzten Tagen des Novembers 1878 auf etwas, was eine Welle der Betroffenheit im ganzen Land auslöste. Auf dem Gipfel waren die Schädel Hunderter von Menschen verscharrt worden. Kein Bestattungsplatz wohlgemerkt, sondern eine Opferstätte, die über Jahrzehnte hinweg Schauplatz grausamster Verbrechen gewesen sein musste. Untersuchungen ergaben, dass nicht nur Indianer zu den Opfern zählten, sondern vor allem Weiße: Siedler, Holzfäller, Jäger, Landvermesser.
Einige der Mounties berichteten von merkwürdigen Klängen, die oben auf der Bergspitze zu hören gewesen waren. Geräusche, die entfernt an das Schlagen von Trommeln erinnerten und sogar unter den Füßen zu spüren gewesen sein sollten. Schon bald verbreitete sich das Gerücht von den Totentrommeln der Algonkin.
Obwohl die Entdeckung jetzt bereits fünfzig Jahre zurückliegt und die Toten angemessen bestattet wurden, spukt noch immer der Schatten der Vergangenheit in vielen Köpfen herum.
Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, dass die Entdeckung der Kultstätte mit einem Ereignis in Verbindung stand, das 1878 hohe Wellen schlug: die Verfolgung und Gefangennahme des Frauenmörders Nathan Blake. Rückblickend betrachtet mag dieser Vorfall ebenso mysteriös erscheinen wie die Entdeckung der Kultstätte selbst, doch genau wie das Rätsel des Berges wird auch er vermutlich niemals vollständig aufgeklärt werden.
Sollten Sie sich also entschließen, Ihre nächsten Sommer- oder Winterferien in den zauberhaften Laurentinischen Bergen zu verbringen, lassen Sie sich die Stimmung nicht von alten Geschichten trüben. Genießen Sie Ihren Urlaub, fahren Sie Kanu, angeln Sie mit Ihren Kindern oder wandern Sie im Schnee. Und sollten Sie des Nachts in Ihrem Zelt erwachen und glauben, die Totentrommeln der Algonkin zu hören, drehen Sie sich einfach um und schlafen Sie weiter. Vermutlich waren es nur ein paar herabfallende Steine oder Äste, die im Wind gegeneinandergeschlagen haben.
1
London, heute …
Die Testamentseröffnung fiel auf einen Freitag den Dreizehnten. Kein aufsehenerregendes Datum, schließlich bin ich nicht abergläubisch. Schwarze Katzen, zerbrochene Spiegel und Tierkreiszeichen – dieser ganze Hokuspokus ist nichts für mich. Und was die Kirche betrifft, darüber möchte ich lieber schweigen, schließlich gibt es genug andere Dinge, um die ich mir Gedanken machen muss.
Der Verkehr war für einen solchen Tag normal. Die Strecke zwischen Phillimore und Kensington Gardens gehört zu den am stärksten befahrenen Abschnitten der Innenstadt. Hier ist eigentlich immer etwas los, besonders, wenn alle gegen Ende der Woche noch schnell ein paar Besorgungen machen wollen. Vor mir rauschte ein Mercedes zu dicht am Bordstein vorbei und besprühte ein paar unvorbereitete Passanten mit Gischt, was eine Welle der Wut und Empörung zur Folge hatte.
Es war ein Dezembertag wie jeder andere: stürmisch, regnerisch und von geradezu spektakulärer Bedeutungslosigkeit - wäre nicht vor drei Wochen meine Großmutter gestorben und mit ihr ein Großteil dessen, was mir an dieser Familie lieb und teuer war. Ihre kurze heftige Krankheit, ihr Tod und die Beerdigung hatten eine Leere hinterlassen, die ich weder erklären, noch auszufüllen vermochte. Es war, als würde ein Teil von mir mit in dieses Grab steigen, als würden all die Fragen, die ich ihr noch stellen wollte, nun niemals eine Antwort erfahren.
Rupert erwartete mich mit einem Regenschirm in der Hand. Er stand unter dem Vordach des Notariatsgebäudes und begrüßte mich auf unnachahmliche Weise: charmant, hochgewachsen, taktvoll – Markenzeichen der van Aldens. Er wusste, wie sehr ich meine Großmutter geliebt hatte.
»Hallo Eve.« Küsschen links, Küsschen rechts, ein warmherziger Händedruck. Genau, wie es das Protokoll verlangte. Meine Eltern sahen uns durch die Glastür zu, da verbot sich ein Kuss auf den Mund. Natürlich. Er trat einen Schritt zurück und betrachtete mich mit sorgenvollem Blick. »Du meine Güte, Käferchen. Du bist ja völlig durchnässt. Warum hast du keinen Schirm genommen?«
»Du weißt doch, ich mag den Regen.«
»Willst du damit sagen, du bist den ganzen Weg zu Fuß gelaufen? Warum hast du denn nicht angerufen, ich hätte dich doch mit dem Auto abgeholt.«
»Nicht nötig, es geht mir gut. Danke, dass du gekommen bist.«
»Ist doch eine Selbstverständlichkeit. An guten wie an schlechten Tagen, erinnerst du dich?«
Ich lächelte gequält. Mein Verlobter war in jeder Hinsicht perfekt. Gutaussehend, aufmerksam, wohlsituiert. Ein Mann mit Prinzipien. Er war gebildet, besaß Niveau und war obendrein auch noch Kirchgänger. Wo fand man so etwas heute noch? Ein Traum von einem Schwiegersohn, wie meine Mutter nicht müde wurde zu betonen.
Sein Blick wanderte zum bleigrauen Himmel hinauf. »Scheußliches Wetter. Gesellen wir uns zu den anderen?«
»Na klar, warum nicht?«
Ohne rechte Begeisterung hakte ich mich bei ihm unter und ließ mich ins Innere des Gebäudes führen. Ich wollte das alles möglichst schnell hinter mich bringen.
Das Notariat Waterstone, angeschlossen an eine Rechtsanwaltskanzlei für Erb- und Familienrecht, lag an der Kensington High Street, schräg gegenüber der St. Mary Abbot Church. Ein alter Bau mit Ziegelfassade und kleinen Fenstern, die wie Schießscharten in den grauen Tag blinzelten. In der Eingangshalle dominierte schwarzer Travertin.
Meine Mutter empfing mich, wie sie es immer tat: mit hochgezogener Augenbraue, den Kopf leicht zur Seite geneigt, ihr kleiner Mund unzufrieden und streitlustig. Der Mund einer Frau, die der Überzeugung war, dass sich das Leben gegen sie verschworen habe. Anscheinend hatte auch ich mich gerade wieder mal eines Vergehens schuldig gemacht, wenn ich die Signale richtig deutete. Ich blickte an mir hinab. Aber ja, ich trug die bordeauxrote Tweedjacke, die mir Großmutter Lizzy geschenkt hatte. Außerdem waren meine Schuhe vom Regen durchweicht, und mein Haar unordentlich und nass. Ein Affront!
Meine Mutter war ein wandelndes Ausrufezeichen in Sachen Benehmen und Etikette. Der Hut mit Schleier und Rose ruhte wie eine Feder auf ihrem leicht ergrauten Haar. Das auberginefarbene Betty Barclay Kleid saß tadellos und der Schal aus schwarzem Kaninchen glänzte, als würde er gleich davonhoppeln. Wie hätte ich jemals den Ansprüchen einer solchen Frau genügen können? Das war mir nicht gelungen, als ich noch ein kleines Mädchen war. Heute, mit sechsundzwanzig, war es schlimmer denn je.
»Du bist spät dran, Eve. Deine Brüder sind bereits vor dir eingetroffen, das will schon etwas heißen.«
»Ich habe die Entfernung unterschätzt«, erwiderte ich. »Aber es ist ja nichts passiert. Es hat ja noch nicht mal angefangen.«
»Sie ist zu Fuß gelaufen«, ergänzte Rupert. »Dabei hätte ich sie doch mitgenommen. Aber meine Liebste hat ihr eigenes Köpfchen und dafür liebe ich sie.« Er setzte mir einen Kuss aufs Haar.
Margrets behandschuhte Hand berührte seinen Oberarm. »Du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass mein kleines Mädchen doch noch jemanden gefunden hat. Damit war kaum noch zu rechnen. Nicht nach all den Versagern, die sie angeschleppt hat. Du machst mich sehr glücklich, Rupert.«
Ich verdrehte die Augen im Geiste und wandte mich meinem Vater zu. Grau und unscheinbar stand er im Hintergrund und lächelte mir zu. Auch das ein vertrautes Bild.
Alfred war früher ein anderer gewesen. Ein fröhlicher Mann, der zwar grauenhaft schlecht Witze erzählte, selbst aber gern und herzlich darüber lachte. Doch irgendwann während der letzten Jahre war er verstummt. Das Lachen war seltener geworden und einem Dauerschmunzeln gewichen, das wie aufgemalt wirkte. Er verließ die Kühle im Schatten meiner Mutter höchst ungern, und dann auch nur, wenn es darum ging, ihr einen Wunsch von den Augen abzulesen. Man sah ihn oft in irgendwelchen Zimmerecken stehen, gleich einem Farn oder Ficus, den Kopf gesenkt, dafür aber voller Gedanken. Mochte der Himmel wissen, an was er die ganze Zeit dachte. Vermutlich war es der Job, der ihn am Leben hielt, seine Praxis für Augenheilkunde und der Kontakt zu seinen Mitarbeitern und Patienten.
»Wo stecken denn eigentlich Paul und Jason«, fragte ich. »Ihr sagtet doch, sie wären bereits da?«
»Oh, sie sind drinnen bei Waterstone«, erwiderte Dad und deutete hinüber zu der schweren Kirschholztür. »Müssen noch ein paar Personalien nachtragen lassen, ihre neuen Anschriften und so. Aber ich denke … ah, da kommen sie.«
Die Tür schwang auf und Pauls verstrubbelter Kopf erschien. »Ihr könnt jetzt reinkommen.« Als er mich sah, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. »Hallo, Eve, schön, dich zu sehen. Wir hatten schon Sorge, du wärst verloren gegangen.«
»So schnell gehe ich nicht verloren, das weißt du doch«, sagte ich und grinste. Es war mir unmöglich, in Pauls Gegenwart ernst bleiben. Von meinen beiden Brüdern war er der jüngere und mein besonderer Liebling. Er studierte an der Royal Academy of Music und war unverschämt begabt. Sechstes Semester Geige und schon jetzt trudelten die ersten Orchesteranfragen ein.
»Klar, weiß ich doch«, sagte er. »Und ich weiß auch, was es dich für eine Überwindung gekostet haben muss, her zu kommen.« Er trat auf mich zu und schloss mich in die Arme. »Es tut mir so leid«, flüsterte er. »Ich wusste, wie viel sie dir bedeutet hat.«
»Lieb von dir«, erwiderte ich, gegen die Tränen ankämpfend. Ich war so verdammt nah am Wasser gebaut. »Sie hat ein erfülltes Leben gehabt und wäre sicher zufrieden gewesen, wie es jetzt gelaufen ist. Einschließlich ihrer Beerdigung.«
»Die Friedwaldbestattung war eine prima Idee«, sagte Paul. »Ein bescheidenes Grab unter Bäumen, das passt zu ihr.«
»Besser jedenfalls, als von einem kalten Marmorblock erschlagen zu werden«, ergänzte ich und warf einen kurzen Blick hinüber zu meiner Mutter, die nicht mal so tat, als würde sie weghören. Ihr Mund war auf einen winzigen Punkt zusammengeschrumpft, ihre Brauen bildeten eine durchgehende Linie.
Margret hatte die Friedwaldbestattung aufs Schärfste missbilligt, konnte aber nicht dagegen vorgehen, weil es von meiner Großmutter ausdrücklich so verfügt worden war. Noch heute war es mir ein Rätsel, wie diese beiden Frauen Mutter und Tochter sein konnten.
»Genug geredet.« Sie schnürte an uns vorbei. »Wir wollen Mr. Waterstone nicht warten lassen. Zeit ist schließlich Geld. Alfred, kommst du?«
Mein Vater folgte ihr treu ergeben und auch ich und Rupert gingen hinein. Paul schloss die Tür hinter uns.
Archibald Waterstone Senior war seit ewigen Zeiten der Notar unserer Familie. Ein gebeugter alter Mann von etwa fünfundsiebzig Jahren. Sein Haar bildete einen schlohweißen Kranz und auf seiner langen, spitzen Nase saß eine Brille, deren goldener Rand im Licht der Deckenleuchte kostbar schimmerte. Als er uns begrüßte, bewegte er sich langsam und vorsichtig, so, als bestünde er aus Glas. Doch kaum hinter seinem Mahagonitisch verschwunden, wurde er agil. »Nehmen Sie doch bitte Platz«, sagte er und deutete auf die bereitgestellten Stühle. Ich ließ mich nieder und genoss den würzigen Geruch, der den Lederpolstern entströmten.
»Wir haben uns heute hier versammelt, um das Testament von Mrs. Elisabeth Wachowski zu verlesen, und um ihren Nachlass zu regeln.« Waterstone legte die Hände auf zwei Aktenstapel, die vor ihm platziert lagen. »Mir liegen Aufstellungen über die gesammelten Besitz- und Vermögenswerte vor und ich möchte sie gerne im Einzelnen mit Ihnen durchgehen. Grundsätzlich kann ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass Ihre Mutter - beziehungsweise Großmutter - ein beträchtliches Vermögen hinterlassen hat, das sie zu gleichen Teilen sowohl zwischen ihrer Tochter Margret, sowie den drei Enkelkindern Jason, Eve und Paul aufgeteilt sehen möchte. Dabei muss zwischen Immobilienwerten, Aktien, Firmenanleihen, Gold und Barvermögen unterschieden werden. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne die Positionen im Einzelnen mit Ihnen durchgehen …«
Ich versank im Lederpolster. Zahlen, Konten und Depots ließen mich kalt. Klar, es war erstaunlich, wie reich meine Großmutter anscheinend gewesen war, aber im Gegensatz zum Rest der Familie hatte sie mich nur als Person interessiert.
Lizzy war eine Außenseiterin gewesen. Geboren in irgendeinem Kaff in Devon und über Umwege in London gelandet, wo sie meinem Großvater, einem Fotografen und Lebenskünstler, begegnet war. Die beiden durchlebten die Zeit des Aufbruchs, der Beatniks und der sexuellen Revolution, mieteten eine Wohnung und führten ein ziemlich verrücktes Leben. Sie reisten gerne, am liebsten im VW-Bus, hatten einige Jahre im Ausland verbracht, rauchten dann und wann etwas Gras und trieben sich, wenn sie mal wieder in London waren, vorwiegend in der Intellektuellenszene herum. Die Tatsache, dass mein Großvater für das Nova Magazine fotografiert hatte, war daran sicher nicht ganz unschuldig gewesen. Die beiden waren gern gesehene Gäste, sie waren witzig, intelligent und, wie alle, ein bisschen verrückt. Mit Lizzys Schwangerschaft und Margrets Geburt änderten sich die Dinge. Die Reisen wurden an die Schulferien gekoppelt, die Partys seltener, die Zahlen auf dem Bankkonto wuchsen. Nicht, dass sie es nötig gehabt hätten, Lizzy entstammte mütterlicherseits einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie, aber dieses Geld wurde nie angetastet. Stattdessen lebten sie vom Selbstverdienten, und das genügte, um sich dann und wann etwas leisten zu können. So wie die kleine, aber feine Kollektion von Hasselblad-Kameras meines Großvaters und Lizzys Indianerschmuck. Anhänger aus Türkis und Silberblättern, Schlangenringe mit Malachit oder Korallenketten - sie liebte das und war die Einzige, die es tragen konnte. Andere Frauen hätten lächerlich damit ausgesehen, bei ihr wirkte es authentisch. Niemand wusste, woher dieses Faible kam, und sie selbst gab darüber keine Auskunft. Nichts an ihr war indianisch und soweit mir bekannt gab es auch keinen familiären Hintergrund. Irgendwie hing es wohl mit ihrem Glauben zusammen, obwohl sie nicht darüber sprach. Aber in Zeiten, in denen die Menschen scharenweise nach Indien und in die Ashrams pilgerten, in denen Kristalle besungen und mit Wünschelruten umhergetanzt wurde, waren das ohnehin Peanuts. Lizzy war einfach ein bisschen anders, dabei aber bodenständig und realitätsbezogen. Außerdem war sie eine begnadete Heilerin. Ich war vielleicht drei oder vier, als mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass Menschen von nah und fern zu ihr kamen, um sich behandeln zu lassen. Nicht, dass sie eine medizinische Ausbildung gehabt hätte, das nicht. Sie war nur ungeheuer treffsicher in ihren Diagnosen. Sie fasste die Menschen an, horchte in sie hinein, sprach mit ihnen und verwies sie an den betreffenden Arzt. Für mich war sie ein Vorbild und der Grund, warum ich beschloss, Medizin zu studieren. Doch nun war sie tot, und nichts würde sie jemals wieder zurückbringen.
»… und damit kommen wir zum abschließenden Punkt des Letzten Willens, dem Haus und Grundstück an der Ecke Ladbroke Grove und Lansdowne Walk im Stadtteil Notting Hill«, hörte ich Waterstone sagen und erwachte aus meinem Tagtraum. »Frau Wachowski hat verfügt, dass das Haus sowie der gesamte Gartenanteil an ihre Enkelin Eve fällt, in der Hoffnung, der Besitz möge ihr Freude bereiten.« Er schob die Brille zurück auf die Nasenwurzel. »Wenn Sie erlauben, möchte ich an dieser Stelle aus dem Letzten Willen Ihrer Großmutter vorlesen:
Liebe Eve, ich kann nur vermuten, wie sehr mein Tod dich schmerzt. Jemandem, der uns nicht kennt, mag es schwerfallen, zu begreifen, was uns verbindet. Aber die vielen Wochen und Monate, die wir zusammen waren und in denen wir geredet, gelesen und geträumt haben, waren etwas ganz Besonderes. Für mich bist du mehr als nur meine Enkelin. Du bist eine Geistesverwandte, eine Ojichaagwan. Manch einer wird mich für verrückt halten, aber ich glaube fest daran, dass das Bewusstsein der Menschen auf ihre Gebäude übergehen und dass unsere beiden Seelen in diesem Haus vereint sind. Mir war immer bewusst, wie sehr dich die Fragen deiner Herkunft und Familie beschäftigen, und ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, mehr darüber zu erfahren. Es ist ein langer Pfad, und er wird Strapazen und Schmerzen bereithalten, aber vielleicht lernst du etwas über dich und bist für das Leben danach besser gewappnet. Ich möchte, dass du mein Haus erbst und dort glücklich wirst. In Liebe, deine Lizzy.«
Waterstone richtete sich auf und öffnete eine Schublade. »Zusammen mit dieser Nachricht wurde etwas für Sie hinterlassen.« Er legte einen Luftpolsterumschlag auf den Tisch.
Ich entnahm ihm zwei Schlüssel, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können: einen unscheinbar aussehenden Haustürschlüssel, wie er zu jedem handelsüblichen Sicherheitsschloss passte, und einen anderen. Größeren.
Ich musterte ihn und drehte ihn zwischen den Fingern hin und her.
»Keine Ahnung, wozu der gehört«, sagte ich. »Diesen Schlüssel habe ich noch nie gesehen.«
»Tatsächlich?« Waterstone hob eine Braue. »Nun, mir liegen auch keine Informationen darüber vor. Sie werden das Rätsel vermutlich alleine lösen müssen.«
»Sieht so aus«, sagte ich und strich sanft mit dem Finger über das schwere Messing. Es fühlte sich an, als wäre es elektrisch aufgeladen. Ich bemerkte den argwöhnischen Blick meiner Mutter, ging jedoch nicht darauf ein.
»Nun, was immer Sie herausfinden werden, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Mögen Sie in diesem Haus glücklich werden. Und den anderen möchte ich sagen: Falls etwas unklar sein sollte, oder Sie Fragen haben, ich stehe rund um die Uhr für Sie bereit. Ich kannte Frau Elisabeth Wachowski seit über vierzig Jahren. Sie war eine besondere Frau und eine gute Freundin. Ich fühle mich ihr gegenüber besonders verpflichtet. Wenn Sie also Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, mich anzurufen. Und nun möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Haben Sie noch einen schönen Tag.«
2
Der Anblick des Hauses weckte eine Flut von Erinnerungen. Der Ziegelbau mit seiner Unzahl von kleinen Türmen und Schornsteinen war mir lange Zeit eine zweite Heimat gewesen. Ein lustiges, verwinkeltes Gebäude, dem der unverwechselbare Charme von Londons Kleinbürgertum anhaftete. Der weiß verputzte Eingangsbereich mit seinen zwei Säulen und dem darüber aufragenden Erker, den man über den zweiten Stock erreichen konnte, ließ sofort eine vertraute Wärme in mir aufsteigen. Wenn ich mich umdrehte, blickte ich direkt auf den Ladbroke Square Garden mit seinen alten Bäumen, den großen Rasenflächen und den weißen Bänken. Hier hatte ich oft mit Lizzy meine Decke ausgebreitet und ein Picknick veranstaltet. Hier hatten wir Federball gespielt, Frisbeescheiben und Bumerangs geworfen und nachts zu den Sternen hinaufgeblickt. Die langen, heißen Sommer hatte ich fast ausschließlich in diesem Haus verbracht, und selbst die Urlaube mit meinen Eltern und Geschwistern verblassten angesichts der großartigen Zeit, in der ich hier hatte wohnen dürfen.
Und nun sollte es mir gehören.
Ich stand immer noch sprachlos auf dem Bürgersteig, als ich das Herannahen von Schritten hörte. Mir blieb kaum Zeit, mich vom Anblick des Hauses zu lösen, als ich auch schon gepackt und umarmt wurde. »Komm her und lass dich drücken, kleine Eve.«
Wer mich da so stürmisch an ihren gewaltigen Busen drückte, war niemand anderes als meine beste Freundin Rita, mit der ich zusammen Medizin am University College Hospital studierte. Eine achtzig Kilo schwere Wuchtbrumme mit feuerroten Haaren, hellblauem Lidschatten und klingelndem Ohrgeschmeide.
Rita Cole war eine Naturgewalt. Ein Tsunami mit scharfem Verstand, blitzenden Augen und einem Mund, der immer zum Lachen, Küssen oder Essen bereit war. Verglichen mit ihr, war meine Familie Toastbrot.
Als ich mich endlich aus ihrem Griff löste, war ich völlig benebelt. Ich sah Tränen in ihren Augen schimmern und hätte fast selbst angefangen zu weinen.
»Ach, meine Kleine«, sagte sie. »Wenn ich nur wüsste, wie ich dich aufmuntern kann. Aber ich bin selbst so nah am Wasser gebaut, dass ich bestimmt keine große Hilfe für dich bin.«
»Doch, das bist du«, erwiderte ich. »Ich könnte mir niemanden vorstellen, den ich jetzt lieber an meiner Seite hätte. Als ich von der Erbschaft erfuhr, konnte ich es selbst kaum glauben. Ihr Haus. Ich bin immer noch ganz überwältigt.«
»Wie hat denn deine Familie darauf reagiert?«
»Dreimal darfst du raten.«
»Ich hoffe, sie haben sich für dich gefreut. Schließlich sind sie ja selbst auch sehr gut weggekommen, wie du mir am Telefon erzählt hast.«
»Könnte man meinen, ja«, sagte ich. »Klar, meine Brüder und Papa haben sich gefreut, aber du kennst ja meine Mutter.«
»Allerdings …«
»Sie war verstimmt, weil sie keine Sonderbehandlung erfahren hat. Sie musste sich die Erbschaft mit ihren drei Kindern teilen, und das geht natürlich gar nicht.« Während ich mit dem Schlüsselbund klingelte, verstellte ich meine Stimme und schlug einen klagenden Singsang an: »Was hat sich Elisabeth nur dabei gedacht? Was soll denn mein kleines Mädchen mit diesem alten Haus anfangen? Wenn es wenigstens ein schicker Neubau in Chelsea gewesen wäre, den hätte man bei den derzeitigen Immobilienpreisen sicher gut verkaufen können. Aber so eine völlig verbaute Hütte … da müsste man erst mal von Grund auf sanieren … und was das kostet dieser Tage …«
Rita verdrehte die Augen. »Eine der schönsten Wohnlagen Londons, und deine Mutter hat immer noch etwas zu mäkeln.«
» … na ja, das Grundstück mag für Liebhaber ja einen gewissen Reiz haben, aber so nah an der Portobello Road … mit all diesen seltsamen Menschen. Davon abgesehen wirst du ja ohnehin bald bei Rupert einziehen, nicht wahr, Liebes? Eine Familie gründen, Kinder bekommen …«
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«
»Wort für Wort. Ich glaube allerdings, dass es etwas mit unserer Familiengeschichte zu tun hat. Irgendwie scheint ihr die ein Dorn im Auge zu sein, und sie möchte verhindern, dass ich zu tief darin herumwühle. Ich habe ein paarmal versucht, das Thema darauf zu lenken, aber sie kam nur mit Ausflüchten. Ich hatte dir ja bereits erzählt, dass ich das Gefühl habe, sie würde sich für irgendetwas in der Vergangenheit furchtbar schämen, ich habe nie Genaueres erfahren. Auch nicht von Lizzy. Sie sagte, eines Tages würde ich schon selbst darauf kommen …«
»Und dein Vater?«
»Alfred stand wie gewohnt daneben und schmunzelte. Aber ich nehme ihm das nicht übel. Er muss mit dieser Frau Tag für Tag leben, da will er sich natürlich nicht gegen sie stellen.«
»Ist ihr denn überhaupt nicht klar, was dir deine Großmutter bedeutet hat? Ich meine, die Zeit, die du hier verbracht hast, euer Vertrauensverhältnis …«
»Margret ist extrem phantasielos, wenn es darum geht, sich in andere hineinzuversetzen. Sie hat Lizzy nie wirklich verstanden, was dazu geführt hat, dass die beiden sich ziemlich auseinandergelebt haben.« Ich zuckte die Schultern. »Aber ich habe keine andere Reaktion erwartet. Für meine Brüder freue ich mich, und was Margret und Alfred mit ihrem Geld machen, ist mir egal.«
»Und Rupert?«
»Tja, das könnte ein Problem werden …«
»Wieso?«
Ich warf einen kurzen Blick in Richtung Park. »Er möchte weg von hier.«
»Weg von London?«
Ich nickte. »Er hat das Angebot bekommen, die Zweigstelle der Kanzlei in Edinburgh zu übernehmen. Sein Vater meint, er sei jetzt erfahren genug, und hat ihm den Posten angeboten. Rupert würde dadurch in den Vorstand aufrücken.«
»Ja, aber … Schottland?« Rita schnappte nach Luft wie ein Goldfisch auf dem Trockenen. »Und was hast du geantwortet?«
Ich zuckte erneut mit den Schultern. Langsam wurde ich schon wie mein Vater.
»Nein. Das glaube ich nicht. Du spielst tatsächlich mit dem Gedanken …«
»Noch ist nichts entschieden.«
»Aber was ist mit uns? Mit deinem Studium? Ich dachte, wir ziehen das gemeinsam durch. So, wie wir es immer geplant hatten.«
»Ich könnte mir ein freies Jahr nehmen und mich dann auf die Uni Edinburgh umschreiben lassen. Die städtische Klinik dort hat einen guten Ruf. Ich habe gehört, dass sie da händeringend nach guten Leuten suchen …«
Die Luft entwich aus Ritas Mund wie aus einem geplatzten Ballon. »Dafür, dass noch nichts entschieden ist, hast du dich aber schon recht gut informiert. Ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.«
Ich versuchte es mit einem Lächeln, aber es wollte mir nicht recht gelingen. »Nicht sehr viel, wie es scheint.«
»Das wäre noch untertrieben.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn du mich fragst, du machst da einen Riesenfehler. Haus, Ehemann, Kinder, das passt nicht zu dir. Das ist deine Mutter, die da spricht.«
»Vielleicht bin ich ja reifer geworden«, erwiderte ich, vielleicht eine Spur zu heftig. »Woher willst du wissen, dass ich mir nicht genau so ein Leben wünsche?«
»Weil ich dich kenne, Herzchen. Und ich kenne Margret und Rupert.«
»Rupert ist in Ordnung, lass ihn aus dem Spiel.«
Sie stemmte die Hände in die Hüften und sah mich schräg an. »Jetzt mal ehrlich: Rupert ist ein angepasster Spießer. Typen wie er leben noch in den Fünfzigern. Er will, dass alles geregelt und geordnet ist, damit seine Karriere reibungslos abläuft. Ziemlich egoistisch, wenn du mich fragst. Oder hast du das Gefühl, dass er sich wirklich für dich und deine Träume interessiert? Wenn dem so ist, halte ich umgehend meine Klappe. Tatsache ist aber, dass ich es bin, die jetzt hier neben dir steht, und nicht er. Klar, er ist nett und sieht gut aus, aber wenn der Lack erst mal ab ist, kommt der Rost durch. Denk an meine Worte.«
Ich presste die Lippen aufeinander. Ich hatte Rita nicht hergebeten, um mich von ihr auf offener Straße maßregeln zu lassen. »Könnten wir jetzt bitte hineingehen?«, fragte ich. »Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal einen Tee.«
Meine Freundin stand einen Moment lang unschlüssig neben mir, dann senkte sie den Kopf. »Sorry, Kleines, da sind wohl gerade die Gäule mit mir durchgegangen. Ich wollte dich nicht in die Enge drängen, es kam nur so überraschend. Du wirst wissen, was am besten für dich ist. Ich hatte kein Recht, dich so anzufahren. Was ich gesagt habe, tut mir leid, ehrlich.« Sie legte den Arm um mich und drückte mir einen Kuss aufs Haar. »Und jetzt komm. Ich glaube, es wird gleich wieder zu regnen anfangen.«
Ich nahm den Haustürschlüssel und steckte ihn ins Schloss.
Alles war noch genau so, wie ich es in Erinnerung hatte. Nichts hatte sich verändert. Weder der überschwänglich mit Pflanzen und Buddhastatuen dekorierte Eingangsbereich noch der Geruch nach Räucherstäbchen und Curry, der die Räume durchwehte wie einen indischen Tempel. Dieser Duft war so fest mit dem Gemäuer verwoben, dass er als olfaktorischer Fingerabdruck gelten konnte. Ich lauschte.
Fast bildete ich mir ein, Lizzy herumlaufen zu hören. Leise, wie sie es immer tat, mit einem kleinen Lied auf den Lippen oder etwas klassischer Musik im Hintergrund. Es war gespenstisch, wie präsent sie noch immer war. Als würde sie jeden Moment um die Ecke kommen und uns begrüßen. Doch das geschah natürlich nicht. Alles war still. So still, dass es in den Ohren dröhnte. Nicht mal das Ticken der Standuhr war zu hören. Ich war froh, Rita bei mir zu haben, die Gefühle hätten mich sonst überwältigt.
Vom Flur mit seiner Garderobe und Schuhablage ausgehend, zweigten zwei Glastüren ab, durch die man in die Küche und das Wohnzimmer gelangte. Keine der Türen ähnelte der anderen. Die Bleiverglasungen waren mit Jugendstilmotiven besetzt und leuchteten in unterschiedlichen Blau- und Grüntönen. Da es heutzutage kaum noch jemanden gab, der diese Art von Einlegearbeiten anfertigte, war meine Großmutter immer sehr darauf bedacht gewesen, dass ihnen nichts zustieß. Ballspiele jeglicher Art waren im Haus verboten gewesen, Herumrennen und Fangenspielen sowieso. Wer toben wollte, ging in den Garten oder besser noch in den Park, der ja direkt vor der Haustür lag. Links von der Küche befand sich eine unscheinbare Holztür, die in den Keller führte. Noch weiter links eine massive nachgedunkelte Holztreppe, über die man in den oberen Stock gelangte.
Ich zog den massiven Messingschlüssel aus meiner Jeans und wog ihn nachdenklich in der Hand. Für einen Türschlüssel war er zu klobig und zu unförmig. Eine Schublade vielleicht oder ein Schrank?
Rita sah mich neugierig an. »Wo sollen wir anfangen?«
»Keine Ahnung. Am besten, wir gehen systematisch vor. Raum für Raum, von unten nach oben, so lange, bis wir wissen, wozu er passt. Bist du bereit?«
Die Suche entwickelte sich zu einer Reise durch die Vergangenheit. Durch die Gärten des Vorderen Orients, die Ornamente und den Schmuck Nordamerikas bis hin zu den Skulpturen und Götterbildern Mittel- und Südamerikas. In den Bücherregalen stapelten sich Bildbände zu den Mayas und Azteken, den Dogon und Anasazi, hin zu den Tempeln und Wundern fernöstlicher Kulturen. Die Städte Babylon, Ur, Machu Picchu, Tikal - das war ihr Ding gewesen. Lizzy war zeit ihres Lebens fasziniert gewesen von Kunst, Mythen und Spiritualität, vor allem aber liebte sie die Legenden und Überlieferungen der frühen Hochkulturen. Viele dieser Länder hatte sie selbst bereist, in einigen, wie zum Beispiel Nepal, sogar längere Zeit gelebt. Zwischen Traumfängern und Sonnensymbolen hingen Fotos, die meine Großmutter als junge Frau zeigten. Zu Pferd durch den Hindukusch, mit Rucksack und Wanderstab im Kaukasus oder auf dem Rücken eines Dromedars im Atlasgebirge. Ich kannte diese Bilder seit meiner frühesten Kindheit, aber für Rita schien das alles neu zu sein. Alle paar Minuten musste sie stehen bleiben und die Exponate in Augenschein nehmen.
»Das ist ja unglaublich«, murmelte sie. »Ich komme mir vor wie in einem Museum. Die ganze Welt in einer Nussschale. Mir war nicht bewusst, dass deine Großmutter so viel herumgekommen ist.«
»Warst du denn noch nie hier?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin immer nur bis zur Wohnungstür gekommen, ein paarmal bis in der Küche. Gerade lang genug, um Hallo zu sagen, einen Schluck zu trinken und mit dir in den Park zu düsen. Deine Großmutter hat mich nie hereingebeten, deshalb dachte ich, es wäre ihr vielleicht unangenehm. Wenn ich gewusst hätte, was für Schätze hier lagern …«
»Hat sich ganz schön was angesammelt über die Jahre«, sagte ich. »Viele Sachen kenne ich natürlich, aber noch längst nicht alle. Dies hier zum Beispiel muss sie in jüngerer Zeit erworben haben.« Ich hielt ein Lederband hoch, an dem ein dunkelblauer Stein hing. Er lag auf dem Schreibtisch neben einigen anderen Schmuckstücken.
»Sieht indianisch aus.«
»Und ziemlich alt. Nicht so ein billiger Tand von irgendeinem Straßenhändler. Ein Stück mit Geschichte.« Ich hielt ihn dicht vors Auge. Er war überraschend schwer und mit blauen, schimmernden Adern durchzogen.
»Ich bin kein Fachmann in Gesteinskunde«, sagte Rita, »aber das scheint ein Korund sein. Ein heiliger Stein der Ureinwohner Nordamerikas.«
»Lizzy hat sich immer sehr für die indianische Kultur interessiert. Sie war mal drüben und hat längere Zeit dort gelebt. Anfang der Achtziger war das, glaube ich, nachdem Margret bei ihr ausgezogen ist. Vielleicht hat sie das Amulett von dort mitgebracht.«
»Woran ist sie eigentlich gestorben? Ich meine, neunundsiebzig ist doch kein Alter für eine solche Frau.«
»Der ärztliche Befund lautete schwerer Schlaganfall«, sagte ich. »Eine Ablagerung in ihrer Halsschlagader, die sich gelöst und das Gehirn erreicht hat. Zack. Das Herz war es jedenfalls nicht, habe ich mir sagen lassen. Es muss sehr schnell gegangen sein. Ich hoffe, sie hat nicht gelitten.« Ich schluckte.
Da war es wieder, dieses Gefühl der Leere und Hoffnungslosigkeit, das ich schon während der Beerdigung gehabt hatte. Ich atmete tief durch. »Immerhin kann sie sich nicht vorwerfen, etwas im Leben ausgelassen zu haben. Sex, Drugs and Rock’n Roll, du verstehst?«
»Gras?«
»Bis zum Schluss. Nicht viel, aber regelmäßig. Ich wette, wenn wir einen Blick in diese vielen bemalten und lackierten Holzdöschen werfen, finden wir irgendwo noch ein paar Bröckchen Schwarzer Afghane. Auch in Sachen Alkohol war sie kein Kind von Traurigkeit. Das war übrigens mit ein Grund, warum Margret es immer gehasst hat, wenn ich mich hier länger aufgehalten habe. Sie fürchtete, ich könnte versehentlich etwas davon in die Finger bekommen.«
»LSD?«
»Na klar, was denkst du denn? Das gehörte damals doch fast schon zum guten Ton, genau wie Koks. Aber nichts davon hat sie süchtig gemacht. Sie war nur einfach verdammt neugierig und wollte viel ausprobieren.«
Rita grinste. »Eine ziemlich coole Bitch, deine Großmutter, das muss ich schon sagen. Ich wünschte, ich wäre so lässig drauf, wenn ich mal so alt bin. Hat sie noch weitere Kinder?«
Ich schüttelte den Kopf. »Margret ist Einzelkind geblieben. Ich glaube, sie war bereits als kleines Mädchen so anstrengend, dass Lizzy die Nase voll hatte. Vielleicht entspringt ihre Zuneigung zu mir ja einem tiefen Wunsch nach weiteren Kindern, aber, wie gesagt: es blieb bei der einen Tochter.«
»Und wie sah’s mit Männern aus?« Sie warf mir ein bedeutungsvolles Zwinkern zu.
»Darüber wurde nicht gesprochen. Obwohl ich von etlichen Verehrern weiß und auch glaube, dass nach Jackys Tod noch einiges gelaufen ist. Aber sicher bin ich nicht. Lizzy hat meinen Großvater abgöttisch geliebt. Er und sie, das war wie Bonnie und Clyde. Wie Red Butler und Scarlett O'Hara – eine Romanze, bei der die Post abging. Bis zu dem Tag, an dem er bei diesem Bombenanschlag ums Leben kam.«
»Ein Bombenanschlag? Das wusste ich gar nicht.«
»Habe ich das nie erzählt? Er war Fotograf, der unter anderem für das Nova Magazine fotografiert hat. Sie wurde irgendwann in den Siebzigern wieder eingestellt.«
»Und der Bombenanschlag? Hatte die IRA etwas damit zu tun?«
Ich nickte. »Das war am 27. März 1976. Es gab eine Fotoausstellung im Earls Court, als oben an der Rolltreppe eine Bombe explodierte, die in einem Mülleimer deponiert worden war. Jacky war sofort tot, viele andere wurden schwer verletzt.«
»Scheiße …«
»Da es ein Terroranschlag war, wurden die Ermittlungen auch in Richtung der Opfer ausgedehnt. Konnte ja sein, dass sich einer der Attentäter versehentlich selbst in die Luft gejagt hatte. Jedenfalls kamen die Ermittler zu uns nach Hause und stellten alles auf den Kopf. Kannst dir ja vorstellen, was in dieser Zeit bei uns los war.«
»Lebhaft …«
»Ich glaube, in dieser Zeit distanzierte sich meine Mutter innerlich von Lizzy. Sie wollte nichts mit Flower Power, Drogen und der ganzen Kriminalität zu tun haben. Sie war fünfzehn und hat das alles voll mitbekommen. Sie muss wohl wegen ihrer Hippieeltern in der Schule fürchterlich gehänselt worden sein. Bis hin zu dem Punkt, an dem sie sich schwor, nichts mehr damit zu tun haben zu wollen.«
»Irgendwie verständlich …«
»Schon. Aber dass es gleich so extrem sein musste …« Ich seufzte. »Doch ich will hier nicht über meine Mutter sprechen, sondern endlich ein Schloss für diesen verdammten Schlüssel finden. Bisher sind wir nicht besonders weit gekommen. Ich habe alle Schubladen, Schränke und Schatzkästchen hier unten durchprobiert.«
»Dann lass uns woanders weitersuchen.«
»Abgemacht.«
Wir suchten im Keller, in der Küche, im Speiseraum, draußen im Gartenhäuschen, dann oben im Bad, im Schlafzimmer, im Gästezimmer und im Wintergarten. Überall Fehlanzeige. Blieb nur noch der Dachboden. Wir waren verstaubt und verschwitzt. Die erste Euphorie war einem Gefühl von Ernüchterung gewichen.
»Und wenn der Schlüssel nirgendwohin passt?«, fragte Rita.
Ich zuckte die Schultern. »Dann weiß ich auch nicht weiter. Lizzy hat keine anderen Immobilien. Sie sagte immer, wer reisen will, darf sich nicht zu viele Klötze ans Bein binden. Aber uns bleibt ja noch der Dachboden.« Ich nahm den langen Stielhaken aus der Besenkammer, und gemeinsam machten wir uns auf den Weg nach oben.
Der Dachboden war für mich immer ein verzauberter Ort gewesen. Im Alter von sechs Jahren hatte mir Lizzy zum ersten Mal Alice im Wunderland vorgelesen, und seitdem war ich süchtig nach diesem Buch. Für mich war klar, dass sich die Tür zum Kaninchenbau nicht etwa unter einem Baum befand, vielmehr war sie hier, hoch oben in einem Dachstuhl. Ich konnte mich erinnern, dass ich sehr oft alleine hier oben gewesen war und mit meinen Stofftieren ein Teekränzchen abgehalten oder eine Partie Schach gespielt hatte. Seit meinem letzten Besuch hier oben mochten gut zehn Jahre vergangen sein, und ich spürte ein nervöses Kribbeln. Ob der alte Zauber noch immer wirkte?
Den Stab fest umklammernd, erreichte ich den obersten Stock. Über uns war eine Falltür in der Decke eingelassen, die man mittels eines Riegels öffnete. Ich schob den Haken durch die Öse und zog die Klappe herunter. Die Spannfedern gaben ein knarrendes Geräusch von sich, als ich die Ausziehleiter nach unten zog und dann hinauf kletterte. Rita zögerte kurz, als überlegte sie, ob die schmale Holzleiter sie wohl tragen würde, dann folgte sie mir.
Ich war bereits oben, als ich sah, wie sie ihren Kopf durch die Luke schob. »Gibt es hier irgendwo einen Lichtschalter?«
»Da drüben an dem Pfosten«, erwiderte ich. »Warte einen Moment, ich mache es uns etwas heller.«
»Pass bloß auf, dass du nicht stolperst.«
Im schummerigen Licht ertastete ich mir den Weg durch das Labyrinth aus Kisten, alten Möbeln und Regalen. Im Laufe der Jahrzehnte hatte sich ganz schön was angesammelt. Ich fand den Schalter und betätigte ihn. Eine einzelne Glühbirne flammte auf.
»Wow.« Rita sah sich um. Das Licht der Lampe schimmerte in ihren Augen. Sie hatte denselben Ausdruck, wie ich ihn wohl damals gehabt haben musste, als ich den Raum zum ersten Mal gesehen hatte.
Sie kletterte nach oben, machte ein paar Schritte und konnte sich nicht sattsehen. »Also das nenne ich mal einen schönen Dachboden«, sagte sie. »Nicht so eine Abstellkammer wie in den meisten Häusern. Ein richtig gemütliches kleines Nest.«
Ich konnte nicht anders, als ihr beipflichten. Die Magie war sofort wieder da. Im Zentrum des spitzwinkeligen Dachstuhls lag ein alter, ausgefranster Teppich, um den einige abgewetzte Sessel standen. Zum Schutz gegen Staub und eindringende Feuchtigkeit waren sie mit Plastikfolien abgedeckt. Die niedrigen Regale und Faltkisten waren bis zum Anschlag mit Büchern, Spielen, Schachteln, Puppen, Kissen und sonstigem Krimskrams vollgestopft. Ich ging in die Hocke, zog das eine oder andere heraus und betrachtete es liebevoll. Im Nu war ich von herumfliegendem Staub umgeben. Er roch muffig und stach mir in die Nase. Mein Gott, war das alles lange her. Als hätte ich eine Zeitmaschine betreten - als würden die Jahre von mir abfallen und das kleine Mädchen zum Vorschein kommen, das damals hier gespielt hatte.
Das meiste war unverändert, doch es gab auch neue Stücke. Ein mächtiger Globus zum Beispiel, der von Licht und Wasser fleckig und braun geworden war. Oder die geschnitzte, etwa ein Meter zwanzig hohe Figur eines schwarzen Mädchens aus der Kolonialzeit, die auf dem Kopf eine Schüssel trug, in die man Obst legen oder eine Pflanze stellen konnte. Aber da war noch etwas anderes und Rita hatte es ebenfalls entdeckt. »Schau mal dahinten«, sagte sie. »Sieht aus wie eine Truhe oder so.«
Oder so. Genau.
3
Die Truhe war neu. Nicht fabrikneu, sondern neu im Sinne von noch nie gesehen. Ein solch schweres, aus antikem Holz zusammengeschustertes Unikum wäre mir bestimmt aufgefallen. Unwillkürlich stellte ich mir die Frage, wie Lizzy den Transport auf den Dachboden wohl bewerkstelligt hatte. Bestimmt hatte sie die Kiste nicht alleine geschleppt. Aber selbst die Vorstellung von zwei muskelbepackten Transporteuren, die sich die schmale Leiter hinaufquälten, schien mir abwegig. Und dennoch, die Spuren auf dem Boden ließen keinen Zweifel: die Truhe war kürzlich bewegt worden.
Breite Metallbänder umspannten das Holz, zusammengehalten von einem vorsintflutlich anmutenden Vorhängeschloss. Der Schlüssel in meiner Hand schien schwerer zu werden. Rita sah mich neugierig an.
»Größe und Form könnten stimmen.«
»Wir werden sehen.« Ich steckte ihn ins Schloss. Ein sanfter Widerstand, ein sattes Klicken, dann sprang es auf.
Der Deckel gab beim Anheben ein knarrendes Geräusch von sich. Ein Geruch von Alter stieg mir in die Nase. Altes Leder, altes Papier, altes Holz, dahinter eine ferne Andeutung von Harz und Gewürzen. Wenn das Abenteuer einen Duft hat, so war es dieser. Mir schlug das Herz bis zum Hals.
»Du lieber Himmel«, stieß Rita aus. »Was ist denn das? Sieht aus wie der Koffer eines Kolonialwarenhändlers.« Ich hätte es nicht treffender formulieren können. »Lass uns nachsehen«, sagte ich und wühlte ein bisschen darin herum. Nicht zu wild, denn die Dinge schienen alle einen festen Platz zu haben. »Was haben wir hier? Eine Feder, eine Silberkette, Steine, Baumrinde, daneben einige in Leder gebundene Folianten. Oh, und hier ist etwas, das wie ein Tagebuch aussieht.«
»Vielleicht solltest du noch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, sondern zunächst hiermit beginnen.« Rita deutete auf den länglichen Umschlag, der ursprünglich obenauf gelegen hatte, durch unsere Öffnungsaktion aber etwas zur Seite gerutscht war. Das Papier war schwer und mit einer leichten Leinenstruktur versehen. Ich zog ihn hervor und erkannte die Handschrift meiner Großmutter.
»Für Eve«, las ich vor. »Erst nach meinem Tod zu öffnen.«
Mit einem vielsagenden Blick in Ritas Richtung, drehte ich ihn um. Der Umschlag war verschlossen, die Klappe mit Wachs versiegelt. In der Kiste lag ein Armeemesser, die Klinge schwarz vom Alter. Vorsichtig schlitzte ich das Papier auf, legte das Messer zur Seite und zog zwei eng beschriebene Seiten hervor. Die Schrift war klein und ich musste etwas ins Licht rücken, um besser sehen zu können.
Ich überflog die Zeilen und was ich las, machte mich nur noch stutziger. Rita sah mich an, wie ein Hund, der um einen Knochen bettelt. Auf ihren Lippen formte sich das Wort: Bitte. Ich lächelte.
»Meine kleine Eve«, las ich laut vor. »Wenn du dies hier liest, werde ich nicht mehr bei dir sein. Sei nicht traurig. Ich habe ein schönes Leben gehabt, und es gibt nichts, was ich bereue. In der Truhe findest du viele Dinge, die dir fremd erscheinen mögen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dir nicht früher davon erzählen soll, glaube aber, es ist besser, wenn du alleine auf Entdeckungsreise gehst. So wie ich, als ich vor dreißig Jahren loszog, um das Unbekannte zu erkunden. Manchmal muss man alleine gehen, um die Dinge klarer zu sehen.
Was dich erwartet, ist eine Geschichte, so seltsam und faszinierend, dass es schwer sein wird, sie zu glauben. Aber sie ist wahr, Wort für Wort. Überstürze nichts und ziehe keine voreiligen Schlüsse. Lass dir Zeit. Nicht alles, was auf den ersten Blick abgründig erscheinen mag, ist wirklich dunkel. Manchmal genügt eine kleine Veränderung des Blickwinkels, um die Dinge anders zu bewerten.
Ich weiß, wie sehr wir uns wünschen, mehr über uns, über unsere Eltern und Ahnen zu erfahren. Du genau wie ich. Nicht jeder hat das Glück, das Geheimnis seiner Herkunft zu lüften. Einhundert oder zweihundert Jahre können eine lange Zeit sein. Armut, Kinderlosigkeit, Kriege – es gibt so viele Gründe, warum manche Geschichten im Nebel verschwinden. Oft sind die Hinweise zu spärlich, als dass es sinnvoll wäre, die Spuren nachzuzeichnen. Doch in unserem Fall ist es mir gelungen, so viele Puzzlesteinchen zusammenzusetzen, dass man ein einigermaßen vollständiges Gesamtbild erhält.
Als ich mich damals auf das Abenteuer einließ, hatte ich keine Ahnung, wohin es mich führen würde. Ich wusste nur, dass in mir eine Kraft schlummerte, die nicht ruhen wollte, bis auch das letzte Geheimnis gelüftet wäre. Ganz gelungen ist mir das zwar nicht, aber was ich erfahren habe, genügt, um irgendwann in ferner Zukunft die Augen schließen zu können und das Gefühl zu haben, die Fackel weiterzureichen. Die Fackel, die du nun in Händen hältst.
Das klingt ziemlich pathetisch, ich weiß, aber bitte gönne mir dieses kleine Vergnügen. Immerhin haben nicht viele Frauen meines Alters die Freude, ihren Hinterbliebenen eine beinahe lückenlose Familienchronik vorweisen zu können.
Unsere Wurzeln reichen bis nach Nordamerika. Es mag 1981 gewesen sein, dass ich zum ersten Mal davon hörte. Es war während eines Vortrags über die Indianer der nordamerikanischen Ostküste und ihrer Legenden. Ich erinnerte mich, dass mein Vater, der polnische Musiker und Komponist André Wachowski, mir diese Geschichte erzählt hat. Ich habe sie in meiner kindlichen Erinnerung als Märchen abgespeichert, aber das stimmt nicht. Die Geschichte handelte von einer unheimlichen Kreatur, die tief in den Bergen lebt und die den Menschen ihr Herzen stiehlt. Über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende, hatte sie dort gehaust und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Bis sie eines Tages besiegt wurde. Nicht etwa von Kriegern auf Pferden oder von Siedlern mit Planwagen und Gewehren, sondern von zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können. Einer jungen Frau, strahlend wie der Tag, und einem Mann, finster wie die Nacht. Ihre Geschichte hat sich in den Mythen und Legenden der Region niedergeschlagen. Ich erinnerte mich, dass mein Vater einen Namen nannte, und beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Dieser Namen war das erste Puzzlesteinchen einer Reihe von Hinweisen und Indizien. Er war es, der die Lawine ins Rollen brachte. Er lautet Nathan Blake. Du wirst später von ihm erfahren.
Als ich diese Truhe von meiner Reise mitbrachte, wusste ich bereits, dass sie einiges an familiärem Sprengstoff enthielt. Ich stellte sie an einen vermeintlich sicheren Ort, doch leider stellte sich heraus, dass er nicht ganz so sicher war wie erhofft. Nach einigen unerfreulichen Begebenheiten, auf ich hier nicht näher eingehen möchte, ließ ich die Truhe auf den Dachboden schaffen, wo sie nun auf dich wartet.
Du wirst viele Gegenstände entdecken, die dir unsinnig oder befremdlich erscheinen mögen: Steine, Federn, Rindenstücke. Ich möchte dich bitten, nichts davon wegzuwerfen. Zumindest jetzt noch nicht. Sie alle haben eine tiefere Bedeutung. Auch eine Menge Briefe, Zeitungsausschnitte und alte Fotos sind vorhanden. Ich habe sie chronologisch geordnet, um dir die Arbeit zu erleichtern. Die wichtigste Quelle – der Punkt, an dem du beginnen solltest - sind zwei Bücher. Ein altes, wurmstichiges Tagebuch, geschrieben in einer merkwürdigen Mischung aus Englisch und Ojibwe – einer Indianersprache -, sowie ein anderes, moderneres. Mein Buch.
Ich habe versucht, die Fragmente zu einer Geschichte zusammenzufassen. Dabei erhebe ich keinen Anspruch auf historische Korrektheit. Dies ist kein Tatsachenbericht, sondern eine Zusammenfassung der Ereignisse, wie ich sie interpretiere. Möglicherweise kommst du zu anderen Schlüssen, das sei dir unbenommen. Insgeheim hoffe ich sogar auf Widerspruch, denn das würde bedeuten, dass die Erzählung deine Neugier geweckt hat und du mehr darüber herauszufinden gedenkst.
Meine Angaben stützen sich auf die Aufzeichnungen einer gewissen Myra Preston, Tochter von Scott Preston. Er war Deputy in einem kleinen Ort namens Morrisonville, westlich des Lake Champlain und nahe der kanadischen Grenze. Hier nimmt die Geschichte ihren Anfang. Also schnapp dir das Buch, schenke dir eine gute Tasse Tee ein und lass dich von mir in eine ferne Zeit entführen. In eine andere Welt …«
4
1878 …
Der Wind wehte von Osten. Über die Green Mountains und den Lake Champlain bis hinüber nach Morrisonville, wo er die regenschweren Wolken gegen die Bergflanken des Saranac presste und sie zwang, sich zu entleeren. Die Einheimischen nannten ihn Autumn Widow - Herbstwitwe. Waabani-noodin in der Sprache der Indianer. Ein kalter, feuchter Wind, der von der Küste her wehte und in kräftigen Böen durch die Stadt fegte. Regenschauer prasselten auf die Dächer der Holzhäuser und füllten die Vertiefungen in den Straßen im Nu mit einer unansehnlichen, braunen Brühe. Erste Vorboten eines frühen, frostigen Winters.
Deputy Scott Preston stand vor dem Büro des Sheriffs und starrte die Ortsstraße entlang. Jemand kam durch den Regen auf ihn zugerannt. Kein Erwachsener, dafür war er zu klein. Ein Kind.
Der Junge trug ein maisfarbenes Hemd und braune Hosen, die mit dünnen Trägern an seinen Schultern befestigt waren. Auf dem Kopf saß eine braune Kappe, deren Ohrklappen beim Laufen wie Hundeohren flatterten. Scott kniff die Augen zusammen. Der Junge schlug immer wieder Haken, wobei er Steinen und Pfützen auswich. Seine Füße waren augenscheinlich nackt.
»Sieht aus wie der kleine Rogers.«
»Was hast du gesagt?«
»Na, der Junge da.« Scotts Freund Isaak schob seinen Kautabak in die rechte Backe und spuckte einen hohen Bogen über die Brüstung. Die Augen leuchteten aus seinem schwarzen Gesicht wie Sterne in der Nacht. »Das is‘ doch der kleine Rogers. Ich frag mich, wo der wohl hinwill. Geht doch keiner freiwillig raus, bei dem Scheißwetter.«
Isaak hatte Augen wie ein Luchs. Er hockte auf einer Holzbank neben der Eingangstür und blickte versonnen in den Regen. Im Ort war er fürs Schweinehüten zuständig. Normalerweise hielt er sich drüben bei der Winfield-Farm auf, aber bei dem Wetter waren die Viecher natürlich im Stall. Er war ein paar Jahre jünger als Scott, einundzwanzig oder zweiundzwanzig, und stammte aus der Ecke von Louisville. Nach dem Krieg war er zusammen mit vier seiner Landsleute hierhergekommen, auf der Suche nach Arbeit. Scott erinnerte sich, wie sie hier eingetrudelt waren: ein Haufen magerer, halbverhungerter Nigger, denen die Rippen durch die Haut stachen und die nichts als die zerlumpten Uniformen besaßen. Von den vieren war nur Isaak geblieben, die anderen waren weitergezogen.
Er war ein feiner Kerl, Scott mochte ihn. Er war ruhig, konnte gut zupacken und ging einem nicht auf die Nüsse - was man von den wenigsten in seinem Alter behaupten konnte. Und was das Spucken betraf, war er Weltmeister.
Der Junge passierte den Eisenwarenladen und kam jetzt am Green Turtle vorbei, dem ortsansässigen Saloon und Hurenhaus. Eine der Hinterzimmerbräute rief ihm etwas hinterher, doch auf die Entfernung war es nicht zu verstehen. Noch immer machte der Kleine keine Anstalten anzuhalten. Der Ausdruck in seinem Gesicht war besorgniserregend.
Scott strich sich die blonden Haare aus dem Gesicht. »Scheint wichtig zu sein. Ich gehe ihm mal entgegen.«
Er kannte Jimmy, seit er auf der Welt war. Jeder im Ort tat das. Ein aufgewecktes Bürschchen von neun Jahren. Sein Vater war Dorfschmied, drüben am westlichen Ende der Stadt. Der alte Rogers hatte das Geschäft kurz nach dem Bürgerkrieg übernommen, und seitdem florierte der Laden. Er arbeitete eng mit Sven Olsberg, dem schwedischen Eisenwarenhändler, zusammen, einem rauflustigen Sonderling, der einen fatalen Hang zum Alkohol hatte. Rogers war der Einzige, der mit ihm klarkam, und das auch nur, weil er den Schweden einmal mit seiner stählernen Rechten so in die Erde gerammt hatte, dass dieser seitdem einen Sprachfehler hatte.
Sheriff Tanner – Scotts Chef – war mit Rogers und dessen drei älteren Söhnen gerade in den Hügeln unterwegs, um einem Gerücht nachzugehen. Angeblich trieb sich ein Gesetzloser in der Gegend herum. Ein Mann, der steckbrieflich gesucht wurde und über den einige äußerst merkwürdige Gerüchte im Umlauf waren. Bis die Männer zurück waren, konnten noch Stunden vergehen.
Scott griff nach seinem Hut, der seitlich am Nagel hing, und ging die drei Stufen zur Straße runter. Fast augenblicklich versank sein Schuh im Matsch. Fluchend wich er seitlich auf festeres Gelände aus und stakste dem Kleinen entgegen. Der Regen veranstaltete einen Trommelwirbel auf seinem Hut.
Das Wasser strömte nur so an Jimmy herab. Sein Hemd klebte ihm am Körper. Etwas musste passiert sein. Der Junge würde sonst nicht so panisch durch den Regen rennen. Scott hob die Hand. »He, Kleiner, wo willst du denn hin? Bleib mal stehen, ich will mit dir re…«
Jimmy stolperte und fiel Scott in die Arme. Sein Atem ging stoßweise. Er war patschnass und fühlte sich eiskalt an. Große verzweifelte Augen blickten zu Scott auf. Ein krächzender Laut, der vielleicht mal ein Wort werden sollte, kam aus einem Hals. Scott überlegte, was er tun sollte, dann packte er kurzentschlossen den Jungen, hob ihn hoch und stapfte mit ihm zurück. Den Kleinen erst mal ins Trockene bringen, weg von den neugierigen Augen, die hinter den Fenstern lauerten.
Jimmy war schwerer, als er aussah. Der Matsch schwappte Scott in die Schuhe, aber das war egal. Er spürte, dass etwas Schlimmes vorgefallen sein musste.
Isaak kam ihm entgegen und nahm ihm den Jungen ab. Gemeinsam brachten sie ihn ins Büro und legte ihn dort auf eine Liege in einer der Zellen. Sie standen zurzeit alle leer.
Während Isaak einen Pott Kaffee aufsetzte, zog Scott dem dürren Kerlchen die patschnassen Klamotten vom Leib. Der Kleine war bleich bis auf die Knochen und zitterte wie Espenlaub.
Im Spind nebenan hingen ein paar trockene Sachen für den Notfall. Es kam immer wieder vor, dass jemand, der die Nacht wegen Trunkenheit hier verbringen musste, sich bekotzte oder gar einnässte. Die Sachen waren zwar grob und viel zu groß, aber sie erfüllten ihren Zweck. Zusätzlich legte Scott noch eine Decke über das zitternde Bündel, dann war der Junge versorgt.
Jetzt kam auch schon der Kaffee.
»Hier, Jimmy.« Issak hielt ihm den Blechnapf hin. »Trink das. Und verbrenn dir nicht die Lippen, das Metall ist verdammt heiß.« Vorsichtig half er ihm, die Tasse zum Mund zu führen. »Extra stark, mit drei Löffeln Zucker. Isaaks Spezialrezept für kalte Tage.« Er lächelte aufmunternd.
»Nun erzähl mal«, sagte Scott. »Ist was mit deinem Vater oder mit deinen Brüdern? Haben sie sich schon zurückgemeldet?«
Kopfschütteln.
»Hast du was beobachtet? Es muss doch was passiert sein, so wie du gerannt bist.«
Der Junge gab keine Antwort. Stattdessen schaute er an Scott vorbei auf den Steckbrief an der Wand. Der Blick dauerte nur wenige Sekunden, doch er veränderte alles. Scott merkte, wie der Kleine sich versteifte. Der Pott entglitt seinen Händen, und kochend heißer Kaffee schwappte Scott über den Arm.
»Jesses!« Hastig wischte er das schmerzhafte Gebräu weg.
Isaak sprang auf. »Bleib sitzen, ich hol rasch etwas Wasser.« In diesem Moment fing der Junge an zu schreien. Das Kreischen war unerträglich. Es fuhr einem durch Mark und Bein. Wie ein Schwein, wenn Schlachttag war. Jimmy saß da, die Hände vor die Ohren gepresst, und schrie und schrie. Seine glasigen Augen waren fest auf den Steckbrief gerichtet. Den Steckbrief von Nathaniel Blake.
Scott brauchte nicht lange, um zu begreifen. Er riss das Bild von der Wand und hielt es Jimmy vors Gesicht. »Der Mann«, drang er auf den Jungen ein, »kennst du ihn?«
Der Junge wollte nicht aufhören zu schreien. Scott zögerte kurz, dann gab er dem Bengel eine Ohrfeige. Nicht zu stark, aber doch so heftig, dass das Kreischen aufhörte. Jimmy zuckte zusammen, die Augen weit aufgerissen. Scott war immer noch erschrocken über die unerwartete Entwicklung, doch Isaak packte den Jungen bei den Schultern und sah ihm eindringlich in die Augen.
»Der Deputy hat dir eine Frage gestellt. Du musst antworten, wenn dich ein Mann des Gesetzes was fragt. Also spuck’s aus: Hast du diesen Mann gesehen?«
Ein kaum erkennbares Kopfnicken.
»Wo?«
»W… Werkstatt.«
»In eurer Werkstatt?«
»M … mm.« Ein feuchter Fleck breitete sich unter der Hose des Jungen aus.
Scott hatte genug gehört. Er riss den Revolvergurt von der Wand und prüfte, ob die Waffe geladen war. Dann ließ er sie ins Holster gleiten und setzte seinen Hut auf.
Isaak sah ihn erschrocken an. »Was hast du vor?«
»Na, was denkst du denn? Rübergehen natürlich.«
»Wäre es nicht besser zu warten, bis der Sheriff zurück ist?«
»Du bleibst bei dem Kleinen. In diesem Zustand können wir ihn nicht allein lassen.«
»Aber …«
»Keine Widerrede.«
In diesem Moment erklangen schwere Schritte auf der Veranda. Es klopfte und Benjamin Vanderbilt, der stämmige Kolonialwarenhändler von nebenan, steckte den Kopf zur Tür herein. »Kann ich helfen? Ich hab ein Kind schreien hören und dachte, ich schau mal vorbei. Hallo, ist das nicht der kleine Jimmy?«
Isaak nahm den zweiten Revolvergurt von der Wand und band ihn sich um die Hüfte. Noch ehe Scott Widerspruch einlegen konnte, wandte sein Freund sich an ihren Besucher. »Mr. Vanderbilt, würden Sie bitte kurz auf Jimmy aufpassen? Es ist dringend.«
»Was soll ich …?«
»Es könnte sein, dass Nathan Blake in der Stadt ist.«
Die buschigen Brauen schossen in die Höhe. »Sind Sie sicher?«
»Wir müssen nachsehen«, erwiderte Scott. »Jimmy hat da so etwas erzählt. Sehen Sie sich den Jungen doch an, er ist völlig durch den Wind. Und wenn nur eine winzige Chance besteht, dass wir Blake erwischen, müssen wie sie nutzen.«
Vanderbilt sah sie erschrocken an. »Aber das ist Sache des Sheriffs«, stieß er aus.
»Wenn es wirklich Blake ist, sollten Sie auf keinen Fall ohne Verstärkung hinüberreiten. Haben Sie nicht gehört, was man sich über ihn erzählt? Angeblich soll er etliche Frauen …«
»Mr. Vanderbilt, bitte. Nicht vor dem Jungen.«
»Wir würden nicht fragen, wenn‘s nicht wirklich wichtig wäre«, drang Isaak auf ihn ein.
Unter dem Stetson arbeitete es gewaltig. Nach einer gefühlten Unendlichkeit lenkte der Ladenbesitzer ein. »Nun gut«, sagte er. »Aber sehen Sie sich vor, meine Herren.
Wenn Sie nur die Hälfte von dem gehört hätten, was mir über diesen Mann zu Ohren gekommen ist, würde es Ihnen den Angstschweiß auf die Stirn treiben.«
5
Der Regen hatte nachgelassen. Nur hier und da fielen noch ein paar Tropfen, der Rest war mit den dunklen Wolken davongezogen. Scott und Isaak hatten die Pferde gesattelt und ritten an den neugierigen Blicken vorbei in westlicher Richtung die Hauptstraße hinunter. Seit der Wolkenbruch aufgehört hatte, verließen die Menschen wieder ihre Häuser. Kunden wechselten die Läden, Passanten eilten seitlich über die Planken, während Transportunternehmer und Händler versuchten, ihre Pferdefuhrwerke aus dem Matsch zu befreien.
Die beiden jungen Männer passierten die Druckerei von Émile Jouvet, der gerade an der Wochenendausgabe des Morrisonville Pioneer arbeitete und Kästen mit Bleilettern durch die Gegend wuchtete. Der französischstämmige Verleger hatte es sich in den Kopf gesetzt, eine Zeitung zu gründen, vermutlich, weil er dachte, dass seine Französischkenntnisse im kanadischen Grenzgebiet vielleicht von Vorteil wären. Nicht die schlechteste Idee, wie man an der wachsenden Auflagenzahl ablesen konnte.
Sie kamen an der methodistischen Kirche St. Mary‘s vorbei, in der Pater Holcombe gerade die Nachmittagspredigt vorbereitete. Auf dem Hügel gegenüber sah man die Gebäude der Morrisonville Brickworks Company, die die Stadt und viele umliegende Ortschaften mit Ziegeln versorgten.
Die Schmiede lag am Stadtrand, etwas abseits der Hauptstraße. Anwohner hatten sich über den Lärm beklagt, weswegen der alte Rogers nach etlichem Hin und Her eingelenkt und einen Hof außerhalb von Morrisonville erworben hatte. Inzwischen war die Stadt allerdings so gewachsen, dass die ersten Häuser schon wieder in seine Nähe rückten. Scott erinnerte sich noch, was für ein Theater das damals gegeben hatte. Ein zweites Mal würde Rogers sicher nicht von dort weggehen.
Er lenkte den Mustang über den Straßengraben und eine Böschung hinauf, dann quer über die Wiese und auf das Wäldchen zu, hinter dem das Rogershaus lag.
Hannah war kurz nach der Geburt des kleinen Jimmy an einer Lungenentzündung gestorben, und Lucas hatte danach nicht wieder geheiratet. Er und seine vier Söhne bewirtschafteten das Anwesen gemeinsam. Sie waren eine verschworene Gemeinschaft. Die Jungs waren wie die Orgelpfeifen und genossen im Ort einen zweifelhaften Ruf. Einerseits waren sie fleißige Arbeiter, die ordentlich zupacken konnten und sich nicht über kargen Lohn beklagten, andererseits sah man sie etwas zu oft im Green Turtle oder im Wascomb’s, etwas die Straße runter. Scott war ein paarmal mit ihnen aneinandergeraten, meist wegen Trunkenheit und unziemlichen Benehmens. Doch im Großen und Ganzen mochte er die Jungs. Sie konnten schließlich nichts dafür, dass ihre Mutter gestorben war. Und wer außer Hannah hätte ihnen Manieren beibringen sollen? Der alte Rogers war doch selbst der Schlimmste von allen. Cholerisch, aufbrausend und jähzornig, aber ansonsten ganz in Ordnung. So wie der Rest der Familie.