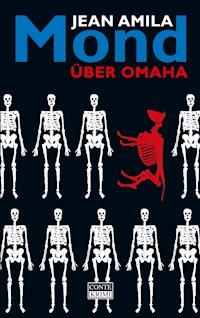Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
René Lecomte ist wieder da. Nach einem längeren Aufenthalt in Lateinamerika will der »Comte«, Chef der Pariser Unterwelt, offen stehende Rechnungen begleichen und ausstehende Schulden eintreiben. Bei einer Schießerei wird er schwer verletzt und rettet sich ins Krankenhaus. Aline, Sylvie und Thérèse, Krankenschwestern im zweiten Lehrjahr, müssen zum ersten Mal in der Nachtschicht über Leben und Tod entscheiden. Während der »Comte« die Notoperation übersteht, beginnt draußen schon der Kampf um seine Nachfolge. Spannend, unterhaltsam und mit ungewohnt erotischen Momenten, lädt Jean Amila ein, in die Seelen der Beteiligten zu schauen. Er verbindet Handlungsstränge und Milieus zweier Welten, die erst auf den zweiten Blick strukturelle Ähnlichkeiten zeigen: starke Hierarchien und die Konfrontation mit dem Tod. Der Mythos der »Halbgötter in Weiß« wird gnadenlos demontiert. Idealismus und Unzufriedenheit im Kontrast. Das ist sehr gegenwärtig, Gesundheitsreform revisited!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erstes Kapitel
Welcher Tag war heute denn eigentlich?
Welcher Tag − oder eher welche Nacht, denn die Sonne würde bald untergehen.
Ach genau, es war der Anfang einer Mittsommernacht. Der Tag war schwül gewesen. In der U-Bahn herrschte nach Büro- und Betriebsschluss die Lethargie eines zu Ende gehenden Sommers. Die Straßenlaternen waren gerade angegangen.
Roger fuhr langsam, sehr langsam, als ob er einen Ort zum Halten suche.
Eigentlich jedoch hatte er die Qual der Wahl, denn die Straße lag verlassen da. Links zog sich eine endlos lange Mauer hin. Rechts standen Mietshäuser, die wohl aus dem Jahre 1910 stammten, dem Jahr der großen Überschwemmung, völlig überladen; aber sie waren glücklicherweise in der Dämmerung kaum zu erkennen.
Der Graf, der den Hut tief ins Gesicht gezogen hatte, schien neben Roger vor sich hinzudösen.
War er etwa tot? Nein! Was wäre das dann wohl für eine Geschichte? Ihm ging es blendend; ruhig vor sich hinatmend, auf Sparflamme laufend und in sich ruhend wie ein Meister aller Klassen. Weder war er tot, noch schlief er.
Unter seiner Hutkrempe würde seinem unsichtbaren Blick jedoch kein Gebäudeeingang, keines der vielen Geschäftslokale, die eher wie Handwerksbetriebe als wie Ladengeschäfte aussahen, entgehen.
Es gab da einen Handkarrenvermieter, einen Kohlenhandel, einen Fuhrbetrieb, eine Fahrradreparaturwerkstatt: Alle schlossen jetzt gerade oder würden doch in knapp einer Stunde schließen. Es gab da sogar eine hochoffiziell daherkommende Steuerkasse, deren Gitter bereits heruntergezogen waren.
Erst vor einem baufälligen Laden tauchte der Graf aus seiner gravitätischen Ruhe auf. Er öffnete ein wenig den Mund, soviel wie eben nötig, und ließ mit tiefer Stimme verlauten:
»Dort!«
»O.k!«, sagte Roger. »Und jetzt?«
»Weiter!«
Der Laden war einmal blau gewesen; jetzt sah er allerdings noch verwaschener aus als ein alter Blaumann. Auf einem uralten, halbverrosteten Emaille-Schild ließ sich noch mit Mühe Veedol entziffern, was auf eine Werkstatt hinzuweisen schien. Aber das durchgesackte, nach außen gebeulte Wellblechgitter machte den Eindruck, als sei es schon seit einigen Jahren nicht mehr hochgezogen worden. Eine durch den Rost verfärbte Kreideaufschrift forderte unverhohlen schon seit vielen Monaten: Nieder mit den Pfaffen! Verfechter der Partei der Pfarrer hatten es heimlich in ein Nieder mit den Affen verändert.
Der tief liegende Studebaker fuhr langsam und geräuschlos weiter. Roger schien beunruhigt. Er verzog das Gesicht.
»Ganz schön schäbig!«
Der Graf sagte nichts. Seine Gestalt ließ auf einen Mann von Einfluss schließen, und der andere schien sein Schweigen zu achten.
Allerdings betrachteten sie nicht die Werkstatt, sondern das Einfamilienhaus daneben, das deutlich zurückgesetzt hinter einem Mäuerchen und einem Eisentor stand.
Ein einstöckiges Haus aus grauem Stein mit einem Mansardendach aus dem achtzehnten Jahrhundert, das verloren zwischen den Gebäuden aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stand und dessen Anblick sogar schon in der Dämmerung von völliger Verlassenheit zeugte.
Es stand eingezwängt zwischen den toten Mauern zweier fünfstöckiger Gebäude. Gegenüber ragte die hohe Mauer des Krankenhauses auf. Es lag abgeschirmt da, versteckt, vor neugierigen Blicken sicher: als ob es der Eingang zu einer unbekannten Welt wäre.
»Anhalten?«
»Weiter!«, sagte der Graf wieder.
Roger beschleunigte sachte und das Auto glitt leise, mit gedämpftem Auspuffgeräusch, bis zum Ende der Straße.
Die Frau auf der Rückbank hatte sich umgedreht. Sie stützte sich mit den Fingern an der Scheibe ab und schaute immer noch zurück.
»Maine?«, fragte der Graf, ohne sich auch nur einen Millimeter von der Stelle zu rühren.
»Ja«, sagte die Frau. »Das hier ist trostlos. Und im Übrigen gefällt mir auch der Name der Straße nicht!«
Sie fuhren unter dem Straßenschild an der Ecke vorbei. Darauf war Rue Larousse zu lesen. Auf der anderen Seite wiesen Schilder den Eingang des Krankenhauses in zweihundert Metern Entfernung aus, mit den Abteilungen, den Namen der Oberärzte und den Sprechzeiten.
»Und nach Äther stinkt’s hier auch noch!«, fügte Maine hinzu.
An der Ecke bogen sie ab und fuhren wieder in Richtung Porte de Vanves. Nach fünfzig Metern hob der Graf die Hand. Auf der rechten Seite war eine Kneipe zu sehen; Roger verstand und hielt an.
»Und jetzt?«, fragte die Frau.
»Und jetzt, Süße, jetzt steigst du aus!«, sagte der Dicke. »Du nimmst dir ein Taxi und ab nach Hause. Ich muss noch mal kurz mit Roger reden.«
»Ich dachte, meine Meinung sei wenigstens gefragt?«
»Wenn’s sein muss!«
»Ungünstig!«, sagte sie. »Äußerst ungünstig. Das hier, das wird doch kein Nachtclub werden, sondern ein Friedhof. Gegenüber das Krankenhaus und in fünfzig Metern Entfernung das Bestattungsinstitut mit einem Mastiff vor der Tür; hier wird sich kein Schwein blicken lassen!«
»Ich bin ganz ihrer Meinung«, sagte Roger. »Außerdem ist die Straße verlassen. Sobald da auch nur drei Autos stehen, ist doch das gesamte Viertel gleich in Aufruhr.«
»Ein Nachtclub in der Rue Larousse, der Polentestraße!«, trumpfte Maine mit kaum unterdrückter Empörung auf. »Schon bei dem Gedanken vergeht mir alles! Da geht es uns doch in Montmartre viel besser. Was willst du denn, René? Dezentralisieren?«
»Ich seh’, dass ihr nicht gerade begeistert seid«, stellte der Graf fest.
Er bedeutete ihnen auszusteigen, öffnete dann seine Tür und kletterte mit bemerkenswerter Leichtigkeit hinaus. Klein, stämmig, breitschultrig stand er da. Er sah aus wie ein Gewichtheber, ein kleiner, kraftstrotzender Herkules mit vorgeschobenem Unterkiefer und mit einem unbeirrbaren Blick, als er seinen Hut nach hinten schob: wie eine Bulldogge!
Er betrat, ohne auf sie zu warten, die Kneipe, in der Gewissheit, dass sie ihm folgen würden. Drinnen stand ein Tresen, dessen nachträglich aufgemalte Eichenmaserung an die Zwanzigerjahre erinnerte. Ein fluoreszierendes, rautenförmiges Licht an der Decke sollte wohl für einen Hauch von Modernität sorgen, verlieh aber vor allem allen Gästen ein krankhaftes Aussehen.
Gäste gab es hier kaum welche. Was die Kranken angeht, so waren da besonders zwei junge, lachende und schnatternde Krankenschwestern, die an einem Holztisch saßen und gemütlich an ihrem Bier nippten.
Der Graf ging durch den Raum und setzte sich in die gegenüberliegende Ecke, dort, wo es am dunkelsten war.
»Telefonieren!«, dachte er. »Gewinn machen! Erst einmal sehen! Beobachten!«
Die Wirtin sah wie eine Provinzlerin aus der Auvergne aus: schwarze Augen und Haare, große Nase, Brüste und ein breites Becken. Sie strickte an ihrem Tresen, allem gegenüber gleichgültig zählte sie ihre Maschen. Sie hatte beim Eintreffen des Grafen kaum aufgeschaut.
Geistesabwesend murmelte sie: »Guten Abend!«, als Roger und Maine eintraten.
Roger war größer als der Graf. Er hatte eine schmale Taille und breite Schultern, trug ein grünes Nylonhemd, eine Krawatte aus schwarzer Seide und gelbe Mokassins. Er hatte wohl in zahlreichen Kinovorstellungen gesehen, wie er lächeln musste, um vorteilhafter auszusehen. Er ließ seinen männlichen Charme spielen. Sogar seine Stimme ließ er gekonnt in den tiefen Basslagen vibrieren. Als er die beiden Krankenschwestern erblickte, rückte er automatisch seine Krawatte zurecht.
Diese hatten sich leicht umgedreht, um Maines Auftritt zu sehen, die überall, wo sie hinkam, auffiel.
Sie hatte ein recht üppiges Hinterteil und war kräftig, aber wunderbar gebaut, trug stets die passende Kleidung, die allen den Atem raubte und die Blicke der Männer auf sich zog – übrigens auch die der Mädchen, ja vielleicht sogar noch mehr.
»Hohe Kundschaft«, sagte das Mädchen mit den helleren Haaren.
Da sie den Satz in die allgemeine Stille hinein gesagt hatte, hielt sie sich verspätet die Hand vor den Mund, und beide begannen, wie zwei dumme Gänse zu lachen.
Bei näherem Hinsehen konnte man feststellen, dass Maine eher eine zweite Jugend als ihre erste erlebte. Doch mit der Jugend verhält es sich wie mit der Natur: Gute Gewohnheiten zahlen sich aus. Gut massiert, gut genährt, gut belüftet und gut geölt hatte Maine noch einige Jahre vor sich, bevor sie zu einer schrecklichen alten Schachtel mutieren würde.
Ganz die feine Dame, ignorierte sie das unverschämte Verhalten und begab sich zum hintersten Tisch. Kundig fuhr sie mit ihrem Daumen über das klebrige Holz und verzog vielsagend das Gesicht. Die Wirtin, die vornehme Kundschaft witterte, war aus ihrer Abwesenheit aufgetaucht und näherte sich dem Tisch in Dr. Léon-Pantoffeln, denn genau wie alle aus der Auvergne fürchtete sie kalte Füße.
»Was darf es für Sie sein, meine Herrschaften?«
»Zunächst mal was Nasses«, antwortete Maine von oben herab.
»Etwas Edleres?«
»Nein. Ich hatte an einen einfachen Lappen gedacht. An Ihrem Tisch bleibt man ja kleben!«
Die Wirtin blieb gelassen, holte in aller Ruhe ihren speckigen Lappen hinter der Theke hervor und kam zurück, um den Tisch abzuwischen. Maine, die ihr mit den Augen gefolgt war, hielt sie zurück: »Aber sauber, bitte!«
»Klar doch!«
»Mit einem sauberen Lappen. Es war nicht die Rede von einem vergammelten Abwaschlappen!«, sagte Maine mit einer immer noch höflichen, nun aber gebieterischen Stimme.
Die Wirtin verharrte mit offenem Mund an Ort und Stelle; sie errötete. Man konnte zwar gedämpft, aber sehr deutlich die Stimme der blonden Krankenschwester vernehmen, die sagte: »Was für eine Nervensäge!«
Die zwei Mädchen prusteten erneut los. Hin und hergerissen zwischen dem Wunsch, gehört zu werden und einer Heidenangst davor, dass man sie gehört hatte. Schon drehte Maine sich zu ihnen um. Sie lächelte, doch sie hatte dabei etwas von einem Raubtier.
»Also irgendwas riecht hier komisch!«
Die Blonde hatte eine Gegenantwort parat. Sie führte das Spielchen halblaut weiter.
»Ja, stimmt, aber erst, seit die da ist!«
»Es riecht nach Bettpfannenmädchen. Finden Sie nicht?«
»Die blafft uns an«, flüsterte die braunhaarige Krankenschwester ängstlich, aber entzückt. »Sei still, Sylvie.«
Maine war kurz davor zu explodieren. Der Graf hob seine Hand und machte ein beschwichtigendes Zeichen.
»Halt die Klappe«, sagte er kaum hörbar.
»Ich hab nicht damit angefangen!«
Dumpf grollend wischte die Wirtin den Tisch ab.
»Haben Sie hier Telefon?«, fragte der Graf.
»Natürlich«, erwiderte sie noch immer beleidigt. »Ganz hinten. Sie brauchen eine Telefonmünze.«
Er erhob sich.
»Geben Sie mir fünf. Und eine Flasche Mineralwasser.«
»Welche Sorte?«
»Egal!«
Er berührte sie nicht, doch allein seine Masse ließ sie in Richtung Theke zurückweichen. Sie wühlte in ihrer Kasse und nahm eine Handvoll Telefonmünzen heraus. Er nahm sie sich sofort und ging dann nach hinten.
»Ihre Flasche Mineralwasser«, rief sie, »soll die auf den Tisch?«
Doch er war bereits hinter einer kleinen Glastür verschwunden.
»Wie bescheuert«, stöhnte Maine. »Die Füße will er sich damit bestimmt nicht waschen.«
Knallrot angelaufen brachte die Wirtin die Flasche.
»Und für die Dame und den Herrn?«
»Schätzchen«, sagte Maine zu ihr, »man merkt, dass hier nicht sehr häufig gepflegte Kundschaft verkehrt.«
Sie hatte ein entspanntes, bezauberndes Lächeln aufgesetzt. Die Wirtin stand jetzt zwar kurz davor zu explodieren, konnte sich aber doch noch mal beherrschen.
»Gepflegte Kundschaft? Was soll das denn heißen? Meine Kundschaft ist immer gepflegt. Was glauben Sie denn?«
»Die Dame kommt aus derselben Branche«, gab Roger ihr zu verstehen, indem er mit dem Kinn in Richtung Maine deutete. »Die weiß genau, wovon sie spricht. Bringen Sie mir ein Glas Weißwein.«
»Und für die Dame?«
Maine schaute sich interessiert um. Ihre Nummer der Dame von Welt war beendet, nun mimte sie die Nette.
»Das Gleiche und nichts für ungut! Sagen Sie mal, läuft’s eigentlich gut hier in der Gegend?«
»Ich kann nicht klagen!«
»Mit dem Krankenhaus direkt gegenüber muss es bei Ihnen ja hoch hergehen, wenn die Besuchszeit vorüber ist. Und dann die Beerdigungen, da wird doch immer gut gebechert!«
»Es läuft ganz gut«, sagte die Wirtin. »Es gibt schlechtere Lagen als diese hier.«
Ihr Tonfall wurde freundlicher. Es gibt nichts Besseres als Fachsimpelei, um eine Unterhaltung in Gang zu bringen.
Die Krankenschwestern ihrerseits hatten ebenfalls gedanklich umgeschaltet. Die kürzesten Auseinandersetzungen sind schließlich die vernünftigsten.
Die Krankenschwestern hatten sich lediglich schnell etwas über den Kittel gezogen, um sich ein alltagstaugliches Erscheinungsbild zu geben. Die blonde Sylvie trug eine blaue Leinenjacke; Thérèse, die Brünette, eine leicht verblichene Strickjacke, die an den Ellenbogen etwas abgewetzt war. Sie sahen wie zwei kleine Mädchen aus, zwei Schülerinnen.
Als der junge Mann eintrat, lächelten alle beide. Er kam zu ihnen an den Tisch, gab ihnen die Hand und setzte sich neben Thérèse.
»Heute ist es soweit!«, sagte diese.
»Was denn?«
»Mein erster Nachtdienst. Nachher geht’s los. Ich hab vielleicht Bammel!«
»Dabei wollte ich Sie beide doch heute eigentlich ins Kino einladen.«
»Ja, Kino! Ich wünschte, ich hätte die Nacht schon hinter mir!«
»Schimpfen Sie ruhig mit ihr«, spottete Sylvie. »Das ist vielleicht ein Angsthase. Die sollte sich was schämen!«
»Aber du!«, erwiderte Thérèse. »Du hast auch nicht gerade geglänzt bei deinem ersten Nachtdienst!«
»Aber wie du siehst, leb ich noch! Das ist schon mein dritter diese Nacht. Abgesehen davon, dass man am nächsten Tag hundemüde ist, mag ich das, glaub ich.«
»Ach, Sie arbeiten heute Nacht mit Sylvie?«, fragte der junge Mann. »Na, dann werden Sie beide ja ganz schön viel Spaß haben.«
Thérèse war ein wenig empört. Für sie stellte diese erste Nacht eine wichtige Etappe in ihrem Leben dar, und der da redete von Spaß! Sie dachte an heroische Selbstaufopferung, Edelmut, bedingungslose Hingabe, Nächstenliebe, und er machte das alles mit nur einem Wort zunichte: wenn das kein regelrechter Scheidungsgrund war! Freilich war von einer Hochzeit zwischen ihr und dem jungen Lucien noch lange nicht die Rede. Über flüchtige Berührungen der Hände und verschämte Blicke waren sie noch nicht hinausgekommen.
»Also, ich mag die Musik der Frères Jacques und Beethoven und Roller fahren und Ferien in den Bergen!«
Der konnte ihr jetzt gestohlen bleiben mit seinen Frères Jacques und dem blöden Roller, den er sich kaufen wollte. Sie setzte eine trotzige Miene auf.
»Die Leiden der Menschen zu lindern, das findet ihr beiden also witzig?«
Sylvie brach nun in lautes Lachen aus.
»Ach herrje! Jetzt fängt sie wieder an, zu philosophieren. Pass auf, Thérèse, jetzt kannst du so etwas noch sagen: Aber wenn du morgen früh immer noch diesen Quatsch plapperst, dann gibt es für dich keine Rettung mehr. Dann solltest du dir besser einen anderen Beruf suchen! Die Leiden der Menschen lindern, sagst du? Von wegen! Das ist den großen Chefärzten und Chefärztinnen vorbehalten, Süße! Wir sind eher …«
Sie deutete auf den Tisch im hinteren Teil der Bar.
»… was die da hinten schon gesagt hat.«
»Was hat sie gesagt?«, fragte Lucien.
»Dass wir nur fürs Leeren von Bettpfannen gut sind.«
»Wie hässlich, so etwas zu Ihnen zu sagen!«, empörte sich Lucien. »Das sollten Sie sich nicht gefallen lassen!«
»Ist schon erledigt«, sagte Sylvie. »Beruhigen Sie sich!«
Sie holte ihr Portemonnaie heraus.
»Ich möchte euch ja nicht hetzen, meine Lieben, aber wir sollten so langsam los.«
»Schon!«, rief Lucien enttäuscht.
Er schickte sich an, zu zahlen.
»Nein«, sagte Sylvie. »Das geht auf Thérèse und mich. Aber Sie können uns gerne auf eine Zigarette und ein Glas Rum einladen.«
»Die ist nicht aufs Maul gefallen«, bemerkte Thérèse.
»Zur Zwangsarbeit Verurteilten wie uns kann man das nicht verweigern«, entgegnete die bissige Blondine.
Der junge Mann wusste offenbar, was sich gehörte. Er holte seine Gauloises hervor und bestellte drei Rum.
»Beeilung«, sagte Sylvie noch schnell zur Wirtin. »Wir haben Nachtwache, Madame Vigouroux!«
Diese brachte die drei kleinen Gläser und die Flasche und schenkte mit einer geschickten Handbewegung ein.
»Ach, ihr seid ja schon im zweiten Jahr«, sagte die Wirtin, die das schon kannte. »Jetzt wird’s ernst. Wie viele junge Mädchen habe ich hier nicht schon bedient, die ihre erste Nachtwache hatten! Wer sind eure Assistenzärzte?«
»Doktor Augereau und Doktor Carré.«
»Die sind nett«, lachte die Wirtin. »Und gar nicht eingebildet. Doktor Carré hat außerdem immer einen Witz auf Lager. Da werdet ihr euch bestimmt nicht langweilen.«
Lucien gab ihr das Geld. Am hinteren Tisch nippten Maine und Roger an ihrem Weißwein. Die Tür der Telefonkabine war fest geschlossen, nichts von dem Gespräch drang nach außen. Draußen in der Dämmerung zog der geparkte Studebaker die flüchtigen Blicke der Passanten auf sich: Männer, die von der Arbeit heimkamen, Hausfrauen, die zum Vini-Médoc oder zur Bäckerei nebenan gingen.
Auf der anderen Straßenseite erstreckte sich die lange Krankenhausmauer, die so imposant wirkte wie die Hauptfigur eines Dramas. Daran schloss sich das große rote Gebäude der Schwesternschule an.
Es war neunzehn Uhr vierzehn. Damit begann offiziell die Nacht.
Zweites Kapitel
Sie standen zusammen vor der Tür. Lucien hielt ihre Hand.
»Ich lass’ Sie nicht gehen!«
»Das sollten Sie aber«, sagte Thérèse. »Ich bin schon jetzt spät dran. Sylvie ist sicher schon in ihrem Zimmer.«
»Ist schon eine Nummer für sich, Ihre Freundin!«
»Sie ist sehr nett. Sie spielt zwar gerne die Lässige, nimmt ihre Arbeit aber sehr ernst. Sie ist wirklich meine beste Freundin. Außerdem ist sie die Intelligenteste von allen!«
»Sogar intelligenter als Sie?«
»Na – und ob!«, versicherte ihm Thérèse im Brustton der Überzeugung.
»Sie kommen gut mit ihr aus?«
»So! Jetzt muss ich aber gehen«, sagte das Mädchen und machte sich los. »Bis Sonntag, Lucien. Ich hoffe, wir haben Glück mit dem Wetter!«
»Wo ist Ihr Zimmer?«
»Im dritten Stock.«
»Ich seh dann hoch«, meinte Lucien.
»Auf Wiedersehen!«
Sie drückte ihm freundschaftlich die Hand. Er versuchte noch, sie festzuhalten: Er hätte sie gerne geküsst. Er hätte ihr auch gerne Hals- und Beinbruch gewünscht, um ihr Glück zu bringen, ließ es dann aber doch.
Sie drückte auf den Knopf und die Tür öffnete sich unter dröhnendem Klingeln.
»Auf Wiedersehen!«
Sie stieß die Tür auf und ging hinein. In Eile überquerte sie den Hof, denn sie war schon viel zu spät dran.
Hier in der Schule kannte sie jeden Winkel, jedes Geräusch und jeden Geruch. Sie war ja nun schon seit mehr als einem Jahr hier. Es war eine Welt für sich, die zwar für Männer unzugänglich war, in der aber dennoch ein wenig die Atmosphäre einer Kaserne herrschte. Auch hier trug man Uniform, herrschte Disziplin, gab es nackte Wände, erklang das abgehackte Hallen von Schuhen auf dem Zementboden, das Klirren von Besteck und das Stimmengewirr aus dem Speisesaal, roch es nach Suppe, Wachstüchern, Desinfektionsmittel und, immer mal wieder, kaum wahrnehmbar, nach heimlich gerauchten Zigaretten.
Zunächst musste sie an der Loge von Frau Frédéric vorbei, der mürrischen und allseits gefürchteten Pförtnerin, die man mit Lächeln überhäufte, insgeheim jedoch als blöde Ziege beschimpfte. Danach musste sie die Treppe hinaufeilen und hoffen, keinem Vorgesetzten zu begegnen.
Und Lucien? Ach ja, Lucien! Ein wirklich netter Kerl! Sie musste ihm noch aus dem Fenster nachwinken. Doch das Wichtigste war jetzt diese Nacht, diese Nachtwache, die sie wie eine Prüfung bestehen musste und aus der sie am nächsten Morgen begeistert, gleichgültig oder niedergeschlagen herauskommen würde.
Im dritten Stock lief sie den langen Korridor hinunter bis zur vorletzten Tür. Sie drückte den Griff herunter, stieß die Tür auf und platzte ins Zimmer hinein: Das Fenster stand offen, man konnte die Straßengeräusche hören. Aline, die sich die Hände am Waschbecken wusch, mimte ein heftiges Zusammenzucken.
»Hexe! Hast du mich erschreckt!«
»Ich bin zu spät«, antwortete Thérèse. »Selber Hexe!«
Sie eilte zum Fenster und schaute hinaus. Dort stand Lucien auf dem gegenüberliegenden Gehweg und schaute herauf. Sobald er sie entdeckt hatte, winkte er ihr mit ausgestrecktem Arm zu. Er stand unter einer Straßenlaterne, sein Fahrrad hatte er an der Bordsteinkante abgestellt. Wie er so hochsah, wirkte er noch jünger und umso liebenswürdiger, als er in seiner Verliebtheit schüchtern war.
Er rief ihr etwas zu. Alle Fenster lagen zur Straße und Thérèse legte keinen Wert auf einen Auftritt in der Öffentlichkeit; sie legte den Zeigefinger an die Lippen – also warf er ihr eine Kusshand zu.
»Spinner!«, sagte sie mit halblauter Stimme ganz gerührt.
Und der Finger, der auf ihren Lippen lag, erwiderte den stummen Kuss ein bisschen beschämt, so als hätte er ihr ein Versprechen abgerungen. Sie winkte noch einmal kurz, dann trat sie vom Fenster zurück.
»Na, ist das dein Romeo?«, wollte Aline wissen. »Lass mal sehen!«
Sie ging ans Fenster.
»Der mit dem Fahrrad?«
»Ja.«
Da sie seit über einem Jahr ihr Zimmer miteinander teilten, kannten Aline und Thérèse sich in- und auswendig und liebten sich wie Schwestern – das heißt, sie zankten sich dauernd über irgendetwas.
Außer dieser Ähnlichkeit in ihrem Verhalten waren sie von Grund auf verschieden. Thérèse war klein und hatte braunes Haar, sie war unscheinbar, kümmerte sich wenig um ihr Äußeres, wirkte etwas bieder. Aline war hochgewachsen, elegant und ein kleines bisschen hochnäsig. Thérèses Eltern waren arm, die von Aline ziemlich wohlhabend. Die eine sah ihren Prüfungen entgegen, als könne eine jede zu einer Schicksal weisenden Katastrophe werden, die andere legte routinierte Gelassenheit an den Tag.
Aline war auch zur Nachtschicht eingeteilt. Im zweiten Lehrjahr mussten dazu alle Lernschwestern mindestens einmal wöchentlich antreten, immer zwei im Krankenhaus und eine in der Entbindungsstation.
Das Zimmer war einfach eingerichtet, mit je einem Bett links und rechts der Tür, einem viel zu großen Waschbecken, einem Spiegelschrank und einer Kommode, die direkt aus einem Hotel zu stammen schien. Auf Regalbrettern standen Medizin- und Pharmaziebücher sowie Romane, wovon die meisten Aline gehörten.
Diese suchte sich gerade ein Buch aus, um es auf die Entbindungsstation mitzunehmen, da sie nichts weniger ausstehen konnte als Langeweile. Das Buch hatte einen schwarzen Schutzumschlag und den Titel: Ich hol dich da raus. Ein Bezug zur Gynäkologie bestand allerdings nicht.
Thérèse, die gerade in sentimentaler Stimmung war, sagte missbilligend: »Du wirst dem größten Wunder auf der Welt beiwohnen, der Geburt, und du …«
Aline verdrehte genervt die Augen.
»Ach, hör doch auf. Du wärst ja so nett, meine liebe Thérèse, wenn du nicht dauernd so gestelzte Reden schwingen würdest!«
Da konnte man nichts machen, sie waren einfach von ganz unterschiedlichem Charakter. Glücklicherweise waren sie vernünftig genug, diese Tatsache positiv zu sehen: Komplementärfarben ergänzen sich ja bekanntlich auch. Davon hatten sie mehr, als wenn sie sich gehasst hätten.
Thérèse gehörte das Bett, das beim Eintreten links von der Tür stand. Auf einem Wandbrett standen das Foto ihrer Eltern und ihre Mitschriften in einer roten Kladde. Sie belegte seit acht Tagen den Chirurgie-Kurs und ihr Buch war gespickt mit verschiedensten Lesezeichen: Arzneimittelwerbung, bunten Papierchen, Stückchen von ehemals sterilen Mullbinden.
»Soll ich meine Bücher mitnehmen?«
»Du spinnst doch!«, antwortete ihr Aline. »Nimm dir lieber was zu beißen mit, das wirst du gegen zwei Uhr morgens gut gebrauchen können.«
»Ich hab Schiss! Ich werd nichts runterkriegen.«
»Nimm wenigstens die hier!«, sagte Aline und hielt ihr eine Packung Butterkekse hin. Sie ging nochmals zum Fenster, um es zu schließen, und warf einen letzten Blick in den Himmel und über die Dächer.
»Das wird dir gefallen, du Angsthase! Ich glaub, es gibt ein Gewitter.«
»Nicht wirklich, oder?«
Thérèse stellte sich neben sie und schaute ihrerseits zum schwarzen Himmel hoch. In weiter Ferne, jenseits von Montrouge, war Wetterleuchten zu sehen. Vielleicht würde das Gewitter nicht bis Paris kommen, aber irgendwo im Südwesten tobte es. Der Sommer ging zünftig zu Ende.
Sie schaute die Straße entlang. Lucien war nicht mehr zu sehen. Vor dem Café Vigoureux stiegen drei Personen in den gelben Studebaker.
»Ah, da sind ja wieder die feinen Herrschaften von vorhin; sie ziehen ab«, sagte Thérèse. »Schau mal! Wegen Sylvie hätten wir mit denen beinahe Ärger bekommen.«
»Komm, beeilen wir uns«, drängte Aline.
Das Auto setzte sich geräuschlos in Bewegung. Es fuhr unter dem Fenster mit einem dumpfen, satten Schnurren vorbei. Von oben sah es lang wie ein mächtiges Insekt aus, wie eine riesige Wespe, eine schwerfällig schwebende Drohne, die abdrehte, um in der ersten Straße rechts, in Richtung des kleinen Bahnhofes, zu verschwinden.
»Das ist mal ein Schlitten«, meinte Aline beifällig.
»Merkwürdige Leute.«
Sie schlossen das Fenster, verriegelten ihr Zimmer und eilten die Treppe hinunter. Unten wartete Sylvie mit Frau Debrais.
»Auf, auf!«, sagte diese und klatschte in die Hände. »Wir müssen uns beeilen, Sie sind zu spät, meine Damen!«
Die Schwesternhelferin war kräftig gebaut und groß; ihr Gesicht war freundlich, mit etwas maskulinen Zügen. Meistens waren die Mädchen im ersten Studienjahr von ihr eingeschüchtert, aber gegen Ende des Studiums mussten sie alle zugeben, dass sie bei näherem Kennenlernen ganz anders war.
Sie gehörte zum Pflegepersonal des Krankenhauses, war also nicht Teil des Lehrkörpers. Die Infektionsstation war ihr Hoheitsgebiet und gerade war sie mit der Nachtschicht dran.
»Wer geht auf die Geburtshilfe?«
»Ich«, sagte Aline.
»Gut, gehen Sie gleich hin! Und Sie zwei kommen mit mir.«
Thérèse war bange zumute. Frau Debrais musterte sie. Sie kannte sie vom Sehen, da Thérèse während ihres Praktikums schon mehrmals auf der Station gewesen war.
»Ihre Namen, bitte?«
»Sylvie Legagneur.«
»Thérèse Menant.«
Sie wandte sich zuerst Thérèse zu:
»Das erste Mal?«
»Ja.«
Sie schaute Sylvie mit forschendem Blick an.
»Sylvie, Sie haben sich wohl freiwillig gemeldet, nicht? Nun, ich möchte Sie beide unbedingt daran erinnern, dass ich für Ihr Verhalten verantwortlich bin. Aber ich werde Ihnen nicht die ganze Nacht auf die Finger schauen können, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Also, sehen Sie zu, dass Sie sich den Assistenzärzten gegenüber angemessen verhalten, verstanden? Sie verstehen doch, wovon ich rede, Sylvie?«
Sylvie war rot geworden und Thérèse, die geglaubt hatte, alles über Sylvie zu wissen, begann zu ahnen, dass es da etwas gab, was sie ihr nicht erzählt hatte.
»Ihr wisst Bescheid!«, sagte Frau Debrais barsch. »Die Männer sind alle gleich. Sie stehen auf junges Fleisch. Und wenn was passiert, fliegen nicht die, sondern Sie. Verstanden, Sylvie? Antworten Sie!«
»Ja, verstanden.«
»Gut«, sagte Frau Debrais.
Mit großen Schritten durchquerte sie den Hof, gefolgt von den beiden Mädchen. Das Krankenhaus war durch eine hohe Mauer und eine Eisentür von der Schule getrennt. An der Tür hing ein Anschlag, den man im Dunkeln nicht sehen konnte, den die Schülerinnen jedoch auswendig kannten, da sie ihn seit mehr als einem Jahr, das sie nun dort waren, schon zigmal gelesen hatten.
Es ist den Schülerinnen ausdrücklich verboten, das Krankenhaus ohne DIENSTLICHE GRÜNDE zu betreten.
Frau Debrais öffnete die quietschende Tür.
»Gehen wir!«
Alle drei betraten das Krankenhausgelände und gingen dann eine von Spindelsträuchern gesäumte Allee entlang; es roch hier eher nach nächtlicher Frische als nach zementiertem Hof. Man konnte von hier die beleuchteten Zimmer aller Stationen sehen; es roch hier auch anders.
Frau Debrais schloss die schwere Metalltür wieder und verriegelte sie mit zwei Schlüsselumdrehungen. Thérèse fühlte, wie ihr das Herz schlug. So, von nun an befand sie sich in einer in sich selbst ruhenden Welt, die von hohen Mauern umschlossen war und zu der man nur durch große Tore gelangen konnte. Eine ganze Nacht lang würde sie nun eine Verantwortung tragen, wie sie kein anderes junges Mädchen in ihrem Alter hatte.
Instinktiv nahm sie Sylvies Hand und sie folgten schweigend Frau Debrais zum Arztzimmer. Die Arbeit begann.
Drittes Kapitel
Die Straße war wie ausgestorben. Jetzt waren alle Geschäfte geschlossen und in den wenigen Wohnhäusern genossen die Mieter die Ruhe eines lauen Abends; aus den Fenstern drangen Radiowerbung und Unterhaltungsmusik.
Die Scheinwerfer des 15 CV tauchten am Ende der Straße, die von zwei langen Reihen Gaslaternen gesäumt war, auf. Das Auto preschte mit voller Geschwindigkeit die Straße entlang und hielt abrupt vor der alten Garage in verwaschenem Blau an.
Ein Mann sprang auf den Gehweg, beugte sich über das alte, verrostete Eisentor und zog es mit regelmäßigem Rhythmus hoch – kein Quietschen war zu hören, nur das gleichmäßige Gleiten des Tores; offensichtlich wurde es öfter geöffnet und geschlossen, als es den Anschein hatte.
Sobald die Tür eine genügend hohe Öffnung freigab, fuhr der 15 CV auf den Gehsteig und dann mit einer Sicherheit, die auf regelmäßige Besuche schließen ließ, in die alte Garage.
Die roten Rücklichter hatten kaum die Schwelle überschritten, als sich das verzogene Eisentor auch schon wieder mit demselben regelmäßigen Rhythmus schloss.
Wenige Sekunden später lag die Rue Larousse wieder wie eine große, unbewegliche Schlange da; in ihrem Magen war auch für den 15 CV und seine Insassen noch Platz.