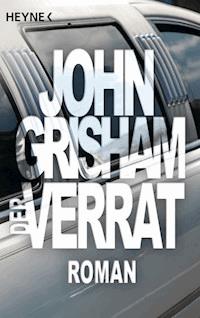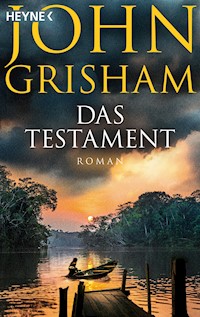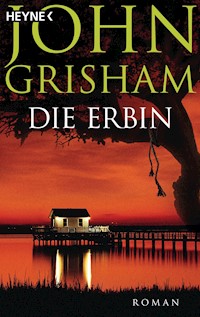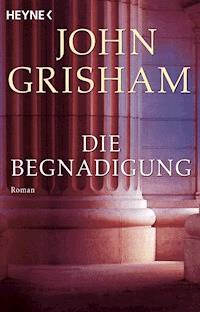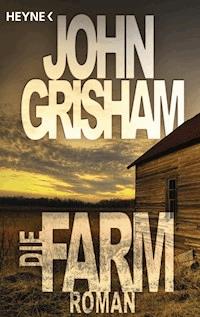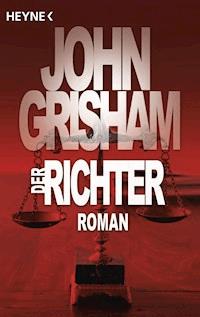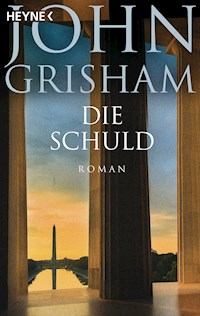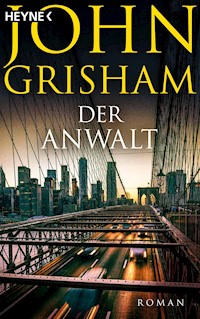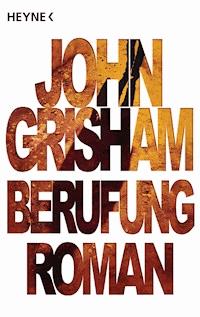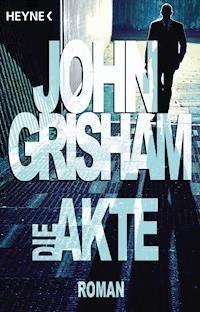
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
"Ein Thriller, bei dem man den Atem anhält." Frankfurter Rundschau
In einer Oktobernacht werden zwei Richter des obersten Bundesgerichts der USA ermordet. Die Jurastudentin Darby Shaw legt eine Akte über den schlimmsten politischen Skandal seit Watergate an - ein tödliches Dokument für alle, die sie kennen. Eine erbarmungslose Jagd beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 662
Ähnliche
Das Buch
Mit John Grisham hat die amerikanische Spannungsliteratur zu einem neuen Höhenflug angesetzt. Kein Thrillerautor der Gegenwart beherrscht so perfekt wie er die schwierige Kunst, brisante Zeitthemen in atemberaubend spannende Handlungskonstellationen umzusetzen. Der phänomenale Erfolg seines Mafia-Romans DieFirma beweist es. Auch in seinem Politthriller Die Akte mischt Grisham Fakten und Fiktionen zu einem hochexplosiven Gemisch:
Zwei mysteriöse Mordfälle im Umfeld höchster Regierungskreise der Vereinigten Staaten verursachen einen politischen Skandal, der Watergate in den Schatten stellt. In einer Oktobernacht werden zwei Richter des Obersten Bundesgerichts ermordet. Hinweise besagen, daß es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt – einen professionellen Killer. Aber es gibt kein gemeinsames Motiv. FBI und CIA sind ratlos. Doch dann hat Darby Shaw, Jurastudentin an der Tulane University in New Orleans, eine zündende Idee. Tagelang arbeitet sie an den Computern der Juristischen Fakultät und stößt dabei auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Mordfällen. Sie faßt ihre Ergebnisse in einer Akte zusammen und gerät damit ins Kreuzfeuer. Die Akte wird zu einem tödlichen Dokument für alle, die sie kennen. Darby begreift, daß irgend jemand entschlossen ist, auch sie umzubringen. Eine erbarmungslose Jagd beginnt – eine Jagd, bei der es ums Leben geht. Um Leben und Tod.
Inhaltsverzeichnis
Für meine ersten Leser:
Renée, meine Frau und inoffizielle Lektorin; meine Schwestern Beth Bryant und Wendy Grisham; meine Schwiegermutter Lib Jones und meinen Freund und Mitverschworenen Bill Ballard
Danksagungen
Dank schulde ich meinem literarischen Agenten Jay Garon, der vor fünf Jahren meinen ersten Roman entdeckte und damit in New York hausieren ging, bis jemand ja dazu sagte.
Dank auch meinem Lektor David Gernert, Freund und Baseballexperte; Steve Rubin und Ellen Archer und dem Rest der Familie bei Doubleday; und Jackie Cantor, meiner Lektorin bei Dell.
Herzlichen Dank allen, die mir geschrieben haben. Ich habe versucht, allen zu antworten; diejenigen, bei denen mir das nicht gelang, mögen mir verzeihen.
Besonderen Dank schulde ich Raymond Brown, dem noblen, rechtskundigen Anwalt in Pascagoula, Mississippi, für den keine Schwierigkeit zu schwierig war; Chris Charlton, meinem Studienkollegen, der die Straßen von New Orleans kennt wie seine Westentasche; Murray Avent, einem Freund aus den Tagen von Oxford und Ole Miss, der jetzt in D. C. lebt; Greg Block von der Washington Post und natürlich Richard und der Mannschaft von Square Books.
1
Kaum zu glauben, daß er noch imstande war, ein solches Chaos auszulösen. Aber vieles von dem, was er da unten sah, ging auf sein Konto. Und das war erfreulich. Er war einundneunzig, halb gelähmt, an einen Rollstuhl gefesselt und auf Sauerstoffzufuhr angewiesen. Sein zweiter Schlaganfall vor sieben Jahren hatte ihm beinahe den Rest gegeben. Dennoch war Richter Abraham Rosenberg nach wie vor am Leben, und selbst mit Schläuchen in der Nase führte er im Obersten Bundesgericht immer noch ein gewichtigeres Wort als seine acht Kollegen. Er war die einzige Legende, die dem Gericht geblieben war; und allein der Umstand, daß er immer noch atmete, brachte den größten Teil des Mobs da unten auf der Straße in Aufruhr.
Er saß in seinem Rollstuhl in seinem Büro im Gebäude des Gerichts. Seine Füße berührten die Fensterkante, und er beugte sich vor, als der Lärm anschwoll. Er haßte Polizisten, aber zu sehen, wie sie in dichten, ordentlichen Reihen dastanden, war doch ein wenig beruhigend. Sie standen unerschütterlich da, während der Mob, mindestens fünfzigtausend Menschen, nach Blut schrie.
»So viele waren es noch nie!« krächzte Rosenberg, ohne sich umzusehen. Er war fast taub. Jason Kline, sein ältester Mitarbeiter, stand hinter ihm. Der erste Montag im Oktober, der Eröffnungstag der neuen Sitzungsperiode, war zu einer traditionellen Feier des Ersten Verfassungszusatzes ausgeartet – einer grandiosen Feier. Rosenberg war begeistert. Für ihn war Redefreiheit gleichbedeutend mit Freiheit zu Demonstration und Aufruhr.
»Sind die Indianer dabei?« fragte er laut.
Jason Kline beugte sich zu seinem rechten Ohr. »Ja!«
»In voller Kriegsbemalung?«
»Ja! Mit allem, was dazugehört.«
»Tanzen sie?«
»Ja!«
Die Indianer, die Schwarzen, Weißen, Braunen, Frauen, Schwulen, Naturschützer, Christen, Abtreibungsaktivisten, Arier, Nazis, Atheisten, Jäger, Tierfreunde, weiße Suprematisten, schwarze Suprematisten, Steuerverweigerer, Farmer – es war ein gewaltiges Meer des Protestes. Und die Einsatzkommandos der Polizei umklammerten ihre schwarzen Stöcke.
»Die Indianer sollten mich lieben!«
»Das tun sie bestimmt.« Kline nickte und lächelte den gebrechlichen kleinen Mann mit den geballten Fäusten an. Seine Ideologie war simpel: die Regierung rangierte vor dem Geschäft, der Einzelne vor der Regierung und die Umwelt vor allem anderen. Und was die Indianer betraf – gebt ihnen, was immer sie haben wollen.
Das Beten, Singen, Skandieren, Rufen und Schreien wurde lauter. Die Polizisten rückten näher zusammen. Der Mob war größer und wütender als in den voraufgegangenen Jahren. Die Atmosphäre war gespannter. Gewalt war an der Tagesordnung. Auf Abtreibungskliniken waren Bombenattentate verübt worden. Ärzte hatte man angegriffen und verprügelt. In Pensacola war einer umgebracht worden, geknebelt, in der Position eines Fetus zusammengeschnürt und mit Säure verätzt. Allwöchentlich kam es zu Straßenschlachten. Militante Schwule hatten Geistliche und Kirchen attackiert. Weiße Suprematisten hatten sich zu einem Dutzend bekannter, finsterer paramilitärischer Organisationen formiert und waren bei ihren Angriffen auf Schwarze, Lateinamerikaner und Asiaten wesentlich kühner geworden. Haß war Amerikas beliebtester Zeitvertreib.
Und natürlich war das Gericht eine bequeme Zielscheibe. Drohungen, ernstzunehmende Drohungen gegen die Richter hatten sich seit 1990 verzehnfacht. Der Polizeischutz des Obersten Bundesgerichts war verdreifacht worden. Mindestens zwei FBI-Agenten waren mit der Bewachung jedes Richters beauftragt und weitere fünfzig damit beschäftigt, den Drohungen nachzugehen.
»Sie hassen mich, nicht wahr?« sagte er laut und schaute aus dem Fenster.
»Ja, etliche von ihnen tun das«, erwiderte Kline belustigt.
Rosenberg freute sich, das zu hören. Er lächelte und inhalierte tief. Achtzig Prozent der Drohungen waren gegen ihn gerichtet.
»Haben sie auch Transparente bei sich?« fragte er. Er war fast blind.
»Eine ganze Menge.«
»Was steht drauf?«
»Das Übliche. Rosenberg soll zurücktreten. Nieder mit Rosenberg. Schluß mit dem Sauerstoff.«
»Solche blöden Sprüche klopfen sie schon seit Jahren. Warum lassen sie sich nicht mal was Neues einfallen?«
Kline antwortete nicht. Abe hätte schon vor Jahren zurücktreten sollen, aber eines Tages würden sie ihn auf einer Bahre hinaustragen. Seine drei Mitarbeiter erledigten den größten Teil der Recherchen, aber Rosenberg bestand darauf, seine Urteile selbst zu schreiben. Er tat es mit einem dicken Filzstift und kritzelte seine Worte auf große Kanzleibogen, ungefähr wie ein ABC-Schütze, der gerade schreiben lernt. Es war ein langsames Arbeiten, aber was macht das schon, wenn man auf Lebenszeit in sein Amt berufen ist? Die Mitarbeiter überprüften seine Urteile und fanden selten einen Fehler.
Rosenberg kicherte. »Wir sollten den Indianern Runyan zum Fraß vorwerfen.« John Runyan war der Gerichtspräsident, ein zäher Konservativer, von einem Republikaner ernannt und bei den Indianern und den meisten anderen Minderheiten unbeliebt. Sieben der neun Richter waren von republikanischen Präsidenten ernannt worden. Seit fünfzehn Jahren wartete Rosenberg auf einen Demokraten im Weißen Haus. Er wollte aufhören, mußte aufhören, aber den Gedanken, daß ein Stockkonservativer vom Typ Runyans seinen Sitz einnehmen könnte, ertrug er nicht.
Er konnte warten. Er konnte hier in seinem Rollstuhl sitzen und Sauerstoff atmen und für die Indianer, die Schwarzen, die Frauen, die Armen, die Behinderten und den Umweltschutz eintreten, bis er hundertfünf war. Und kein Mensch auf der Welt konnte auch nur das mindeste dagegen unternehmen, es sei denn, man brachte ihn um. Und das wäre nicht einmal die schlechteste Lösung.
Sein Kopf schwankte, dann taumelte er und sank auf seine Schulter. Er war eingeschlafen. Kline zog sich leise zurück und machte sich wieder an seine Recherchen in der Bibliothek. Er würde in einer halben Stunde wiederkommen, um den Sauerstoff zu überprüfen und Abe seine Medikamente zu geben.
Das Büro des Gerichtspräsidenten liegt im Hauptgeschoß und ist größer und besser ausgestattet als die anderen acht. Der äußere Raum wird für kleine Empfänge und formelle Veranstaltungen benutzt; im inneren arbeitet der Präsident. Die Tür zum inneren Büro war geschlossen. Im Raum befanden sich der Präsident, seine drei Mitarbeiter, der Chef der Polizei des Obersten Bundesgerichts, drei FBI-Agenten und K. O. Lewis, der stellvertretende Direktor des FBI. Die Stimmung war ernst, alle bemühten sich, den Lärm von der Straße unten zu ignorieren. Es war schwierig. Der Präsident und Lewis erörterten die jüngste Serie von Morddrohungen, und alle anderen hörten zu. Die Mitarbeiter machten sich Notizen.
In den letzten sechzig Tagen hatte das FBI mehr als zweihundert Drohungen registriert, ein neuer Rekord. Es gab das übliche Sortiment von Sprengt das Gericht in die Luft-Drohungen, aber viele waren gezielt und bezogen sich auf Namen, Fälle und Urteile.
Runyan unternahm keinen Versuch, seine Besorgnisse zu verheimlichen. Er las ein vertrauliches FBI-Resümee, in dem die Namen der Organisationen aufgeführt waren, die als Urheber der Drohungen in Frage kamen. Der Ku-Klux-Klan, die Arier, die Nazis, die Palästinenser, die schwarzen Separatisten, die Abtreibungsgegner, die Homosexuellenhasser. Sogar die IRA. Alle, wie es schien, ausgenommen die Rotarier und die Pfadfinder. Eine vom Iran unterstützte Gruppe im Mittleren Osten hatte mit Blutvergießen auf amerikanischem Boden als Vergeltung für den Tod von zwei Justizbeamten in Teheran gedroht. Es gab absolut keinen Beweis dafür, daß die Vereinigten Staaten irgend etwas mit den Morden zu tun hatten. Eine neue, kürzlich zu Ruhm gelangte inländische Terrororganisation, die sogenannte Underground Army, hatte in Texas einen Bundesrichter mit einer Autobombe umgebracht. Niemand war verhaftet worden, aber die UA behauptete, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Sie war auch die Hauptverdächtige bei einem Dutzend Bombenattentaten auf Büros der American Civil Liberties Union, aber man konnte ihr nichts nachweisen.
»Was ist mit diesen puertoricanischen Terroristen?« fragte Runyan, ohne aufzuschauen.
»Leichtgewichte. Die machen uns keine Sorgen«, erwiderte Lewis gelassen. »Sie drohen schon seit zwanzig Jahren.«
»Nun, vielleicht ist jetzt für sie die Zeit gekommen, etwas zu tun. Das Klima ist gerade richtig, meinen Sie nicht?«
»Die Puertoricaner können Sie vergessen, Chief.«Runyan ließ sich gerne Chief nennen. Nicht Chief Justice, nicht Mr. Chief Justice. Einfach Chief. »Sie drohen nur, weil alle anderen es auch tun.«
»Sehr komisch«, sagte der Chief, ohne zu lächeln. »Sehr komisch. Ich möchte nicht, daß irgendeine Gruppe außer acht gelassen wird.« Runyan warf das Resümee auf seinen Schreibtisch und rieb sich die Schläfen. »Reden wir über die Sicherheitsvorkehrungen.« Er schloß die Augen.
K. O. Lewis legte seine Kopie des Resümees gleichfalls auf den Schreibtisch. »Also, der Direktor ist der Ansicht, daß wir jedem Richter vier Agenten zuordnen sollten, zumindest während der nächsten neunzig Tage. Für die Fahrten zum Gericht und zurück werden Limousinen mit Eskorte eingesetzt. Die Polizei des Obersten Bundesgerichts unterstützt uns und bewacht dieses Gebäude .«
»Was ist mit Reisen?«
»Keine gute Idee, zumindest im Augenblick. Der Direktor findet, die Richter sollten bis Ende des Jahres hier in Washington bleiben.«
»Sind Sie verrückt? Ist er verrückt? Wenn ich meine Kollegen aufforderte, dieser Bitte nachzukommen, würden sie alle noch heute abend die Stadt verlassen und den ganzen nächsten Monat herumreisen. Das ist absurd.« Runyan warf seinen Mitarbeitern einen finsteren Blick zu; sie schüttelten entrüstet die Köpfe. Wirklich absurd.
Lewis war unbeeindruckt. Das war zu erwarten gewesen. »Wie Sie wünschen. Es war nur ein Vorschlag.«
»Ein törichter Vorschlag.«
»Der Direktor hat in dieser Hinsicht nicht mit Ihrer Kooperation gerechnet. Er erwartet jedoch, daß er im voraus über alle Reisepläne informiert wird, damit wir unsere Vorkehrungen treffen können.«
»Soll das heißen, daß Sie vorhaben, jeden Richter zu eskortieren, wenn er die Stadt verläßt?«
»Ja, Chief. Genau das haben wir vor.«
»Unmöglich. Diese Leute sind es nicht gewohnt, rund um die Uhr beaufsichtigt zu werden.«
»Ja, Sir. Sie sind es auch nicht gewohnt, daß sich jemand an sie heranmacht. Wir versuchen, Sie und Ihre Kollegen zu beschützen. Natürlich sagt uns niemand, daß wirirgend etwas tun müssen. Ich glaube, Sir, Sie selbst waren es, der uns gerufen hat. Wenn Sie es wünschen, können wir wieder gehen.«
Runyan rückte auf seinem Stuhl nach vorn und attakkierte eine Büroklammer, zog sie auseinander und versuchte, den Draht vollkommen gerade zu biegen. »Und hier?«
Lewis seufzte und hätte beinahe gelächelt. »Das Gebäude macht uns keine Sorgen, Chief. Das läßt sich mühelos sichern. Hier rechnen wir nicht mit Problemen.«
»Wo dann?«
Lewis nickte zum Fenster hinüber. Der Lärm war wieder lauter geworden. »Irgendwo da draußen. Auf den Straßen wimmelt es von Idioten, Verrückten und Fanatikern.«
»Und alle hassen uns.«
»Offensichtlich. Wir machen uns große Sorgen um Richter Rosenberg, Chief. Er weigert sich nach wie vor, unsere Leute in sein Haus zu lassen; sie müssen die ganze Nacht auf der Straße verbringen. Er gestattet einem der Polizisten des Obersten Bundesgerichts, den er besonders schätzt – wie heißt er? Ferguson –, draußen an der Hintertür zu sitzen, aber nur von zehn Uhr abends bis sechs Uhr morgens. Niemand darf hinein außer Richter Rosenberg und seinem Pfleger. Das Haus ist nicht sicher.«
Runyan stocherte mit der Büroklammer auf seiner Schreibunterlage herum und lächelte in sich hinein. Rosenbergs Tod, wie immer er auch eintreten mochte, wäre eine Erleichterung. Nein, er wäre ein grandioses Ereignis. Der Chief würde Schwarz tragen und eine Nachrede halten müssen, aber hinter verschlossenen Türen würde er mit seinen Mitarbeitern kichern. Der Gedanke behagte Runyan.
»Was schlagen Sie vor?« fragte er.
»Können Sie mit ihm reden?«
»Ich habe es versucht. Ich habe ihm erklärt, daß er vermutlich der meistgehaßte Mann in Amerika ist, daß Millionen von Menschen ihn tagtäglich verfluchen, daß die meisten Leute ihn am liebsten tot sähen, daß er viermal soviel Haßbriefe bekommt wie alle anderen Richter zusammen, und daß er für einen Mörder eine ideale und leichte Zielscheibe ist.«
Lewis wartete. »Und?«
»Er hat gesagt, ich könnte ihn am Arsch lecken. Dann ist er eingeschlafen.«
Die Mitarbeiter kicherten, wie es sich gehörte; erst dann begriffen auch die FBI-Agenten, daß Humor erlaubt war, und schlossen sich mit einem kurzen Auflachen an.
»Also was unternehmen wir?« fragte Lewis ungerührt.
»Sie beschützen ihn, so gut Sie können, halten es schriftlich fest und zerbrechen sich deswegen nicht den Kopf. Er fürchtet sich vor nichts, auch nicht vor dem Tod, und wenn er nicht nervös ist, warum sollten Sie es dann sein?«
»Der Direktor ist nervös, also bin ich auch nervös, Chief. Es ist ganz simpel. Wenn einem von Ihnen etwas zustößt, muß das FBI es ausbaden.«
Der Chief schaukelte auf seinem Stuhl. Der Lärm von draußen war entnervend. Diese Zusammenkunft hatte sich lange genug hingezogen. »Vergessen wir Rosenberg. Vielleicht stirbt er im Schlaf. Ich mache mir mehr Sorgen um Jensen.«
»Jensen ist ein Problem«, sagte Lewis und blätterte in seinen Papieren.
»Ich weiß, daß er ein Problem ist«, sagte Runyan langsam. »Er ist eine Pest. Manchmal hält er sich für einen Liberalen und votiert in der Hälfte der Fälle wie Rosenberg. Einen Monat später ist er ein weißer Suprematist und unterstützt die Rassentrennung in den Schulen. Dann entdeckt er seine Liebe zu den Indianern und möchte ihnen Montana schenken. Es ist, als hätte man es mit einem zurückgebliebenen Kind zu tun.«
»Er ist wegen Depressionen in Behandlung.«
»Ich weiß, ich weiß. Er erzählt mir davon. Ich bin seine Vaterfigur. Welches Medikament?«
»Prozac.«
Der Chief stocherte unter seinen Fingernägeln herum. »Was ist mit dieser Aerobic-Lehrerin, mit der er sich immer getroffen hat? Läuft das noch?«
»Eigentlich nicht, Chief. Ich glaube, er macht sich nicht viel aus Frauen.« Lewis war mit sich zufrieden. Er wußte mehr. Er warf einem seiner Agenten einen Blick zu und bestätigte diesen pikanten kleinen Leckerbissen.
Runyan wollte davon nichts hören. »Kooperiert er?«
»Natürlich nicht. In vielem ist er schlimmer als Rosenberg. Er läßt zu, daß wir ihn zu dem Haus begleiten, in dem er wohnt. Aber dann läßt er uns die ganze Nacht auf dem Parkplatz sitzen. Er wohnt im siebenten Stock, wie Sie vielleicht wissen. Wir dürfen uns nicht einmal in der Eingangshalle aufhalten. Das stört die Mitbewohner, sagt er. Also sitzen wir in unseren Wagen. Das Gebäude hat zehn Ein- und Ausgänge, und es ist unmöglich, ihn zu beschützen . Er spielt Verstecken mit uns. Er schleicht die ganze Zeit herum, und wir wissen nie, ob er im Haus ist oder nicht. Bei Rosenberg wissen wir wenigstens, daß er die ganze Nacht über da ist. Jensen ist unmöglich.«
»Großartig. Wenn Sie ihm nicht folgen können, wie kann es dann ein Mörder?«
Der Gedanke war Lewis noch nicht gekommen. Die Ironie entging ihm. »Der Direktor macht sich große Sorgen um Jensens Sicherheit.«
»Er bekommt nicht so viele Drohbriefe.«
»Er ist Nummer sechs auf der Liste, nur ein paar weniger als Sie, Chief.«
»Oh. Also stehe ich auf dem fünften Platz.«
»Ja. Gleich hinter Richter Manning. Der kooperiert übrigens. Voll und ganz.«
»Er fürchtet sich vor seinem eigenen Schatten«, sagte Runyan, dann zögerte er. »Das hätte ich nicht sagen sollen. Tut mir leid.«
Lewis ignorierte es. »Überhaupt ist die Zusammenarbeit einigermaßen gut, von Rosenberg und Jensen abgesehen. Richter Stone beschwert sich dauernd, aber er hört auf uns.«
»Er beschwert sich über alles mögliche, also nehmen Sie es nicht persönlich. Was glauben Sie, wo Jensen sich hinschleicht?«
Lewis warf einem seiner Agenten einen Blick zu. »Wir haben keine Ahnung.«
Ein großer Teil des Mobs vereinigte sich plötzlich zu einem hemmungslosen Chor, und alle Leute auf der Straße schienen einzufallen. Der Chief konnte es nicht länger ignorieren. Er stand auf und beendete die Zusammenkunft.
Das Büro von Richter Glenn Jensen lag im zweiten Stock, der Straße und dem Lärm abgewandt. Es war ein geräumiges Zimmer, aber das kleinste von den neun. Jensen war unter den Bundesrichtern der jüngste und konnte von Glück sagen, daß er überhaupt ein Büro hatte. Als er sechs Jahre zuvor im Alter von zweiundvierzig Jahren nominiert worden war, galt er als strenger, gesetzestreuer Jurist mit ausgesprochen konservativen Ansichten, genau wie der Mann, der ihn nominiert hatte. Seine Bestätigung durch den Senat war eine Schlacht gewesen. Vor dem Komitee hatte Jensen eine schlechte Figur gemacht. Bei heiklen Themen suchte er Ausflüchte, und beide Seiten fielen über ihn her. Die Republikaner waren peinlich berührt. Die Demokraten rochen Blut. Der Präsident hatte getan, was er nur irgend konnte, und Jensen war mit einer Mehrheit von nur einer sehr widerwilligen Stimme bestätigt worden.
Aber er hatte es geschafft, auf Lebenszeit. In seinen sechs Jahren im Amt hatte er es niemandem recht gemacht. Tief verletzt vom Resultat seiner Anhörung hatte er sich geschworen, Mitleid zu empfinden und entsprechend zu urteilen. Das hatte die Republikaner aufgebracht. Sie fühlten sich betrogen, vor allem, als er eine latente Leidenschaft für die Rechte der Kriminellen in sich entdeckte. Fast ohne jeden ideologischen Gewaltakt verließ er schnell die Rechte und rückte zuerst in die Mitte und dann auf die Linke. Und dann, während sich die Rechtsgelehrten die Spitzbärte rauften, schoß Jensen zurück auf die Rechte und schloß sich Richter Sloan bei einem seiner abscheulichen Minderheitsvoten gegen die Rechte der Frauen an. Jensen mochte keine Frauen. Er war neutral, was Gebete anging, skeptisch in bezug auf Redefreiheit, mitfühlend bei Steuerprotestlern, gleichgültig gegenüber den Indianern, ängstlich gegenüber Schwarzen, hart gegen Verfasser pornographischer Schriften, weich gegen Kriminelle und einigermaßen konsequent, was den Umweltschutz anging. Und schließlich hatte Jensen, zur weiteren Bestürzung der Republikaner, die Blut vergossen hatten, um seine Bestätigung durchzusetzen, eine beunruhigende Sympathie für die Rechte der Homosexuellen an den Tag gelegt.
Auf seinen Wunsch hin war ihm der unerfreuliche Fall eines Mannes namens Dumond übertragen worden. Ronald Dumond hatte acht Jahre mit seinem Freund zusammengelebt. Sie waren ein glückliches Paar gewesen, einander treu ergeben und vollauf zufrieden, die Erfahrungen des Lebens gemeinsam machen zu können. Sie wollten heiraten, aber die Gesetze von Ohio verboten eine derartige Verbindung. Dann bekam der Freund AIDS und starb eines gräßlichen Todes. Ronald wußte genau, wie er ihn begraben wollte, aber dann mischte sich die Familie des Freundes ein und ließ nicht zu, daß Ronald an der Trauerfeier und der Beerdigung teilnahm. Ronald hatte die Familie verklagt und behauptet, emotionelle und psychische Schäden davongetragen zu haben. Der Fall war sechs Jahre lang vor den unteren Instanzen verhandelt worden und nun plötzlich auf Jensens Schreibtisch gelandet.
Zur Debatte standen die Rechte der »Ehegatten« von Schwulen. Dumond war zum Schlachtruf homosexueller Aktivisten geworden. Schon die bloße Erwähnung von Dumond löste Straßenschlachten aus.
Und Jensen hatte den Fall. Die Tür zu seinem kleineren Büro war geschlossen. Jensen und seine drei Mitarbeiter saßen am Konferenztisch. Sie hatten zwei Stunden über Dumond verbracht und waren nicht weitergekommen. Sie hatten das Diskutieren satt. Einer der Mitarbeiter, ein Liberaler von der Universität Cornell, wollte eine eindeutige Stellungnahme, die schwulen Partnern weitreichende Rechte einräumte. Die wollte Jensen auch, aber er war nicht bereit, das zuzugeben. Die anderen beiden Mitarbeiter waren skeptisch. Sie wußten, genau wie Jensen, daß es unmöglich sein würde, eine Mehrheit von fünf zu erreichen.
Das Gespräch wendete sich anderen Dingen zu.
»Der Chief ist sauer auf Sie, Glenn«, sagte einer der Mitarbeiter. Wenn sie unter sich waren, nannten sie ihn beim Vornamen. »Richter« war so ein lästiger Titel.
Glenn rieb sich die Augen. »Was gibt es denn nun schon wieder?«
»Einer seiner Leute hat mich wissen lassen, daß der Chief und das FBI sich Sorgen machen wegen Ihrer Sicherheit. Er sagte, daß Sie nicht kooperierten und daß der Chief sehr beunruhigt sei. Er hat mich gebeten, das an Sie weiterzugeben.« Alles wurde durch das Netzwerk der Mitarbeiter weitergegeben. Alles.
»Soll er sich doch Sorgen machen. Das ist sein Job.«
»Er möchte, daß Ihnen zwei weitere Fibbies als Leibwächter zugewiesen werden. Sie wollen Zutritt zu Ihrer Wohnung. Und das FBI möchte Sie zum Gericht und wieder zurück fahren. Außerdem wollen sie, daß Sie Ihre Reisen einschränken.«
»Das habe ich bereits gehört.«
»Ja, das wissen wir. Aber der Mitarbeiter des Chief hat gesagt, der Chief wünscht, daß wir Sie noch einmal ausdrücklich darum bitten sollen, mit dem FBI zu kooperieren, damit die Ihr Leben retten können.«
»Ich verstehe.«
»Und deshalb bitten wir Sie darum.«
»Danke. Schaltet euch wieder ins Netzwerk ein und sagt dem Mitarbeiter des Chief, daß ihr mich nicht nur darum gebeten, sondern mir regelrecht die Hölle heiß gemacht habt, und daß ich euer Bitten und Hölleheißmachen zu würdigen wußte, aber daß es zu einem Ohr hinein und zum anderen wieder hinausgegangen ist. Sagt ihm, Glenn Jensen findet, daß er schon ein großer Junge ist.«
»Wird gemacht, Glenn. Sie haben wohl keine Angst?«
»Nicht die geringste.«
2
Thomas Callahan war einer der beliebteren Professoren an der Tulane University, vor allem deshalb, weil er sich weigerte, Seminare vor elf Uhr vormittags anzusetzen. Er trank ziemlich viel, wie die meisten seiner Studenten, und brauchte die ersten paar Morgenstunden zum Schlafen und dazu, wieder zu sich zu kommen. Seminare um neun und um zehn waren ein Graus. Er war auch beliebt, weil er cool war – ausgeblichene Jeans, Tweedjacketts mit abgeschabten Lederflecken an den Ellenbogen, keine Socken, keine Krawatte. Die schick-liberale Akademikerkluft. Er war fünfundvierzig, aber mit seinem dunklen Haar und der Hornbrille konnte er als Fünfunddreißigjähriger durchgehen; ihm selbst war es allerdings völlig gleichgültig, für wie alt man ihn hielt. Er rasierte sich einmal in der Woche, wenn es zu jucken begann; und wenn das Wetter kalt war, was in New Orleans selten vorkam, ließ er sich einen Bart stehen. Man wußte, daß er oft Affären mit Studentinnen hatte.
Er war auch beliebt, weil er Verfassungsrecht lehrte, ein ziemlich verhaßtes Thema, aber Pflichtstoff. Mit seiner Brillanz und seinem coolen Wesen schaffte er es, Verfassungsrecht interessant zu machen. Das brachte in Tulane sonst niemand fertig. Und im Grunde wollte es auch niemand; also drängten sich die Studenten, um an Callahans Seminar über Verfassungsrecht um elf teilzunehmen, an drei Vormittagen in der Woche.
Achtzig von ihnen saßen in sechs ansteigenden Reihen und flüsterten, während Callahan vor seinem Pult stand und seine Brille putzte. Es war genau fünf Minuten nach elf; immer noch zu früh, dachte er.
»Wer hat Rosenbergs Minderheitsvotum in Nash gegen New Jersey verstanden?« Alle Köpfe senkten sich, und im Saal war es still. Es mußte ein böser Kater sein. Seine Augen waren rot. Wenn er mit Rosenberg anfing, bedeutete das gewöhnlich einen ungemütlichen Verlauf des Seminars. Niemand meldete sich. Nash? Callahan ließ den Blick langsam und methodisch durch den Raum schweifen und wartete. Totenstille.
Der Türknauf klickte laut und zerbrach die Spannung. Die Tür ging auf, und eine attraktive junge Frau in ausgewaschenen Jeans und einem Baumwollpullover schob sich rasch hindurch und glitt an der Wand entlang bis zur dritten Reihe, wo sie sich geschickt zwischen den dicht gedrängt sitzenden Studenten hindurchmanövrierte, bis sie ihren Platz erreicht hatte und sich setzte. Die Burschen in der vierten Reihe beobachteten sie bewundernd. Die Burschen in der fünften Reihe reckten die Hälse. Seit inzwischen zwei harten Jahren bestand eines der wenigen Vergnügen des Jurastudiums darin, zu beobachten, wie sie mit ihren langen Beinen und weiten Pullovern die Flure und Säle zierte. Sie waren ganz sicher, daß darunter eine prachtvolle Figur steckte, aber sie war keine von denen, die dergleichen zur Schau stellten. Sie gehörte einfach dazu und kleidete sich so, wie es unter Jurastudenten üblich war – Jeans, Flanellhemden, alte Pullover und übergroße Khakijacken. Was hätten sie nicht für einen Minirock aus schwarzem Leder gegeben!
Sie lächelte den Mann neben ihr kurz an, und eine Sekunde lang waren Callahan und seine Fragen nach Nash vergessen. Das dunkelrote Haar reichte ihr gerade bis auf die Schultern. Sie war die perfekte kleine Cheerleaderin mit den vollkommenen Zähnen und dem vollkommenen Haar, in die sich jeder Junge auf der High School mindestens zweimal verliebte. Und mindestens einmal während des Jurastudiums.
Callahan ignorierte ihr Eintreten. Wenn sie in ihrem ersten Studienjahr gewesen wäre und sich vor ihm gefürchtet hätte, dann hätte er sie vielleicht aufs Korn genommen und ein paarmal gebrüllt. »Bei Gericht gibt es kein Zuspätkommen!« war eine alte Maxime, die andere Juraprofessoren längst zu Tode geprügelt hatten.
Aber Callahan war nicht nach Brüllen zumute, und Darby Shaw fürchtete sich nicht vor ihm. Eine kurze Sekunde lang fragte er sich, ob jemand wußte, daß sie miteinander schliefen. Vermutlich nicht. Sie hatte auf absoluter Geheimhaltung bestanden.
»Hat jemand Rosenbergs Minderheitsvotum in Nash gegen New Jersey gelesen?« Plötzlich stand er wieder im Rampenlicht, und es herrschte Totenstille. Eine hochgereckte Hand konnte dreißig Minuten pausenlosen Kreuzverhörs auslösen. Keine Freiwilligen. Die Raucher in der obersten Reihe zündeten sich ihre Zigaretten an. Die meisten der achtzig kritzelten irgend etwas auf ihre Blocks. Alle Köpfe waren gesenkt. Es wäre zu offensichtlich und zu riskant gewesen, im Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen zu blättern und Nash zu suchen; dazu war es zu spät. Jede Bewegung konnte Aufmerksamkeit erregen. Irgendwer würde dran glauben müssen.
Nash stand nicht im Verzeichnis. Es war einer von einem Dutzend unbedeutender Fälle, die Callahan eine Woche zuvor nebenbei erwähnt hatte; jetzt wollte er feststellen, ob irgend jemand ihn nachgelesen hatte. Dafür war er berühmt. Sein Abschlußexamen umfaßte zwölfhundert Fälle, von denen tausend nicht im Verzeichnis standen. Das Examen war ein Alptraum, aber er war ein netter Kerl und ein milder Beurteiler, und wer bei ihm durchfiel, mußte ein ziemlicher Blödmann sein.
In diesem Moment schien er kein netter Kerl zu sein. Er sah sich im Saal um. Zeit für ein Opfer. »Was ist mit Ihnen, Mr. Sallinger? Können Sie uns Rosenbergs Minderheitsvotum erläutern?«
Sofort sagte Sallinger aus der vierten Reihe heraus: »Nein, Sir.«
»Ah ja. Liegt das vielleicht daran, daß Sie Rosenbergs Urteil nicht gelesen haben?«
»Das könnte es. Ja, Sir.«
Callahan funkelte ihn an. Seine geröteten Augen ließen den arrogant finsteren Blick noch drohender wirken. Allerdings sah ihn nur Sallinger, da die Augen aller anderen auf ihre Hefte gerichtet waren. »Und warum nicht?«
»Weil ich versuche, keine Minderheitsvoten zu lesen. Vor allem nicht die von Rosenberg.«
Dumm. Dumm. Dumm. Sallinger hatte offenbar beschlossen, den Kampf aufzunehmen, aber er hatte keine Munition.
»Haben Sie etwas gegen Rosenberg, Mr. Sallinger?«
Callahan verehrte Rosenberg. Betete ihn an. Las Bücher über den Mann und seine Urteile. Studierte ihn. Hatte sogar einmal mit ihm gegessen.
Sallinger zappelte nervös. »O nein, Sir. Ich mag nur keine Minderheitsvoten.«
Es steckte ein bißchen Humor in Sallingers Antwort, aber niemand lächelte. Später, bei einem Bier, würden er und seine Kommilitonen lauthals lachen, wenn über Sallinger und seinen Abscheu vor Minderheitsvoten, insbesondere solchen von Rosenberg, geredet wurde. Aber nicht jetzt.
»Ich verstehe. Lesen Sie Mehrheitsentscheidungen?«
Zögern. Sallingers schwächlicher Versuch zu kämpfen konnte nur eine Demütigung nach sich ziehen. »Ja, Sir. Eine Menge.«
»Großartig. Dann erklären Sie doch bitte die Mehrheitsentscheidung im Fall Nash gegen New Jersey.«
Sallinger hatte noch nie von Nash gehört, aber jetzt würde er den Fall während seiner gesamten juristischen Laufbahn nie wieder vergessen. »Ich glaube, die habe ich nicht gelesen.«
»Sie lesen also keine Minderheitsvoten, Mr. Sallinger, und jetzt erfahren wir, daß Sie auch Mehrheitsentscheidungen vernachlässigen. Was lesen Sie eigentlich, Mr. Sallinger? Liebesromane? Boulevardzeitungen?«
Es folgte ein flüchtiges Lachen aus den Reihen oberhalb der vierten, und es kam von Studenten, die sich zum Lachen verpflichtet fühlten, aber gleichzeitig keinesfalls die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollten.
Sallinger, jetzt rot im Gesicht, starrte Callahan nur an.
»Warum haben Sie den Fall nicht gelesen, Mr. Sallinger?« fragte Callahan.
»Ich weiß es nicht. Er muß mir irgendwie entgangen sein.«
Callahan nahm es erstaunlich gut auf. »Das überrascht mich nicht. Ich habe ihn vorige Woche erwähnt. Letzten Mittwoch, um genau zu sein. Er wird im Abschlußexamen vorkommen. Ich verstehe nicht, wie Sie einen Fall ignorieren können, der Bestandteil des Examens ist.« Callahan wanderte jetzt langsam vor seinem Pult herum und musterte die Studenten. »Hat sich irgend jemand sonst die Mühe gemacht, ihn zu lesen?«
Schweigen. Callahan schaute zu Boden und ließ die Stille einsinken. Alle Augen waren gesenkt, alle Kugelschreiber und Bleistifte erstarrt. Von der obersten Reihe stieg Rauch auf.
Endlich hob auf dem vierten Platz in der dritten Reihe Darby Shaw langsam die Hand, und die Klasse stieß einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus. Sie hatte sie wieder einmal gerettet. Irgendwie erwartete man das von ihr. Sie war die Nummer Zwei in ihrer Klasse, ganz nahe der Nummer Eins, und sie konnte die Fakten und Ansichten und Präzedenzfälle und Minderheitsvoten und Mehrheitsentscheidungen von praktisch jedem Fall zitieren, den Callahan ihnen an den Kopf geworfen hatte. Ihr entging nichts. Die perfekte kleine Cheerleaderin besaß einen Magna cum laude-Grad in Biologie und hatte sich vorgenommen, ein Magna cum laude in Rechtswissenschaft zu erreichen und sich danach ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, daß sie Chemiefirmen wegen Umweltzerstörung verklagte.
Callahan musterte sie mit gespielter Frustration. Sie hatte vor drei Stunden seine Wohnung verlassen, nach einer langen Nacht mit Wein und Rechtswissenschaft. Aber von Nash war zwischen ihnen nicht die Rede gewesen.
»Sehr schön, Ms. Shaw. Weshalb ist Rosenberg empört ?«
»Er meint, daß das Gesetz von New Jersey gegen den Zweiten Verfassungszusatz verstößt.« Sie sah den Professor nicht an.
»Das ist gut. Und damit auch der Rest der Klasse informiert ist – was besagt dieses Gesetz?«
»Es verbietet halbautomatische Schußwaffen, unter anderem.«
»Wunderbar. Und nur des Spaßes halber – was besaß Mr. Nash zum Zeitpunkt seiner Verhaftung?«
»Eine AK-47.«
»Und was passierte mit ihm?«
»Er wurde zu drei Jahren verurteilt und ging in die Berufung.« Sie wußte über die Details Bescheid.
»Welchen Beruf hatte Mr. Nash?«
»Das wird in dem Urteil nicht genau gesagt, aber es ist von einer zusätzlichen Anklage wegen Rauschgifthandels die Rede. Zur Zeit seiner Verhaftung hatte er keinerlei Vorstrafen.«
»Er war also ein Drogenhändler mit einer AK-47. Aber in Rosenberg hatte er einen Freund, nicht wahr?«
»Natürlich.« Jetzt beobachtete sie ihn. Die Spannung hatte sich gelöst. Die meisten Augen folgten ihm, während er langsam herumwanderte, den Blick durch den Saal schweifen ließ, ein anderes Opfer auswählte. Es kam oft vor, daß Darby in diesen Seminaren den Ton angab, und Callahan ging es um breitere Beteiligung.
»Weshalb, meinen Sie, steht Rosenberg auf seiner Seite?« fragte er die Klasse.
»Er liebt Drogenhändler.« Es war Sallinger, verwundet, aber noch immer kampfbereit. Callahan legte großen Wert auf Diskussionen. Er lächelte sein Opfer an, wie um es wieder beim Blutvergießen willkommen zu heißen.
»Finden Sie, Mr. Sallinger?«
»Klar. Drogenhändler, Kinderbetatzer, Revolverhelden, Terroristen. Solche Leute bewundert Rosenberg. Sie sind seine schwachen und mißhandelten Kinder, also muß er sie beschützen.« Sallinger versuchte, rechtschaffen entrüstet zu sein.
»Und was sollte, Ihrer fachmännischen Ansicht zufolge, mit solchen Leuten geschehen?«
»Simpel. Sie sollten eine faire Verhandlung mit einem guten Anwalt bekommen, dann ein faires, schnelles Berufungsverfahren. Und wenn sie schuldig sind, sollten sie bestraft werden.« Sallinger war gefährlich nahe daran, sich anzuhören wie ein rechtsradikaler Verfechter von Gesetz und Ordnung, für die Jurastudenten von Tulane eine Todsünde.
Callahan verschränkte die Arme. »Bitte, fahren Sie fort.«
Sallinger roch eine Falle, stapfte aber weiter. Er hatte nichts zu verlieren. »Ich meine, wir haben einen Fall nach dem anderen gelesen, wo Rosenberg versucht hat, die Verfassung umzuschreiben und ein neues Schlupfloch für die Nichtzulassung von Beweismaterial zu schaffen, damit ein offenkundig schuldiger Angeklagter freigesprochen wird. Es kann einem beinahe schlecht dabei werden. Er hält alle Gefängnisse für grausame und unnatürliche Orte, und deshalb sollten gemäß dem Achten Verfassungszusatz alle Gefangenen freigelassen werden. Glücklicherweise ist er jetzt in der Minderheit, einer schrumpfenden Minderheit.«
»Ihnen gefällt die Einstellung des Gerichts, ist es nicht so, Mr. Sallinger?«
»So ist es.«
»Sind Sie einer von diesen normalen, tatkräftigen, patriotischen Durchschnittsamerikanern, die sich wünschen, daß der alte Bastard einschläft und nicht wieder aufwacht?«
Hier und dort wurde gekichert. Jetzt war es sicherer, wenn man lachte. Sallinger war zu klug, um wahrheitsgemäß zu antworten. »Das würde ich niemandem wünschen«, sagte er, fast verlegen.
Callahan wanderte wieder herum. »Vielen Dank, Mr. Sallinger. Sie haben uns, wie gewöhnlich, die Ansicht des Laien über das Recht geliefert.«
Jetzt war das Lachen wesentlich lauter. Sallingers Wangen röteten sich, und er sank auf seinem Sitz zusammen.
Callahan lächelte nicht. »So, und nun möchte ich das intellektuelle Niveau ein bißchen anheben. Also, Ms. Shaw, weshalb ist Rosenberg für Nash eingetreten?«
»Der Zweite Verfassungszusatz garantiert das Recht auf den Besitz und das Tragen von Waffen. Für Richter Rosenberg ist dieses Recht absolut und wörtlich zu nehmen. Nichts darf verboten werden. Wenn Nash eine AK-47 besitzen möchte oder eine Handgranate oder eine Bazooka, dann kann der Staat New Jersey kein Gesetz erlassen, das ihm das verbietet.«
»Sind Sie auch dieser Ansicht?«
»Nein, und damit stehe ich nicht allein. Es war eine Entscheidung von acht gegen einen. Niemand hat sich ihm angeschlossen.«
»Welcher Gedanke lag dem Urteil der anderen acht zugrunde?«
»Das liegt auf der Hand. Die Staaten haben zwingende Gründe, den Verkauf und den Besitz bestimmter Waffentypen zu verbieten. Das Interesse des Staates New Jersey ist gewichtiger als die im Zweiten Verfassungszusatz garantierten Rechte von Mr. Nash. Die Gesellschaft kann nicht zulassen, daß Einzelpersonen hochtechnisierte Waffen besitzen.«
Callahan musterte sie eingehend. Attraktive Jurastudentinnen waren selten in Tulane, aber wenn er eine entdeckt hatte, handelte er rasch. Im Verlauf der letzten acht Jahre war er ziemlich erfolgreich gewesen. Und in den meisten Fällen hatte er leichtes Spiel gehabt. Die Frauen kamen emanzipiert und willig an die Universität. Darby war anders gewesen. Zum ersten Mal war sie ihm im zweiten Semester ihres ersten Jahres in der Bibliothek aufgefallen, und es hatte einen Monat gedauert, bis sie mit ihm essen gegangen war.
»Wer hat die Mehrheitsentscheidung geschrieben?«
»Runyan.«
»Und Sie stimmen mit ihm überein?«
»Ja. Der Fall liegt im Grunde sehr einfach.«
»Was also ist in Rosenberg vorgegangen?«
»Ich glaube, er haßt die anderen Richter.«
»Und widerspricht deshalb nur, um ihnen eins auszuwischen?«
»Jedenfalls oft. Es wird immer schwieriger, seine Urteile zu verteidigen. Nehmen wir Nash. Für einen Liberalen wie Rosenberg ist die Frage der Kontrolle des Waffenbesitzes leicht zu beantworten. Er hätte die Mehrheitsentscheidung schreiben sollen, und vor zehn Jahren hätte er es auch getan. Bei Fordice gegen Oregon, einem Fall aus dem Jahr 1977, hat er den Zweiten Verfassungszusatz wesentlich enger ausgelegt. Seine Inkonsequenz ist beinahe peinlich.«
Callahan hatte Fordice vergessen. »Wollen Sie damit sagen, daß Rosenberg senil ist?«
Wie ein schwer angeschlagener Boxer ging Sallinger in die letzte Runde. »Er ist total übergeschnappt, und das wissen Sie. Sie können seine Urteile nicht verteidigen.«
»Nicht immer, Mr. Sallinger, aber zumindest ist er noch da.«
»Sein Körper ist da, aber sein Gehirn ist tot.«
»Er atmet noch, Mr. Sallinger.«
»Ja, mit Hilfe einer Maschine. Sie müssen ihm Sauerstoff in die Nase pumpen.«
»Aber es hilft, Mr. Sallinger. Er ist der letzte unter den großen Richterpersönlichkeiten, und er atmet noch.«
»Sie sollten anrufen und sich vergewissern«, sagte Sallinger, dann hielt er den Mund. Er hatte genug gesagt. Nein, er hatte zuviel gesagt. Als der Professor ihn anfunkelte, senkte er den Kopf, richtete die Augen auf seinen Block und fing an, sich zu fragen, warum er all das gesagt hatte.
Callahan durchbohrte ihn mit Blicken, dann begann er, wieder herumzuwandern. Es war in der Tat ein schlimmer Kater.
3
Er sah jedenfalls aus wie ein alter Farmer, mit Strohhut, sauberer Latzhose, ordentlich gebügeltem Khaki-Arbeitshemd, Stiefeln. Er kaute Tabak und spuckte in das schwarze Wasser unter der Mole. Er kaute wie ein Farmer. Sein Pickup, obwohl ein neueres Modell, war hinreichend verwittert und sah nach staubigen Straßen aus. Nummernschilder von North Carolina. Er stand, hundert Meter entfernt, im Sand am anderen Ende der Mole.
Es war Mitternacht an einem Montag, dem ersten Montag im Oktober, und die nächste halbe Stunde mußte er in der dunklen Kühle an der menschenleeren Mole warten, nachdenklich kauend auf das Geländer gestützt, und dabei intensiv aufs Meer hinausschauend. Er war allein, und er hatte gewußt, daß es so sein würde. Es war so geplant. Um diese Zeit war die Mole immer menschenleer. Hin und wieder flackerten die Scheinwerfer eines Wagens an der Küste entlang, aber um diese Zeit hielten die Scheinwerfer nie an.
Er beobachtete die roten und blauen Fahrrinnenlichter weit draußen. Er sah auf die Uhr, ohne den Kopf zu bewegen. Die dichten Wolken hingen tief, und es würde schwierig sein, es zu sehen, bevor es die Mole fast erreicht hatte. Aber so war es geplant.
Der Pickup kam nicht aus North Carolina, und der Fahrer auch nicht. Die Nummernschilder waren von einem alten Laster auf einem Schrottplatz in der Nähe von Durham abmontiert worden. Der Pickup war in Baton Rouge gestohlen. Der Farmer war aus dem Nichts gekommen und hatte keinen der Diebstähle begangen. Er war ein Profi, und deshalb erledigte jemand anders die schmutzige Kleinarbeit.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!