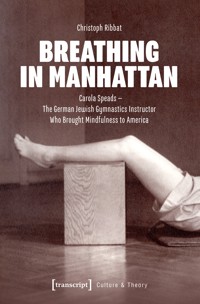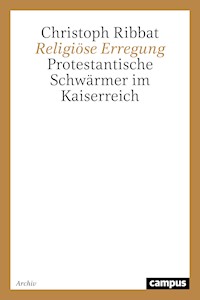18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine Dame mit leichtem deutschen Akzent unterrichtet Achtsamkeit in New York City: wie man bewusst atmet, den Körper erspürt und den Stress der Großstadt überlebt. Ihr Studio ist ein Geheimtipp für Sängerinnen, Tänzerinnen und verkrampfte Büromenschen. Ihre Schülerinnen meinen, sie sei ganz und gar entspannt. Aber ihre eigene, schmerzhafte Vergangenheit hält sie vor ihnen geheim.
Die Atemlehrerin erzählt die berührende Geschichte der Carola Joseph. Die Gymnastiklehrerin, 1901 geboren, lebt, arbeitet, forscht in Berlin, heiratet, heißt nun Carola Spitz, und verlässt die Stadt erst, als es fast schon zu spät ist. Sie wird zu einem jüdischen Flüchtling unter Zehntausenden, etabliert sich als »Carola Speads« in Manhattan und lehrt, als sie 98 Jahre alt ist, noch immer in ihrem Studio am Central Park.
Christoph Ribbat verknüpft eine Biografie aus nächster Nähe mit der Geschichte von Atemübungen und Gymnastikexperimenten im 20. Jahrhundert. Aus dem Nachlass einer nahezu unbekannten Emigrantin entsteht eine fesselnde Familien- und Kulturgeschichte. Wer sie liest, wird selbst beginnen, ganz bewusst Luft zu holen. Das – sagt Carola Spitz/Speads – macht glücklich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Ähnliche
Christoph Ribbat
Die Atemlehrerin
Wie Carola Spitz aus Berlin floh und die Achtsamkeit nach New York mitnahm
Suhrkamp
»Und wenn nichts anderes«, sagte der Jehudi, »eins habe ich bei meinem Lehrer, dem heiligen Rabbi in Lublin, gelernt: wenn ich mich schlafen lege, schlummre ich im gleichen Augenblick ein.«
Martin Buber
Inhalt
1. Das Studio der Körperlichen Umerziehung
2. Wandervogel
3. Mehr als ein Guru
4. Die Liste der jüdischen Gymnastiklehrerinnen
5. Blumen von Charlotte
Quellen
Bildnachweise
Anmerkungen
1. Das Studio der Körperlichen Umerziehung
Die Entspannungsexpertin ist nicht entspannt. Sie blickt Richtung Osten. Sie schaut auf die Bäume, die Wiesen, den See. Ihr Hals schmerzt. Eine Knorpelzwischenscheibe quetscht einen Nerv. Sie sorgt sich, dass die Miete für diese Wohnung viel zu hoch ist. Was für ein enormes finanzielles Risiko, hier einzuziehen. Aber was für ein Geschenk, so viel von diesem weiten Himmel zu sehen, von der Sonne und den Wolken. Möwen segeln dahin.
Der Bruch mit Charlotte wühlt sie auf. Sie, Carola, hat sie früher Charlöttchen genannt und Charlöttchen sie Carölchen. Mehr als zehn Jahre haben sie zusammengearbeitet. Sie waren wie Schwestern. Zusammen sind sie durch die harten Zeiten gegangen. Jetzt sprechen sie nicht mehr miteinander. Carola beobachtet, wie der Wind Streifen auf das Wasser des Sees bringt und wie sich diese Muster immer wieder ändern. Sie blickt auf Laubbäume und Tannen und schmale Pfade, die sich durchs Grün winden. In einer geraden Linie hinter den Bäumen, 800 Meter entfernt, sieht sie das Metropolitan Museum of Art an der Fifth Avenue. Hinter dem Museum liegt die Upper East Side und der East River und Queens und Long Island und dann der Atlantik und dann Europa. Sie fährt regelmäßig mit dem Bus nach Deutschland.
Ihre Schülerinnen und Schüler werden gleich kommen. Die Strohhalme liegen bereit. Es sind nicht die großen für Milkshakes, sondern die kleinen für Cocktails. Das Strohhalm-Experiment ist ihr wichtig. Gedämpft hört sie die Autos zehn Etagen unter ihr. Dieses helle, leere Zimmer hier oben ist ihr Arbeitsplatz: das Studio der Körperlichen Umerziehung. So hat sie es getauft. Sie ist dreiundfünfzig Jahre alt. Ihr Name vor dem Gesetz ist Carola Henriette Spitz. Für ihre Klienten heißt sie Carola Speads. In einem alten Pass Carola Spitzová. Vorher Carola Joseph. Irgendwann als Kind hieß sie Molle, weil sie eine Zeit lang ein bisschen ins Pummelige ging. Ihre Mutter hat sie aber auch als Erwachsene noch so genannt, selbst in ihren letzten Briefen aus Amsterdam.
Der Bus kreuzt den Park an der 86. Straße. Dann sind es noch einige Blocks und sie ist in Yorkville, Kleindeutschland. Schaller & Weber an der Second Avenue führen deutsches Apfelmus, Gewürzgurken und Pumpernickel sowie Kasseler Leberwurst, Braunschweiger Leberwurst und »Deutsche Blockwurst«.1 Das Schweinefleisch darin stört sie nicht. Ihr Mann ist Jude. Sie ist Jüdin. Sie haben auch jedes Jahr einen Christbaum, genau wie damals in Deutschland.
Das Haus, in dem sie seit einem knappen Jahr wohnt, heißt Rossleigh Court. Es liegt an der Ecke von 85. Straße und Central Park West. Daher hat es zwei Adressen. Für den privaten Briefverkehr nutzt sie: 1 West 85th Street. Sie hat viel Post zu erledigen, vor allem mit deutschen Behörden und ihren Anwälten in West-Berlin. Einer von ihnen, Herr Schwarz, ist Spezialist für Entschädigungsangelegenheiten. Er selbst hat seinen Vater in Theresienstadt verloren.2 Komplizierte, schmerzhafte Dinge tauscht sie mit den Juristen aus.
Ihre professionelle Anschrift, die des »Studio of Physical Re-Education«, lautet: 251 Central Park West. Jeder in New York weiß, was das bedeutet. Welch eine fantastische Lage das ist. Was für einen Blick man genießt. Vielleicht ist Rossleigh Court selbst nicht das glamouröseste Gebäude der Stadt. Aber einige Meter nach links ragen die luxuriösen Türme des Eldorado auf und rechts herunter geht es zum Dakota. Dort wird eines Tages ein Musiker namens John Lennon einziehen.
Häuser stehen nur auf der einen Seite von Central Park West. Wenn man die Straße überquert, läuft man also gleich in diese ganz andere Welt, ins Grüne, in den weiten Park, wo die Luft frischer ist als überall sonst in Manhattan, weil die Bäume die Atemluft filtern. Jetzt, im Herbst des Jahres 1954, qualmen in New York Hunderttausende Kohleheizungen, Tausende private Müllverbrennungsanlagen und Busse und Laster und Autos, täglich werden es mehr. Auf neu gebauten Einfallstraßen steuern die Pendler aus den Vororten ihre privaten Kraftfahrzeuge in die Stadt. Das ist ein sehr modernes Konzept. Überall lagert sich Ruß ab. An manchen Tagen meint man in New York, dass die Luft nur aus Abgasen besteht. Nur nicht hier am Park.3
Im Haus ist es still. Die Wände sind dick. Man bekommt nicht viel von den Nachbarn mit. Über die kroatische Familie im achten Stock munkelt man, dass sie Beziehungen zur SS gehabt und deshalb nach dem Krieg die Flucht nach New York ergriffen hätte. In der elften Etage wohnt Alberta Szalita. Während des Krieges war sie als Neurologin in einem Moskauer Krankenhaus tätig. Dort erhielt sie die Nachricht, im Herbst 1943, dass ihr Ehemann, ihr Vater, ihre Mutter, vier ihrer Schwestern und einer ihrer Großväter bei einer von Deutschen organisierten Massenerschießung umgebracht worden waren. Alberta Szalita ist in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Sie hat sich zur Psychoanalytikerin ausbilden lassen. Sie hat versucht, ihre Beziehungen mit den Ermordeten zu reflektieren, so unmöglich das auch erschien. Vor dem Trauern sei sie davongelaufen, schreibt Szalita später in ihrer Autobiografie, und das Trauern habe sie eingeholt.4
Es ist ein Schicksal, das viele hier auf der Upper West Side teilen. Die meisten aber schweigen über solche Dinge. Vielleicht laufen sie noch davon. Carola könnte vom unvorstellbaren Schicksal ihrer Mutter und ihres Bruders berichten oder von ihren eigenen Erfahrungen in Berlin, Amsterdam und Paris. Sie spricht nicht darüber, auch nicht mit Stevie, Alan und Johnny, ihren Enkeln. Ihre Großmutter, das werden diese später als erfolgreiche Männer um die sechzig sagen, habe wohl ihre amerikanischen Leben nicht beeinträchtigen wollen. Sie kommen regelmäßig vorbei, die kleinen Jungs, meistens am Samstagnachmittag, wenn Carolas Wochenendkurs vorbei ist. Manchmal bleiben sie über Nacht. Ihre Omi erzählt ihnen von dem Schäferhund, den sie als Kind besaß und der bei ihr im Bett schlafen durfte. Damals in Berlin.
Im diesem Sommer haben hier die Sirenen geheult. New York rechnet damit, von Atombomben getroffen zu werden. Früher war die Stadt weit weg von Europas Kriegen. Im Nuklearzeitalter ist das anders. Operation Alert, abgehalten an einem Montag im Juni, ging davon aus, dass drei Wasserstoffbomben in der Stadt detoniert seien. Eine habe Queens, eine die Bronx und eine Manhattan getroffen, genau an der Kreuzung von First Avenue und 57. Straße. Zügig räumten die New Yorker die Bürgersteige und suchten die vorgesehenen Schutzräume auf. Die Übung sollte ihren Glauben daran verstärken, dass ihr Land mit allem umgehen könne, auch der größten denkbaren Attacke. Falls es sich aber tatsächlich um Bomben gehandelt hätte, das sagen Realisten, wären mehr als zwei Millionen Menschen zu Tode gekommen.5
Ihre Schülerinnen und Schüler suchen eine andere Art Schutzraum. Das ist Carolas Studio für sie: ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen und sicher. Manche kommen direkt unter dem Gebäude mit der U-Bahn an, an der Station 86. Straße. Sie lassen das Rumpeln, das Quietschen, die stickige Dunkelheit hinter sich, steigen die Treppen hoch ans Tageslicht, laufen am Gebäude entlang, biegen rechts in die 85. Straße ein. Dort ist gleich der Eingang. Im Foyer hängt das Schild: ALL VISITORS & DELIVERIES MUST BE ANNOUNCED. PLEASE CO-OPERATE WITH DOORMAN. Irgendwann wird die Tafel THIS IS A SMOKE-FREE BUILDING daneben platziert. Die Schülerinnen und Schüler kooperieren mit dem Doorman.
Der Begriff »Kulturschock« stammt von Cora Du Bois, einer von Carolas Schülerinnen. Sie ist Anthropologin, eine der besten ihrer Epoche. Sie hat Feldforschung auf der Insel Alor betrieben, im Malaiischen Archipel, allein in einer für sie komplett fremden Welt. Du Bois geht davon aus, dass die ersten zwei Monate in einer anderen Kultur verlorene Zeit sind. Zuerst muss man den Schock der Fremde verarbeiten, sich gewöhnen: an die anderen Wege, das ungewohnte Essen, die Körpersprache. Du Bois will herausfinden, ob man diese Phase verkürzen kann. Ist es möglich, sich schneller zu verändern? Kann man flexibler reagieren? Carolas Unterricht scheint genau darauf vorzubereiten. Also hat Du Bois sie neulich eingeladen, zu einem Vortrag vor Anthropologen.6
Über den Kulturschock kann Carola nicht nur als Wissenschaftlerin sprechen. Sie leidet an Amerika. Aber es sind eindeutig mehr als zwei Monate seit ihrer Ankunft vergangen. Vierzehn Jahre lebt sie nun hier. Seit dem 25. März 1946 ist sie amerikanische Staatsbürgerin. Sie hadert immer noch.
Am Anfang war es die Enge in der U-Bahn. Auf den Bahnsteigen standen Angestellte, die nur dafür da waren, Menschen in die überfüllten Waggons zu schieben, ihre Hinterteile, Schultern, Köpfe. Damals wohnten sie in Washington Heights, ganz im Norden Manhattans, und sie arbeitete in Midtown. Sie stieg auf dem Weg zur Arbeit an der 191. Straße ein, ganz zu Beginn der Linie, und musste sich dennoch in ein schon überfülltes Abteil hineinquetschen. Bei der Rückfahrt von der 57. Straße war dann alles noch viel schlimmer.
Und jetzt schockieren sie andere Dinge. Sie klagt über den »entsetzlich harten Existenzkampf« und den »Großkapitalismus« in den Vereinigten Staaten. Die »Skrupellosigkeit, ein Ziel zu erreichen«, sagt sie, sei »einfach unbeschreiblich«. Sie sei schon erstaunt darüber, wenn sich die Menschen hier einmal einfach nur »ordentlich« benähmen. In der Zeitung liest sie von Kindern, die ihre Eltern erschlagen, von Eltern, die ihre Kinder umbringen, und von Auftragsmorden, verübt für ein paar Dollar.
Wer Angst hat, sagt die Expertin Carola Speads, dessen Körper verändert sich. Das ist ein natürlicher Prozess. Der Körper will helfen, den Ausnahmezustand Angst zu überstehen. Aber was passiert, wenn die Angst nicht verschwindet? Dann verändert sich die Wachsamkeit des Körpers in etwas anderes. Man verkrampft. Die Muskeln sind angespannt, die Gelenke steif, die Atmung flach. Die Anspannung kann zu einer solchen Anstrengung führen, dass einem alles zu viel wird und wiederum große Schlaffheit die Folge ist. Ein Teufelskreis ist das, sagt Speads. Weil der ängstliche Mensch über Muskeln, Sehnen, Atmung nicht mehr richtig verfügen kann, legt er sich andere Körperhaltungen zu, so dass sich Anspannung oder Schlaffheit noch mehr ausbreiten und man noch ängstlicher wird.
In vierundzwanzig Jahren, 1978, wird sie ein Buch über das Atmen veröffentlichen. Der moderne Mensch, schreibt sie darin, lebt buchstäblich in einer atemlosen Zeit. Sie beleuchtet den Unterschied zwischen gestörtem Atmen und befriedigendem Atmen und demonstriert, dass alle Aspekte des Lebens vom Luftholen beeinflusst werden. Wer eine befriedigende Atem-Art meistert, sagt Carola Speads, wird auch das Leben insgesamt in den Griff bekommen.7
Auch wenn sie sich über Manhattan ärgert: Eigentlich ist sie, die Atemfachfrau, am genau richtigen Ort angelangt. Der Südtiroler Leo Kofler hat hier in New York die moderne Technik des Luftholens entwickelt. Er hatte als Sänger nie die große Karriere geschafft, aufgrund von Atemproblemen, spielte also die Orgel in der St. Paul’s Chapel nahe der Wall Street, dirigierte Kirchenchöre und schrieb nebenbei das Atem-Standardwerk schlechthin. An einem Novembertag des Jahres 1908 schob sich Kofler eine Schusswaffe in den Mund und drückte ab. Aber Die Kunst des Atmens ist unsterblich.8
Carolas Laufbahn begann in Berlin, in den zwanziger Jahren. In ihren Kreisen kannte jeder den Kofler: seinen »Lungenfeger« (ausatmen durch eine winzige Lippenöffnung, die »erfrischende Wirkung«, so Kofler, »tritt augenblicklich ein«), die »Schlürfübung«, die Muskelübung für das Crescendo und das Decrescendo, sowie die Übung, die die Elastizität der Rippenknorpel erhöhen sollte. Natürlich auch den Leitsatz im sechsten Abschnitt: »Nimm Atem durch die Nase.«9 Das jedoch war und ist Carola zu wenig. Sie will nicht nur Sängerinnen zum besseren Singen führen oder Schauspieler zur kräftigeren Stimme. Dass man etwas gut oder besser oder schlechter oder richtig oder falsch macht: Diese Gedanken lehnt sie ab. Sie will den Körper, das Atmen erforschen. Ihr Studio ist ein Raum der Wissenschaft.
Unten im Haus gehen die Schüler durch die Lobby, vorbei an den Briefkästen, zum Aufzug Richtung Achtsamkeit. Es gibt sechs Lifts in Rossleigh Court: zwei für Lieferanten, vier für Bewohner und Besucher. Oben biegen die Klienten nach links und betreten die Umkleiden, zwei kleine Kammern. Manche erinnern diese Kabinen an den Sportunterricht in der High School. Sie legen einiges ab, ziehen relativ wenig an. In hellen Badeanzügen betreten die Frauen das Studio. Die Männer tragen Schwimmshorts. Carola sitzt auf der Fensterbank. Sie ist bereit, mit ihnen zu atmen.
Jeder atmet, aber wer denkt schon über das Atmen nach? Dichter tun das vielleicht, weil die Poesie so viel mit dem Luftholen zu tun hat. Jede Zeile eines Gedichts wird von der Länge eines Atemzugs beschränkt. Elizabeth Bishop, zehn Jahre jünger als Carola, hat eine Ode namens »O Breath« geschrieben. Sie sieht darin einer unbekleideten Frau beim Atmen zu. Sie betrachtet, wie sich die Härchen um die Brustwarzen ihrer Liebhaberin im Zuge der Atemluft bewegen. Vier Härchen sind es an der einen, fünf an der anderen Brust. Es ist ein kompliziertes Gedicht über den Wunsch, mehr zu wissen von der Anderen, nicht in sie hineinschauen zu können, sondern nur diese Bewegung zu sehen: das Wehen der Härchen. »O Breath« fließt nicht dahin. Es stockt. Verhakt sich. Die Asthmatikerin Elizabeth Bishop konzentriert sich auf die Schwierigkeiten des Atmens. Sie zeigt, wie sich Worte und Ideen formen, wenn das Luftholen nicht von allein kommt, sondern unregelmäßig ist, schmerzhaft, schwer.10 Vielleicht machen sich nur solche Menschen Gedanken über das Atmen, die Probleme damit haben. Alle anderen nehmen es als selbstverständlich hin.
Nach der Ankunft in New York, 1940, hatte sich Carola gleich mit Charlotte zusammengeschlossen. Mit ihr war sie schon in Deutschland befreundet gewesen. Sie hatten so viele Gemeinsamkeiten: waren beide Gymnastiklehrerinnen, beide 1901 geboren, beide aus begüterten Familien. Und hatten beide fast alles verloren, durch die Emigration. Sie fühlten sich am stärksten von Elsa Gindler beeinflusst. In der Schule für harmonische Gymnastik, Kurfürstenstraße, Berlin, hatte Gindler nicht auf Übungen, Wiederholung und Korrektur gesetzt, sondern auf die achtsame Erkundung des eigenen Körpers. Damit finde man, sagte Gindler, den Weg aus der Verkrampfung. Weil die Methode in den USA kaum bekannt war, versuchten Charlotte und Carola, in dieser Nische ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie mieteten ein kleines Studio in der Nähe von Carnegie Hall. Carolas Name schien für Reklamezwecke nicht recht tauglich. Er klang, amerikanisch ausgesprochen, wie »Carola spuckt«. Also benannte sie sich um. Dann begannen Speads und Selver, für ihre Gymnastik zu werben.
Siebzigtausend deutschsprachige Flüchtlinge hatten zu Beginn der vierziger Jahre das Gleiche vor wie sie: irgendwie anzukommen in New York, irgendwie Geld zu verdienen. Der soziale Abstieg war der Normalfall. Es kursierte der Witz über den Dackel, der zu einem anderen Dackel sagt, in Europa sei er ein Bernhardiner gewesen.11 Gerade ältere Flüchtlinge gingen an der Neuen Welt zugrunde. Bei Carolas Nachbarn in Washington Heights war es so, den Kissingers aus Fürth. Der Vater, schwer depressiv, war eigentlich nie in Amerika angekommen. Also schuftete seine Frau als Köchin und der Sohn Heinz, später Henry, Schulkamerad von Carolas Tochter, in einer Rasierpinselfabrik. Was aus einem solchen Flüchtlingsjungen wie Heinz/Henry Kissinger einmal werden sollte, bei seinem starken deutschen Akzent: Niemand vermochte es zu sagen.
Amerikanerin seit 1946: Das Foto auf Carola Spitz’ Einbürgerungsurkunde.
Carola und Charlotte konnten beide, immerhin, auf ihre abgeschlossene Ausbildung zur Gymnastiklehrerin verweisen. Aber dieses Diplom war ihnen viel und hier gar nichts wert. Die Hindernisse waren für sie, deutsche Fachfrauen in Körperarbeit, noch viel größer, weil deutsche Flüchtlinge auf Amerikaner gerade körperlich so seltsam wirkten. Man erkannte sie an ihrem schweren, steifen Schritt und ihrer Mimik. Den »German look« nannte man dieses ernste, besorgte, fast paranoid wirkende Gesicht. Die New Yorker, so viel lockerer, wussten meist nicht, dass diese mürrischen Deutschen ihre Vermögen, ihre Karrieren verloren hatten, ihre engsten Verwandten nicht aus Europa herausbekamen und dass sie erst von Gerüchten, dann von immer verlässlicheren Nachrichten über Massenmorde gepeinigt wurden. Stattdessen sahen sie die absurden, anscheinend jahrhundertealten Mäntel der Flüchtlinge und wie verkrampft sich die Deutschen, wenn sie einen begrüßten, mit ausladender Geste den Hut abnahmen, sich in dieser verbeugungsfreien Großstadt reflexhaft verbeugten oder, schlimmer noch, die Absätze aneinanderknallten. Die Deutschen beherrschten keinen Smalltalk, hatten von Baseball keine Ahnung, gingen aber dennoch davon aus, alles über die Welt zu wissen. Dass sie zum Abschied zwanghaft Hände schütteln wollten, auch wenn das hier niemand machte.12 Vielleicht war es kein überzeugendes Geschäftsmodell, als deutsches Duo den Amerikanern während des Weltkriegs Entspanntheit beizubringen.
Aber Speads & Selver gaben nicht auf. Sie übernahmen, weil es sein musste, den Stil der New Yorker. Eine Broschüre ließen sie drucken, die die wichtigsten Verkaufsargumente in Großbuchstaben setzte. Sie gaben an, dass »DIESE ARBEIT IN LANGEN JAHREN DER LEHRE AN UNIVERSITÄTEN, KRANKENHÄUSERN UND KUNSTSCHULEN« getestet worden sei. Dass sie entwickelt worden sei »IN ZUSAMMENARBEIT MIT EUROPAS BEDEUTENDSTEN SPEZIALISTEN«. Sie präsentierten Gindlers Achtsamkeits-Ansatz, der, wie sie genau wussten, keine Methode war, sich kaum zusammenfassen ließ, keine simplen Ergebnisse versprach, als eine »NEUE METHODE« und fassten zusammen: »DIE ERGEBNISSE SIND.« Sie versprachen zukünftigen amerikanischen Klienten mehr Vitalität, Effizienz und Elastizität. Sie gingen zu Ärzten, Psychoanalytikern, Orthopäden, hinterließen die Broschüren in deren Wartezimmern, hofften auf Erfolg. Aber der Markt für Menschen mit Elastizitätsproblemen war in den vierziger Jahren nicht sonderlich dynamisch, nicht einmal in New York.
Jetzt, im Kalenderjahr 1954, stimmt es zwischen Carola und ihrem Mann nicht. Otto arbeitet als Vertreter auf Provisionsbasis. Damit verdient er so gut wie nichts. Wenn sie ehrlich sind, ist er arbeitslos. Otto weiß nicht, was er sonst tun soll. Er ist 67 Jahre alt. Sie können es sich nicht leisten, dass er sich zur Ruhe setzt. Auch Carolas Studio könnte besser laufen. Aber Ottos amerikanische Geschäftsidee ist zweifellos gescheitert. Mit seinem Bruder Friedrich, genannt Fritz, hatte er eine Damenboutique gegründet. Sie hatten ihre beiden Namen zum Namen des Geschäfts gemacht und Fred für Fritz und O für Otto zu »Fredo« zusammengefügt. Bei Fredo verkauften sie Mäntel und Kostüme. Das Geschäft lag günstig und zentral, mitten im Schmattes District, dem Modeviertel von Manhattan. Doch es warf nicht genug Geld ab und wurde 1952 liquidiert.
In den fünfziger Jahren gilt es als fast schon spektakulär peinlich, wenn eine Familie von der arbeitenden Frau über Wasser gehalten wird. Für deutsche Flüchtlinge mögen andere Standards gelten. Bei den Kissingers ist der Vater schließlich auch untätig. Aber jedes andere Ehepaar würde zumindest den größten, schönsten, hellsten Raum der Wohnung als Wohnzimmer nutzen. Bei Carola und ihrem Mann befindet sich dort das Studio der Körperlichen Umerziehung. Das kleine, dunkle Esszimmer dient als Salon. Und dies auch nur so lange, wie sie die Miete noch bezahlen können. Das ist die Zwickmühle, in der Carola steckt: Die Schüler kommen auch deshalb zu ihr, weil das Studio so schön ist. Aber wenn nicht bald mehr Schüler kommen, wird das schöne Studio nicht mehr ihres sein.
Otto hängt zudem so an ihr. Er kann schlecht allein sein, braucht sie ständig, als Partnerin, Freundin, Zuhörerin. Sein Bruder verbringt viel Zeit im Eclair an der 72. Straße, wo sich die mitteleuropäischen Kellner auf Deutsch mit »Herr Doktor« anreden, vielleicht weil einige von ihnen tatsächlich in der Heimat promoviert wurden, vielleicht auch nur, weil das so schön nach Alter Welt klingt. Isaac Bashevis Singer ist Stammgast hier. Er bestellt stets das Thunfisch-Sandwich und ist der größte Autor jiddischer Sprache.13 Ein ebenso vertrautes Gesicht im Eclair, Fritz/Fred Spitz, hat immerhin ein Leben jenseits von Frau und Familie. Er probiert es gerade auch noch einmal als Geschäftsmann, mit einer neuen Modeboutique. Otto dagegen scheint keine Pläne mehr zu haben. Carola beschreibt ihn als »konservativen Geist, dem alles Neue schwerfällt«. Sie bemerkt, dass ihn die Arbeitslosigkeit auffrisst. Er ist so schrecklich nervös.
Im Umkleideraum im zehnten Stock von 251 Central Park West steht ein roter Aschenbecher aus Emaille. Ein wunderschönes Objekt. Das findet zumindest eine Schülerin von Carola, die jahrelang an den Kursen teilnimmt und das Stück eines Tages mitgehen lassen wird.
Carolas Studio ist ein Unterrichtsraum für bewusstes Atmen. Aber es ist normal, dass hier vor den Sitzungen letzte Kippen ausgedrückt werden. In den frühen fünfziger Jahren zündet sich jeder Amerikaner 3500 Zigaretten pro Jahr an. Zwar sind einzelne Mediziner schon dem Zusammenhang zwischen Tabakkonsum und Lungenkrebs auf der Spur. Doch die Tatsache, dass so viele Menschen Zigaretten konsumieren, macht es schwierig, die gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens zu erfassen. Ein Fachmann sagt, das sei so, als wolle man eine Verbindung zwischen dem Sitzen und dem Krebs untersuchen. Und der Zweite Weltkrieg hat das Rauchen noch einmal populärer gemacht. Es hat etwas Soldatisches, Modernes, dieses glühende Stäbchen zu halten, an ihm zu ziehen, zu in-, zu exhalieren und so selbst den heftigsten Stress zu kontrollieren. Die Zigarette kann alles. Das sagt die Werbung.14
Seltsamerweise wollen manche Menschen dennoch zu Nichtrauchern werden. Ihnen empfiehlt Carola die Arbeit mit Strohhalm oder Zigarettenspitze: eine leicht überarbeitete Variante des Kofler’schen Lungenfegers. Man atmet durch die Nase ein, hält die Luft kurz an, beginnt, wieder durch die Nase, auszuatmen, hält inne, steckt sich einen Strohhalm oder eine zigarettenlose Zigarettenspitze in den Mund, bläst nun durch die kleine Öffnung aus, eher locker, eher leicht, entfernt dann kurz vor Ende des Ausatmens noch einmal Strohhalm oder Zigarettenspitze und atmet schließlich den Rest Luft durch die Nase aus, wieder: nicht gewaltsam, ganz entspannt. Dann wiederholt man das Experiment mehrfach, atmet durch diesen unterbrochenen Exhalationsvorgang mehr Luft aus als gewöhnlich und deshalb auch mehr Luft ein, wird befriedigt von all diesem Sauerstoff und muss fortan nicht mehr rauchen.
Der Schönheitskolumnistin der New York Times hat Carola einiges zu verdanken. Martha Parker empfahl ihren Leserinnen während des Zweiten Weltkrieges die innovative zweiminütige Dauerwelle sowie staubabweisendes Make-up für in Waffenfabriken arbeitende Frauen. Dann löste sie das komplexe Problem, ob der Lippenstift vor dem Puder aufzutragen sei, wie von Elizabeth Arden empfohlen, oder, nach Helena Rubinsteins Prinzip, der Puder vor dem Lippenstift. (Parker deutete eine Synthese an, nach der Lippenstift wie Puder jeweils mehrfach und abwechselnd appliziert werden sollten.) Zu Weihnachten 1944 widmete Martha Parker eine gesamte Times-Kolumne einer bisher unbekannten Gymnastikform, die eine gewisse Carola Speads in die Stadt gebracht habe.
Speads, so Parker, lasse ihre Schüler selbst herausfinden, was gut für sie sei. Beuge dich nach unten, sage sie. Versuche, deine Knie zu berühren. Aber wenn das nicht geht, dann halte da an, wo du angehalten wirst, und dann frage dich: Was hält mich hier an? Bleibe in dieser Position. Bleibe einfach da – so lange, bis du weißt, was dich eigentlich daran hindert, ganz nach unten zu kommen.15
Nun sitzen die Frauen in den Badeanzügen und die Männer in den Badehosen auf dem Parkett. In ihrem Rücken ragt eine Bücherwand auf. Von rechts strömt das Licht durch die Fenster. Vorn sitzt die Dozentin im Schneidersitz. Es dauert nur ein paar Augenblicke, bis alle zur Ruhe kommen. Ihre Schülerinnen sehen etwas Geduldiges, Ätherisches in Carola. Ihre Ausstrahlung allein sorgt schon dafür, dass die Großstadthektik in diesen Raum nicht eindringt.
In die Stille fragt sie, wie es so geht. Was Probleme mache. Ob sich irgendetwas anders anfühle als letzte Woche. Ist etwas besser geworden? Schlechter? Es melden sich Einzelne. Rücken tun weh. Köpfe schmerzen. Ein Knie macht Probleme. Aber da sind auch die, die nichts plagt. Sie kommen, weil sie mehr über sich herausfinden möchten. Das sind Carolas Lieblingsschüler. Weil sie den wichtigsten Punkt verstanden haben: Je mehr der Mensch über seinen Körper weiß, sagt sie, desto besser wird es ihm gehen.
Die ersten Jahre in New York waren hart, aber für Charlotte waren sie noch härter. Carola hatte, selbst in den schwersten Zeiten, Otto, den damals halbwegs hoffnungsvollen Geschäftsmann, und ihre Tochter, die Schülerin Dorothea, die mit Näharbeiten zum Familieneinkommen beitrug. Charlotte hatte nur einen Ex-Mann, der sie in eine Lebenskrise gestürzt hatte. In Deutschland hatte Charlotte nie ohne Personal gelebt. In New York wurde sie selbst zur Hausdame. Sie arbeitete für die enorm reiche, bettlägerige Mrs. Rice am Riverside Drive, pflegte sie, leerte ihre Nachttöpfe. Sie legte ein Massagediplom ab, um für weitere High-Society-Frauen attraktiv zu sein. Die stadtbekannte Mrs. Schinasi stellte sie ein. Charlotte schlief in einem Zimmer mit ihr, weil Mrs. Schinasi manchmal nachts wach wurde und erst dann wieder einnicken konnte, wenn ihr die Millionenerbinnenfüße massiert wurden. Die gestresste Charlotte wurde krank, immer wieder, konnte ihre Stunden nicht geben, so dass Carola sich nicht nur um Charlotte kümmern musste, sondern auch um Charlottes Klienten, die nun doch, wenn auch nicht scharenweise, in das Studio an der Carnegie Hall kamen, um ihre Körper zu elastifizieren.
Obwohl Carola immer wieder für sie eingesprungen war, warf die wieder gesundete Charlotte ihr dann vor, sie konzentriere sich zu sehr auf ihre Familie, auf Otto, auf Dorothea. Damit ging es um die entscheidende Frage: wer von ihnen beiden die Achtsamkeitsarbeit ernster nehme. Für Charlotte stand fest, dass Carola ohne ihr, Charlottes, Eingreifen ihre Laufbahn überhaupt nicht weitergeführt hätte. War es denn nicht so, dass Otto in der ersten New Yorker Zeit Carola im Grunde hatte zwingen wollen, als Näherin für ihn, Fritz, Fredo, zu arbeiten und Pelzfutter in Damenmäntel zu nähen, statt Körperspüren zu unterrichten? Hatte denn nicht erst Charlotte sie vor diesem Leben als Schmattes-District-Hilfsarbeiterin bewahrt und davon überzeugt, dass sie bei all ihren Kenntnissen und Erfahrungen sich niemals auf so ein Leben einlassen dürfe? Mit solchen Fragen entfernten sich die Quasischwestern voneinander.
Stille im Studio. Carola schaut sich die Gruppe an. Wenn sie glaubt, dass die Leute Bewegung brauchen, dann bittet sie sie, aufzustehen, die Augen zu schließen und auf der Stelle zu gehen. Nach ein paar Minuten schlägt sie vor, wieder stehen zu bleiben. Dem Atem nachzuspüren. Wie hat er sich verändert zwischen dem Stehen und dem Gehen und dem erneuten Stehen? Man findet das heraus, indem man ganz ruhig wird und in sich hineinspürt. Nach einer gewissen Zeit kann man dann wieder die Beine bewegen. Dann wieder stehen bleiben. Luftholen. Ausatmen. Wieder fragen: Was hat sich verändert?
Sie bittet die Gruppe, herumzugehen, wieder mit geschlossenen Augen. Sie befinden sich in einem recht leeren Raum, in einem für New Yorker Verhältnisse äußerst großzügigen Wohnzimmer. Aber es ist eben doch nur ein Wohnzimmer. Also stoßen die Schülerinnen und Schüler beim Herumgehen immer wieder aneinander. Hier sind lauter New Yorker, die es gewohnt sind, auf engstem Raum ihren Mitmenschen auszuweichen. Excuse me, Sorry, kein Körperkontakt. New York City hat jetzt acht Millionen Einwohner. Dazu kommen jeden Tag drei Millionen Pendler: eine Großstadt, die über eine Großstadt hereinbricht. Alle fangen zur selben Zeit an zu arbeiten. Alle hören zur selben Zeit auf. Die U-Bahnen, Busse, Bürgersteige sind voller Menschen. Auch die Wohnung, in die man als einer der acht Millionen abends zurückkehrt, ist mit ziemlicher Sicherheit um einiges zu klein und die Nachbarn zu laut und zu nah.16 Nun prallen auch im sonst friedlichen Studio New Yorker aufeinander und sind dazu noch spärlich bekleidet. Haut trifft auf Haut. Es ist in Ordnung, deshalb nervös zu lachen. Das stoppt Carola nicht. Aber sie will, dass die einzelnen Schüler bemerken, was mit ihren Körpern in dieser Situation vorgeht.
Die Gruppe setzt sich wieder. Wie fühlen sich jetzt die einzelnen Gliedmaßen an? Was hat sich mit dem Atem verändert? Sie lässt sie minutenlang stillsitzen. Lässt sie ihre Fragen beantworten. Hört zu. Jemandem ist warm geworden. Jemand hat sich erschreckt. Jemand spürt Anspannung in den Schultern. Sie fragt nach den Details der Empfindungen – weil sie will, dass sie immer auf das »wie« achten. Wie ist es, eine bestimmte Bewegung zu machen? Die Leute antworten. Oder denken schweigend nach. Sie sagt: Good. Keep working. Wenn jemand zu viel erzählt, das kommt vor, macht sie klar: Dies ist keine Diskussionsrunde. Hier wird gespürt.
Wenn Carola durch Manhattan läuft, findet sie die besten Argumente für ihre Arbeit. Sie schaut sich die angestrengten Gesichter an. So locker sind die New Yorker dann doch nicht. Starre Blicke sieht sie, Spannungsfalten zwischen den Augen, nach vorn gereckte Kinne. Sie bemerkt, dass die Leute viel zu oft den Atem anhalten oder zu flach atmen, weil sie gestresst sind. Da sie sich ständig beeilen, bleibt ihnen der Atem weg. Weil sie chronisch in Hektik sind, werden auch ihre Atemprobleme chronisch. Carola erkennt die gestörte Körperhaltung, wenn Leute Treppen heruntergehen. Dass sie sich fast panisch am Handlauf festhalten, weil sie sonst fallen würden. Wie sie den ganzen Körper drehen müssen, um einen Fuß eine Stufe weiter herunter zu manövrieren. Sie bemerkt, was für Angst es manchen Leuten macht, einfach nur aus dem Bus auszusteigen.