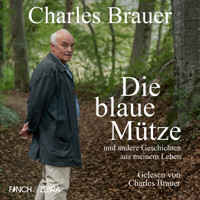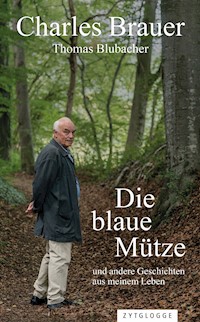
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Als Tatort-Kommissar Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug kennen ihn die meisten: Charles Brauer. John-Grisham-Fans ist seine unverwechselbare Stimme von den Hörbüchern vertraut, die er als Stammsprecher seit vielen Jahren einliest. Das Theaterpublikum hat ihn in unzähligen Rollen gesehen, die er im Laufe seiner Bühnenkarriere gegeben hat. Aber dass Charles Brauer mehr als ein Dreivierteljahrhundert deutscher Schauspielgeschichte miterlebt und mit nahezu allen Größen seines Metiers zusammengearbeitet hat, ist wahrscheinlich den wenigsten in dieser Konsequenz bewusst.In seinen «Geschichten aus meinem Leben» erzählt der seit fast 40 Jahren in der Schweiz lebende Schauspieler von seiner Kindheit im zerbombten Berlin, wie er als Elfjähriger zufällig für den Film entdeckt wurde, von seinen Anfängen auf der Bühne und vor der Kamera, seiner Schauspielausbildung und den vielen Stationen seines ereignisreichen Lebens.Warmherzig, pointiert, persönlich und authentisch – unverkennbar Charles Brauer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als Tatort-Kommissar Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug kennen ihn die meisten: Charles Brauer. John-Grisham-Fans ist seine unverwechselbare Stimme von den Hörbüchern vertraut, die er als Stammsprecher seit vielen Jahren einliest. Das Theaterpublikum hat ihn in unzähligen Rollen gesehen, die er im Laufe seiner Bühnenkarriere gegeben hat. Aber dass er mehr als ein Dreivierteljahrhundert deutscher Schauspielgeschichte miterlebt und mit nahezu allen Größen seines Metiers zusammengearbeitet hat, ist wahrscheinlich den wenigsten in dieser Konsequenz bewusst.
In seinen «Geschichten aus meinem Leben» erzählt der seit fast 40Jahren in der Schweiz lebende Schauspieler von seiner Kindheit im zerbombten Berlin, wie er als Elfjähriger zufällig für den Film entdeckt wurde, von seinen Anfängen auf der Bühne und vor der Kamera, seiner Schauspielausbildung und den vielen Stationen seines ereignisreichen Lebens. Warmherzig, pointiert, persönlich und authentisch – unverkennbar Charles Brauer.
CHARLES BRAUER
THOMAS BLUBACHER
DIE BLAUE MÜTZE
UND ANDERE GESCHICHTEN AUS MEINEM LEBEN
ZYTGLOGGE
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Autor und Verlag danken der Gemeinde Böckten für den Druckkostenbeitrag.
© 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Thomas Gierl
Coverfoto: Ute Schendel
Umschlaggestaltung: Hug & Eberlein, Leipzig
Layout/Satz: Hug & Eberlein, Leipzig
E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book: 978-3-7296-2394-1
www.zytglogge.ch
INHALT
Vorab
Die blaue Mütze
Kuchen aus Kartoffelschalen
Splitter sammeln
Hungerwinter
Mein Kiez, die Friedrichstraße
Putzi, Hotte und die anderen
Straßenfeger
Gipfeli
Verknäult
Abgeschnappt
Telegramm aus Bremen
Die Kunst, «Mein Herr» zu sagen
Turbulenzen
Ein Anruf, der alles ändert
Buhs und Bravos
Hoch in den Wolken
Das blaue Haus
Finnische Wälder und Hamburger Tatorte
Musik neben und auf der Bühne
In die Welt hinaus
«Die haben es nicht kapiert.»
Neuanfänge
Thomas Blubacher: Charlie
Bildnachweise
Über die Autoren
Leseempfehlungen
VORAB
«Schreiben heißt, auf die Welt verzichten – dazu ist keine Zeit mehr!»
Das schrieb mir Freund Krug, als ich mich entschlossen hatte, auf eine erbetene und geplante Autobiografie zu verzichten. Was hier nun vorliegt, ist davon ein gutes Stück entfernt. Keiner Chronologie folgend, habe ich versucht, mich an Ereignisse und Dinge zu erinnern, die mir in meinem Leben wichtig und erzählenswert scheinen.
Aber ich möchte auch Fernando Pessoa zitieren: «Ich vergesse unabsehbar, ich vergesse mehr, als ich erinnern könnte.» Doch all das, woran ich mich erinnerte und es dann mit meinem geliebten Füllfederhalter zu Papier brachte, daran hatte ich viel Freude und Vergnügen.
Den Menschen, vor allem meiner Frau und Thomas Blubacher, denen es dann gelang, alles in eine gedruckte Form zu bringen, danke ich von ganzem Herzen. Und ich danke dem Zytglogge Verlag und Thomas Gierl, dass er sich auf so schöne Weise für mein «Sicherinnern» interessierte.
DIE BLAUE MÜTZE
Alles begann an einer Straßenbahnhaltestelle. An der Leipziger Straße, Ecke Friedrichstraße, Berlin-Mitte, im März 1946. Es war kalt, sehr kalt. So kalt, dass Menschen erfroren, auf der Straße oder zu Hause, denn es gab in diesem Winter nichts, womit man heizen konnte. «Du setzt die Mütze auf, sonst setzt es was!», kam von meiner Mutter. Es gab keine andere Mütze als die in himmelblau und noch dazu aus Samt. Mein Vater hatte sie während eines Fronturlaubs aus Frankreich mitgebracht. Ich fand sie trotzdem doof.
Als ich aus der 74 ausstieg, sprach mich ein Mann an. Mantel, Hut, Krawatte, in meinen Augen ein älterer Herr, der aber freundlich auf mich Steppke einredete. Filmregisseur sei er, und ich sei ihm aufgefallen, er wolle einen Film über Berliner Kinder drehen. Ganz in der Nähe, am Dönhoffplatz, sei das Büro der Filmfirma, ob ich nicht einfach dahin mitkäme. Wäre ich mitgegangen, wenn ich schon damals gewusst hätte, dass er der Regisseur des berühmten Films Emil und die Detektive war, nach dem Buch von Erich Kästner, und dass am Drehbuch sogar der junge Billy Wilder mitgeschrieben hatte? Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie sollte ich auch? Das «Tausendjährige Reich» war – nach zwölf Jahren – gerade erst vorbei; die Nazis hatten Kästners Bücher verbrannt und verboten. Und natürlich ging ich nicht mit zum Dönhoffplatz, weil man in dieser Zeit und überhaupt mit niemandem Fremden mitging. Also schwindelte ich, ich müsse zum Frisör, aber ich gab ihm unsere Adresse, und er meinte, dass jemand bei uns vorbeikommen werde.
Bei uns, ja, denn wir gehörten zu den Glücklichen, die eine Wohnung zugeteilt bekommen hatten, in Schöneberg, im amerikanischen Sektor, in der Kulmer Straße 21. Davor waren wir ein halbes Jahr bei Tante Ida untergekommen, genauer gesagt: Meine Mutter konnte bei ihr im Hinterhaus kochen, geschlafen haben wir in einem Zimmer im halbzerstörten Vorderhaus. Meine dicke Tante Ida, zu der ich «Tante» sagte, die aber eine Freundin meiner Eltern war, hatte Glück gehabt. Ihre Wohnung in der Zimmerstraße war heilgeblieben. Sie lag im russischen Sektor, und deshalb musste ich später noch einige Male mit der 74 von Schöneberg nach Stadtmitte fahren, um einzukaufen, was uns von der Lebensmittelkarte des russischen Sektors noch zustand.
Irgendwann in diesem Winter 45/46 – wir hausten noch in der Zimmerstraße – traf meine Mutter unsere ehemalige Hauswartin aus der Friedrichstraße. «Sagen sie mal, Frau Knetschke, haben Sie gewusst, dass unser nettes Fräulein Beier über all die Jahre einen Juden versteckt hat? In ihrer Wohnung!» Meine Mutter: «Ja, ja, das habe ich gewusst, und ich war wohl die einzige im Haus, die das wusste.» – «Aber, Frau Knetschke, mir hätten Sie das doch erzählen können!» – «Nee, Frau Lorenz, das hätte ich niemandem erzählen können und schon gar nicht ihnen.» Frau Lorenz, sie ruhe in Frieden, war vielleicht eine anständige Person, und ich hatte sie gemocht, aber da hatte es die Blockwarte gegeben, unangenehme, gefährliche Leute. Und wäre sie nicht sogar verpflichtet gewesen zu denunzieren, was in ihrem Haus passierte? Dieser Jude, zu dem ich «Onkel Fietze» sagte, überlebte auf wunderbare Weise die schreckliche Zeit. In den ganzen Jahren hatte er nie die Wohnung von Fräulein Beier verlassen, und meine Mutter als Mitwisserin hatte das Geheimnis dieser beiden gefährdeten Menschen gehütet. Ihm verdankten wir aufgrund seiner Stellung bei einer Behörde, dass uns die Wohnung in Schöneberg zugewiesen worden war. Anderthalb Zimmer im sogenannten Gartenhaus, kein Glas in den Fenstern, nur Pappe und Röntgenplatten. Kam man in die Wohnung, war gleich links die Küche mit dem großen Herd mit seinen Eisenringen, den man mit Holz befeuerte, rechter Hand eine Stufe zur Toilette; ein Badezimmer gab es nicht. Wir wuschen uns in einer Waschschüssel und ab und an leisteten wir uns eine Dusche im Stadtbad Schöneberg. Mir ist unvergesslich, wie stolz meine Mutter war, ein Sofa organisiert zu haben, mit schwarzweiß kariertem Stoff bezogen, das unser Wohnzimmer freundlich und wohnlich machte. Das Schlafzimmer war nur ein halbes Zimmer unter schräger Decke, darin standen das Elternbett und mein Bett, in dem ich schlief, bis ich achtzehn Jahre alt war, und in einer Ecke ein Tisch für meine Schularbeiten.
[1]
Ich ging ja wieder in die Schule. Allerdings war ich da nicht oft, und in meinem Zeugnis stand, dass ich fünfzig Tage gefehlt hätte. Schuld daran waren der Film und sein Regisseur, Gerhard Lamprecht.
Zufall? Schicksal? Was wäre gewesen, hätte ich diesen Mann nicht getroffen? Was wäre aus mir geworden? Wieso saß er in derselben Straßenbahn und erzählte mir später, dass er mich schon einmal gesehen hätte mit dieser Mütze, da sei ich ihm aber entwischt. Zufall? Mir damals nicht bewusst, war es eine Art Startschuss, eine Aussicht auf etwas, das besser aussah als alles, was meine Eltern erlebt hatten. Es hat dann einige Jahre gedauert, bis ich dachte, dass dies ein Beruf sein könnte: Theater zu spielen, vor einer Kamera zu stehen. Damals war es ein Privileg, verglichen mit dem Schicksal meiner Kumpels auf der Straße. Ich verdiente schon Geld, wurde zum Drehen mit dem Auto abgeholt, einem Opel P4 mit Holzvergaser, und auch wieder nach Hause gebracht. Aber genauso wichtig war es mir, beim Schlagball, beim Fußball und den Kämpfen in den Trümmern gegen die Kinder anderer Straßen einer von ihnen zu sein.
[2]Charles mit Chauffeur und Horst Trinkaus
Als ich meiner Mutter von der Begegnung mit dem Filmregisseur erzählte, lachte sie sich kringelig. Umso mehr staunte sie dann, als es am nächsten Tag tatsächlich bei uns klingelte, ein Herr Körner sich als Aufnahmeleiter vorstellte und uns erzählte, was es mit diesem Film auf sich habe. Ein Film mit vielen Kindern, ein Film über Kinder in den Trümmern von Berlin. Irgendwann gebe es ein Treffen mit dem Regisseur und den Kindern in der Krummen Straße in Charlottenburg. Da werde ausgesucht, wer dabei sei und wer nicht. Ob ich nicht Lust hätte, auch mitzumachen? Und ob ich hatte! Mutter hatte nichts dagegen, und Vater war zwar gerade mal wieder nicht zu Hause, aber es war klar, dass auch er es toll finden würde.
Die Krumme Straße war ein einziges Trümmerfeld. Später wurde sie dann auch unser Hauptdrehort. Aber erst einmal gab es das, was man heute ein Casting nennt. Gerhard Lamprecht saß auf irgendeiner Art Stuhl, und wir, ein Haufen Kinder, standen um ihn herum und versuchten zu verstehen, um was es da eigentlich ging. Lamprecht erzählte uns ein wenig von der Geschichte, die er sich für den Film ausgedacht hatte, und animierte uns dann, von uns zu erzählen, ein Gedicht aufzusagen, etwas zu spielen, was immer uns einfiele. Mir fiel sofort etwas ein: Einige Tage vorher war ich mit meinem Vater im Friedrichstadt-Palast, dem alten, gleich neben dem heutigen Berliner Ensemble, bei einer Boxveranstaltung gewesen, einer der ersten, die in Berlin stattfanden. Mein Vater hatte als Amateur geboxt, und ich war später noch oft mit ihm bei Boxkämpfen. War es meine Idee, mir so ein Porzellanding zu schnappen, das da in den Trümmern herumlag, einen halbzersplitterten Isolator von einem Telegrafenmast? Ich weiß es nicht. Aber das war mein Mikrofon, und ich tat so, als sei ich ein Sportreporter und berichtete über diesen Boxkampf.
[3]Gerhard Lamprecht mit Kindern beim Casting, Zweiter von rechts Charles Knetschke
Offenbar war meine Reportage ziemlich gut und lebendig, jedenfalls gefiel ich Herrn Lamprecht so, dass ich der Gustav in seinem Film wurde, und das war eine der Hauptrollen. Der DEFA-Film Irgendwo in Berlin war erst der dritte überhaupt nach dem Krieg. An den ersten kann ich mich gut erinnern: Die Mörder sind unter uns in der Regie von Wolfgang Staudte mit der jungen Hildegard Knef.
Auch in unserem Film geht es um Menschen, die den Krieg überlebt haben, vor allem um eine Horde Zehn- bis Zwölfjähriger, die nichts anderes im Kopf haben, als Krieg zu spielen, mitten in den Ruinen, in der vollkommen zerstörten Tankstelle von Gustavs Vater. Der würde alles wieder aufbauen, sobald er aus dem Krieg zurückkäme, davon ist Gustav felsenfest überzeugt. Doch der Vater kommt als gebrochener Mann ohne jede Hoffnung auf einen Neubeginn aus dem Krieg zurück. Einen «dreckigen Jammerlappen» nennen ihn die anderen Jungs.
Zu Gustav hält nur Willi, sein bester Freund, der beide Eltern verloren hat und bei einer Verwandten aufwächst, die einen Papierwarenladen betreibt.
[4]Charles und Harry Hindemith
[5]Charles und Hans Trinkaus
Ihr Untermieter, ein mieser Schieber, stiftet die Kinder an, Lebensmittel zu klauen, und besorgt ihnen dafür Feuerwerkskörper für ihre Kriegsspiele. Wegen einer Wette und weil er kein Feigling sein will, besteigt Willi eine zwanzig Meter hohe Mauer und stürzt ab. In einer der letzten Szenen des Films stehen seine Kameraden um das Bett ihres sterbenden Freundes, und eigentlich sollte das der Schluss dieses pazifistischen Films sein, mit der Botschaft: Krieg, ob unter Erwachsenen oder unter Kindern, tötet und ist zu verurteilen. Doch die russische Administration, die den Film abnahm, forderte ein positives Ende, das den Menschen Mut mache, und so wurde in einer neugedrehten Schlussszene gezeigt, wie die Kinder, um Gustavs Vater zu überraschen, gemeinsam die Trümmer seiner Tankstelle räumen.
[6]
Gerhard Lamprecht hatte damals einer Zeitung von unserer Arbeit erzählt, und meine stolze Mutter las es mir vor:
«Die Auswahl der Hauptdarsteller war, als das Drehbuch fertig vorlag, das größte Problem. Aber ich verließ mich auf mein Fingerspitzengefühl und auf meine Erfahrung. Den Jungen, der im Film die Rolle des kleinen Gustav spielt, entdeckte ich in der Straßenbahn. Ein helles, aufgewecktes Gesicht, frisches Benehmen. Er schien mir geeignet, und ich ließ mir seine Adresse geben. Ich hatte mich in Charles, so heißt er, nicht getäuscht. Er benimmt sich ganz großartig vor der Kamera, als wenn er in seinem ganzen Leben nichts anderes getan hätte. Dann habe ich wochenlang fast alle Berliner Schulen besucht, an den Unterrichtsstunden teilgenommen und jeden Jungen genau beobachtet. Ich fand alle Typen, die ich brauchte. Aus sämtlichen Stadtteilen Berlins setzten sich nun meine dreißig kleinen Schauspieler zusammen, alle sind mit Begeisterung bei der Sache und machen uns das Leben weniger schwer, als wir im Grunde befürchtet hatten.»
Die Premiere fand am 18.Dezember 1946 statt, und wir, meine Eltern und ich, waren natürlich eingeladen. Ehrfürchtig saßen wir in einer Loge der Staatsoper, die ihr Domizil damals im Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße hatte. Es gab hinterher viel Applaus, und ich musste das erste Mal in meinem Leben auf eine Bühne, um mich zu verbeugen. Noch heute ist Irgendwo in Berlin nicht nur ein einzigartiges Zeitdokument, sondern auch ein eindrucksvoller Film, trotz des leisen Pathos und manchmal altmodisch agierender Schauspieler. Aber das betrifft nicht den seitdem von mir verehrten Paul Bildt und auch nicht Fritz Rasp, der ja schon 1931 in Lamprechts Emil und die Detektive als Bösewicht brilliert hatte. Und es ist deutlich zu sehen, wie gut Lamprecht es verstand, Kinder zu führen. Ich jedenfalls finde uns noch immer prima.
Gerhard Lamprecht habe ich nach der Premiere leider nie wieder getroffen. Irgendwann, Ende der Fünfziger, schrieb ich ihm, was aus mir geworden sei und dass ich am Hamburger Schauspielhaus spiele. Er antwortete sofort, er freue sich und gratuliere mir, und sein reizender Brief schmückt nun meine Briefsammlung.
Bei diesem Film hatte allein ich zweiundsiebzig Drehtage – ich weiß natürlich, wie sehr sich Material und Technik verbessert haben, aber unsere Neunzig-Minuten-Tatorte durften nie mehr als dreiundzwanzig Drehtage haben. Es war für mich kleinen Kerl eine wunderbare Zeit und auch für meine Eltern ziemlich abenteuerlich.
Mein erster Drehtag war draußen in den zuletzt von der TOBIS genutzten Johannisthaler Filmateliers, 1920 eröffnet als das «größte Filmatelier der Welt». In Halle B, die die Bomben verschont hatten, wurden sämtliche Innenaufnahmen gedreht. Das, was ich am ersten Morgen anhatte, gefiel den Filmleuten und war ab da mein Kostüm. Abends wurde ich nach Hause gebracht, und meine Mutter fand, dass das Hemd aber nun gewaschen werden müsse, also zog sie mir am nächsten Morgen ein anderes an. Riesenaufregung, als ich in Johannisthal ankam, wo denn mein Hemd sei. Es wurde geholt, und ich lernte den Begriff «Anschluss» kennen. Ich lernte auch, dass es beim Drehen im Atelier sehr warm werden konnte. Das Filmmaterial damals brauchte enorm viel Licht, und die Scheinwerfer erzeugten eine geradezu unerträgliche Hitze. Eines Tages fiel ich einfach um. Wahrscheinlich war die mittägliche Suppe ein wenig zu dünn ausgefallen, jedenfalls war an diesem Tag für mich Drehschluss.
Natürlich erhielt ich eine Gage für den Film: fünfzehnhundert Mark. Wenn man weiß, dass auf dem Schwarzen Markt ein Pfund Butter für achthundert und eine Zigarette für fünf Mark gehandelt wurden – also toll war das nicht! Meine Eltern gaben mir jeden Morgen eine Büchse mit belegten Stullen mit, was für sie mit unseren mageren Lebensmittelmarken wirklich nicht einfach war. So kam es, dass mein Vater schon bald energisch mit dem Produktionsleiter sprach und daraufhin meine Gage um fünfhundert Mark erhöht wurde.
[7]
Nach der Premiere des Films bekam ich einen Zweijahresvertrag bei der DEFA. Die monatliche Gage betrug zweihundert Mark, was aber viel wichtiger war: Ich hatte ein Anrecht auf die Lebensmittelkarte 1 für Schwerstarbeiter und künstlerisch Tätige. Zu denen gehörte nun auch ich. Aber noch wichtiger für unser tägliches Leben war die Verfügung der russischen Kommandantur, dass in ihrem Sektor Künstler eine zusätzliche monatliche Lebensmittelration bekamen. Da stand ich dann irgendwo in Berlin-Mitte mit meiner Mutter und berühmten Leuten in der Schlange vor einem Laden, der für die Öffentlichkeit geschlossen war und in dem man so kostbare Extras wie Haferflocken, Kaffee und Fleisch bekam. Das war eine Riesenhilfe für uns.
Und ich, der elfjährige Charles Knetschke, wie ich damals noch hieß, war zum Haupternährer der Familie geworden.
KUCHEN AUS KARTOFFELSCHALEN
«Wie können Sie Ihrem Sohn einen so undeutschen Namen geben!» Die Stationsschwester der Frauenklinik in der Berliner Charité war schon stramm auf völkischem Kurs, obwohl die Nazis im Juli 1935 erst seit gut zwei Jahren bestimmten, wer ein richtiger Deutscher sein durfte. Aber es soll ja auch heute schon wieder Gegenden in Deutschland geben, wo solch völkisch versaute Fragen gestellt werden. Doch es blieb bei meinem Namen Charles, den sich meine Eltern, vor allem mein Vater, gewünscht hatten. Er selbst hieß Karl, wurde aber überall Charly genannt, und der Sohn sollte eben nun Charles heißen. Charles Knetschke!
Geht es noch berlinischer? Mein Freund Manfred Krug aber hatte irgendwann ausgegraben, dass der Name ganz sicher aus dem Polnischen stamme. Mir fällt Zuckmayers Hauptmann von Köpenick ein, den er sagen lässt: «Heitzetage sin doch de meisten Berlina aus Posen. Ick bin schon aus de Wuhlheide.»
Mein Kiez war die Stadtmitte, zwischen Koch- und Puttkamerstraße, und wenn ich Komiker geworden wäre, hätte Karl vielleicht viel besser gepasst. Es blieb bei Charles, aber den Knetschke zu ändern, hatte mir bei dem Film Kampf der Tertia schon Erik Ode geraten. Er führte Regie und war damals noch kein prominenter Fernsehkommissar. Das war 1952 in Hamburg, und es dauerte noch einige Jahre, bis ich den Mädchennamen meiner Mutter annahm: Brauer. Auch das geschah wieder in Hamburg und kostete bei der dortigen Innenbehörde flotte hundertachtzig DM. Viel Geld war das damals und ein beachtlicher Teil meiner Theatergage. Meine Mutter hat sich gefreut, und mein Vater konnte nichts dagegen haben, sie hatten sich scheiden lassen und lebten in verschiedenen Teilen Berlins.
Seit 1949 hatte ich auch einen Bruder namens Ronald, der mein kleiner Bruder war und heute ein großer Freund für mich ist.
Meine Eltern hatten sich 1929 kennengelernt, in Swinemünde, wo mein Vater in einem Trio zum Tanz aufspielte. Beide, 1909 geboren, unehelich, sie in Stettin, er in Berlin, hatten keine gute Kindheit.
Meine Mutter, Lotte hieß sie, war bei ihren Großeltern mit Geschwistern aufgewachsen, die eigentlich Onkel und Tanten waren. Ihre Mutter oder ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Sie machte in Stettin eine Lehre bei einer Firma für Lampenschirme und war ihr Leben lang mit ihren schönen Händen geschickt im Umgang mit Nadel und Faden. Sie war 18 Jahre alt, als sie nach Berlin kam, um in den «Goldenen Zwanzigern» ihr Glück zu machen.
Mein Vater hatte gar nichts gelernt. Mit zehn Jahren gab ihn seine Mutter in die Pflege nach Calau in der Lausitz. Es folgten schlimme vier Jahre, die er bei einem Schulpedell und dessen Frau als Pflegekind verbrachte. Was auch bedeutete, eine billige Arbeitskraft zu sein und zum Beispiel täglich nach dem Unterricht die Tintenfässer der Schüler reinigen zu müssen. Es gab auch gehörig Prügel, und Schmalhans war Küchenmeister. Seine Mitschüler hänselten ihn als Waisenkind, doch er war ein starker Junge und ging keiner Schlägerei aus dem Weg. 1923, mit vierzehn Jahren, kam er zurück nach Berlin; eine Schule besuchte er dort nicht mehr. Er war ein gutaussehender, auch ein heller Junge und bekam eine Anstellung als Page im vornehmen Hotel Esplanade am Potsdamer Platz. Bald war er intim mit dem Berliner Nachtleben, den Clubs, den Cafés und überall da, wo Jazz gespielt wurde. Irgendwann saß er selbst an einem Schlagzeug, trat schon bald in einem Trio in Winterkurorten und an der Ostsee auf, sang mit einer angenehmen Stimme die Schlager der Zeit und schien etwas gefunden zu haben, das ihn glücklich machte. Er war Mitglied eines Boxvereins und wohl auch eines der Berliner Ringvereine, die sich nach außen einen bürgerlichen Anstrich und Namen wie «Glaube, Liebe, Hoffnung» gaben, aber ähnlich der Mafia kriminelle Vereinigungen waren und auch Schutzgelder eintrieben.
Am 13.Juni 1931 heirateten meine Eltern, sie waren verliebt, und als ich 1935 geboren wurde, waren wir das, wonach sie sich gesehnt hatten – eine Familie. Alles hätte gut sein können.
[8]Mutter Lotte, Vater Karl
Aber nichts war gut, denn Musik durfte mein Vater als Nichtgelernter nicht mehr machen, das verboten die Regeln der neu installierten Reichsmusikkammer. Und meine Eltern hatten nichts im Sinn mit den Machthabern. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie Umwege machte, um bei Aufmärschen nicht am Straßenrand stehen und den Arm zum Hitlergruß erheben zu müssen. Beide kannten sie zu viele jüdische Menschen, die nach und nach einfach verschwanden. Mein Vater gehörte auch zu denen, die sicher waren, erst recht nach der Pogromnacht 1938, dass es zu einem Krieg kommen werde.
Rückblickend bin ich froh, dass mein Vater kein Beamter, Geschäftsmann oder etwas Ähnliches gewesen ist, was ihn genötigt hätte, der NSDAP beizutreten. Denn anders konnte man damals in diesem Staat kaum Karriere machen. Doch wovon haben meine Eltern gelebt, wie verdienten sie ihr Geld? Ich kann mich erinnern, dass sie einen Kiosk betrieben im «Clou», einem Tanzetablissement um die Ecke in der Mauerstraße, wo Mutti mit dem Bauchladen Zigaretten verkaufte.
Am 1.September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall Deutschlands auf Polen. Mein Vater hatte mir erzählt, er habe zu denen gehört, die als Erste eine Einberufung in ihrem Briefkasten gehabt hätten. Er erzählte aber auch, dass er sich freiwillig zur Schutzpolizei gemeldet habe, mit dem Hintergedanken, dass er dadurch nicht zum Heer eingezogen werden würde. Welch ein Irrtum! Die Bataillone der Schutzpolizei waren die ersten, die zusammen mit dem Heer in Polen einmarschierten. Wie es wirklich war, werde ich nicht mehr in Erfahrung bringen. Auch ist zu vermuten, dass man Vorbestrafte und unsichere Kantonisten in spezielle Polizeibataillone steckte und sie an die Front schickte. Sie hatten für Ordnung in den besetzten Gebieten zu sorgen und waren eine berüchtigte Truppe. Vater berichtete mir von Erschießungen und dass er sich geweigert habe, daran teilzunehmen. Und dass es ein Märchen sei, dass diese Verweigerungen bestraft worden wären, wie man es nach dem Krieg erzählte. Eine militärische Karriere machte man so natürlich nicht, aber damit hatte mein Vater ja sowieso nichts am Hut.
Ich habe keine Ahnung, wie lange er in Polen gewesen ist. Gesehen habe ich ihn erst wieder im Sommer 1941, da kam er aus Frankreich, das im Juni 1940 kapituliert hatte. Er war in der Festung La Rochelle stationiert und bediente dort den Entfernungsmesser. Ich sehe ihn in der Berliner Wohnung vor dem Radio sitzen mit einer dicken Decke über dem Kopf und mir Sechsjährigen leise und sehr eindringlich erklären, dass ich niemandem davon erzählen dürfe. Ich habe das Signal der Nachrichten-Ankündigung von BBC noch im Ohr. Einen Feindsender zu hören war damals lebensgefährlich, und Leute, die einen denunzierten, gab es auch.
Bis zum Kriegsende habe ich ihn nur noch einmal gesehen. Da waren wir, meine Mutter und ich, schon evakuiert und lebten in der kleinen Gemeinde Niederwürschnitz im Erzgebirge. Für meine Mutter, eine echte Großstadtpflanze, war das eine schlimme Zeit. Ihre geliebte Wohnung, unser Zuhause in der Friedrichstraße zu verlassen, war schrecklich für sie. Jetzt bewohnten wir ein Zimmer ohne Bad in der ersten Etage eines zweistöckigen Mietshauses. Einmal in der Woche lieh meine Mutter eine Zinkwanne aus, in der ich gebadet wurde. Aber wo Mutter kochte in diesem einzigen Zimmer, wo die Toilette war, das alles ist aus meiner Erinnerung verschwunden. Gut weiß ich aber noch, wie schwer es ihr fiel, uns etwas Schmackhaftes auf den Teller zu bringen. Ich wurde zum Pilzkenner, sammelte Blaubeeren, es gab Suppe aus Brennnesseln, und wenn man aus getrockneten Kartoffelschalen Mehl machte, konnte man daraus eine Art Kuchen backen. Wir hatten die mieseste Lebensmittelkarte, und meine Mutter machte manchmal den Scherz, ob wir uns mit der wöchentlichen Butterration nicht einfach nur ein anständiges Brot schmieren sollten.
Trotzdem hatte ich damals nicht das Gefühl von Armut. Den Leuten um uns herum ging es nicht viel besser – von den Bauern einmal abgesehen.
Die Menschen in Niederwürschnitz lebten vom Bergbau, und in vielen Wohnungen standen Webstühle für Weißwäsche. Mit einer Familie hatte sich meine Mutter etwas angefreundet, und deren Sohn nahm mich mit zu den anderen Jungs des Dorfes. Erst einmal wurde ich misstrauisch beäugt, auch verstand ich kaum ein Wort von dem Dialekt, den sie sprachen. Allerdings besaß ich etwas, das sie neugierig machte: einen Spielzeugrevolver, der verblüffend echt aussah, und damit war ich natürlich hochinteressant. Ob sie den auch mal in die Hand nehmen dürften? Ich erlaubte es großzügig, und damit war das Eis gebrochen.
Anfang 1944 glaubte meine Mutter gehört zu haben, dass es weniger Bombenangriffe auf Berlin gebe, und sie beschloss, dort nach dem Rechten zu sehen.
Gegen Abend hätte unser Zug in Berlin ankommen sollen, doch kurz vor Jüterbog hielt er auf freier Strecke. Dort standen wir viele Stunden, weil Berlin bombardiert wurde, wir konnten sogar das Wummern in der Ferne hören. Im Morgengrauen kamen wir dann endlich am Anhalter Bahnhof in Berlin an. Zu Fuß gingen wir die halbe Stunde zu unserem Haus, das unzerstört war, aber diese halbe Stunde war beängstigend. Die Luft war noch voller Rauch, wir liefen an zerstörten Häusern vorbei, die Straßen waren voller Trümmer, und ich sah meinen ersten Toten. Er lag im Wasser eines überschwemmten Kellers. Im Kino in der Wochenschau hatte ich zwar schon tote Soldaten gesehen, aber jetzt stand ich da und konnte nicht wegsehen, bis mich meine Mutter weiterzog. Wir blieben achtundvierzig Stunden in Berlin, saßen jede Nacht im Keller und kehrten mit dem nächsten Zug nach Sachsen zurück. Denn wie immer es dort auch war, vor Bomben waren wir zumindest sicher. Chemnitz war die nächste größere Stadt, und soweit ich weiß, wurde sie erst Anfang 1945 aus der Luft angegriffen.
Am 4.