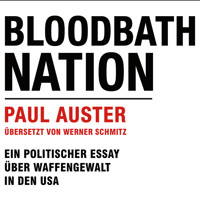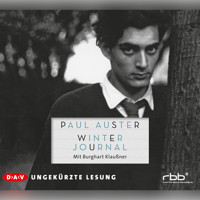9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Brooklyn – eine literarische Liebeserklärung Nathan ist 59 und frühpensionierter Versicherungsvertreter. Er hat seine Frau durch Scheidung verloren, eine Therapie gegen Lungenkrebs hinter sich und ist aus New Jersey nach Brooklyn gezogen, um dort «auf den Tod zu warten». Eines Tages trifft er seinen Neffen Tom, den er Jahre nicht gesehen hat. Tom scheint ziemlich auf den Hund gekommen. Er jobbt bei einem merkwürdigen Antiquar namens Brightman. Auch Nathan beginnt sich öfter in dessen Antiquariat aufzuhalten. Irgendwann erzählen ihm Tom und Brightman von ihrem großen Plan, in dem es um ein gefälschtes Manuskript eines berühmten Schriftstellers und einen leichtgläubigen Millionär geht … «Ein Abgesang auf die Tage der Unschuld … ein wunderbar wehmütiger Roman.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) «Paul Auster erweist sich erneut als charismatischer Dirigent einer Musik des Zufalls.» (Neue Zürcher Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Ähnliche
Paul Auster
Die Brooklyn-Revue
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Für meine Tochter
Sophie
OUVERTÜRE
Ich suchte nach einem ruhigen Ort zum Sterben. Jemand empfahl mir Brooklyn, und so brach ich am nächsten Morgen von Westchester aus auf, um das Terrain zu sondieren. Ich war seit sechsundfünfzig Jahren nicht mehr dort gewesen und erinnerte mich an nichts. Meine Eltern waren aus der Stadt fortgezogen, als ich drei war, und doch fand ich instinktiv in die Gegend zurück, in der wir damals gewohnt hatten: Wie ein verprügelter Hund schlich ich mich nach Hause, zurück an den Ort meiner Geburt. Ein Makler führte mir sechs oder sieben Apartments in Brownstonehäusern vor, und am Ende des Nachmittags hatte ich eine Zweizimmer-Gartenwohnung in der First Street gemietet, nur einen halben Block vom Prospect Park entfernt. Ich hatte keine Ahnung, wer meine Nachbarn waren, und es kümmerte mich auch nicht. Sie arbeiteten alle ganztags, keiner von ihnen hatte Kinder, daher würde es in dem Gebäude relativ ruhig sein. Und danach sehnte ich mich mehr als nach irgendetwas sonst. Nach einem stillen Ende meines traurigen, lächerlichen Lebens.
Das Haus in Bronxville war bereits verkauft, Ende des Monats sollte es geräumt werden, und Geld wäre dann kein Problem. Meine Exfrau und ich hatten vor, den Erlös unter uns aufzuteilen, und mit vierhunderttausend Dollar würde ich mehr auf der Bank haben, als ich bis zu meinem letzten Atemzug benötigte.
Anfangs wusste ich nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Einunddreißig Jahre lang hatte ich ein Pendlerleben zwischen den Vorstädten und den Manhattaner Büros der Mid-Atlantic Accident & Life geführt, und jetzt, ohne Arbeit, hatte mein Tag zu viele Stunden. Etwa eine Woche nach meinem Einzug kam meine verheiratete Tochter Rachel aus New Jersey herüber, um mich zu besuchen. Sie sagte, ich müsse irgendetwas tun, Pläne machen, mir etwas vornehmen. Rachel ist kein Dummkopf. Sie hat an der University of Chicago in Biochemie promoviert und arbeitet in der Forschungsabteilung eines großen Pharmakonzerns in der Nähe von Princeton, doch ähnlich wie bei ihrer Mutter vergeht selten ein Tag, an dem sie etwas anderes als Platituden von sich gibt – all diese ausgelaugten Phrasen von den Müllhalden zeitgenössischer Weisheit.
Ich erklärte, bis zum Jahresende sei ich wahrscheinlich längst tot, also scheiß auf irgendwelche Pläne. Einen Augenblick lang sah es so aus, als wollte Rachel zu weinen anfangen, aber sie verkniff sich die Tränen und nannte mich stattdessen einen grausamen und egoistischen Menschen. Kein Wunder, dass «Mom» sich endlich von mir habe scheiden lassen, fügte sie hinzu, kein Wunder, dass sie das nicht mehr ausgehalten habe. Die Ehe mit einem wie mir müsse eine endlose Qual gewesen sein, die Hölle auf Erden. Die Hölle auf Erden. Ach, arme Rachel – sie kann einfach nicht anders. Seit neunundzwanzig Jahren bewohnt mein einziges Kind diese Erde, und nicht ein einziges Mal in dieser Zeit hat sie eine originelle Bemerkung von sich gegeben, irgendetwas, das eindeutig und uneingeschränkt von ihr gestammt hätte.
Ja, ich glaube auch, dass ich zuweilen fies sein kann. Aber nicht immer – und nicht aus Prinzip. An guten Tagen bin ich so nett und freundlich wie nur irgendwer. Wer seine Kunden ständig vor den Kopf stößt, kann nicht so erfolgreich Lebensversicherungen verkaufen, wie ich es immerhin drei Jahrzehnte lang getan habe. Da muss man einfühlsam sein. Da muss man zuhören können. Da muss man die Menschen zu bezaubern wissen. Das alles und mehr vermag ich. Ich bestreite nicht, dass ich auch meine schlechten Augenblicke hatte, aber jeder weiß doch, welche Gefahren hinter den geschlossenen Türen des Familienlebens lauern. Es kann für alle Beteiligten Gift sein, besonders wenn man dahinter kommt, dass man wahrscheinlich von vornherein nicht für die Ehe geschaffen war. Ich hatte sehr gern Sex mit Edith, aber nach vier oder fünf Jahren war die Leidenschaft verbraucht, und von da an war ich sicher kein perfekter Gatte mehr. Und wenn ich Rachel so höre, habe ich auch als Vater nicht viel getaugt. Ich möchte ihren Erinnerungen nicht widersprechen, aber die Wahrheit ist, dass ich den beiden auf meine Weise sehr zugetan war, und wenn ich mich gelegentlich in den Armen anderer Frauen fand, habe ich diese Affären doch nie ernst genommen. Die Scheidung war nicht meine Idee. Trotz allem hatte ich vor, bis zum Ende mit Edith zusammenzubleiben. Sie war es, die nicht mehr wollte, und in Anbetracht der Sünden und Fehltritte, die ich im Lauf der Jahre beging, konnte ich ihr daraus keinen Vorwurf machen. Dreiunddreißig Jahre hatten wir unter einem Dach gelebt, und als wir schließlich auseinander gingen, war unterm Strich kaum noch etwas übrig.
Ich hatte Rachel erklärt, meine Tage seien gezählt, aber das war nur eine hitzköpfige Erwiderung auf ihre unerwünschten Ratschläge gewesen, jähzornig und völlig übertrieben. Mein Lungenkrebs befand sich in Remission, und nach dem, was der Onkologe mir bei der letzten Untersuchung gesagt hatte, bestand Grund zu verhaltenem Optimismus. Das hieß jedoch nicht, dass ich ihm traute. Der Krebs hatte mir einen solchen Schock versetzt, dass ich immer noch nicht daran glaubte, die Krankheit überleben zu können. Ich hatte mich aufgegeben, und nachdem mir der Tumor entfernt worden war und ich die lähmenden Torturen von Strahlenbehandlung und Chemo, die langwierigen Zustände von Übelkeit und Benommenheit, den Verlust meiner Haare, den Verlust meiner Willenskraft, den Verlust meiner Arbeit und den Verlust meiner Frau überstanden hatte, konnte ich mir kaum vorstellen, wie es weitergehen sollte. Daher Brooklyn. Daher meine unbewusste Rückkehr an den Ort, wo meine Geschichte angefangen hatte. Ich war fast sechzig Jahre alt und wusste nicht, wie viel Zeit mir noch blieb. Vielleicht noch zwanzig Jahre, vielleicht nur noch ein paar Monate. Unabhängig von der ärztlichen Prognose meines Zustands galt für mich die Devise, nichts mehr als selbstverständlich zu betrachten. Solange ich am Leben war, musste ich einen Weg finden, damit noch einmal von vorn anzufangen, aber selbst wenn ich nicht mehr lange zu leben hatte, konnte ich nicht bloß herumsitzen und auf das Ende warten. Wie üblich hatte meine wissenschaftlich ausgebildete Tochter Recht, auch wenn ich zu störrisch gewesen war, das zuzugeben. Ich musste mich beschäftigen. Ich musste meinen lahmen Hintern hochkriegen und etwas tun.
Mein Einzug fand zu Beginn des Frühjahrs statt, und in den ersten Wochen füllte ich meine Zeit mit Erkundungsgängen in der Nachbarschaft aus, machte lange Spaziergänge im Park und pflanzte Blumen in meinem Garten – einem kleinen, mit Unrat übersäten Stückchen Erde, um das sich seit Jahren niemand gekümmert hatte. Ich ließ mir im Park Slope Barbershop an der Seventh Avenue die nachgewachsenen Haare schneiden, lieh mir Videos im Movie Heaven und sah mich häufig in Brightman’s Attic um, einem voll gestopften, schlecht organisierten Antiquariat, das einem schillernden Homosexuellen namens Harry Brightman gehörte (mehr über ihn später). Das Frühstück machte ich mir meistens selbst in meiner Wohnung, aber da ich ungern koche und auch gar kein Talent dafür habe, aß ich mittags und abends in Restaurants – immer allein, immer mit einem aufgeschlagenen Buch vor mir, immer mit großem Bedacht kauend, um die Mahlzeit so lange wie möglich hinzuziehen. Nachdem ich einige Alternativen in der Nähe ausprobiert hatte, wählte ich den Cosmic Diner zu meinem Stammlokal. Das Essen dort war bestenfalls mittelmäßig, aber es gab eine entzückende Kellnerin, eine Puertoricanerin namens Marina, in die ich mich sofort verknallt hatte. Sie war halb so alt wie ich und schon verheiratet, weshalb eine Affäre mit ihr für mich nicht in Frage kam, aber sie war so herrlich anzuschauen, so freundlich im Umgang mit mir, und sie lachte so bereitwillig über meine nicht sehr komischen Witze, dass ich mich an ihren freien Tagen buchstäblich nach ihr verzehrte. Streng anthropologisch betrachtet, stellte ich fest, dass Brooklyner weniger abgeneigt sind, mit Fremden zu sprechen, als jedes andere Völkchen, dem ich je begegnet war. Sie mischen sich nach Belieben in anderer Leute Angelegenheiten ein (alte Frauen, die junge Mütter schelten, weil sie ihre Kinder nicht warm genug anziehen; Passanten, die Hundebesitzer anschnauzen, weil sie zu fest an der Leine zerren); sie zanken sich wie geistesgestörte Vierjährige um einen Parkplatz; sie verblüffen einen aus heiterem Himmel mit geistreichen Sprüchen. Eines Sonntagmorgens betrat ich ein überfülltes Deli mit dem absurden Namen La Bagel Delight. Ich wollte einen Zimt-Rosinen-Bagel verlangen, aber die Zunge gehorchte mir nicht, und es kam etwas heraus wie Zimt-Reagan. Postwendend erwiderte der junge Mann hinter der Theke: «Tut mir Leid, die führen wir nicht. Wie wär’s stattdessen mit einem Pumpernixon?» Fix. So verdammt fix, ich hätte mir fast in die Hose gemacht.
Nach diesem unabsichtlichen Versprecher kam ich schließlich auf eine Idee, die Rachel gutgeheißen hätte. Nun, vielleicht war es nicht direkt eine Idee, aber es war doch immerhin etwas, und wenn ich so rigoros und gewissenhaft daran festhielt, wie es meine Absicht war, dann hatte ich mein Projekt, das kleine Steckenpferd, nach dem ich gesucht hatte und das mich aus der Trägheit meines einschläfernden Tagesablaufs heraustragen sollte. Mein Projekt war bescheiden, aber ich taufte es auf einen hochtrabenden, etwas pompösen Namen – um in mir die Illusion zu wecken, dass ich mit einer wichtigen Arbeit beschäftigt sei. Ich nannte es Das Buch menschlicher Torheiten, und ich wollte darin in möglichst einfacher und klarer Sprache jeden Fehler festhalten, jede Blamage, jede Peinlichkeit, jede Idiotie, jede Schwäche und jede Albernheit, die ich im Lauf meiner langen, buntscheckigen Karriere als Mann begangen hatte. Wenn mir keine Geschichten mehr von mir selber einfielen, wollte ich Dinge aufschreiben, die Bekannten von mir passiert waren, und wenn auch dort nichts mehr zu holen wäre, wollte ich mich historischen Ereignissen zuwenden und die Torheiten meiner Mitmenschen durch sämtliche Zeitalter hindurch aufzeichnen, angefangen bei den untergegangenen Zivilisationen der Antike bis zu den ersten Monaten des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Wenn es auch sonst nichts taugt, dachte ich, habe ich wenigstens etwas zu lachen. Es ging mir nicht darum, meine Seele bloßzulegen oder mich in düsterer Selbstbetrachtung zu ergehen. Mir schwebte ein durchweg leichter, possenhafter Tonfall vor, und Zweck des Ganzen war allein, mich zu unterhalten und mir damit so viele Stunden des Tages wie möglich zu vertreiben.
Ich nannte das Projekt ein Buch, tatsächlich aber konnte von einem Buch keine Rede sein. Ich schrieb auf Notizblöcke, auf lose Zettel, auf die Rückseiten von Briefumschlägen und Reklamebriefen für Kreditkarten und Hausrenovierungsdarlehen; ich trug eine ganze Kollektion von einzelnen Notaten zusammen, ein Sammelsurium unverbundener Anekdoten, die ich, sobald eine fertig war, in eine Pappschachtel warf. Mein Wahnsinn hatte wenig Methode. Manche dieser Notate waren nur ein paar Zeilen lang, und einige, vor allem die Schüttelreime und Wortverdrehungen, die ich so gern hatte, bestanden nur aus einem einzigen Satz. Oko-Scheiß statt Schoko-Eis, zum Beispiel, was mir als Kind manchmal herausgerutscht war, oder die unbeabsichtigt tiefsinnige, gleichsam mystische Bemerkung, die ich bei einem bösen Streit mit Edith einmal fallen ließ: Das seh ich erst, wenn ich’s glaube. Wenn ich mich zum Schreiben hinsetzte, schloss ich zunächst die Augen und ließ meine Gedanken einfach nach Belieben schweifen. Auf diese Weise gezwungen, mich zu entspannen, gelang es mir, ziemlich viel Material aus der fernen Vergangenheit auszugraben, Dinge, von denen ich bis dahin angenommen hatte, sie seien für immer verloren. Ein Augenblick (um einmal eine solche Erinnerung zu zitieren) aus dem sechsten Schuljahr, als ein Junge aus unserer Klasse, Dudley Franklin hieß er, mitten in der Geographiestunde in einer plötzlich eingetretenen Stille einen lang gezogenen, trompetenschrillen Furz fahren ließ. Natürlich lachten wir alle (nichts ist für ein Klassenzimmer voller Elfjähriger komischer als ein lautstark abgelassener Darmwind), aber was diesen Vorfall von anderen kleinen Peinlichkeiten unterschied und zum Klassiker machte, zu einem bleibenden Meisterwerk in den Annalen der Schande und Demütigung, war der Umstand, dass Dudley in seiner Naivität den fatalen Fehler beging, sich zu entschuldigen. «Verzeihung», sagte er, senkte den Blick auf sein Pult und errötete, bis seine Wangen mit einem frisch lackierten Feuerwehrwagen konkurrieren konnten. Einen Furz darf man niemals eingestehen. So lautet das ungeschriebene Gesetz, die strengste protokollarische Vorschrift der amerikanischen Etikette. Fürze kommen von niemandem und nirgendwo; es sind anonyme Emanationen, die einer Gruppe als Ganzes gehören, und selbst wenn jeder im Raum auf den Schuldigen zeigen kann, ist das Dementi die einzig vernünftige Verhaltensweise. Der unbedarfte Dudley Franklin war dafür jedoch zu aufrichtig, und das ist er nie mehr losgeworden. Von diesem Tag an war er der Verzeihung-Franklin, und diesen Spitznamen trug er bis ans Ende der High School.
Die Geschichten schienen in mehrere verschiedene Rubriken zu gehören, und nachdem ich etwa einen Monat lang an dem Projekt gearbeitet hatte, gab ich mein aus einer einzigen Schachtel bestehendes Ordnungssystem auf und benutzte fortan mehrere Schachteln, in denen ich meine fertigen Texte nach Themen sortieren konnte. Eine für Versprecher, eine für körperliche Missgeschicke, eine für gescheiterte Pläne, eine für Ausrutscher in Gesellschaft und so weiter. Mit der Zeit konzentrierte sich mein Interesse auf die Slapsticksituationen des Alltagslebens. Nicht nur auf die unzähligen Male, wo ich über irgendetwas gestolpert war oder mir irgendwo den Kopf gestoßen hatte, nicht nur darauf, dass mir immer wieder die Brille aus der Hemdtasche rutschte, wenn ich mich bückte, um mir die Schuhe zu binden (gefolgt von der zusätzlichen Demütigung, die Brille durch einen ungeschickten Schritt nach vorn zu zertrampeln), sondern auch auf die selten dämlichen Patzer, die mir seit frühester Kindheit immer wieder unterlaufen waren. Zum Beispiel, wie ich 1952 bei einem Picknick am Labor Day gähnen musste und mir eine Biene in den aufgerissenen Mund flog, die ich, von Panik und Ekel überwältigt, herunterschluckte, statt sie auszuspucken; oder, noch unwahrscheinlicher, wie ich vor sieben Jahren, geschäftlich unterwegs, meine Bordkarte auf dem Weg ins Flugzeug locker zwischen Daumen und Mittelfinger haltend, von hinten angestoßen wurde, sodass mir die Karte entglitt und genau auf den Schlitz zwischen Gangway und Flugzeugtür zutrudelte – die denkbar schmalste Lücke, höchstens ein paar Millimeter breit–, um sodann zu meiner äußersten Verblüffung geradewegs durch diesen engen Spalt zu segeln und sieben Meter tiefer auf der Rollbahn zu landen.
Das sind nur ein paar Beispiele. In den ersten zwei Monaten schrieb ich Dutzende solcher Geschichten auf, und sosehr ich mich um einen launigen, leichten Ton bemühte, stellte ich bald fest, dass das nicht immer möglich war. Jeder Mensch hat seine düsteren Anwandlungen, und ich gestehe, dass ich nicht selten von Einsamkeit und Niedergeschlagenheit heimgesucht wurde. Ich hatte den Großteil meines Berufslebens mit dem Tod zu tun gehabt und dabei wahrscheinlich so viele schlimme Dinge zu hören bekommen, dass ich mir die Gedanken daran, wenn ich ohnehin schon gedrückter Stimmung war, nicht einfach aus dem Kopf schlagen konnte. Die vielen Menschen, die ich im Lauf der Jahre aufgesucht hatte, die vielen Policen, die ich verkauft hatte, die Angst und Verzweiflung, die ich beim Gespräch mit meinen Kunden kennen gelernt hatte. Schließlich fügte ich meiner Sammlung eine weitere Schachtel hinzu. Auf das Etikett schrieb ich «Grausame Schicksale», und die erste Geschichte, die dort hineinkam, war die von Jonas Weinberg, dem ich 1976 eine Lebensversicherung über eine Million Dollar verkauft hatte – damals ein außerordentlich hoher Betrag. Ich erinnere mich, dass er gerade seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert hatte, dass er Internist am Columbia-Presbyterian Hospital war und Englisch mit leicht deutschem Akzent sprach. Wer Lebensversicherungen verkauft, muss sich auf Emotionen gefasst machen, und ein guter Vertreter sollte in der Lage sein, bei den oftmals schwierigen, quälenden Diskussionen mit seinen Kunden einen klaren Kopf zu behalten. Die Aussicht auf den Tod lenkt die Gedanken automatisch auf ernste Dinge, und mag es bei dem Job auch hauptsächlich ums Geld gehen, kommt man doch an den damit verbundenen schwerwiegenden metaphysischen Fragen nicht vorbei. Was ist der Sinn der Existenz? Wie lange habe ich noch zu leben? Was kann ich nach meinem Tod für die Menschen tun, die ich liebe? Dr.Weinberg hatte aufgrund seines Berufs ein scharfes Gespür für die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens, dafür, wie wenig es braucht, unseren Namen aus dem Buch der Lebenden zu streichen. Wir trafen uns in seiner Wohnung am Central Park West, und nachdem ich ihm die Vor- und Nachteile der verschiedenen Policen erläutert hatte, begann er mir aus seiner Vergangenheit zu erzählen. Er war 1916 in Berlin zur Welt gekommen, erfuhr ich; sein Vater fiel in den Gräben des Ersten Weltkriegs, und so wuchs er bei seiner Mutter auf, einer Schauspielerin, einziges Kind einer enorm auf Unabhängigkeit bedachten und manchmal sehr eigenwilligen Frau, der es nie mehr in den Sinn gekommen war, sich wieder zu verheiraten. Falls ich seine Bemerkungen nicht überinterpretiere, schien mir Dr.Weinberg andeuten zu wollen, dass seine Mutter lieber mit Frauen als mit Männern zusammen war, und in den chaotischen Jahren der Weimarer Republik hat sie dieser Neigung offenbar ziemlich freien Lauf gelassen. Im Gegensatz zu seiner eigenwilligen Mutter war der kleine Jonas ein stiller Junge, der gern las, ein guter Schüler war und davon träumte, Wissenschaftler oder Arzt zu werden. Er war siebzehn, als Hitler an die Macht kam, und wenige Monate später traf seine Mutter Vorbereitungen, ihn außer Landes zu bringen. In New York lebten Verwandte seines Vaters, und die waren einverstanden, ihn bei sich aufzunehmen. Im Frühjahr 1934 reiste er ab, während seine Mutter, die doch so frühzeitig die den Nichtariern im Dritten Reich drohenden Gefahren erkannt hatte, sich hartnäckig weigerte, diese Gelegenheit zu nutzen und selbst das Land zu verlassen. Ihre Familie sei seit Jahrhunderten deutsch gewesen, erklärte sie ihrem Sohn, und sie werde den Teufel tun, sich von irgendeinem hergelaufenen Tyrannen ins Exil jagen zu lassen. Komme, was da wolle, sie sei entschlossen, das durchzustehen.
Wie durch ein Wunder gelang ihr das tatsächlich. Dr.Weinberg erwähnte wenig Einzelheiten (möglich, dass er die Geschichte selbst nie vollständig erfahren hat), aber anscheinend gab es eine Gruppe von Christen, die seiner Mutter aus mehreren kritischen Situationen half, und 1938 oder 1939 gelang es ihr, sich falsche Ausweispapiere zu beschaffen. Sie veränderte ihr Aussehen radikal – nicht schwer für eine Schauspielerin, deren Spezialität exzentrische Charakterrollen waren; verkleidet als unscheinbare Blondine mit Brille, gelangte sie mit ihrem neuen Namen an einen Job als Buchhalterin in einem Textilgeschäft in einer Kleinstadt vor den Toren Hamburgs. Als der Krieg im Frühjahr 1945 endete, hatte sie ihren Sohn seit elf Jahren nicht mehr gesehen. Jonas Weinberg war inzwischen Ende zwanzig, ein fertig ausgebildeter Arzt, der gerade seine Assistenzzeit am Bellevue Hospital abschloss; sobald er erfuhr, dass seine Mutter den Krieg überlebt hatte, begann er mit den Vorbereitungen, sie zu einem Besuch nach Amerika zu holen.
Alles war bis ins kleinste Detail geplant. Das Flugzeug würde um die und die Zeit landen, an dem und dem Gate parken, und dort würde Jonas Weinberg seine Mutter abholen. Gerade als er zum Flughafen fahren wollte, wurde er jedoch zu einer Notoperation ins Krankenhaus gerufen. Er hatte keine Wahl. Er war Arzt, und sosehr er sich danach sehnte, seine Mutter nach so vielen Jahren wiederzusehen, galt doch seine erste Pflicht den Patienten. In aller Eile wurde ein neuer Plan eingefädelt. Er rief bei der Fluggesellschaft an und bat darum, man möchte seine Mutter in New York in Empfang nehmen, ihr erklären, dass er in letzter Minute fortgerufen worden sei, und sie in ein Taxi nach Manhattan setzen. Er werde einen Schlüssel beim Portier deponieren, und sie solle schon in seine Wohnung gehen und dort auf ihn warten. Frau Weinberg hörte sich das alles an und stieg in ein Taxi. Der Fahrer raste los, und zehn Minuten später auf dem Weg in die Stadt verlor er die Kontrolle über den Wagen und stieß frontal mit einem anderen zusammen. Er und seine Passagierin wurden schwer verletzt.
Unterdessen war Dr.Weinberg bereits im Krankenhaus und operierte. Der Eingriff dauerte etwas über eine Stunde, und als der junge Arzt fertig war, wusch er sich die Hände, zog sich um und eilte aus dem Umkleidezimmer, um zum verspäteten Wiedersehen mit seiner Mutter nach Hause zu fahren. Als er auf den Flur trat, wurde gerade der nächste Patient in den Operationssaal geschoben.
Es war seine Mutter. Nach dem, was Jonas Weinberg mir erzählte, ist sie gestorben, ohne noch einmal das Bewusstsein zu erlangen.
EINE UNERWARTETE BEGEGNUNG
Jetzt quassele ich schon ein Dutzend Seiten, dabei hatte ich nur vor, mich den Lesern vorzustellen und die Kulissen für die Geschichte aufzubauen, die ich eigentlich erzählen möchte. Nicht ich bin die Hauptfigur dieser Erzählung. Die Ehre, als Held dieses Buches aufzutreten, gebührt meinem Neffen Tom Wood, dem einzigen Sohn meiner verstorbenen Schwester June. Little June-Bug, wie wir sie nannten, kam zur Welt, als ich drei war, und meine Eltern nahmen ihre Geburt zum Anlass, aus der engen Wohnung in Brooklyn in ein Haus in Garden City auf Long Island umzuziehen. Wir kamen immer gut miteinander aus, meine Schwester und ich, und als sie vierundzwanzig Jahre später heiratete (sechs Monate nach dem Tod unseres Vaters), führte ich sie zum Altar und gab sie ihrem Mann, Christopher Wood, der als Wirtschaftsjournalist für die New York Times arbeitete. Die beiden zeugten zwei Kinder (meinen Neffen Tom und meine Nichte Aurora), aber nach fünfzehn Jahren zerbrach die Ehe. Ein paar Jahre später heiratete June erneut, und wieder begleitete ich sie zum Altar. Ihr zweiter Mann war Philip Zorn, ein wohlhabender Börsenmakler aus New Jersey, der zwei Exfrauen und seine fast erwachsene Tochter Pamela im Gepäck hatte. Und dann, im empörend jungen Alter von neunundvierzig Jahren, erlitt June eine massive Hirnblutung, als sie eines brütend heißen Nachmittags Mitte August in ihrem Garten arbeitete, und starb noch vor Sonnenaufgang des nächsten Tages. Für ihren großen Bruder war das mit Abstand der schlimmste Schlag, den er je hat einstecken müssen, und nicht einmal, als er einige Jahre später an Krebs erkrankte und dem Tod ins Auge sah, war er auch nur annähernd so unglücklich wie damals.
Nach ihrer Beerdigung verlor ich den Kontakt zur Familie, und als ich Tom am 23.Mai 2000 zufällig in Harry Brightmans Antiquariat begegnete, hatte ich ihn seit fast sieben Jahren nicht mehr gesehen. Ihn hatte ich immer besonders gern gehabt, und schon als kleiner Knirps hatte er mich beeindruckt als jemand, der über dem Durchschnitt stand, als jemand, der dazu bestimmt war, im Leben Großes zu erreichen. Den Tag von Junes Beisetzung ausgenommen, hatte unser letztes Gespräch im Haus seiner Mutter in South Orange, New Jersey, stattgefunden. Tom hatte gerade seinen Abschluss in Cornell mit Auszeichnung gemacht und stand jetzt am Beginn eines vierjährigen Stipendiums an der University of Michigan, wo er amerikanische Literatur studieren wollte. Alles, was ich ihm prophezeit hatte, war eingetreten, und ich erinnere mich noch gut an dieses Familienessen und die schöne Szene, als wir alle die Gläser hoben und auf Toms Erfolg anstießen. Als ich in seinem Alter war, hatte ich gehofft, einmal einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie mein Neffe. Wie er hatte auch ich am College Englisch als Hauptfach gehabt, mit der heimlichen Absicht, danach Literatur zu studieren oder mich als Journalist zu versuchen, hatte aber für beides keinen Mut aufgebracht. Das Leben kam mir in die Quere – zwei Jahre bei der Armee, Arbeit, Ehe, Familienpflichten, die Notwendigkeit, immer mehr Geld zu verdienen, der ganze Sumpf, der uns verschlingt, wenn wir nicht den Mumm haben, unsere eigenen Belange durchzusetzen–, aber mein Interesse an Büchern hatte ich nie verloren. Lesen war meine Unterhaltung und mein Trost, mein Labsal, mein liebster Genuss: Lesen zum puren Vergnügen, wegen der wunderbaren Ruhe, die einen umgibt, wenn man die Worte eines Autors in seinem Kopf widerhallen hört. Tom hatte diese Liebe immer mit mir geteilt, und als er mit fünf oder sechs damit anfing, hatte ich es mir zum Prinzip gemacht, ihm Jahr für Jahr mehrere Bücher zu schicken – nicht nur zum Geburtstag oder zu Weihnachten, sondern wann immer ich auf etwas stieß, von dem ich annahm, es könnte ihm gefallen. Als er elf war, hatte ich ihn mit Poe bekannt gemacht, und da Poe einer der Schriftsteller war, die er in seiner Magisterarbeit behandelte, war es nur natürlich, dass er mir davon erzählen wollte – und nur natürlich, dass ich ihm gern zuhörte. Die Mahlzeit war inzwischen beendet, und während alle anderen schon im Garten saßen, blieben Tom und ich im Esszimmer und schenkten uns den restlichen Wein ein.
«Auf deine Gesundheit, Onkel Nat», sagte Tom und hob sein Glas.
«Auf deine, Tom», antwortete ich. «Und auf ‹Imaginäre Paradiese: Das amerikanische Geistesleben vor dem Bürgerkrieg›.»
«Ein prätentiöser Titel, muss ich leider sagen. Aber was Besseres ist mir nicht eingefallen.»
«Prätentiös ist gut. Da horchen die Professoren auf. Du hast eine Eins plus bekommen, richtig?»
Bescheiden wie immer machte Tom eine abwehrende Handbewegung, als wollte er die Bedeutung der Note herunterspielen. Ich fuhr fort: «Da geht’s auch um Poe, sagst du. Und worum sonst noch?»
«Thoreau.»
«Poe und Thoreau.»
«Edgar Allan Poe und Henry David Thoreau. Ein unglücklicher Reim, findest du nicht auch? Die vielen O, die man da im Mund hat. Ich muss dabei immer an jemanden denken, der im Zustand ewiger Überraschung verharrt. Oh! Oh, Poe! Oh, Thoreau!»
«Eine unbedeutende Misslichkeit, Tom. Aber ein Bravo dem Mann, der Poe liest und Thoreau nicht vergisst. Stimmt’s?»
Tom lächelte breit und hob noch einmal sein Glas. «Auf deine Gesundheit, Onkel Nat.»
«Und auf deine, Dr.Thumb», sagte ich. Wir tranken noch einen Schluck Bordeaux. Ich stellte mein Glas auf den Tisch und bat ihn, mir den Inhalt seiner Arbeit zu skizzieren.
«Es geht um nicht existierende Welten», sagte mein Neffe. «Es geht um die Flucht ins Innere, um den Ort, an den sich ein Mensch zurückzieht, wenn ihm das Leben in der realen Welt nicht mehr möglich ist.»
«Die Welt im Schädel.»
«Genau. Ich beginne mit Poe und einer Analyse dreier seiner am wenigsten beachteten Werke. ‹Die Philosophie der Einrichtung›, ‹Landschaft mit Haus› und ‹Der Park von Arnheim›. Für sich allein genommen ist jeder dieser Texte nur seltsam, verschroben. Nimmt man sie zusammen, hat man ein vollständiges System menschlicher Sehnsucht.»
«Ich habe diese Sachen nie gelesen. Ich glaube, ich habe sogar noch nie davon gehört.»
«Poe beschreibt dort das ideale Zimmer, das ideale Haus und die ideale Landschaft. Danach wechsle ich zu Thoreau und untersuche das Zimmer, das Haus und die Landschaft, die er in Walden beschreibt.»
«Also eine vergleichende Studie.»
«Kein Mensch nennt Poe und Thoreau im selben Atemzug. Die beiden bilden die Extreme des amerikanischen Denkens. Aber das ist gerade das Schöne daran. Ein Säufer aus dem Süden – reaktionär in seinen politischen Überzeugungen, aristokratisch in seiner Haltung, chimärenhaft in seiner Phantasie. Und ein Abstinenzler aus dem Norden – radikal in seinen Ansichten, puritanisch in seinem Verhalten, hellsichtig in seiner Arbeit. Poe lebte in einer artifiziellen Welt, in mitternächtlicher Schwermut. Thoreau lebte in einer einfachen Welt, im hellen Sonnenschein. So verschieden, und doch wurden sie im Abstand von nur acht Jahren geboren, waren also im strengsten Sinne Zeitgenossen. Und beide sind jung gestorben – mit vierzig beziehungsweise fünfundvierzig. Zusammen haben sie gerade mal so lange gelebt wie ein alter Mann, und beide hatten keine Kinder. Thoreau ist sehr wahrscheinlich als Jungfrau ins Grab gegangen. Poe hat seine minderjährige Cousine geheiratet, aber ob diese Ehe vor Virginia Clemms Tod überhaupt vollzogen wurde, ist bis heute nicht geklärt. Man kann hier von Parallelen sprechen, man kann von Zufällen sprechen, aber diese äußeren Umstände sind weniger wichtig als die innere Wahrheit des Lebens dieser beiden. Jeder von ihnen fühlte sich in seiner extrem eigensinnigen Haltung dazu berufen, Amerika neu zu erfinden. In seinen Rezensionen und Kritiken kämpft Poe für eine neue bodenständige Literatur, eine amerikanische Literatur frei von englischen und europäischen Einflüssen. Thoreaus Werk ist eine unaufhörliche Attacke auf den Status quo, ein Kampf für ein neues Leben in Amerika. Beide haben an Amerika geglaubt, und beide haben geglaubt, Amerika sei zum Teufel gegangen, das Land sei von einem ständig wachsenden Berg aus Maschinen und Geld zu Tode gequetscht worden. Wie sollte man bei diesem Lärm noch denken können? Beide wollten da raus. Thoreau zog sich in die Umgebung von Concord zurück, stellte sich die Wildnis als sein Exil vor – einzig und allein, um zu beweisen, dass so etwas möglich war. Solange jemand den Mut hat, nein zu sagen zu dem, was die Gesellschaft von ihm verlangt, kann er zu seinen eigenen Bedingungen leben. Und warum? Um frei zu sein. Aber frei wozu? Bücher zu lesen, Bücher zu schreiben, zu denken. Frei, um ein Buch wie Walden zu schreiben. Poe auf der anderen Seite hat sich in einen Traum von Vollkommenheit zurückgezogen. Sieh dir ‹Die Philosophie der Einrichtung› an, da wirst du feststellen, dass sein imaginäres Zimmer genau zu diesem Zweck entworfen wurde. Als ein Ort, an dem man lesen, schreiben und denken kann. Eine Stätte der Besinnung, ein stilles Heiligtum, wo die Seele endlich ein gewisses Maß an Frieden finden kann. Unmöglich? Utopisch? Ja. Aber auch eine vernünftige Alternative zu den damaligen Lebensbedingungen. Denn es stimmt ja, Amerika war tatsächlich zum Teufel gegangen. Das Land war gespalten, und wir alle wissen, was ein Jahrzehnt später geschah. Vier Jahre lang Tod und Zerstörung. Ein Blutbad, angerichtet von ebenden Maschinen, die uns alle reich und glücklich machen sollten.»
Der Junge war so klug, so wortgewandt, so belesen, dass ich mich geehrt fühlte, mich zu seiner Familie zählen zu dürfen. Die Woods hatten in den letzten Jahren allerhand durchgemacht, aber Tom schien dank seiner nüchternen, überlegten, ziemlich nachdenklichen Einstellung zum Leben die Katastrophe der Scheidung seiner Eltern gut überstanden zu haben – ebenso die stürmische Pubertät seiner jüngeren Schwester, die sich gegen die zweite Ehe ihrer Mutter aufgelehnt hatte und mit siebzehn von zu Hause weggelaufen war–, und ich konnte nur bewundern, wie fest er mit den Füßen auf dem Boden geblieben war. Er hatte wenig oder keinen Kontakt zu seinem Vater, der gleich nach der Scheidung nach Kalifornien gezogen war und einen Job bei der Los Angeles Times angenommen hatte, und empfand, ähnlich wie seine Schwester (wenn auch in stark gedämpfter Form), keine sonderliche Zuneigung oder Respekt für Junes zweiten Ehemann. Er und seine Mutter verstanden sich aber gut, und die beiden hatten das Drama von Auroras Verschwinden als gleichberechtigte Partner durchlebt, dieselbe Verzweiflung durchlitten und dieselben Hoffnungen gehegt, dieselben bösen Erwartungen, dieselben nie aufhörenden Sorgen geteilt. Rory war eins der lustigsten, bezauberndsten Mädchen gewesen, die ich je gekannt habe: ein Wirbelwind, vorlaut, frech und neunmalklug, impulsiv und mutwillig bis zum Gehtnichtmehr. Seit ihrem zweiten oder dritten Lebensjahr hatten Edith und ich sie nur noch das Lachende Mädchen genannt; sie war die hauseigene Entertainerin der Woods, ein Clown, der mit den Jahren immer pfiffiger und wilder wurde. Tom war nur zwei Jahre älter als sie, aber er hatte sich immer um sie gekümmert, und seine bloße Anwesenheit hatte nach dem Fortgang des Vaters ihrem Leben Halt gegeben. Dann aber ging er aufs College, und Rory geriet außer Kontrolle – erst entwich sie nach New York, und dann, nach einer kurzzeitigen Versöhnung mit ihrer Mutter, verschwand sie ins Unbekannte. Als Toms Examen mit jenem Essen gefeiert wurde, hatte sie bereits ein außereheliches Kind geboren (ein Mädchen namens Lucy), war gerade lange genug nach Hause zurückgekommen, um meiner Schwester das Baby in den Schoß zu werfen, und dann aufs Neue verschwunden. Als June vierzehn Monate später starb, erfuhr ich von Tom auf der Beerdigung, dass Aurora vor kurzem wieder aufgetaucht war und das Kind zurückverlangt hatte – nur um nach zwei Tagen wiederum zu verschwinden. Zur Beerdigung ihrer Mutter erschien sie nicht. Vielleicht wäre sie gekommen, sagte Tom, aber sie hätten nicht gewusst, wie oder wo man mit ihr Kontakt habe aufnehmen können.
Trotz dieser familiären Schwierigkeiten und obwohl er seine Mutter schon mit dreiundzwanzig verlor, hatte ich nie daran gezweifelt, dass Tom seinen Weg machen würde. Mit seinen Anlagen konnte er nicht scheitern, einen starken Charakter wie ihn konnten die unvorhersehbaren Stürme des Schicksals nicht aus der Bahn werfen. Bei der Beerdigung seiner Mutter war er, von Trauer überwältigt, wie betäubt umhergelaufen. Wahrscheinlich hätte ich mehr mit ihm reden sollen, aber ich war selbst viel zu erschüttert, als dass ich ihm irgendwie hätte beistehen können. Ein paar Umarmungen, ein paar gemeinsame Tränen, mehr aber auch nicht. Dann ging er nach Ann Arbor zurück, und der Kontakt riss ab. Ich gebe hauptsächlich mir die Schuld daran, aber Tom war alt genug, selbst die Initiative zu ergreifen, und hätte sich jederzeit bei mir melden können. Oder wenn nicht bei mir, dann bei seiner Cousine Rachel, die inzwischen in Chicago studierte und also ebenfalls im Mittleren Westen lebte. Sie kannten sich seit frühester Kindheit und waren immer gut miteinander ausgekommen, aber auch von ihr schien er nichts wissen zu wollen. Die Jahre vergingen, und gelegentlich beschlichen mich leise Schuldgefühle, aber ich hatte selbst eine schwierige Phase (Eheprobleme, Gesundheitsprobleme, Geldprobleme) und war zu abgelenkt, um groß über ihn nachzudenken. Und wenn ich einmal an ihn dachte, stellte ich ihn mir als fleißigen Studenten vor, der systematisch seine Karriere verfolgte und auf der akademischen Leiter immer höher stieg. Im Frühjahr 2000 war ich mir sicher, dass er längst eine Stelle an einer prestigeträchtigen Uni wie Berkeley oder Columbia angetreten hatte – ein erfolgreicher junger Intellektueller, der bereits an seinem zweiten oder dritten Buch arbeitete.
Man stelle sich daher meine Überraschung vor, als ich an diesem Dienstagmorgen im Mai in Brightman’s Attic hineinspazierte und dort hinter der Kasse meinen Neffen erblickte, der gerade einer Kundin Wechselgeld herausgab. Zum Glück sah ich Tom, bevor er mich sah. Gott weiß, was für bedauerliche Worte mir entschlüpft wären, hätte ich nicht diese zehn oder zwölf Sekunden gehabt, den Schrecken aufzufangen. Ich rede nicht nur von dem rätselhaften Umstand, dass er als Aushilfe in einem Antiquariat arbeitete, sondern auch von seinem völlig veränderten Äußeren. Tom hatte immer zur Korpulenz geneigt. Er war mit der grobknochigen Statur eines Bauern geplagt, die mühelos große Gewichte tragen konnte – ein genetisches Geschenk seines verschwundenen, mehr oder weniger alkoholsüchtigen Vaters–, aber trotzdem war er, als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, relativ gut in Form gewesen. Stämmig, das ja, aber doch muskulös und kräftig, mit athletisch federndem Gang. Jetzt, sieben Jahre später, hatte er gut fünfzehn bis zwanzig Kilo zugelegt und machte einen ausgesprochen pummeligen Eindruck. Wo früher ein Kinn gewesen war, hatte er jetzt zwei, und sogar seine Hände waren dick und rund, wie man es oft bei älteren Klempnern sieht. Wahrlich ein trauriger Anblick. Das Funkeln in den Augen meines Neffen war erloschen, seine ganze Erscheinung ein Bild des Scheiterns.
Als die Kundin ihr Buch bezahlt hatte, schob ich mich dorthin, wo sie eben gestanden hatte, legte meine Hände auf die Theke und beugte mich vor. Tom bückte sich gerade nach einer Münze, die auf den Boden gefallen war. Ich räusperte mich und sagte: «Hallo, Tom. Lange nicht gesehen.»
Mein Neffe sah auf. Anfangs schien er völlig verwirrt, und ich fürchtete schon, er hätte mich nicht erkannt. Dann aber trat ein Lächeln auf sein Gesicht, und als es immer breiter wurde, erkannte ich erleichtert, dass es noch sein altes Lächeln war. Mit einer kleinen Beimischung von Melancholie, mag sein, aber ich sah, dass er doch nicht so verändert schien, wie ich befürchtet hatte.
«Onkel Nat!», rief er. «Was zum Teufel treibst du in Brooklyn?»
Ehe ich antworten konnte, stürzte er hinter der Theke hervor und schlang seine Arme um mich. Zu meiner nicht geringen Verwunderung füllten sich meine Augen mit Tränen.
ABSCHIED VOM HOF
Noch am selben Tag lud ich ihn zum Essen im Cosmic Diner ein. Die prächtige Marina brachte uns Truthahn-Sandwiches und Eiskaffee, und ich flirtete ein wenig aggressiver mit ihr als gewöhnlich, vielleicht weil ich Tom beeindrucken wollte, vielleicht auch einfach, weil ich so überschwänglich war. Mir war nicht bewusst gewesen, wie sehr ich den guten Dr.Thumb vermisst hatte, und jetzt stellte sich heraus, dass wir Nachbarn waren – der Zufall wollte es, dass wir nur zwei Blocks voneinander entfernt im alten Königreich Brooklyn, New York, lebten.
Er arbeite seit fünf Monaten in Brightman’s Attic, erzählte er, und ich hätte ihn nur deshalb nicht schon früher gesehen, weil er sonst immer oben an den monatlichen Katalogen der Rara arbeite, was ein wesentlich lukrativeres Geschäft sei als der Handel mit gebrauchten Büchern im Erdgeschoss. Tom war kein Verkäufer, und er saß sonst nie an der Kasse, aber der eigentliche Verkäufer hatte an diesem Vormittag einen Arzttermin, und Harry hatte Tom gebeten, solange für ihn einzuspringen.
Der Job sei nichts Besonderes, fuhr Tom fort, aber immer noch besser als Taxi fahren, was er gemacht habe, seit er nach dem Abbruch seines Studiums nach New York zurückgekehrt sei.
«Wann war das?», fragte ich und suchte meine Enttäuschung so gut es ging zu verbergen.
«Vor zweieinhalb Jahren», sagte er. «Ich habe meine Kurse alle abgeschlossen und die mündlichen Prüfungen absolviert, aber dann bin ich in der Dissertation stecken geblieben. Ich habe mich übernommen, Onkel Nat.»
«Sag nicht dauernd Onkel Nat, Tom. Sag einfach Nathan zu mir, wie jeder andere auch. Seit deine Mutter tot ist, komme ich mir nicht mehr wie ein Onkel vor.»
«Also gut, Nathan. Aber mein Onkel bist du trotzdem, ob du willst oder nicht. Tante Edith ist wohl nicht mehr meine Tante, nehme ich an, aber selbst wenn sie jetzt zur Extante degradiert ist, ist Rachel immer noch meine Cousine, und du bist immer noch mein Onkel.»
«Sag einfach Nathan zu mir, Tom.»
«Mach ich, Onkel Nat, versprochen. Von jetzt an werde ich immer Nathan zu dir sagen. Zum Ausgleich möchte ich, dass du Tom zu mir sagst. Nicht mehr Dr.Thumb. Abgemacht? Das ist mir peinlich.»
«Aber so habe ich dich immer genannt. Schon als du ein kleiner Junge warst.»
«Und ich habe dich immer Onkel Nat genannt.»
«Du hast Recht. Ich gebe mich geschlagen.»
«Glass und Wood sind in ein neues Zeitalter eingetreten, Nathan. Das post-familiäre, post-studentische, post-historische Zeitalter.»
«Post-historisch?»
«Das Jetzt. Und auch das Später. Aber kein Verweilen mehr beim Damals.»
«Schnee von gestern, Tom.»
Der ehemalige Dr.Thumb schloss die Augen, legte den Kopf nach hinten und stieß den Zeigefinger in die Luft, als versuchte er sich an etwas zu erinnern, das er schon vor langer Zeit vergessen hatte. Dann rezitierte er mit düsterer, pseudo-theatralischer Stimme die ersten Zeilen von Walter Raleighs «Abschied vom Hof»:
Wie falsche Träume, alle Freuden vergangen,
Unwiederbringlich die vertändelten Tage,
Das Falsche geliebt, erstorben das Verlangen:
Von dem, was gewesen, bleibt nur die Klage.
FEGEFEUER
Niemand wächst mit der Vorstellung auf, es sei ihm bestimmt, Taxifahrer zu werden, aber in Toms Fall hatte der Job als besonders harte Buße gedient, als eine Möglichkeit, das Scheitern seiner ehrgeizigsten Ziele zu betrauern. Er hatte vom Leben nicht viel erwartet, doch selbst das wenige hatte sich als unerreichbar erwiesen: seinen Doktor zu machen, eine Englisch-Professur an irgendeiner Universität anzutreten und die nächsten vierzig oder fünfzig Jahre in Forschung und Lehre zu arbeiten. Mehr hatte er nie haben wollen, allenfalls noch eine Frau und ein paar Kinder dazu. Das war doch nicht zu viel verlangt, aber nachdem Tom sich drei Jahre lang mit seiner Dissertation herumgeschlagen hatte, musste er schließlich einsehen, dass die Arbeit über seine Kräfte ging. Oder falls sie das nicht tat, konnte er sich jedenfalls nicht mehr davon überzeugen, dass sie noch irgendeinen Wert besaß. Also verließ er Ann Arbor und kehrte nach New York zurück, achtundzwanzig Jahre alt, ein Versager, der keine Ahnung hatte, wohin die Reise ging und was das Leben noch für ihn bereithielt.
Zu Beginn war das Taxi bloß eine zeitweilige Notlösung, ein Provisorium, wovon er die Miete finanzierte, während er nach etwas anderem Ausschau hielt. Er suchte wochenlang, aber die Dozentenstellen an Privatschulen waren zu der Zeit gerade alle besetzt, und je mehr er sich an die Schinderei seiner täglichen Zwölfstundenschichten gewöhnte, desto geringer wurde seine Motivation, sich nach einer anderen Arbeit umzusehen. Das Provisorium wurde zum Dauerzustand, und wenn ihm auch bewusst war, dass er vor die Hunde ging, glaubte er andererseits, dass dieser Job ihm vielleicht nützen könnte, dass er, wenn er darauf achtete, was er tat und warum er es tat, in seinem Taxi etwas lernen würde, das anderswo nicht zu lernen war.
Was das sein sollte, war ihm nicht immer klar, aber dass er, wenn er sechs Tage die Woche von fünf Uhr nachmittags bis fünf Uhr morgens in seinem klapprigen gelben Dodge durch die Straßen schlich, etwas lernte, stand außer Frage. Die Nachteile dieser Arbeit waren so offensichtlich, so allgegenwärtig, so niederschmetternd, dass man, wenn man sie nicht zu ignorieren lernte, zu einem Leben voller Verbitterung und Trübsal verurteilt war. Die endlosen Schichten, die schlechte Bezahlung, die physischen Gefahren, der Bewegungsmangel – das waren die feststehenden Begleitumstände, an denen sich so wenig ändern ließ wie am Wetter. Wie oft hatte seine Mutter, als er noch klein war, zu ihm gesagt: «Am Wetter kann man nichts ändern, Tom.» Womit sie meinte, dass manche Dinge eben sind, wie sie sind, und dass wir sie nur akzeptieren können. Tom verstand das Prinzip, aber das hatte ihn nie daran gehindert, die Schneestürme und eisigen Winde zu verfluchen, die gegen seinen zitternden kleinen Körper wüteten. Jetzt schneite es wieder einmal. Sein Leben war zu einem einzigen Kampf gegen die Elemente geworden, und falls er jemals mit Recht auf das Wetter hätte schimpfen dürfen, dann jetzt. Aber Tom schimpfte nicht. Und er suhlte sich auch nicht in Selbstmitleid. Er hatte einen Weg gefunden, für seine Dummheit zu büßen, und wenn er diese Periode überlebte, ohne vollständig den Mut zu verlieren, gab es vielleicht doch noch Grund zur Hoffnung. Dass er am Taxifahren festhielt, hatte nichts mit dem Wunsch zu tun, aus einer schlimmen Situation das Beste zu machen. Vielmehr suchte er nach einer Möglichkeit, irgendetwas in Gang zu bringen, und bis er begriffen hätte, was das eigentlich war, glaubte er, nicht das Recht zu haben, sich von dieser Fessel zu befreien.
Er lebte in einem Einzimmer-Apartment an der Kreuzung Eighth Avenue und Third Street; das Zimmer hatte er vom Freund eines Freundes untergemietet, der aus New York fortgezogen war, um in einer anderen Stadt zu arbeiten – Pittsburgh oder Plattsburgh, Tom wusste es nicht mehr genau. Die Bude war schäbig und klein, ausgestattet mit einer Metalldusche im Bad, zwei Fenstern, die auf eine Backsteinmauer sahen, sowie einer winzigen Kochnische mit Minikühlschrank und einem zweiflammigen Gasherd. Ein Bücherregal, ein Stuhl, ein Tisch, auf dem Fußboden eine Matratze. Es war die kleinste Wohnung, in der er je gelebt hatte, aber mit der auf vierhundertsiebenundzwanzig Dollar im Monat festgesetzten Miete konnte Tom zufrieden sein. Im ersten Jahr nach dem Einzug verbrachte er dort ohnehin nicht sehr viel Zeit. Meist war er unterwegs, besuchte alte Freunde von der High School und vom College, die es nach New York verschlagen hatte, lernte durch die alten Bekannten neue kennen, vertrank sein Geld in Bars, ging, wenn sich die Gelegenheit ergab, mit Frauen aus, kurz, er versuchte, sich ein Leben zu basteln – oder etwas, das einem Leben ähnlich sah. Häufig endeten diese Versuche, sich ein gesellschaftliches Umfeld zu schaffen, in quälendem Schweigen. Seine alten Freunde, die ihn als hervorragenden Schüler und ungeheuer komischen Unterhalter in Erinnerung hatten, sahen entsetzt, was aus ihm geworden war. Tom war aus den Reihen der Gesalbten ausgeschieden, und nun schien sein Sturz ihr eigenes Selbstvertrauen zu erschüttern und sie, was ihre Aussichten betraf, mit neuem Pessimismus zu erfüllen. Es half auch nicht gerade, dass Tom so stark zugenommen hatte, dass seine frühere Stämmigkeit einer fast peinlichen Korpulenz gewichen war. Aber noch verstörender wirkte, dass er offenbar keine Pläne hatte, dass er nie davon sprach, wie er den Schaden, den er sich angetan hatte, beheben und sich wieder aufrappeln wollte. Wenn er von seinem neuen Job erzählte, sprach er in seltsamen, geradezu religiösen Wendungen und erging sich in Spekulationen über spirituelle Stärke und darüber, wie wichtig es sei, mit Geduld und Demut seinen Weg zu finden; das verwirrte sie so, dass sie unruhig auf ihren Stühlen herumrutschten. Toms Intelligenz war durch den Job nicht beeinträchtigt, aber niemand wollte mehr hören, was er zu sagen hatte, am wenigsten die Frauen, mit denen er sprach und die davon ausgingen, dass junge Männer immerzu kühne Ideen und kluge Pläne hatten, wie sie die Welt erobern würden. Tom vergrätzte sie mit seinen Zweifeln und Selbstanalysen, seinen verworrenen Erörterungen über das Wesen der Realität und seiner Zögerlichkeit. Schlimm genug, dass er sein Geld mit Taxifahren verdiente, aber ein philosophierender Taxifahrer, der in Armeeklamotten herumlief und einen dicken Wanst vor sich her trug, ging doch ein bisschen zu weit. Natürlich war er ein liebenswürdiger Mensch, und keine hatte direkt etwas gegen ihn, aber ein ernsthafter Kandidat war er nicht – weder für die Ehe noch auch nur für ein Abenteuer.
Tom zog sich zunehmend in sich selbst zurück. Ein weiteres Jahr verging, und inzwischen war er so gründlich isoliert, dass er seinen dreißigsten Geburtstag ganz allein verbrachte. Die Wahrheit ist, dass er den Tag verschwitzt hatte, und da niemand anrief, um ihm zu gratulieren oder alles Gute zu wünschen, geschah es, dass es ihm erst am nächsten Morgen um zwei endlich einfiel. Da war er irgendwo draußen in Queens, wo er zwei betrunkene Geschäftsleute zu einem Stripclub namens Garden of Earthly Delights gebracht hatte, und um den Beginn der vierten Dekade seines Daseins zu feiern, fuhr er zum Metropolitan Diner am Northern Boulevard, nahm am Tresen Platz und genehmigte sich einen Schoko-Milkshake, zwei Hamburger und eine Portion Fritten.
Unmöglich zu sagen, wie lange Tom ohne Harry Brightman noch in diesem Fegefeuer geblieben wäre. Harrys Laden lag in der Seventh Avenue, nur wenige Blocks von Toms Wohnung entfernt, und Tom hatte sich angewöhnt, täglich einmal in Brightman’s Attic vorbeizugehen. Er kaufte nur selten etwas, stöberte nur gern vor Schichtbeginn eine halbe oder ganze Stunde in den Büchern im Erdgeschoss herum. Zu Tausenden drängten sie sich da – alles Mögliche, von vergriffenen Wörterbüchern über vergessene Bestseller bis hin zu ledergebundenen Shakespeare-Ausgaben. Solche Papiergrüfte hatten es ihm schon immer angetan; hier konnte er in Stapeln ausrangierter Bücher blättern und den schönen alten Staubgeruch genießen. Bei einem seiner ersten Besuche hatte er Harry nach einer bestimmten Kafka-Biographie gefragt, und so waren die beiden ins Gespräch gekommen. Das war die erste von vielen kleinen Plaudereien, und obwohl Harry nicht immer unten im Laden war, wenn Tom hereinschneite (meist hatte er oben zu tun), unterhielten sie sich in den folgenden Monaten doch oft genug, dass Harry nicht nur den Namen von Toms Heimatstadt und das Thema seiner abgebrochenen Dissertation erfuhr (Clarel – Melvilles gigantischer und unlesbarer Versroman), sondern auch die Erkenntnis zu verdauen hatte, dass Tom an Sex mit Männern nicht interessiert war. Trotz dieser letzteren Enttäuschung wurde Harry bald klar, dass Tom den idealen Gehilfen für sein Geschäft mit seltenen Büchern und Manuskripten im Obergeschoss abgeben würde. Er bot ihm den Job einmal an, er bot ihm den Job ein Dutzend Mal an, und obwohl Tom das Angebot immer wieder ausschlug, gab Harry die Hoffnung nicht auf, dass er eines Tages ja sagen würde. Er begriff, dass Tom sich im Winterschlaf befand, blind mit einem dunklen Engel der Verzweiflung rang und dass es früher oder später ein Ende damit haben würde. Das stand fest, auch wenn Tom selbst es noch nicht wusste. Aber wenn er es erst einmal wüsste, würde er den Unsinn mit dem Taxifahren auf der Stelle einstellen.
Tom unterhielt sich gern mit Harry, weil Harry so drollig und unverblümt war, ein Mann, der eine solche Fülle hinreißender Sprüche und herrlicher Spitzfindigkeiten auf Lager hatte, dass man nie wusste, was er als Nächstes von sich geben würde. Vom Aussehen her hätte man ihn für irgendeinen nicht mehr ganz taufrischen New Yorker Schwulen gehalten. Das ganze äußerliche Brimborium diente allein diesem einen Zweck – die gefärbten Haare und Augenbrauen, die Seidenkrawatten und Segelclub-Blazer, die tuntenhafte Ausdrucksweise–, aber wenn man ihn ein bisschen näher kennen lernte, erwies er sich als höchst scharfsinniger und faszinierender Zeitgenosse. Seine Art, jemanden anzugehen, hatte etwas Provozierendes und kündete von einer Intelligenz, der man gute Antworten schuldig zu sein glaubte, wenn er einen mit seinen durchtriebenen, oft allzu persönlichen Fragen löcherte. Einfach nur antworten, das reichte bei Harry nicht. Was man sagte, musste funkeln und glänzen, musste beweisen, dass man mehr war als irgendein Dummkopf, der sich nur so durchs Leben schleppte. Für genau das aber hielt Tom sich in jener Zeit, und so musste er sich schon besondere Mühe geben, wenn er im Gespräch mit Harry nicht den Kürzeren ziehen wollte. Und ebendiese Mühe reizte ihn so an ihren Unterhaltungen. Tom gefiel es, schnell denken zu müssen, es belebte ihn, seine Gedanken zur Abwechslung einmal auf ungewohnte Bahnen zu lenken und immer hellwach zu sein. Drei oder vier Monate nach ihrem ersten Plausch – zu einer Zeit, als sie noch nicht einmal richtige Bekannte waren, geschweige denn Freunde oder Partner – wurde Tom klar, dass es unter allen Menschen, die er in New York kannte, niemanden gab, weder Mann noch Frau, mit dem er so offen sprach wie mit Harry Brightman.
Und doch blieb Tom standhaft bei seinem Nein. Über sechs Monate lang wehrte er das Anerbieten des Buchhändlers ab, in sein Geschäft einzusteigen, kam mit so vielen Ausreden, nannte so viele Gründe, warum Harry sich einen anderen suchen sollte, dass sein Widerstreben zum Anlass immer neuer Witze zwischen den beiden wurde. Anfangs bot Tom alle Kräfte auf, die Vorteile seiner aktuellen Beschäftigung herauszustreichen, und entwickelte komplizierte Theorien über den ontologischen Nutzen des Taxifahrens. «Das ebnet einen direkten Weg in die Formlosigkeit des Seins», sagte er zum Beispiel und gab sich alle Mühe, nicht zu grinsen, als er den Jargon seiner akademischen Vergangenheit nachäffte, «einen großartigen Einstieg in die chaotischen Substrukturen des Universums. Man fährt die ganze Nacht in der Stadt herum, und man weiß nie, wo man als Nächstes hinkommt. Ein Kunde steigt hinten zu dir in den Wagen, sagt dir, wohin er gefahren werden will, und da fährst du hin. Riverdale, Fort Greene, Murray Hill, Far Rockaway, die erdabgewandte Seite des Mondes. All diese Ziele sind willkürlich, jede Entscheidung wird vom Zufall herbeigeführt. Du fädelst dich in den Verkehr, du steuerst das Ziel so schnell an wie möglich, aber ein Mitspracherecht hast du nie. Du bist ein Spielball der Götter, du hast keinen eigenen Willen. Du bist nur dazu da, den Launen anderer Leute zu dienen.»
«Und was für Launen», erwiderte Harry mit einem boshaften Funkeln in den Augen, «was für unartige Launen müssen das sein. Ich wette, du hast in deinem Rückspiegel schon einiges zu sehen bekommen.»
«Allerdings, Harry, du sagst es. Masturbation, Unzucht, Rauschzustände aller Art. Kotze und Sperma, Scheiße und Pisse, Blut und Tränen. Im Lauf der Zeit hat sich jede menschliche Körperflüssigkeit auf meine Rückbank ergossen.»
«Und wer wischt das auf?»
«Ich. Das gehört zum Job.»
«Lass es dir gesagt sein, junger Mann», hauchte Harry, den Handrücken divenhaft an die Stirn legend, als wollte er in Ohnmacht sinken, «wenn du für mich arbeitest, wirst du feststellen, dass Bücher nicht bluten. Und dass sie ganz gewiss nicht defäzieren.»
«Es gibt auch schöne Momente», ergänzte Tom, der Harry nicht das letzte Wort lassen wollte. «Unvergesslich charmante Augenblicke, winzige Glanzpunkte, unerwartete Wunder. Morgens um halb vier auf dem Times Square, kein anderes Auto in Sicht, und du plötzlich ganz allein im Zentrum der Welt, und aus allen Schleusen des Himmels regnet Neon auf dich herab. Oder wenn du kurz vor Sonnenaufgang mit über hundert Sachen den Belt Parkway runterfährst und den Geruch des Ozeans in die Nase bekommst, der durchs offene Fenster zu dir hereinströmt. Oder wenn du über die Brooklyn Bridge fährst, und genau vor dir erscheint der Vollmond im Brückenbogen, und du siehst nur noch diese strahlend gelbe, erschreckend große Scheibe, und du vergisst, dass du hier unten auf der Erde lebst, und stellst dir vor, du fliegst, das Taxi hat Flügel, und du schwebst wahrhaftig durch die Luft. Kein Buch kann so etwas wiedergeben. Das ist für mich wahre Transzendenz. Den Körper hinter sich lassen und in den ganzen Reichtum der Welt eintauchen.»
«Dafür muss man nicht Taxi fahren, Junge. Das geht mit jedem anderen Auto auch.»
«Nein, das ist was anderes. In einem normalen Auto hat man nicht das Gefühl, sich abzurackern, und das ist ein wesentliches Element dieser Erfahrung. Die Erschöpfung, die Langeweile, die geisttötende Eintönigkeit. Und plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, überkommt dich dieses Gefühl von Freiheit, und für einige Sekunden bist du vollkommen selig. Aber man muss dafür bezahlen. Ohne Plackerei keine Seligkeit.»
Tom wusste selbst nicht, warum er Harry solchen Widerstand leistete. Er glaubte nicht ein Zehntel von dem, was er ihm erzählte, aber sobald sie auf das Thema Jobwechsel zu sprechen kamen, wurde er störrisch und fing mit seinen abstrusen Gegenargumenten und Selbstrechtfertigungen an. Natürlich war ihm klar, dass es ihm bei Harry besser gehen würde, aber die Vorstellung, als Gehilfe eines Buchhändlers zu arbeiten, war auch nicht gerade umwerfend, kaum das, was ihm vorgeschwebt hatte, als er davon träumte, sein Leben einer gründlichen Revision zu unterziehen. Der Schritt schien ihm irgendwie zu klein, zu kümmerlich, als dass er sich damit begnügen wollte, nachdem er so viel verloren hatte. Und so ging das Werben weiter, und je mehr ihm sein Job zuwider war, desto hartnäckiger verteidigte er seine Trägheit; und je träger er wurde, desto mehr war er sich selbst zuwider. Der Schock, unter so trostlosen Umständen dreißig zu werden, entfaltete einige Wirkung, aber nicht genug, um ihn zum Handeln zu bewegen, und obwohl seine Mahlzeit am Tresen des Metropolitan Diner mit dem Entschluss geendet hatte, sich spätestens innerhalb eines Monats einen neuen Job zu besorgen, arbeitete er, als der Monat abgelaufen war, immer noch für die 3-D-Taxigesellschaft. Tom hatte sich immer gefragt, wofür diese drei D stehen mochten, und jetzt glaubte er es zu wissen. Dunkelheit, Destruktion und Dämmerzustand. Mit einem Wort: Tod. Er sagte Harry, er wolle sich das Angebot durch den Kopf gehen lassen, und dann tat er nichts mehr, wie immer. Hätte ihm nicht in einer eisigen Januarnacht irgendein stotternder, zugedröhnter Cracksüchtiger eine Kanone in den Hals gerammt – wer weiß, wie lange dieser unentschiedene Zustand noch angehalten hätte? Aber Tom hatte endlich kapiert, und als er am nächsten Morgen in Harrys Laden trat und ihm sagte, er habe sich entschlossen, den Job anzunehmen, waren seine Tage als Taxifahrer mit einem Schlag vorbei.