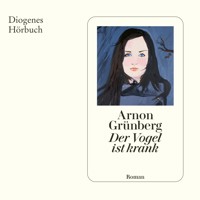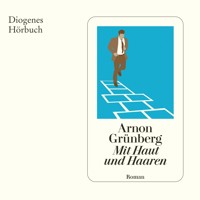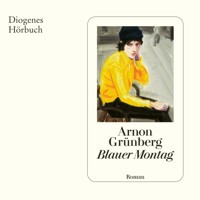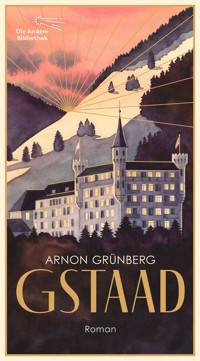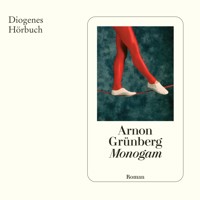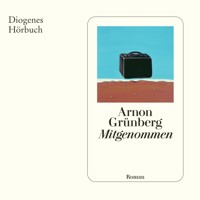6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Zwischen real und digital: Wo bleibt da die Liebe? Was passiert, wenn die Grenzen zwischen Realität und Phantasie verschwimmen? Wenn das Lesen im Netz das tatsächliche dominiert? Mit seinem unverwechselbarem Sinn für Humor und seinem scharfen Blick fürs Detail geht Arnon Grünberg in seiner Novelle genau diesen Fragen auf den Grund.Lillian, Anfang zwanzig ist ein weiblicher Nerd. Sie wohnt noch bei ihren Eltern, ist übergewichtig und alltagsuntauglich. Ihr wahres Leben findet im Netz statt. Dort sind auch ihre Freunde, der wichtigste ist Banri Watanuki. Das Chatten mit ihm hilft Lillian, auch in der Außenwelt besser zurechtzukommen. Sie lebt ein fast normales Leben, bis sie eines Tages glaubt, in ihrem Kollegen Seb ihren Cyber-Freund Banri Watanuki wiederzuerkennen …Ein beeindruckender Text über digitale und analoge Welten – und über die Liebe, die sich zwischen allen Einsen und Nullen immer noch ihren Weg bahnt. "Die Datei" ist die Novelle, die den Kern eines Experiments zur Kreativitätsforschung bildet. Neurowissenschaftler der Universität Amsterdam haben die Hirnströme Arnon Grünbergs beim Verfassen des Texts aufgezeichnet. Auf der Buchmesse 2016 konnten Besucher des "Grünberg Labs" in der Agora ihre Hirnaktivitäten während der Lektüre vermessen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Ähnliche
Arnon Grünberg
Die DateiundDie zweite Datei
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Arnon Grünberg
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Die Datei
Rules of the internet: #30
Rules of the internet: #37
Rules of the internet: #31
Rules of the internet: #38
Rules of the internet: #17
Rules of the internet: #19
Rules of the internet: #11
Rules of the internet: #33
Rules of the internet: #36
Rules of the internet: #21
Rules of the internet: #3
Rules of the internet: #5
Rules of the internet: #16
Danksagung/Quellenangaben
Die zweite Datei
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Die Datei
With the lights out
It’s less dangerous
Nirvana
Rules of the internet: #30
There are no girls on the internet
Kauen ist Meditieren. Seit gut zwölf Stunden hat Lillian, eine junge Frau mit fünf Tätowierungen, vier davon an unauffälligen Stellen, nicht mehr meditiert. Jetzt, im Auto auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch, steckt sie sich ein Weingummi nach dem anderen in den Mund. Obwohl Frühling ist, spricht im Radio ein Mann von einem Herbststurm. In ihrer Straße ist tatsächlich ein Baum umgestürzt, die Feuerwehr musste kommen. Ein Audi war zerschmettert worden, doch ohne Insassen. Der Baum war umsonst umgestürzt. Lillian schafft es immer noch nicht, allen Menschen ein langes Leben, Gesundheit und Glück zu wünschen. Ab und zu hofft sie, dass jemand zerschmettert wird, was aber nicht heißt, dass sie sich solcher Gedanken nicht schämt. Der Mensch ist ein work in progress. Lillian weiß, wie viel Arbeit noch zu tun ist. Schon oft haben ihre Eltern gesagt: »So sind wir Menschen nun mal, das ist unsere Natur.« Wenn das wirklich stimmt, kann man sich genauso gut gleich von einem Wolkenkratzer stürzen. Was Lillian einmal auch ernsthaft erwogen hat, sie hatte sich auf ein Hochhaus gestellt, doch nach ein paar Minuten gedacht: Nein, lieber nicht. Es ging ein starker Wind. Sie sah sich schon unten auf dem Bürgersteig liegen. All der Dreck, all das Fleisch, das vom Boden gekratzt werden müsste, ein Kind, das ihren Sturz vielleicht versehentlich sähe und noch monatelang, möglicherweise für immer, traumatisiert wäre. Das war nicht der richtige Weg.
Heute Nacht hat sie von Zlatan Ibrahimović geträumt. In einem Gebäude, das vage an ein Gemeindezentrum erinnerte, sprach er sie an. Sie fragte sich nicht, was Zlatan Ibrahimović in einem Gemeindezentrum macht, die Leute haben ein Recht auf ihre Geheimnisse. »Kannst du mitkommen?«, hatte Zlatan gefragt, worauf sie zusammen die Treppe hinaufgingen. Da endete der Traum, den sie kurz nach dem Erwachen mithilfe einiger Stichworte in ihr Traumbuch notierte.
Der Name Zlatan gefiel ihr, darum hat sie sich vor einem Jahr sein Buch gekauft. Während einiger Monate hat sie viel mit Zlatan gesprochen, doch damit ist es jetzt vorbei.
Eine Bekannte von Lillian – sie war einmal ihre Freundin, wurde dann aber mehr und mehr die Freundin der Eltern –, die schon ein paarmal gesagt hat, sie solle langsam ihre Flausen vergessen und sich normal aufführen wie andere Leute, hat sich bereitgefunden, sie zu ihrem Bewerbungsgespräch zu fahren. Lillian hat kein Auto, dafür aber ein Rennrad, das sie kaum benutzt. Lange Zeit hielt sie sich für eine asiatische Prinzessin, und asiatische Prinzessinnen sitzen nun mal nicht auf Rennrädern. Ganz aufgegeben hat sie diesen Glauben noch nicht. Einen Glauben gibt man auch nicht auf, höchstens verlässt einen der Glaube, öfter noch muss man ihn sich aus dem Leib reißen wie eine Zecke. Die Mongolei, die Steppen, da möchte sie gern einmal hin. Mit der Transsibirischen Eisenbahn. Das Wort »Samowar« löst Sehnsucht in ihr aus wie das Foto eines entschwundenen Geliebten. Je größer die Sehnsucht, desto stärker der Schmerz. Die Mongolei ist ihr Gelobtes Land, obwohl ihr rotes Haar eher auf irische Vorfahren schließen lässt und sie noch nie östlich von Berlin gewesen ist.
Ungestüm kauend wird ihr klar, dass sie jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach vermutlich doch produktiv wird, genauso produktiv wie Zlatan vielleicht. Endlich ist sie so weit, eine Stelle anzunehmen. Das soll sie bei dem Bewerbungsgespräch auch sagen: »Stellen Sie mich ein. Ich bin so weit. Ich stehe bereit.«
»Du schmatzt«, sagt die Bekannte. »Lillian, du schmatzt!«
Vor zwei Wochen hat Lillian ihren Vater beerdigt. Eine heimtückische Krankheit, es war blitzschnell gegangen. Auf der Trauerfeier hat ein Kollege von ihm gesprochen, Lillian hat ein Gedicht aufgesagt und einige Erinnerungen an ihn hervorgeholt. Erst an eine Radtour, dann an die Schule, wo er unterrichtete, und zuletzt eine an einen innigen Moment vor einem Zelt irgendwo in Frankreich in einer brütend heißen Nacht, in der ihr Vater wie üblich anderthalb Flaschen Rotwein geköpft und ausführlich über seine im ersten Ansatz geknickte wissenschaftliche Karriere philosophiert hatte. Ihre Mutter wollte nichts sagen. Die Leute fanden, Lillian habe schön gesprochen. Sie habe ihn gut getroffen, auch wenn sie dem einen oder anderen zufolge bestimmte Dinge ruhig hätte weglassen können. Ein ehemaliger Schüler von ihm hatte ein Lied gesungen.
Lillians Vater war ein leidenschaftlicher Biologielehrer gewesen, der sich jedes Jahr neue Prüfungsaufgaben ausdachte, während Kollegen einfach die vom letzten oder vorletzten Jahr kopierten. Nach der Beerdigung hatte man im kleinen Kreis – die verbliebene Familie, ein paar Verwandte, drei gute Freunde und zwei ehemalige Schüler – Pfannkuchen gegessen. Im Pfannkuchenrestaurant hatte sie beschlossen, sich den Namen ihres Vaters tätowieren zu lassen, aber sie wusste noch nicht richtig, wohin. Vielleicht auf den Po, da war noch Platz. Sie hatte mal mit einer Waise gesprochen, die sich die Namen ihrer Eltern auf den Hintern hatte tätowieren lassen; links den Namen ihres Vaters, rechts den der Mutter. Als Lillian sie fragte: »Warum?«, hatte die Waise geantwortet: »Ich habe sie nie gemocht und sie mich auch nicht.«
Der Regen hat aufgehört, aber es stürmt noch immer. Lillian wirft einen Blick auf die Wolken: ein typisch niederländischer Himmel, die Steppe kommt einfach nicht näher. Einmal war sie drei Wochen in Brüssel – für einen Workshop bei einer Gruppe berühmter Anarchisten zum Thema Konsens und wie man den erreichen kann, aber nach ein paar Tagen hatte sie davon genug, und sie ließ sich das erste Tattoo stechen. Aufs linke Handgelenk. Erst sollte es in kleinen Buchstaben das Wort »Glück« werden, um nie zu vergessen, dass sie glücklich sein musste – mitunter war sie ziemlich zerstreut, ein Umstand, dem sie ihr seltenes Glücksgefühl zuschrieb, sie vergaß es einfach –, aber da fiel ihr ein, dass so ein Tattoo auch kontraproduktiv wirken könnte, und sie entschied sich stattdessen für »Schmerz«, um immer daran zu denken, dass der Schmerz überall lauert. Wie eine Ratte, allzeit bereit, zuzuschnappen, einem ein Stück Fleisch aus dem Körper zu reißen. Dieser Ratte muss man aus dem Weg gehen, doch manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, dann muss man kämpfen. Und gekämpft hat sie. Die Ratte hat sie gebissen, und sie biss zurück, sie haben einander zerfetzt. Im Tätowierstudio wurde es am Ende jedoch nicht das Wort »Schmerz«, sondern ein chinesisches Schriftzeichen, an dessen Bedeutung sie sich nicht mehr erinnern kann. Sie war betrunken. Der Tätowierer hatte eine hypnotisierende Stimme. »Das Wort ›Schmerz‹ hat auf deinem Körper nichts zu suchen«, hatte er gesagt und ihr zu dem Schriftzeichen geraten. Während er mit seinen Nadeln zugange war, hatte er außerdem für sie gesungen.
Drei Weingummi noch, dann ist die Tüte leer. Wieder einmal hat sie nur Weingummi gefrühstückt, der Traum von Zlatan machte das notwendig. Wenn man nachts Zlatan in einem Gemeindezentrum begegnet, kann man sich am Morgen nicht einfach Obst in den Joghurt schnippeln.
Ihre besten Freunde sind virtuelle Existenzen, doch die Frau neben sich kennt sie noch aus der Grundschule. In dieser enttäuschenden, unvollkommenen und in der Regel recht hässlichen Welt, die von manchen die »Wirklichkeit« genannt wird, sind sie Bekannte geblieben.
Während sie ihren Pfannkuchen mit Äpfeln und Speck klein schnitt, hatte eine Tante gefragt: »Und, Lillian, weißt du jetzt endlich, was du vorhast?« Als hätte sie das all die Jahre nicht gewusst. Als asiatische Prinzessin namens Princess Saba, PSaba oder – für Freunde – einfach PS hatte sie unzählige Chatrooms besucht. Auch unter dem Namen P hatte sie firmiert, denn wenn ein Name nur aus einem Buchstaben besteht, können sie einen nicht googeln, und das waren nur einige der Decknamen, die sie benutzte, um ihrer Existenz Form zu geben. Eine asiatische Prinzessin im Internet war etwas Besonderes. In jener besseren Welt war man nicht determiniert, auch nicht in Fragen des Geschlechts; wenn man wollte, konnte man sich jeden Tag neu erfinden und verschiedene, sogar einander widersprechende Identitäten annehmen. Natürlich bestand die Gefahr, dass man Spuren hinterließ, doch wer ein bisschen geschickt war, konnte die Spurensucher in die Irre führen oder das Hinterlassen von Spuren vermeiden. Für diejenigen, die wirklich wollten, war die Vergangenheit Schall und Rauch.
Als Kind hatte Lillian sich lange für einen Jungen gehalten, bis sie das Licht sah und entdeckte, dass sie eine asiatische Prinzessin war, eine Prinzessin in einem ziemlich durchschnittlichen und lächerlich bleichen Mädchenkörper. Das war mit dreizehn, am 19. Juni 2003, um genau zu sein, am Hauptbahnhof von Den Haag. Mehr will sie darüber nicht verraten. Höchstens, dass sie tatsächlich Licht sah, dass ihr schwindlig wurde und jemand sie fragte: »Alles in Ordnung, Kleine? Möchtest du dich einen Moment hinsetzen?«
Am liebsten sitzt die asiatische Prinzessin an ihrem Laptop.
Dies sind die fünf Studien, die Lillian begonnen hat: Technische Informatik, Kommunikationswissenschaft, Veterinärmedizin, Psychologie sowie Luft- und Raumfahrttechnik. Irgendwann zwischen Kommunikationswissenschaft und Tiermedizin begann sie, fast nur noch online zu leben, und Luft- und Raumfahrttechnik fing sie eigentlich nur darum an, weil sie die erste asiatische Prinzessin im Weltall sein wollte, doch nach ein paar Wochen hatte sie eingesehen, dass dies für ihr Vorhaben nicht das richtige Studium war.
Im Pfannkuchenrestaurant war eine nervöse Stille eingetreten. Offenbar fragten sich noch mehr Anwesende, was Lillian jetzt vorhatte, es schien nach dem Tod ihres Vaters für alle die drängendste Frage. Sie musterte das Schriftzeichen auf ihrem Handgelenk. Die Leute brachten sie durcheinander; ihre Fragen, die Blicke, die Pausen beim Sprechen, ihre Körperlichkeit. Vor allem die. Konnte man keine Menschen ohne Körper erfinden? Das wäre für alle das Beste. Wie groß war der Anteil der Weltbevölkerung, dessen Körper den allgemein akzeptierten Maßstäben genügte? Und selbst wenn jemand eine gewisse Zufriedenheit mit seinem Körper aufbringen konnte und auf Ehre und Gewissen erklärte: »Das mir zugewiesene Exemplar genügt mir vollkommen«, wie lange hielt diese Zufriedenheit vor? Bevor man sie richtig genießen konnte, begann der Verfall. Die Geschichte des Menschen ließ sich in einem Ausdruck zusammenfassen: ein Versuch, dem eigenen Körper zu entfliehen. Wurde es nicht langsam Zeit, die einzig richtige Schlussfolgerung zu ziehen und Menschen zu schaffen, die sich nicht mehr mit einem Körper abplagen mussten? Wer den Menschen als Ideal ernst nahm, musste das Fleisch unbedingt ablehnen.
Alle starrten sie an, bis auf ihre Mutter, die ihren Pfannkuchen studierte wie eine Archäologin eine Tonscherbe, die sie soeben ausgegraben hat. Sie waren die einzigen Gäste im Restaurant.
»Ich werde arbeiten«, sagte Lillian schließlich, »eine Bewerbung hab ich schon geschrieben.« Sie hatte einen Auftrag bekommen, endlich kannte sie ihre Aufgabe. Sie war eine Frau mit einer Mission.
Aus einigen Mündern war erleichtertes Stöhnen gekommen, als erlebten Verwandte und Freunde ihres Vaters bei dieser Nachricht einen kleinen Orgasmus, und ein Onkel hatte geseufzt: »Schade, dass ich das nicht mehr erleben werde.« Danach hatte jeder seinen Pfannkuchen weitergegessen. In einer Ecke des Raums hatte sie die Ratte sitzen sehen, doch die hatte sie geschickt ignoriert.
Rules of the internet: #37
You cannot divide by zero (just because the calculator says so)
Wenn die Gesellschaft ein Klub war, wollte Lillian jetzt doch gern dazugehören. Jahrelang hatte die Gesellschaft signalisiert, dass sie Lillian nicht wollte, und irgendwann kam die zu dem Schluss: Ich will die Gesellschaft auch nicht. Doch jetzt war sie dabei, sich zu ändern, sie konnte die Transformation förmlich spüren, sie fühlte sich wie eine Schlange, die mit erstaunlicher Leichtigkeit die alte Haut abstreift.
Banri Watanuki, ein guter Freund, vielleicht ihr bester, hatte ihr auf die Sprünge geholfen: »Bei BClever suchen sie eine Sekretärin. Deine Mission beginnt.« Später hatte er noch hinzugefügt: »Enttäusche mich nicht.«
Zwei jungenhafte Männer sitzen ihr gegenüber und schauen sie amüsiert und doch prüfend an. Hatten sie eine andere Art Bewerber erwartet? Sie hatte nicht damit gerechnet, dass gleich zwei Männer sie ausfragen würden.
Den Blick des einen Mannes, wie er sie anstarrt, die Fragen, die er meist selbst beantworten könnte, wenn er sich ihren Lebenslauf etwas gründlicher durchgelesen hätte, all das hat sie im Auto schon vor sich gesehen. Sie wusste so ziemlich, was kommen würde, obwohl sie wenig Erfahrung mit Bewerbungsgesprächen hat. Wer will, kann in die Zukunft sehen, die meisten Leute haben dazu aber keine Lust.
Lillian trägt eine Jeansjacke. Sonst zieht sie die nur an, wenn sie ein Date hat, recht selten also. Ein Bewerbungsgespräch ist natürlich auch eine Art Date. Unter der Jeansjacke trägt sie eine weiße Bluse und dazu eine schwarze Hose, die ziemlich neu ist.
Sie wird Banri Watanuki nicht enttäuschen, sie hat sich gekleidet, wie eine vierundzwanzigjährige Frau, die sich auf eine wenig spektakuläre Stelle bewirbt, das ihrer Meinung nach tut. Doch Arbeit ist Arbeit. Und Arbeit ist Leben, Arbeit ist Sinngebung, Arbeit ist Identität, Arbeit ist Glück, Arbeit ist Sex, und Arbeit ist Freundschaft, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, kurzum: Arbeit ist Gott; auch wer sich um eine wenig aufregende Stelle bewirbt, unternimmt also einen Versuch, sich in das System Leben zu hacken – sie wird sagen, was man von ihr erwartet, wird alles Abweichende an sich verstecken, denn das Abweichende ist oft schockierend und bedrohlich für die anderen Mitglieder der menschlichen Gesellschaft.
Lillian stellt sich vor, wie die Männer ihr gegenüber sich morgens rasieren. Wie wohl ihr Bad aussieht? Haben sie einen Badvorleger? Haben sie eine Frau oder Freundin, die eines Abends mit so einem Ding heimgekommen ist und gerufen hat: »Schatz, schau mal, was ich gekauft habe!«?
Lillians Fantasien über die Menschen sind im Grunde nichts als Vermutungen. Ihr Vater hat einmal gesagt: »Eine Erkenntnis ist eine Vermutung, die noch nicht falsifiziert wurde. Sich an Erkenntnisse zu klammern ist auch eine Art Glaube.« Ihr Vater konnte Badvorleger übrigens nicht leiden, er behauptete, nichts sei besser, als nach dem Duschen kalten Boden unter den Füßen zu spüren. Er war überzeugter Kaltduscher.
Sie muss sich konzentrieren, darf sich von ihren Gedanken nicht verführen lassen, muss sich weiter auf diese Männer fokussieren, die auch ihre verführerischen Seiten haben, Sommersprossen und Flecken zum Beispiel. Vielleicht sind es eher Kerle als Männer, auf jeden Fall keine feinen Herren. Den einen würde sie als »Typen« bezeichnen. Ob sie sich ihre Flecken und Sommersprossen ab und zu mal genau ansehen? Vor allem im Gesicht des Typen zählt sie massenhaft Sommersprossen. Als Kind hat sie einmal versucht, ihre eigenen Sommersprossen zu zählen, bis sie davon nicht mehr schlafen konnte, aus Angst, einen Fehler gemacht zu haben. Beim Zählen war ihr zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass sie eine Berufene sein könnte.
Der Mensch mochte ein work in progress sein, viele jedoch begingen Arbeitsverweigerung. Obwohl strikt atheistisch erzogen, hatte sie als Kind immer Nonne werden wollen; Nonnen verweigerten sich in der Regel auf diesem Gebiet nicht. Sie wollte keinen gewöhnlichen Typ als Geliebten, sie wollte Gott. Danach traten die Transsibirische Eisenbahn und die Mongolei in ihr Leben.
Wirklich ruhig wurde sie nur vom Kopfrechnen. Alle Zahlen waren mit Farben verbunden, hinter den Zahlen verbargen sich Welten, von denen ihre Schulfreundinnen offensichtlich nichts ahnten. Es dauerte Jahre, bis sie erkannte, dass es auch Leute gibt, die Zahlen nicht mit Farben assoziieren. »Stell mir eine Rechenaufgabe«, sagte sie abends beim Essen zu ihrem Vater, »schnell, ich brauche eine Aufgabe.« – »Aber du musst auch mit uns reden«, sagte ihr Vater zu ihr, »du kannst nicht den ganzen Tag immer nur kopfrechnen.« Von dem Tag an begann ihr Vater sie zu stören, wie einen ein tropfender Wasserhahn stört. Dabei: Wenn sie kopfrechnete, sprach sie, wenn sie um eine Rechenaufgabe flehte, kommunizierte sie doch! Auch liebte sie es, Seifenblasen zu machen, mindestens einmal im Monat kaufte sie ein paar Fläschchen Lauge und spielte damit auf ihrem Zimmer, das beruhigte sie ebenfalls. Manchmal hatte ihre Mutter gefragt: »Bist du dafür nicht zu alt?« Dann starrte Lillian durch sie hindurch, als wäre sie Luft. Manchmal flüsterte sie »Trulla«, aber so, dass man es nicht hörte. Mit fünfzehn hatte sie von ihrem Vater das Rennrad bekommen.
»Was interessiert dich an BClever?«, fragt der Mann mit den Sommersprossen. »Warum möchtest du hier arbeiten?«
Sie zuckt mit den Schultern und spielt mit einem Ring, den sie sich mal im Urlaub gekauft hat, dem letzten, den sie zusammen mit ihren Eltern verbrachte. Immer waren es Radurlaube. Das Leben ihres Vaters, dieses tropfenden Wasserhahns, der jetzt nicht mehr tropft, bestand aus Biologie, Radurlauben, Rotwein und Kaltduschen.
»Ihr macht etwas, das auch mich seit Langem beschäftigt. Ihr verteidigt Systeme, ihr schützt Netzwerke.«
Der Mann mit den Sommersprossen sieht sie aufmunternd an. Ist es das, was er hören will?
»Ich habe die Schwachstellen in Netzwerken gesucht. Um Leuten zu helfen natürlich. Ich bin ein white hat. Ich finde es gut, was ihr hier macht, ich finde es auch spannend. Ich möchte dazugehören.«
Der Mann mit den Sommersprossen muss lachen. Sie weiß, warum: Sie sieht nicht aus wie jemand, der Schwachstellen in Netzwerken findet, sie wirkt eher selbst wie eine: mädchenhaft, sie wird jünger geschätzt, als sie ist. Lillian hat etwas Unschuldiges.
Für Computer begann sie sich zu interessieren, als sie las, dass deren Sprache aus Nullen und Einsen besteht. Die Null war genau genommen keine Zahl, sehr wohl aber eine essenzielle Bedingung für alle anderen. Die Null faszinierte sie. Als sie in der Schule mit Bruchrechnung anfingen, hatte die Lehrerin gesagt: »Wir haben eine Torte, und die wollen wir teilen.« Was aber war »keine Torte«? Es gab eine Torte, aber die war aufgegessen, das war keine Torte, das war die Null. Oder: Wir können uns vorstellen, dass hier eine Torte ist, aber sie ist nicht da, die Torte hat uns reingelegt. Auch das ist null. Oder: Wir warten auf die Torte, aber sie ist noch nicht geliefert worden – ebenfalls null. Ihr schien überzeugend, dass die Welt aus Nullen und Einsen besteht. Der Rest war Lametta, bunter Flitter drum rum, eine Weigerung, die Gesetze der Logik anzuerkennen, eine Flucht nach vorn. Sprache war Fiktion, die Wirklichkeit beruhte auf Zahlen.
Vor langer Zeit – so kommt ihr es jetzt vor, kurz nach dem Abitur – auf dem Gymnasium hatten sie immer gesagt: »Sie kann viel, aber sie will wenig«, und so hatte sie auch ihre Prüfungen bestanden, indem sie viel konnte und wenig wollte, das heißt: Natürlich wollte sie etwas, nur etwas anderes – vor langer Zeit also hatte sie ihr erstes Bewerbungsgespräch: für eine Stelle als Sekretärin in einem juristischen Beratungsbüro. Ein älterer Herr mit einem diskreten Ordensbändchen auf dem Revers hatte von »durchgreifen« gesprochen. Als er das Wort zum dritten Mal benutzte, sah sie ihn plötzlich vor sich, wie er von einem Bagger überrollt wurde. Wenn Bilder die Hölle sind, ist Kopfrechnen das Paradies. Sie hatte die Stelle nicht bekommen.
Lillian ist normal, und dieser Gedanke macht ihr keine Angst mehr. »Es ist nichts Besonderes an mir, ich bin wie alle, stinknormal«, hat sie morgens im Bad zu sich gesagt. Wie andere merken, dass die schwul sind oder lesbisch, so hat sie gemerkt, dass sie normal ist. Lange fragte sie sich, ob sie es wirklich ist oder nur so tut, doch zuletzt kam die Erkenntnis: Sie ist es tatsächlich, jedenfalls hat sie großes Talent dazu.
»Eines Tages lernst du, dich ins Unvermeidliche zu schicken, und dieses Dreinschicken heißt Realitätssinn«, hat die Bekannte, die sie hierhergefahren hat, schon öfter gesagt. Immer wieder hat sie betont, wie gut es ist, dass Lillian diesen Schritt tut, immer wieder das Wort »Realitätssinn«, als habe sie Angst, Lillian könnte plötzlich erwidern: »Ich lass das Bewerbungsgespräch sausen, fahr mich wieder nach Hause.«
Lillian ist daheim wohnen geblieben, bis auf die drei Wochen Brüssel. Seit ihrer Rückkehr lebte sie in Chatrooms, auf Imageboards, in den Systemen anderer Leute, ihr war egal, wo ihr vorübergehender Körper biwakierte. Ihre Mutter hat einmal gefragt: »Wird es nicht langsam Zeit, dass du aus dem Haus gehst?« Und ihr Vater hatte hinzugefügt: »Wir werden Kostgeld verlangen.« Das Kostgeld hatte nichts genutzt, Vater und Mutter hatten es auch nie eingetrieben. Mit vierundzwanzig wohnte sie noch immer im Kinderzimmer bei ihren Eltern, denen es insgeheim vielleicht ganz gut gefiel, dass ihr einziges Kind noch bei ihnen blieb. Leben war ein endloser Versuch, die Jugend in die Länge zu ziehen.
Eine Weile hatte sie als Kellnerin in einem thailändischen Restaurant in Den Haag gearbeitet. Ein Cousin ihres Vaters war mit einer Thailänderin verheiratet, deren Schwester das Restaurant betrieb. Dort bekam sie die Stelle, und das Kellnern machte ihr sogar ziemlichen Spaß, sie beobachtete die Leute beim Essen wie ihr Vater seine geliebten Ameisen – Ameisen waren sein Hobby, alles andere war Arbeit –, bis sie merkte, dass ihre Eltern den Besitzern Geld dafür gaben, dass sie sie in ihrem Restaurant beschäftigten. Was wie Arbeit aussah, war in Wirklichkeit Beschäftigungstherapie, und vom einen Tag auf den anderen warf sie den Job hin. »Hört auf, mich zu manipulieren«, sagte sie zu ihren Eltern, »so ein Social Engineering kriegt ihr doch nicht hin.« Ihre Eltern lebten in Blasen, ihr Vater in seiner halbwissenschaftlichen aus Biologie auf Mittel- und Oberstufenniveau, ihre Mutter in der namens »Anderen helfen«. Die Mutter war Sozialarbeiterin. Die meisten ihrer Klienten waren Junkies, und ein paar verwirrte und traumatisierte Alte hatte sie auch noch. Ihre Eltern sahen die Wirklichkeit nicht, sie sahen nichts. Was sie sahen, war null, eine Torte, die bestellt, doch aus unerfindlichen Gründen nie geliefert worden war. Was sie sah an dem Tag, als sie zu ihren Eltern sagte, sie sollten das mit dem Social Engineering lassen, tat weh: zwei hart arbeitende, sogar ziemlich intelligente Leute, die von ihrer einzigen Tochter entlarvt wurden.
Mitleid jedoch konnte sie sich nicht leisten; wer den Menschen verbessern will, kann kein Mitleid gebrauchen, denn das Mitleid sagt: »So seid ihr nun mal, da lässt sich nichts ändern.« Das Mitleid sagt: »An euch lässt sich nichts optimieren.« Mitleid ist ein anderes Wort für Aufgeben, Defätismus; wo das Mitleid beginnt, beginnt die Kapitulation.
An dem Tag, als ihr Vater ins Krankenhaus kam, schrieb Lillian ihre Bewerbung an BClever. Das Credo der Firma lautete: »Your Security Is Our Business.« Sie hatte nur einen Teil ihrer Fähigkeiten genannt. Die anderen könnten gegen sie verwandt werden. Mit siebzehn war sie einmal festgenommen worden, aber es war zu keiner Verurteilung gekommen. Auf Twitter hatte sie damit gedroht, ihre Schule in die Luft zu sprengen. Sie war neugierig gewesen, ob man ihre Tweets ernst nähme, wann die Polizei einschreiten würde. Danach wurde sie vorsichtiger. Ihren Twitter-Account hatte sie gelöscht. »Mit dieser Sache kannst du Probleme bekommen, wenn du später mal einen Job suchst«, hatte der Polizeibeamte gesagt. Lillian ging in den Untergrund.
»Es ist wirklich ein reiner Sekretärinnenposten«, erklärt der Mann mit den Sommersprossen, »es hat nichts mit Netzwerken zu tun, mit Programmieren oder Nach-Schwachstellen-Suchen, möglicherweise wird es dich enttäuschen, vielleicht sogar langweilen. Denk darüber nach.«
»Kein Problem«, erwidert sie, »ich habe gesehen, was ihr macht, und ich weiß, wie ihr angefangen habt: Ihr wart ganz gewöhnliche Hacker. Das finde ich cool, ich find BClever eine coole Firma.«
Das Lächeln auf den Gesichtern der Herren wird breit. Das hören sie gern, vor allem aus ihrem Mund. Die asiatische Prinzessin findet ihr Unternehmen cool. Wenn sie heute Abend nach Hause fahren, mit dem Hund Gassi gehen und über ihren Tag nachdenken, können sie zufrieden sein. Sie haben Millionen an Risikokapital eingenommen, bei fast allen Staatsinstitutionen sorgen sie für die IT-Sicherheit, aber noch nie haben sie von einer asiatischen Prinzessin zu hören bekommen, sie seien eine coole Firma. Irgendwo tief im Inneren denken sie bestimmt: Dafür tun wir es.
Sie hätte gern freundlichere Gedanken, bessere, Gedanken, von denen man sagt »Ja, so soll Denken sein«. Die schrecklichsten Gedanken sind die verführerischsten. Immer wieder denkt sie, gegen ihren Willen, dass die Menschen bestraft werden müssen. Wenn der Mensch die Abweichung vom Ideal ist, kommt man mit Liebe nicht weiter, dann müssen Sanktionen erfolgen. Das verbotene Denken fasziniert sie.
»Und Hobbys?«, fragt der Mann mit den Sommersprossen. »Hast du auch Hobbys?«
»Hobbys«, antwortet sie, »ich mag Anime – japanische Animationsfilme. Manga. Chihiros Reise ins Zauberland habe ich mindestens fünfzig Mal gesehen.«
Ob Chihiros Reise den Männern etwas sagt? Sie schauen sie lächelnd an, doch jetzt auch ein bisschen dumpf. Dann sagt der Kerl ohne Sommersprossen, dafür aber mit ein paar mächtigen Muttermalen, der bisher noch so gut wie gar nichts gesagt hat: »Wir wollen nicht zu groß werden, wir wollen jeden Mitarbeiter persönlich kennen. Wir wollen die Besten sein, nicht die Größten.«
»Das gefällt mir«, erwidert Lillian.
Er nickt, als habe er gewusst, dass ihr das gefallen würde. »Auch für diese Stelle müssen wir natürlich einen Background-Check durchführen«, fährt er fort.
»Was bedeutet das eigentlich?«, fragte der Mann mit den Sommersprossen. »Was du da hast?« Er zeigt auf ihr Handgelenk.
Dass man ein chinesisches Schriftzeichen auf dem Körper trägt, dessen Bedeutung man nicht einmal kennt, macht einen schlechten Eindruck, darum sagt sie schnell: »Hoffnung.«
Die Männer nicken. Eine asiatische Prinzessin hat Hoffnung und bringt welche, doch Hoffnung allein ist für die Männer offenbar nicht genug. »Warum bist du nicht auf LinkedIn oder auf Facebook?«, will der Mann ohne Sommersprossen wissen.
Alberne Frage, denkt Lillian. Sie antwortet: »Keine Zeit.«
Rules of the internet: #31
Tits or gtfo, the choice is yours
Axel ruft sie persönlich an, um ihr zu sagen, dass sie es geworden ist. Sie vermutet, er ist der Mann mit den Sommersprossen. »Wir sind eine unkonventionelle Firma und stellen gern unkonventionelle Menschen ein«, erklärt er. Sie hört ein Echo, als liege er in der Wanne oder befinde sich sonst wie in einem gekachelten Raum. Vielleicht ruft er die weniger wichtigen Bewerber zwecks Zeitersparnis von der Toilette aus an.