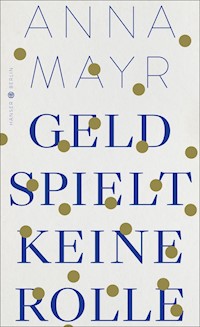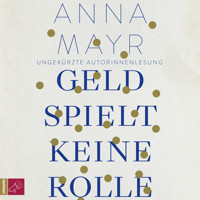Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Anna Mayr war noch ein Kind und schon arbeitslos. Sie ließ die Armut hinter sich, doch den meisten gelingt das nicht – und das ist so gewollt. Dieses Buch zeigt, warum.
Faul. Ungebildet. Desinteressiert. Selber schuld. Als Kind von zwei Langzeitarbeitslosen weiß Anna Mayr, wie falsch solche Vorurteile sind – was sie nicht davor schützte, dass ein Leben auf Hartz IV ein Leben mit Geldsorgen ist und dem Gefühl, nicht dazuzugehören. Früher schämte sie sich, dass ihre Eltern keine Jobs haben. Heute weiß sie, dass unsere Gesellschaft Menschen wie sie braucht: als drohendes Bild des Elends, damit alle anderen wissen, dass sie das Richtige tun, nämlich arbeiten. In ihrem kämpferischen, thesenstarken Buch zeigt Mayr, warum wir die Geschichte der Arbeit neu denken müssen: als Geschichte der Arbeitslosigkeit. Und wie eine Welt aussehen könnte, in der wir Die Elenden nicht mehr brauchen, um unseren Leben Sinn zu geben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Anna Mayr war noch ein Kind und schon arbeitslos. Sie ließ die Armut hinter sich, doch den meisten gelingt das nicht — und das ist so gewollt. Dieses Buch zeigt, warum.Faul. Ungebildet. Desinteressiert. Selber schuld. Als Kind von zwei Langzeitarbeitslosen weiß Anna Mayr, wie falsch solche Vorurteile sind — was sie nicht davor schützte, dass ein Leben auf Hartz IV ein Leben mit Geldsorgen ist und dem Gefühl, nicht dazuzugehören. Früher schämte sie sich, dass ihre Eltern keine Jobs haben. Heute weiß sie, dass unsere Gesellschaft Menschen wie sie braucht: als drohendes Bild des Elends, damit alle anderen wissen, dass sie das Richtige tun, nämlich arbeiten. In ihrem kämpferischen, thesenstarken Buch zeigt Mayr, warum wir die Geschichte der Arbeit neu denken müssen: als Geschichte der Arbeitslosigkeit. Und wie eine Welt aussehen könnte, in der wir die Elenden nicht mehr brauchen, um unseren Leben Sinn zu geben.
Anna Mayr
Die Elenden
Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht
Hanser Berlin
Inhalt
Nehmen wir einmal an …
Das Ändern der Realität
Work work work work work work
In der Welt zumeist fremd
Keine echte Güte
Man kann niemals jemand anderes gewesen sein
»Wir nehmen zurzeit vielen Menschen sehr viel Geld weg.«
Aus Zweifel Wut, aus Wut Visionen
Dank
Nachweise und Anmerkungen
Meiner Familie
Nehmen wir einmal an …
… Sie sind ein Mensch ohne nennenswertes Vermögen. Sie haben also nicht genug Geld, um davon leben zu können, dass es sich von selbst immer weiter vermehrt. Sie besitzen auch keine Güter, die Sie im allerschlimmsten Fall verkaufen könnten. Sie haben irgendeinen Beruf gelernt, und nun verdienen Sie Geld mit diesem Beruf, es ist nicht viel, der Median des Nettoeinkommens lag 2010 in Deutschland bei knapp 1300 Euro — aber Sie fahren einmal im Jahr in den Urlaub. Sie besitzen vielleicht ein Haustier, das Sie gernhaben. Dann werden Sie krank, liegen ewig im Krankenhaus. Ihr Chef bittet Sie, zu kündigen, Sie haben sich immer gut mit ihm verstanden, er verspricht Ihnen, Sie könnten zurückkommen, wenn es Ihnen besser geht. Oder Ihre Eltern werden krank und Sie kümmern sich. Oder Sie bekommen versehentlich ein Kind, das Sie sehr gernhaben und deshalb nicht acht Stunden am Tag alleine herumliegen lassen können. Oder Sie verlieben sich in jemanden, und er verarscht Sie, und am Ende besitzt er Ihr Auto und Sie nur den Fötus, den er Ihnen eingepflanzt hat. Oder Ihre Frau verlässt Sie, und Sie werden depressiv, und die Frau nimmt die Freunde mit und die Kinder, und da ist niemand, der käme, um Sie zu umarmen. Oder eine globale Pandemie grassiert und Ihre Firma muss ein paar Leute rauswerfen, um das Geld einzusparen, das durch den Stillstand verloren geht. Abends trinken Sie. Aber da es keinen Unterschied zwischen Tag und Abend gibt, wenn man gelangweilt ist und allein, trinken Sie bald manchmal auch nachmittags. Zehn Prozent aller Hartz-IV-Empfänger, das hat eine Studie mit Versicherten der AOK ergeben, sind suchtkrank — und das sind nur die, bei denen die Krankenkasse darüber Bescheid weiß.
Am Anfang geht es Ihnen mit der Arbeitslosigkeit noch recht gut. Sie bekommen vielleicht Arbeitslosengeld I, also für ein Jahr 60 Prozent Ihres Nettogehalts. 67 Prozent, falls Sie Kinder haben. Maximal aber 2000 Euro in Westdeutschland, in Ostdeutschland nur knapp 1900. Sie machen sich auf die Suche nach einem neuen Job und trinken abends mit Freunden in den Bars, in denen Sie immer schon getrunken haben. Sie erzählen den Freunden, wie deprimierend die Jobsuche ist, und wenn die Freunde von der Arbeit reden, dann erzählen Sie eben Geschichten von früher.
Einen neuen Job finden Sie nicht. Am Anfang, weil Sie noch wählerisch sind. Am Ende dann, weil die Leute, die die Jobs vergeben, sich fragen, wieso Sie so lange keinen neuen Job gefunden haben. Oder weil es gerade einfach keine Jobs gibt, das kommt vor. Vielleicht können Sie auch nicht aus Ihrer Stadt weg, weil Sie dort ein Kind haben oder ein Tier oder eine Oma, die Sie pflegen. Das Arbeitsamt hält Beschäftigungen für zumutbar, wenn die täglichen Pendelzeiten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz unter zweieinhalb Stunden liegen. Vielleicht gibt es den Beruf auch gar nicht mehr, den Sie gelernt haben. Ohnehin müssen Sie sich langsam von dem Gedanken verabschieden, dass Sie einem Berufsstand angehören. Vom siebten Monat der Arbeitslosigkeit an ist Ihnen jede, wirklich jede Beschäftigung »zumutbar«, deren Lohn höher ist als das Arbeitslosengeld.
Sie haben zufällig keine Partnerin, die genug Geld besitzt, um Sie mitzuversorgen. Falls Sie doch eine hatten, dann vielleicht jetzt nicht mehr, weil sie Ihre Lethargie nicht mehr ertragen konnte. Arbeitslosigkeit führt zu einem höheren Trennungsrisiko, vor allem wenn es der Mann ist, der arbeitslos wird.1 Am Abend der Trennung kommen Freunde zu Ihnen nach Hause. Die Freunde sagen, dass alles wieder gut wird. Sie nicken. Mal schauen, wie lange die Freunde noch kommen. Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, fühlen sich häufiger sozial isoliert und unglücklich.2
Nach etwa anderthalb Jahren müssen Sie aus Ihrer Wohnung ausziehen. Zu groß für Hartz IV. Die angemessene Brutto-Kaltmiete für eine Person beträgt 364,50 Euro, die angemessene Quadratmeterzahl ist 50. Vielleicht haben Sie noch eine Familie, dann gibt es für vier Personen 85 Quadratmeter, Kaltmiete 587 Euro. Sie ziehen also um.
Ach, und Ihr Sparkonto — davon haben Sie hoffentlich bereits Anschaffungen gemacht, denn mehr als 150 Euro pro Lebensjahr dürfen Sie nicht besitzen, und mehr als 10.000 Euro sowieso nicht; nehmen wir mal an, Sie sind 35 Jahre alt — dann dürfen Sie 5250 Euro auf dem Konto liegen lassen. Aber Sie werden es eh bald aufbrauchen.
Nach etwa zwei Jahren werden Sie nicht mehr eingeladen, wenn Ihre Freunde sich treffen. Ihr Leid ist zu bedrückend für alle, die sich über den Stress am Fließband oder im Büro beschweren wollen. Sie werden auch langsam komisch, verschlossen, ein wenig verschroben — weil Sie ja im Alltag kaum noch mit jemandem reden. In Ihrem Regelsatz sind übrigens exakt 10,76 Euro für »Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen« vorgesehen. 37,84 Euro für Bekleidung und Schuhe.
Nach etwa drei Jahren Arbeitslosigkeit sieht man Ihnen deutlich an, wo Sie wohnen, wie Sie wohnen und dass Ihnen nichts mehr einfällt.
Ihr Tier wird krank. Es ächzt, es röchelt, Sie setzen es in eine Box, bringen es zum Tierarzt und bitten ihn, dem Tier zu helfen. Der Tierarzt sieht Ihre Kleidung, er sieht die klapprige Box, und er könnte vielleicht helfen, aber er will Sie nicht vor die Wahl stellen, ob Sie diesen Monat essen oder ob das Tier leben soll, deshalb sagt er, dass er nichts tun kann. Sie sind jetzt noch ein bisschen einsamer, als Sie es vorher waren.
Nach etwa sieben Jahren ist jedes Gerät, das ein menschenwürdiges Leben in diesem Land ausmacht, einmal kaputtgegangen: die Waschmaschine zuerst. Sie haben sich eine neue kaufen müssen, jetzt haben Sie Schulden. Vielleicht hat Ihnen jemand mit ein wenig Geld ausgeholfen? Wenn Sie noch Freunde haben. Dann die Spülmaschine, auch so eine Sache, man kann ohne leben, es kostet nur Zeit. Früher, als das ALG II noch »Sozialhilfe« hieß, erstattete der Staat die Kosten für warme Kleidung im Winter und für andere große, notwendige Anschaffungen. Das wurde 2004 mit den Gesetzen für »Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« abgeschafft.
Die Kinder, die Sie vielleicht haben, bekommen immer häufiger Kopfschmerzen. Kann am Wetter liegen, sagt der Arzt, oder psychisch bedingt sein. Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Status leiden in Europa doppelt so häufig an psychischen Störungen wie andere Kinder.3 Wenn sie nachmittags aus der Schule kommen, geben Sie ihnen etwas zu essen, und dann ist den Kindern langweilig. Aber Sie können ihnen keine Fußballschuhe kaufen und keine Ballettkleidchen, also schalten Sie den Fernseher ein, damit sie endlich Ruhe geben, denn Sie müssen verdammt noch mal das Geschirr spülen. Heute sind Sie noch nicht dazu gekommen — Ihr Wasserkocher ist kaputtgegangen und Sie haben den Vormittag in Geschäften verbracht und Preise verglichen. Von 15 Euro kann man einen Wasserkocher und ein Paar Schuhe kaufen. Man braucht nur viel Zeit dafür. Die Krankenkasse zahlt Ihren Kindern die Medikamente gegen ADHS und Ihnen die Medikamente gegen die Depressionen. Vier von zehn Hartz-IV-Empfängern, das ergab ebenfalls eine Studie der AOK4, sind psychisch krank. Bei Langzeitarbeitslosen, so geht es aus Zahlen der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hervor, sind es 70 Prozent.
Die Kinder bekommen nachmittags in der Schule von einer Studentin Nachhilfeunterricht. In ihrer WG sagt sie zu ihren Mitbewohnerinnen: »Wie schade, dass die Eltern ihre Kinder so vernachlässigen. Die arbeiten doch gar nicht, die hätten doch Zeit.« Sie schicken die Kinder auf den Spielplatz in der Nachbarschaft. Aber die Kinder sind müde vom Ritalin, und als sie zurück nach Hause kommen, hat eins eine Schramme im Gesicht — weil ein anderes Kind zugeschlagen hat, dem genauso langweilig war. Im Fernsehen läuft die Bundestagswahl, Sie schalten um, damit die Kinder still sind. Während die Kinder fernsehen, suchen Sie Formulare zusammen und Unterlagen, um weiter Geld zu bekommen: Ihre eigenen Kontoauszüge, die Kontoauszüge der Kinder. Bewerbungen, von denen Sie schon vorher wussten, dass sie zwecklos sein würden. Schulbescheinigungen. Noch gehen die Kinder zur Schule.
Vielleicht haben Sie auch keine Kinder. Herzlichen Glückwunsch, hoffentlich haben Sie es geschafft, ohne Kinder und ohne Arbeit noch irgendetwas Schönes in Ihrem Leben zu finden. Sonst haben Sie sich vielleicht schon umgebracht. Jeder fünfte Suizid weltweit steht in Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit.
Sie verpassen einen Termin beim Jobcenter. Ihnen werden zehn Prozent Ihres Hartz-IV-Satzes gestrichen. Sie lehnen einen Job ab, weil Sie inzwischen Angst haben, vor die Tür zu gehen. Jetzt bekommen Sie noch mal 30 Prozent weniger Geld. Bis zu 60 Prozent der Leistung konnte man Hartz-IV-Empfängern bis vor kurzem streichen, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkamen. Erst 2019, also etwa 15 Jahre nach der Einführung von Hartz IV, entschied das Bundesverfassungsgericht, dass das zu viel ist. Jetzt sind noch maximal 30 Prozent erlaubt, also Kürzungen bis auf 280 von 420 Euro.
Sie stehen jetzt unter andauerndem Stress. Sie wollen überleben, Sie wollen nicht auffallen, Sie wollen niemandem zur Last fallen. Deshalb rauchen Sie, deshalb essen Sie ungesund und deshalb trauen Sie sich nicht, zum Arzt zu gehen. Arme Menschen sterben früher als reiche Menschen, sie haben im Schnitt etwa zehn gesunde Lebensjahre weniger.
Mit denen da draußen haben Sie keine Berührungspunkte mehr. Mit denen, die in Cafés sitzen und an Kulturveranstaltungen teilnehmen. Die Trennung zwischen Zivilisation und Kultur existiert, um das eine als notwendig und das andere als überflüssig darzustellen — damit das Überflüssige denen exklusiv bleibt, die über das Notwendige nicht nachdenken müssen.5 Vielleicht haben Sie mal Brecht gelesen und denken das jetzt, da Sie seit Jahren nicht mehr an einem schönen Ort waren, in einem Museum oder auf einem Konzert. Wahrscheinlich denken Sie das aber nicht. Wahrscheinlich fühlen Sie sich klein und machtlos, und kein gesellschaftlicher Diskurs über Verteilungsgerechtigkeit kann Ihnen da raushelfen. Es geht nicht mehr um Sie da draußen.
Das Ändern der Realität
Warum das Schicksal der Arbeitslosen für alle wichtig ist
Oft kommt die Wut beim Smalltalk: In einer Redaktion saß ich vor ein paar Jahren neben einem Kollegen, der ungefähr so alt war wie ich — Anfang zwanzig. Als wir darüber sprachen, in welchen Gegenden wir aufgewachsen waren, und ich den Namen meines Viertels nannte, sagte er: »Ah, da gibt es ja ganz schön asoziale Gegenden. Ich war mal für ein Uni-Seminar dort. Es ging um Abgehängte. Wir haben an Türen geklingelt und mit Leuten geredet. Wer dir da so aufmacht …« Natürlich ging er davon aus, ich hätte auf der guten Seite des Viertels gewohnt. Auf der Seite mit den Einfamilienhäusern. Nicht auf der Seite mit den Plattenbauten, die für Feldversuche von Soziologiestudenten geeignet ist. Dass er dabei auch meine Eltern betrachtet haben könnte, dass er auch über sie hätte reden können wie über Zootiere, empörte mich. Einerseits, weil ich mich denjenigen, die er für asozial hält, zugehörig fühle: den Menschen, neben denen ich aufgewachsen bin und die in der öffentlichen Wahrnehmung unter einer Schicht aus Vorurteilen existieren, die so dick ist, dass sie zu ersticken drohen und dass kaum jemand ihre Realität darunter sieht. Andererseits, weil ich mich auch ihm, dem Kollegen, zugehörig fühle. Weil wir im gleichen Job arbeiten, an den gleichen Orten zu Mittag essen — und weil ich beanspruche, dass ich dabei normal bin. Doch ich bin es nicht, denn seine Welt ist immer noch nicht ganz meine, wahrscheinlich wird sie es nie sein.
Ich werde oft gefragt, warum meine Eltern arbeitslos sind. Ich finde die Frage frech. Manchmal frage ich zurück: »Warum ist dein Vater Ingenieur?« Lebensgeschichten sind nicht erklär- oder planbar. Wir können sie zwar rückblickend analysieren — und etwa behaupten, dass erst der Kontakt zu Person A in Firma B uns zu unserem aktuellen Job verholfen hat oder dass unser Leben ohne das freiwillige soziale Jahr in Sri Lanka ganz anders verlaufen wäre. Die Sache ist die: Eine »Wahrheit« oder beweisbare Kohärenz wird in diesen Analysen immer fehlen. Jungen Menschen sagt man ja gerne, sie sollten »ihren Weg gehen« und dabei bloß nicht »auf die schiefe Bahn« geraten — aber der Weg ist ja noch nicht da, bis man den ersten Schritt macht. Man muss ihn selbst asphaltieren. Wer Geld hat, der kann sich eine gewisse Planbarkeit erkaufen; sich selbst ein Netz bauen, das ihn auffängt, wenn der eingeschlagene Weg sich doch als löchrige Hängebrücke herausstellt. Wer kein Geld hat, fällt tiefer. Aber die Hindernisse, die in der Zukunft liegen, sind für alle gleichermaßen allerhöchstens verschwommen sichtbar. Und die Bahn, auf die man gerät, könnte schief sein oder großartig. Das weiß man erst, wenn man ankommt.
Wäre es anders, wären Leben also vollständig planbar und individuelle Entscheidungen frei von ökonomischen und gesellschaftlichen Zwängen, könnte man jedem Menschen zu Beginn seines Lebens einen Zettel hinlegen, auf dem er seine Ziele ankreuzen soll: Möchten Sie (a) Hochschullehrer oder (b) Maurerin oder (c) arbeitslos werden? Je nach Auswahl bekäme er dann eine Landkarte in die Hand gedrückt mit Instruktionen dazu, wo es abzubiegen gilt, um die eigenen Wünsche wahr werden zu lassen.
Die Sache ist: Unsere Lebensgeschichten gehören uns nicht allein. Sie finden innerhalb eines Systems statt, das bestimmte individuelle Geschichten braucht, um als Ganzes zu funktionieren. Dazu gehören Geschichten vom erfolgreichen Aufstieg, die alle dazu motivieren, sich anzustrengen. Aber auch Geschichten von Abstieg und schiefer Bahn. Nicht immer geht man in diesem System selbst voran, oft wird man von den Umständen herumgeschubst oder hinterhergezogen. Meistens merkt man das erst, wenn es schon geschehen ist. Denn auch das ist Teil des Systems: dass es uns vormacht, wir würden unsere Entscheidungen selbst treffen.
»Das System« als Sündenbock heranzuziehen hat natürlich immer einen Nachklang von naiv linkem Weltverbessererquatsch. Dabei ist die Einsicht darüber, dass es keine freien Entscheidungen gibt und auch keine eigenen Wege, schlichtweg realistisch. Sobald mehrere Menschen in einer Gesellschaft zusammenleben und miteinander auskommen müssen, nimmt jedes Individuum eine Rolle innerhalb des Gefüges ein, und diese Rollen begrenzen sich gegenseitig.
Mein Vater hat eine Ausbildung zum Tischler gemacht und war danach immer wieder in Firmen beschäftigt, die sich Menschen von Zeitarbeitsfirmen ausliehen. Seine Rolle ist die eines Menschen, dessen Arbeitskraft sich in verschiedenen Hilfsarbeiterrollen möglichst flexibel und gering bezahlt einsetzen lässt. Er ist einer von denen, die von ihrer Arbeit nie leben konnten, weil die Arbeit zu unwichtig war und den Firmen nichts wert. Einer von denen, die niemals gefragt werden, was sie eigentlich denken und können — weil es schon reicht, dass sie für ein paar Monate mit einem Gabelstapler Paletten hin und her fahren. Und sobald es keine Paletten mehr gibt, werden sie nach Hause geschickt und vergessen.
Meine Mutter war früher Punk. Sie rasierte sich eine Glatze, kippte Spülmittel in Brunnen, besetzte Häuser. Sie machte Abi und studierte Philosophie. Sie ist eine der Frauen, mit deren Lebensgeschichten man Mädchen davor warnen kann, zu früh Kinder zu bekommen und zu sehr aus der Reihe zu tanzen. Eine von denen, auf die man seufzend herabblicken kann: Hach, sie hätte so viel vor sich gehabt, und stattdessen hat sie nur Humankapital produziert; mich zum Beispiel. Als ich drei, vier Jahre alt war, hat sie mir zum Einschlafen ihre Seminararbeiten vorgelesen. Später haben wir morgens, bevor ich in die Schule ging, gemeinsam Zeitung gelesen, immer abwechselnd für jeweils ein Jahr die beiden Lokalblätter, die es gab. Sie hat mir das Schreiben beigebracht und später das Geschichtenschreiben. Sie wollte immer eine Tochter wie die Rote Zora: frech, wild und mutig. Ich war die meiste Zeit ein Madita-Mädchen, brav, höflich, still. Einmal habe ich an der Supermarktkasse einen Knicks gemacht — ich glaube, sie hat sich nie wieder so für mich geschämt wie in diesem Moment.
Die gleiche Redaktion, ein anderer Kollege, kurz vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Er machte sich in einem Kommentar über Nichtwähler lustig. Über Menschen, die zwar von Steuergeldern leben, aber nicht an unserer schönen Demokratie teilnehmen. Die politisch ungebildet sind und faul und außerdem dumm.
Ich dachte an meine Eltern, an all ihre Gründe, nicht zu wählen. An das Viertel der Abgehängten mit den Soziologiestudenten, die dort herumlaufen, an das Elend, an meinen Blick aus dem Kinderzimmerfenster, graue Fassaden, dunkelgrüne Autos und Katzen, die in Sandkästen scheißen, an die schreienden Kinder in der Wohnung über uns, an die Langeweile und an das Gefühl, nicht Teil jener Welt zu sein, die da draußen irgendwo ist und in der es Wahlen gibt und eine schöne, heile Demokratie.
Die Wut schrieb ich auf. Schrieb darüber, wie meine Eltern mich zur Antifaschistin erzogen, wie ihnen nichts wichtiger war als Gerechtigkeit. Und dass sie trotzdem nicht zur Wahl gingen, weil es da keine Partei gab, die sie wählen konnten. Ich schrieb darüber, dass ich wie jedes Kind früher gerne die Welt einteilte — in »die Obdachlosen« und »die Jungs« und »die Frauen« und »die Omas mit Pelzmantel« — und dass meine Mutter mir das verbot, weil sie Pauschalisierungen mehr hasst als alles. Nur Nazis hasst sie noch mehr. Da gibt es keine Kompromisse.
Der Text wurde am Tag der Landtagswahlen veröffentlicht, die Überschrift: »Mama wählt nicht«. Ich bekam daraufhin Zuschriften, die mich froh machten: Einerseits von Menschen aus dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, Menschen, die sich abgebildet fühlten. Andererseits von Menschen aus meinem neuen Milieu, die mir schrieben, dass sie beim Lesen etwas verstanden hätten. Ich dachte wirklich, meine Worte könnten gegen die Pauschalisierungen helfen: von Arbeitslosen, von Armen, von Menschen, die nicht wählen. Heute denke ich, dass es ein guter Text war, aber mit einer idiotischen Haltung. Indem ich meine Familie erklärte, unseren Einzelfall, wollte ich ein Vorurteil aufheben. In Wirklichkeit habe ich meine Eltern und mich durch diesen Text kleingemacht. Ich habe mich denen unterworfen, die einen Augenzeugenbericht benötigen, um wirklich glauben zu können, dass Menschen ohne Arbeit keine Idioten sind. Die Leute, die sich eine Klasse, ein Milieu, erst erklären lassen müssen, führen damit immer auch ihre eigene Überlegenheit vor. Die »normalen Leute« zeigen, dass sie sich mit »solchen Menschen« noch nie auseinandersetzen mussten, und erheben sich dadurch über sie — vielleicht noch nicht einmal mit Absicht. Aber sie tun es, und mit meinem Text habe ich ihnen dabei geholfen, sich ihrer Erhabenheit zu vergewissern.
Inzwischen denke ich, dass es nicht reicht, im Einzelschicksal zu verbleiben. Ein armes Kind erweckt Mitleid, aber dieses Mitleid ändert die Verhältnisse nicht, es macht die Welt nicht gerechter. Meine Kindheit war manchmal beschissen — aber wenn ich darüber weine, bringt das niemandem etwas. Stattdessen werde ich aufschreiben, warum meine Kindheit beschissen war. Welches System dahintersteckt, welche Ideologien, welche Gedanken, die in uns allen wohnen, auch in mir. Ich will verstehen, warum meine Eltern arbeitslos sein mussten und warum ich darunter leiden musste. Und ich will weiterdenken: eine Gesellschaft entwerfen, in der es Kindheiten wie meine nicht gibt. Ich will kein Gerührtsein an der Realität — ich will, dass wir die Realität ändern.
Wer dieses Buch liest, um etwas über ein trauriges Einzelschicksal zu erfahren, über ein armes Kind, das sich hochgearbeitet hat, der wird enttäuscht werden. Natürlich verstehe ich Arbeitslosigkeit auch deshalb, weil sie mir bekannt ist. Ich weiß, dass es kein »echtes Leben« gibt, sondern nur andere Leben abseits von Bildungsbürgerblasen. Ich weiß, dass »der kleine Mann« auch ein Arschloch sein kann. (Dass das kein selbstverständliches Wissen ist, habe ich an der Journalistenschule festgestellt, wo man immer noch selbsternannten Reportern begegnen kann, die meinen, in Strip-Clubs an der Autobahn und in Baugruben das wahre Leben finden zu können.) Ich weiß, dass ich als Kind arm sein musste, damit Deutschland vom »kranken Mann Europas« zu dem Wirtschaftswunderland werden konnte, das es in den letzten Jahren war. Ich habe verstanden, dass dieses Land Geld sparen musste und dass es beschlossen hat, an mir und meiner Familie zu sparen, einfach weil wir uns nicht wehren konnten. Und dass wir in den politischen Entwicklungen Anfang des Jahrtausends weitgehend vergessen wurden; unsere Bedürfnisse, unsere Existenz. Ich weiß, dass es nie darum ging, mich als Individuum leiden zu lassen — aber dass man es in Kauf nahm, als es passierte.
Meine Lebensgeschichte ist von außen betrachtet eine Aufstiegsgeschichte, anhand derer sich unsere Gesellschaft vergewissern kann, dass es so etwas wie »Chancengleichheit« gibt. Ich war das Kind von zwei Langzeitarbeitslosen, nun bin ich eine erwachsene Journalistin, die für eine Zeitung schreibt, in der Hochschulen ihre Anzeigen schalten, wenn sie neue Professorinnen suchen. Wenn man mein Leben als Weg betrachten möchte, dann sieht man relativ am Anfang die Billy-Regale im Flur unserer Wohnung, vor denen ich sitze und darüber nachdenke, was ich lesen soll. Meine Mutter, die rauchend auf dem Balkon sitzt und mir sagt, dass Mädchen nicht dümmer sind als Jungs, sondern dass man ihnen das nur einredet. Meinen Vater, der mir beibringt, wie man eine Mehlschwitze macht und Nägel in Wände haut und Schrauben festzieht. Ein Freundebuch, in das ich mit zwölf Jahren schreibe, dass ich entweder »Astronomin« oder »Redakteurin« werden will. Meine Mathelehrerin in der achten Klasse, die mir ein paar Punkte gibt, weil ich die Textaufgabe in eine Geschichte umgeschrieben habe. Meinen Deutschlehrer, der mich eine Schülerzeitung gründen lässt und mir hilft, Praktikumsstellen zu finden. Dann ein ziemlich perfektes Abitur, das zu einem Stipendium führt, das zu noch einem Stipendium und zu ausreichend Selbstvertrauen führt, um Fächer zu studieren, mit denen man erst mal nichts Konkretes werden kann. Am Wegesrand stehen ein paar Menschen herum — viele sind tatsächlich Männer, weil Menschen in Machtpositionen im Journalismus meistens immer noch Männer sind. Sie nehmen mich eine Weile an die Hand, lassen mich Texte schreiben und zahlen mir sehr wenig Geld dafür, was mir egal ist, denn ich habe ja die Stipendien. Einer der Männer führt mich schließlich in die Deutsche Journalistenschule in München.
Was man oft übersieht dabei: Wie ich meiner Mutter zwei Tage lang die Ohren vollheulte, weil ich auf einen Schüleraustausch wollte, für den wir das Geld nicht hatten, 300 Euro. Die Angst, die ich vorm wöchentlichen Sportunterricht hatte, weil meine Sportsachen mir zu kurz waren und ich mich nicht traute, meine Eltern nach Geld zu fragen. Die Trampelpfade, die von meinem eingeschlagenen Weg immer wieder zurück ins Ruhrgebiet führen. Und den ersten Moment, in dem ich mich getraut habe, einer fremden Person ohne Scham zu sagen, dass meine Eltern nicht arbeiten.
Von dort, wo ich heute stehe, erkenne ich, dass die Soziologiestudenten, die meine Eltern besichtigen und befragen, keinerlei echtes Interesse daran haben, durch ihre Forschungen die Situation ihrer Forschungsobjekte zu verbessern. Sie benutzen die Armen nur als Projektionsfläche. Hier die Akademiker, dort die Elenden. Hier die, von denen man etwas erwartet, dort jene, die man nur noch verwaltet. So erhalten sie ein Wertesystem aufrecht, in dem 19-jährige Soziologiestudentinnen mehr gesellschaftliche Deutungsmacht haben als 55-jährige Arbeitslose. Ein Wertesystem, das festlegt, was als »normal« gilt und erstrebenswert und was die Verlierer von den Gewinnern trennt. Ich weiß natürlich auch, dass die Studentinnen das nicht aus Boshaftigkeit tun, sondern weil es zu der gesellschaftlichen Rolle gehört, in die sie hineingestolpert sind: Sie schreiben Arbeiten darüber, wie man das Leben der Armen lebenswerter machen könnte (Putzpläne für die Flure oder »kulturelle Ereignisse« im lokalen Kulturzentrum, um die Leute »zusammenzubringen«, oder Alleinerziehenden-Cafés), die sich allesamt aus den eigenen Erfahrungen und Gepflogenheiten speisen. Und so wird das »Normale« noch normaler und die falschen Leben werden noch falscher. Die Machtverhältnisse, die bereits dafür gesorgt haben, dass die Menschen in meinem Heimatviertel »unten« sind, verfestigen sich, indem man sie immer wieder so bezeichnet: als abgehängt, als gescheitert.
Dem Kollegen, der über die dummen Nichtwähler geschrieben hat, würde ich heute unterstellen, dass er manchmal an sich selbst zweifelt: ob er genug weiß; ob ihm nicht, was Politik angeht, einiges verborgen bleibt; ob es in Ordnung ist, dass er kein einziges Buch des aktuellen Literaturnobelpreisträgers kennt und die Debatte um ihn nicht versteht; ob es in Ordnung ist, dass er nicht jeden Tag die Nachrichten schaut. Seine eigene Unsicherheit projiziert er auf die Menschen, die mit Sicherheit gar keine Ahnung von Politik haben: die Nichtwähler.
Ich weiß also, welchen Zweck es hatte, dass meine Familie arm war: Wir dienten als abschreckendes Beispiel. Indem wir unnormal waren, fühlten sich die anderen normaler. Indem wir verloren hatten, konnten sich andere Menschen als Gewinner fühlen. Unser Leid ließ andere Leben leichter erscheinen. Es geht mir nicht besser, seitdem ich das weiß. Ich bin eher noch wütender als früher.
Deutsche Leser scheinen in den letzten Jahren ganz versessen auf Milieubetrachtungsbücher zu sein. Es begann mit dem Soziologen Didier Eribon, dessen Essay Rückkehr nach Reims in Frankreich bereits 2009 erschien, in Deutschland erst 2016.6 Eribon schreibt über seine Kindheit und über seine Eltern, zwei französische Arbeiter ohne akademische Bildung. Über den Vater, der die Homosexualität seines Sohnes nie akzeptieren konnte, und über die Geschwister, zu denen er kaum noch Kontakt hat, weil sie sich nichts zu sagen haben. Er selbst nimmt in dieser Geschichte eher die Rolle eines Forschers ein, der erklären möchte, wieso seine Eltern früher einmal Kommunisten waren und heute den Front National wählen. Nachdem er es lange vermieden hatte, mit ihnen mehr Kontakt zu haben als unbedingt nötig, besucht Eribon nach dem Tod seines Vaters die Mutter — um sich, wie er schreibt, auszusöhnen: »mit einem ganzen Teil meines Selbst, den ich verworfen, versagt, verneint hatte«. In ihm löst es »Unbehagen« aus, dass er zwei verschiedenen Welten angehört, der Welt seiner Kindheit und der bürgerlich-akademischen Welt in Paris. Über seinen Vater schreibt er: »Ich mochte ihn nicht. Ich hatte ihn nie gemocht.« Immer wieder bezieht sich Eribon in Rückkehr nach Reims auf die Schriftstellerin Annie Ernaux. Sie schrieb bereits 1983 in La Place die Geschichte ihres Vaters auf, das Buch erschien als Das bessere Leben auf Deutsch, blieb aber unbeachtet — erst 2019 wurde es neu übersetzt und unter dem Titel Der Platz7 breit rezipiert, genau wie Eine Frau, in dem sie ihre Trauer nach dem Tod ihrer Mutter verarbeitete. Bei beiden Erzählungen merkt man, wie sie versucht, sich ihre Eltern selbst noch einmal herzuleiten, sie quasi rückwirkend zu verstehen, nachdem sie in ihrer Jugend damit zu tun hatte, sich von ihnen abzugrenzen. »Die Jugend meiner Mutter«, schreibt Ernaux, »bestand darin, der Bestimmung ihres eigenen Schicksals zu entfliehen: unausweichliche Armut, die Bedrohung durch Alkoholismus und all die anderen Dinge, die einem Mädchen aus der Fabrik passieren, das schlechte Angewohnheiten hat«. Es ist ein liebevoller Blick, gerade im Vergleich dazu, wie sie ihre jugendliche Perspektive auf die Mutter beschreibt: »Manchmal stellte ich mir vor, ihr Tod würde mir nichts bedeuten.«
Anfang 2020 erschien dann die autobiographische Erzählung Ein Mann seiner Klasse des deutschen Journalisten Christian Baron. Der Autor beschreibt das Buch als einen Versuch, seinem prügelnden, saufenden Vater zu verzeihen, indem er ihn als Teil seiner sozialen Klasse begreift und anerkennt, wie sehr diese Prägung sein Leben bestimmte; dass seine finanzielle Ohnmacht und die Erfahrungen der eigenen Kindheit ihn zu einem Tyrannen machten — und dass da niemand war, der der Familie geholfen hätte.
Einerseits sind diese Bücher Versuche, den weltweiten und vor allem europäischen Rechtsruck zu verstehen. Doch indem man dem belesenen Bürgertum die Unterschicht und deren Weltwahrnehmung erklärt, wird suggeriert, dass Nationalismus und Rassismus vor allem aus diesen Milieus kommen. Damit verkennt man leider die Drastik und Ernsthaftigkeit des Problems. Wäre Rechtssein vor allem eine Sache der Ohnmächtigen, dann wären die Rechten insgesamt weitestgehend ohnmächtig. Doch der Rechtsruck kommt nicht aus der Unterschicht, für die Erfolge der AfD sorgen nicht die Stimmen der Elenden, allein statistisch ist das unmöglich. Doch dazu später.
Vielleicht liegt der Trend zu diesen Milieu-Büchern auch darin begründet, dass es diesem Land bis vor kurzem so wahnsinnig gut ging. Je sicherer man selbst vor dem ökonomischen Abstieg ist, desto weiter weg erscheinen die Milieus irgendwo da unten — und desto mehr kann man sich an den Erzählungen über unkontrollierte, ungebildete und dennoch liebevolle Idioten ergötzen. Je weiter sich die Schere zwischen Arm und Reich öffnet, desto zootieriger werden die Armen, desto augenöffnender ihre Geschichten, weil man ja im Alltag kaum etwas mit ihnen zu tun hat.
Und jetzt komme auch noch ich.
Sowohl Ernaux als auch Eribon und Baron haben über ihre Eltern erst geschrieben, nachdem diese tot waren. Vielleicht haben sie den Abstand gebraucht — oder die Freiheit, die man hat, wenn man niemanden mehr verletzen kann.
Meine Eltern haben mich gezeugt und aufgezogen. Sie sind der Grund dafür, warum ich lebe, wie ich lebe, und denke, wie ich denke — und ich möchte nichts über sie schreiben, was nicht auch in ihrer Lebenszeit veröffentlicht werden kann. Ich möchte sowieso gar nicht so viel über sie schreiben — weil ihre gesellschaftlichen Rollen mit ihnen als Individuen sehr wenig zu tun haben. Teilweise grenzt es an Sozialpornographie, was die Kinder der Armen über ihre Eltern schreiben: Da kommen rauhe Hände vor und Tattoos und Sprachfehler, schlechtes Fernsehprogramm, Schweiß und Tränen. Manchmal, wenn ich lese, wie Menschen versuchen, ihre eigenen Eltern zu verstehen, dann denke ich, dass auf dem Weg zwischen Kindheit und Autorschaft genuines Verständnis für das eigene Herkunftsmilieu offenbar so sehr abhandenkommen kann, dass nur der einigermaßen liebevolle Blick eines Bildungsbürgers auf »die da unten« bleibt. Das ergibt Sinn: Wenn man von einer Welt in eine andere Welt wechselt, wenn man »aufsteigt«, dann neigt man dazu, die Welt zu negieren, aus der man kommt, um ein Teil der neuen Welt zu werden — der Welt der Soziologiestudentinnen und Redakteure mit Deutungshoheit, der Welt der Macht, der Welt der Normalität. Man überlebt in ihr am besten, wenn man sich von dem distanziert, was man einmal war. Es ist ein Schutzmechanismus. Man schützt sich vor der Wut, die man früher einmal hatte und die wieder aufkommen könnte; vor dem Neid auf die Sorglosigkeit; vorm Beleidigtsein; vor der Traurigkeit. Ohne Schutz lässt es sich kaum aushalten, aber wenn man sich schützt, geht auch etwas verloren: der besondere Sinn für Gerechtigkeit, der Blick von unten.
Die Momente, in denen ich mich der Welt meiner Einkommensklasse anpasse, bemerke ich immer erst ein paar Minuten zu spät — oder ich erlaube mir erst ein paar Minuten zu spät, sie zu bemerken, damit es sich nicht so seltsam anfühlt: mit jemandem zu reden und gleichzeitig darüber nachzudenken, wie verrückt es ist, dass man jetzt plötzlich so redet. Mit einem Freund, ebenfalls Journalist, saß ich nach Feierabend im Lounge-Bereich einer Berliner Boulderhalle, die einen bescheuerten Wortspiel-Namen trägt. Ich nahm einen Schluck von meinem grünen Smoothie und nickte interessiert, als er sagte, dass man eigentlich gerade jetzt Immobilien kaufen sollte. Dann sprachen wir darüber, ob Aktien oder Immobilien sinnvoller sind, um aus dem Geld, das wir haben, mehr Geld zu machen. Er sagte, das erinnere ich noch ganz genau: »Ich kaufe mir ja nichts, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld.« Ich sagte: »Lass uns mal gleich nach Hause fahren, ich muss morgen arbeiten.« Wir lachten darüber, wie sehr wir unsere eigenen Klischees sind, Berufseinsteiger in Boulderhallen, die über Immobilien reden, haha. Dann stiegen wir auf unsere Rennräder und fuhren in unsere jeweiligen Berliner Altbauwohnungen.
Der Unterschied zwischen mir und meinem Freund ist, dass seine Eltern ein großes Haus besitzen. Dass er zu Weihnachten von ihnen immer noch Geld geschenkt bekommt. Dass für ihn Immobilien und Investitionen und sonstige Geldvermehrungsaktionen zur Normalität gehören, während ich mich immer fühle, als würde ich diese Gespräche schauspielern. So wie ich als Kind geschauspielert habe, dass ich mir Sachen leisten kann, die alle hatten, dass ich irgendwelche Filme schon im Kino gesehen habe, die alle gesehen hatten.