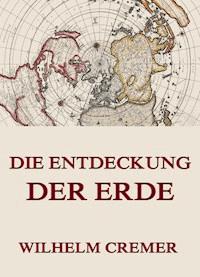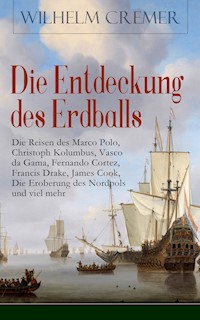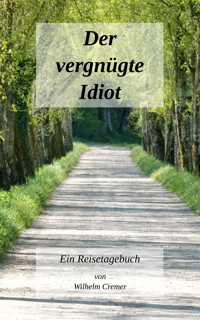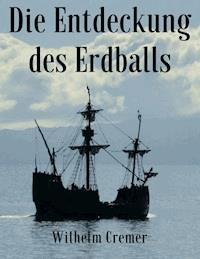Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In 'Die Entdeckung des Erdballs' entführt uns Wilhelm Cremer auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte der Entdeckung der Welt. Mit einem klaren und präzisen Schreibstil präsentiert Cremer die bahnbrechenden Entdeckungen von Seefahrern und Entdeckern aus verschiedenen Epochen. Das Buch bietet nicht nur eine Chronik der Entdeckungen, sondern auch einen Einblick in die Motivationen und Strategien der Abenteurer. Mit tiefgreifendem historischem Wissen verwebt Cremer Fakten und Anekdoten zu einem lebendigen Porträt der frühen Entdeckerzeit. Wilhelm Cremer, ein renommierter Historiker und Autor mehrerer historischer Werke, bringt in 'Die Entdeckung des Erdballs' sein umfangreiches Fachwissen und seine Leidenschaft für Geschichte zum Ausdruck. Seine akribische Recherche und seine detailreichen Beschreibungen machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Werk für Geschichtsinteressierte und Abenteuerliebhaber gleichermaßen. Anhand von spannenden Geschichten und fundierten Analysen empfiehlt Cremer dem Leser eine faszinierende Reise durch die Entdeckungsgeschichte und regt dazu an, die Weltkarte mit neuen Augen zu betrachten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Entdeckung des Erdballs
Inhaltsverzeichnis
Altertum und Mittelalter
Lange Zeit, bevor noch die ersten geschichtlichen Ueberlieferungen aus dem Dunkel menschlicher Vergangenheit auftauchen, hat es schon auf der Erde einen ausgedehnten Handelsverkehr gegeben, sind wagelustige Seeleute ohne Kompass und Karten über weite und stürmische Meere gefahren, haben kühne Kaufleute durch die Sonnenglut der Wüsten und die eisigen Schrecken der Gebirgsländer ihren Weg gefunden. Kulturen sind entstanden, die ihre Beziehungen über ganze Erdteile ausgedehnt haben, und sie sind wieder vergangen, ohne dass von ihnen kaum mehr als ein Name übriggeblieben ist. Grosse Völkerstämme sind von ihren Wohnsitzen vertrieben worden und kämpfend in weite Fernen gewandert. Sie haben Länder verwüstet und Staaten zerstört und sind dann selbst wieder die Begründer neuer Staaten geworden. Und zu allen Zeiten haben sie mit ihren Nachbarn Tauschverkehr und Handel getrieben. Was irgendein Land an Schätzen und Kostbarkeiten, an nützlichen und wertvollen Erzeugnissen bot, das wurde auch ausgeführt und auf Lasttieren oder Schiffen bis zu den fernsten Punkten der Erde geleitet. Dabei müssen schon in diesen vorgeschichtlichen Zeiten ganz erstaunlich kühne und weite Seereisen gemacht worden sein, soweit wir uns nach den Funden der Archäologen ein Urteil erlauben dürfen. Wir wundern uns noch heute über die Kühnheit der Normannen, die schon ein halbes Jahrtausend vor Kolumbus auf ihren offenen Booten Nordamerika entdeckt und eine Zeitlang besiedelt haben. Aber bereits unendlich viel früher hat es vielleicht Beziehungen zwischen Afrika und Südamerika gegeben. Anders lassen sich die peruanischen Pyramiden und die sonstigen Uebereinstimmungen mit der ägyptischen Kultur, ebenso wie die dortigen Nachbildungen von Elefanten, nicht erklären.
Die ältesten geschichtlichen Nachrichten über die Erdkunde verdanken wir griechischen Schriftstellern, und ein griechischer Dichter, Homer, hat uns auch die erste Landkarte gegeben. Es war der im 18. Gesang der Ilias beschriebene Schild des Achilles, auf dem der ganze Umkreis der damals bekannten Welt abgebildet war. Homer dachte sich die Erde als eine runde, rings vom Okeanos umflossene Scheibe. Die Sonne stieg des Morgens aus dem Okeanosfluss im Osten empor, tauchte abends im Westen wieder hinein und wurde während der Nacht auf einem goldenen Wunderschiff um die finstere Nordhälfte herum nach Osten zurückgebracht. Der Mittelpunkt der Erdscheibe war natürlich Griechenland mit dem Olymp. Durch das Schwarze, das Aegäische und das Mittelländische Meer wurde die Erde in zwei Teile geteilt, in eine nördliche Hälfte, die sich in das Dunkel der Kimmerier verlor, und in eine hellere südliche, die hauptsächlich Afrika umfasste, das im Altertum Libyen genannt wurde. Im Westen bildete die Strasse von Gibraltar, damals schon die Säulen des Herkules genannt, die Grenzen der Welt; der Osten ging bis Kolchis. Genau beschrieben werden nur Griechenland und ein Teil Kleinasiens. Italien war Homer unbekannt, doch erwähnt er Aegypten mit dem hunderttorigen Theben und die handeltreibenden Phönikier.
Erst allmählich vergrösserten sich die geographischen Kenntnisse der Griechen, und um 450 v. Chr. bereiste dann Herodot Vorderasien, Nordafrika mit Aegypten und Skythien und beschrieb nach eigenen Anschauungen und genauen Erkundigungen die damals bekannten Länder. Auch für Herodot, dessen Weltbild so wesentlich grösser ist als das der homerischen Zeit, ist Europa der grösste Erdteil, der die ganze nördliche Erdhälfte einnimmt. Die Nord- und Ostgrenzen Europas kennt er nicht. Wohl aber kennt er Spanien, Italien, Thrakien und als grössten europäischen Fluss den Ister, die heutige Donau. Auch das heutige Südrussland, das Land der Skythen, beschreibt er. Asien kennt er bis Indien ziemlich genau, und er schildert schon Arabien. Seine Hauptdarstellung von Asien aber gilt dem damals sehr ausgedehnten Persien. Nach Afrika reiste er zu Schiff über das Mittelmeer und durchforschte recht gründlich Aegypten, das er südlich bis zur Stadt Elefantine besuchte. Er beschreibt das Wunderland, seine Bauten und seine Kultur ausführlich und erzählt auch, dass etwa um das Jahr 600 v. Chr. der König Necho von Aegypten durch phönikische Seeleute Afrika vom Roten Meer aus umsegeln liess. Diese Phönikier segelten nach Süden, und wenn es Herbst wurde, gingen sie ans Land und besäten ein Feld. Erst wenn sie dann eingeerntet hatten, fuhren sie weiter, so dass sie im dritten Jahre durch die Säulen des Herkules wieder nach Aegypten zurückkamen. Dabei erzählten sie, dass sie bei der Umsegelung Afrikas die Sonne im Norden gesehen hätten, was Herodot ganz und gar nicht glauben will. Uns aber ist gerade diese Angabe ein Beweis, dass sie sich wirklich auf der Südhälfte der Erde befunden haben. Westwärts kam Herodot wahrscheinlich bis nach Karthago, so dass er also diese Teile Afrikas aus eigener Anschauung schildert. Was er aber über die Völker südlich der Libyschen Wüste sagt, die er Aethiopier nennt, das ist mit allen möglichen Fabeln der Zeit geschmückt und zum Teil sehr phantastisch.
Karthago, ursprünglich eine phönikische Kolonie, war damals die Beherrscherin des Mittelländischen Meeres und hatte auf den grösseren Inseln und in Spanien Kolonien. Die Karthager besassen keine Scheu vor den Säulen des Herkules und drangen kühn in den Atlantischen Ozean vor bis zum heutigen Irland. Wie gross ihr Unternehmungsgeist war, zeigen zwei Entdeckungsreisen, die gerade zur Zeit Herodots von ihnen unternommen wurden: die Reise Hannos an der Westküste Afrikas entlang und die Himilkos nach den Nordküsten von Europa.
Der kurze Bericht Hannos ist in einer griechischen Uebersetzung erhalten geblieben und so interessant, dass man das Wichtigste daraus mitteilen muss. Mit 60 Fahrzeugen, auf denen sich 30 000 Männer und Frauen befunden haben sollen, fuhr Hanno durch die Strasse von Gibraltar nach Süden und gründete nach zweitägiger Fahrt eine Stadt, die er Thymiaterion nannte. Er umsegelte dann das Libysche Vorgebirge Soloe, gründete an der Küste noch mehrere Städte und gelangte schliesslich an die Insel Kerne (wahrscheinlich eine der Kap-Verde-Inseln oder die Insel Arguia).
»Von da aus«, heisst es in dem Bericht, »fuhren wir in einen grossen und breiten Fluss hinein, der voll von Krokodilen und Flusspferden war. Darauf segelten wir nach Süden an einer Küste entlang, die von Aethiopiern bewohnt war. Sie flohen bei unserer Annäherung, und unsere lixitischen Dolmetscher verstanden ihre Sprache nicht. Am zwölften Tage erreichten wir grosse Berge, die mit wohlriechenden Bäumen von verschiedenen Farben bedeckt waren, und befanden uns nach zwei anderen Tagereisen in einem sehr grossen Meerbusen, an den eine Ebene stiess. Wir folgten seinen Küsten und trafen eine grosse Insel, die einen salzigen See enthielt. Hier landeten wir, sahen aber bei Tage nichts als Wälder. Bei Nacht jedoch bemerkten wir das Leuchten unzähliger Feuer und hörten ein mit schrecklichem Geschrei vermischtes Getöse von Pauken, Zimbeln und Flöten. Wir entsetzten uns darüber, und unsere Wahrsager befahlen uns, eiligst diese Insel zu verlassen. Wir segelten hierauf an einer glühenden, aber nach Wohlgerüchen duftenden Küste entlang, von der überall Feuerströme in das Meer stürzten. Der Boden war so heiss, dass man nicht darüber gehen konnte. Wir verliessen daher schnell diese Gegend, und die folgenden vier Tage, während wir auf offener See waren, schien uns das Land jede Nacht mit Flammen bedeckt zu sein. Mitten unter diesen Feuern aber war eins, das die anderen weit überragte und bis an die Sterne zu reichen schien. Doch sahen wir am Tage nichts als einen sehr hohen Berg, den man den Wagen der Götter nannte. Drei Tage lang fuhren wir an diesen Feuerströmen vorbei und kamen dann in einen Meerbusen, der das Südhorn hiess. In diesem Busen lag wieder eine Insel mit einem See und in dem See eine zweite Insel, die von wilden Menschen bewohnt war. Es gab im ganzen weit mehr Weiber darauf als Männer. Sie waren über und über mit Haaren bewachsen, und unsere Dolmetscher nannten sie Gorillas. Von den Männern konnten wir trotz unserer Bemühungen keinen einzigen ergreifen; sie entflohen über Schluchten hinweg und verteidigten sich mit Steinwürfen. Indes fingen wir drei Weiber, aber da sie ihre Bande zerrissen und uns mit ihren Zähnen angriffen und zerfleischten, töteten wir sie und zogen ihnen die Haut ab, die wir mit nach Karthago brachten. Mangel an Nahrung hinderte uns, weiter zu reisen, und wir kehrten zurück.«
Dieser Bericht hat schon die alten Griechen sehr interessiert. Der Fluss mit den Krokodilen und Nilpferden war wahrscheinlich der Senegal, der Götterwagen mit seinem nächtlich lodernden Feuer der Vulkan von Teneriffa. Auch hat der Gorilla, der grosse afrikanische Menschenaffe, nach diesem Bericht seinen Namen erhalten.
Ueber die Fahrt des Admirals Himilko nach dem Norden haben wir nur eine sehr späte, poetisch ausgeschmückte Beschreibung des römischen Dichters Avienus aus dem 4. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. Die Karthager verstanden es nämlich, wie schon ihre Vorfahren, die Phöniker, ihre Handelsverbindungen in Dunkel einzuhüllen. Besonders suchten sie fremde Nationen davon abzuschrecken, sich durch die Säulen des Herkules hindurchzuwagen, indem sie allerlei Fabelgeschichten über die Schrecken des Atlantischen Ozeans verbreiteten. Jedenfalls erhielten sich diese Märchen noch bis in die Zeit der Römer.
Wie seltsam übrigens die Vorstellung selbst der griechischen Gelehrten über die Gestalt der Erde gewesen ist, ergibt sich aus folgender Zusammenstellung. Homer (und auch noch Herodot) betrachtete die Erde als eine runde Scheibe, Anaximander als eine Walze, Leukippus als eine Trommel und Heraklit als einen Kahn. Eudoxus hielt die Erde für ein längliches Viereck, Xenophanes für einen hohen Berg, Anaximenes für einen Tisch und Pythagoras für einen Würfel. Erst Aristoteles, der Lehrer Alexanders des Grossen, schloss aus dem runden Schatten, den die Erde bei einer Mondfinsternis wirft, und auch aus anderen Gründen auf die Kugelgestalt unseres Planeten. Archimedes war der erste, der diese auch schon den ägyptischen Priestern bekannte Kugelgestalt in sein Lehrsystem aufnahm, und Aristarch behauptete schon fast 300 Jahre v. Chr. die Umdrehung der Erde um die Sonne. Doch hielt sich daneben immer noch die Ansicht, dass die Erde eine runde Scheibe sei; die christliche Kirche verdammte dann später die Lehre von den Gegenfüsslern, und Kolumbus hatte lange Zeit schwer gegen diese Ansicht zu kämpfen, bis schliesslich die erste Weltumseglung durch Magalhaes allen Zweifeln an der Kugelgestalt der Erde ein Ende machte.
Für die Griechen, und überhaupt für die wissenschaftliche Forschung, begann mit den Eroberungszügen Alexanders eine neue Zeit. Der Sohn des makedonischen Königs Philipp fühlte schon in früher Jugend den Beruf in sich, ein Welteroberer zu werden. Als er von dem Philosophen Klearchos hörte, es gäbe noch unendlich viele Welten und auch der Mond sei von Menschen bewohnt, da weinte er, weil er diese Welten doch nicht alle erobern konnte. Vor allem wirkten auf ihn die Schriften des griechischen Arztes Ktesias, der siebzehn Jahre lang Leibarzt am Hofe des Perserkönigs Artaxerxes gewesen ist und sehr viel über asiatische Völker, besonders über die Inder, geschrieben hat. Für Ktesias war Indien ein Wunderland mit märchenhaften Schätzen und fabelhaften Tieren, und seine phantasievollen Schilderungen haben sicherlich noch die Einbildungskraft der Portugiesen und Spanier auf ihren Entdeckungsfahrten beeinflusst.
Die Eroberungsreisen Alexanders des Grossen stehen in der Geschichte ganz einzig da. In zehn Jahren unterwarf er nicht nur das weitausgedehnte und mächtige Reich der Perser, drang im Osten bis in Indien hinein und eroberte im Westen Aegypten, sondern er erschloss auch alle diese Länder auf Jahrhunderte hinaus der griechischen Kultur, er brachte lange unterdrückte Völker zu neuem Leben und leistete unendlich viel für die Wissenschaft. Sein Heer wurde durch einen ganzen Stab von Feldmessern, Astronomen, Mathematikern und Naturforschern begleitet, die alles, was ihnen bemerkenswert erschien, aufzeichnen mussten. Ueberall wurden griechische Kolonien und Städte gegründet. Lateinische Schriftsteller haben 70 Städte mit dem Namen Alexandria gezählt, von denen noch heute die grössere Hälfte besteht, nur dass die Namen sich zum Teil sehr verändert haben. Alexander liess auch das Indische Meer bereisen, und sein Seefeldherr Nearchos untersuchte auf einer fünfmonatigen Küstenfahrt den Weg von der Mündung des Indus bis zur Mündung des Euphrat. Für seinen Lehrer Aristoteles liess Alexander sorgfältig alles Interessante aus der Naturgeschichte sammeln und ermöglichte ihm dadurch einen grossen Teil seiner wissenschaftlichen Arbeiten.
Sehr früh, schon mit 32 Jahren, starb Alexander in Babylon, aber sein Werk war in der Hauptsache getan, und seine Nachfolger, die Diadochen, die sich in das gewaltige Reich teilten, sorgten auch weiterhin für die Ausbreitung der griechischen Kultur. Durch ganz Vorderasien bis nach Indien wurden Heeres- und Handelsstrassen angelegt, und vor allem waren es die Ptolemäer in Aegypten, die Alexandria an der Nilmündung zur Herrin über das Mittelländische und Rote Meer und auch zugleich zu einem Mittelpunkt des damaligen wissenschaftlichen Lebens machten. Die Stadt wurde der grösste Handelsplatz der Welt, so dass die Ptolemäer in den 300 Jahren ihrer Herrschaft ungeheure Schätze ansammeln konnten. In der Alexandrinischen Bibliothek wurde alles gesammelt, was es überhaupt an wissenschaftlichen Schätzen im Altertum gab, und das Museion entwickelte sich zu einer Universität und Lehrstätte von nie wieder erreichter Höhe, die die grössten Denker und Dichter jener Zeit vereinigte. Eratosthenes, der Vorsteher der Bibliothek, ein grosser Astronom und Mathematiker, gab als erster ein vollständiges, systematisches Lehrbuch der Geographie heraus, das vier Jahrhunderte lang von grösster Bedeutung blieb. Er versuchte auch als erster durch eine genaue Gradmessung den Umfang der Erde festzustellen und gab eine sehr wichtige Weltkarte heraus. Allerdings nahm er fälschlich an, dass sich Asien viel weiter nach Osten erstrecke, als es tatsächlich der Fall war, ein Irrtum, der auch später nicht berichtigt wurde und noch im 15. nachchristlichen Jahrhundert eine Rolle spielte. Jedenfalls hätte sich Kolumbus niemals über den Ozean gewagt, wenn er gewusst hätte, wie gross die Entfernung von der Küste Europas bis zur Ostküste Asiens war. Um 150 n. Chr. hat dann Hipparchos vor allem auch die astronomischen Kenntnisse seiner Zeit bereichert und zuerst auch eine nach Länge und Breite in Gradnetze eingeteilte Sternkarte entworfen, durch die man zugleich jeden Punkt auf der Erde mathematisch festlegen konnte.
Inzwischen war aber eine neue Macht in die Weltgeschichte eingetreten. Rom, das Herodot nicht einmal dem Namen nach erwähnt, ein armer, kriegerischer Räuberstaat ohne Kultur und ohne Handelsgeist, aber von einer gewaltigen Herrschsucht erfüllt, eroberte allmählich Italien und besiegte und zerstörte dann Karthago und damit ein altes und wichtiges Handelszentrum für das westliche Europa. Zu derselben Zeit wurde auch Griechenland unterworfen und Korinth mit seinen Tempelbauten und Kunstschätzen in Schutt und Asche gelegt. Die Römer haben weder den Handel Karthagos ersetzen können, noch die Kultur der Griechen weitergeführt. Auf dem Meer breitete sich Seeräuberei aus und in alle Länder der bekannten Welt drang die zerstörende Macht der Legionen. Nirgendwo haben die Römer bei ihren Eroberungszügen wissenschaftliche Zwecke verfolgt, aber mit der Ausbreitung ihrer Weltmacht begannen sie aus praktischen Gründen Vermessungen ihres Besitzes vorzunehmen und Karten aufzuzeichnen, die die Ortschaften und die Länge der Wege enthielten. Als Geographen der römischen Zeit sind vor allem zu nennen: Strabo, der im Anfang der christlichen Zeitrechnung eine vollständige Erdkunde in 17 Bänden schrieb und viele Länder aus eigener Anschauung schilderte, und dann Claudius Ptolemäus in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, dessen astronomisches System erst von Kopernikus gestürzt wurde.
Ptolomäus, der in griechischer Sprache schrieb, hat ein mathematisch-astronomisches und ein achtbändiges geographisches Werk hinterlassen. Seine »Astronomia« schildert die Erde als eine Kugel und als den Mittelpunkt des Weltalls, um den sich Sonne, Planeten und Fixsterne drehen. Seine »Geographia« gibt ein durch Längen- und Breitengrade abgeteiltes Erdbild. Im Norden enden seine Kenntnisse mit Jütland. Schweden und Norwegen nennt er nicht. Von dem fernen Osten weiss er ebenfalls nichts und lässt das Land östlich vom Ganges nach Süden abbiegen und dann westlich zurück sich mit Afrika verbinden, so dass der Indische Ozean ein Binnensee wird. Auch er machte wie seine Vorgänger auf seinen Karten den Fehler, die Längengrade stark auseinanderzuziehen, so dass von der Westküste Europas bis zur Ostküste Asiens gar kein so weiter Weg mehr blieb. Jedenfalls gibt aber Ptolomäus in seiner Erdkunde das umfassendste Wissen des Altertums, und für mehr als ein Jahrtausend stützten sich alle weiteren Forschungen auf die Grundlage, die er gegeben hatte.
Das römische Weltreich zerstörte sich allmählich selbst. Es zehrte nur von fremden Kulturen, es plünderte die fernsten Länder aus und verarmte dabei innerlich und äusserlich. Aus den Katakomben stiegen dann die Christen herauf und brachten einen neuen Glauben; über die Alpen kamen die Germanen mit ihrer jungen Kraft und ihren grossen Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft. Das Mittelalter begann.
Zunächst erscheint alles ein einziger, ungeheurer Rückschritt zu sein. Länder und Städte waren zerstört und verwüstet. Das Christentum, das den Blick der Menschen auf ein jenseitiges Leben gerichtet hielt, verachtete die Wissenschaft der Heiden und machte die Bibel zur Grundlage aller Erkenntnis. Da in der Bibel nichts von einer Kugelgestalt der Erde stand, so wurde die Lehre von den Antipoden als ketzerisch und sinnlos verdammt, und man stellte sich sogar anfangs meist die Erde als eine viereckige Fläche vor, die nach dem Vorbild der israelitischen Stiftshütte erbaut war. Später ging man aber doch lieber zu dem runden Bild der Erde über und schilderte sie als Scheibe, weil ja in der Bibel nicht nur von den vier Ecken der Erde die Rede war, sondern noch häufiger von dem Erdkreis. Im Mittelpunkte lag jetzt Jerusalem, Asien nahm die östliche Hälfte, Europa das nordwestliche Viertel und Afrika das südwestliche Viertel ein. Im übrigen waren diese mittelalterlichen, sogenannten Radkarten ausserordentlich primitiv, wie überhaupt alles, was das Altertum an geographischem Wissen gesammelt hatte, erloschen schien. Um so kritikloser nahm man alles Fabelhafte, ja selbst die sinnlosesten Wundergeschichten aus der Vergangenheit auf.
Zwei weit voneinander entfernten Völkern, den Normannen und den Arabern, ist es zu verdanken, dass die geographischen Forschungen trotzdem fortgesetzt wurden. Die Normannen tauchen schon sehr früh in der Geschichte als äusserst kühne Freibeuter und Seehelden auf und griffen bereits zu den römischen Zeiten die englischen und niederländischen Küsten an. Ihre Heimat war der ganze skandinavische Norden, aber sie dehnten ihre Raub- und Eroberungszüge fast über ganz Europa aus. Jedenfalls beherrschten sie die ganze Ostsee mit den anliegenden Ländern und drangen tief in das heutige Russland hinein. Früh schon eroberten sie England und Irland, und im neunten Jahrhundert zogen sie mit einer Flotte an die fränkische Küste und weit in das Land hinein. Ebenso griffen sie Spanien und Italien an und eroberten 857 Pisa. Gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts entdeckten sie Grönland, das sie besiedelten und vierhundert Jahre lang bewohnten. Sie erbauten dort Städte und hatten Bischöfe, die anstatt des Peterspfennigs an den päpstlichen Stuhl 2600 Pfund Walrosszähne bezahlten. Ende des vierzehnten Jahrhunderts gingen diese Ansiedlungen wieder zugrunde, doch hat man später die Ruinen ihrer Häuser und Kirchen an der südwestlichen und westlichen Küste Grönlands gefunden.
Zu bedauern ist der Untergang dieser normannischen Kolonie vor allem deshalb, weil damit zugleich auch eine andere Entdeckung und Besiedlung in Vergessenheit geriet. Ein Isländer Björn war im Jahre 1001 auf einer Fahrt nach Grönland von einem Sturm weit nach Südwesten getrieben worden und bemerkte ein flaches, mit Holz bewachsenes Land, das wir heute Amerika nennen. Nach seinen Angaben ist er vielleicht bis in die Gegend des heutigen New York gelangt. Jedenfalls entflammte seine Erzählung, als er zurückgekehrt war, den Ehrgeiz Leifs, des Sohnes von Erich dem Roten, der die grönländische Kolonie einst begründet hatte. Leif rüstete sofort ein Schiff aus und steuerte der amerikanischen Küste entlang nach Süden. Er kam zunächst nach Helluland, dem heutigen Labrador, dann nach Markland oder Waldland, dem heutigen Neuschottland, und blieb schliesslich in einer Gegend, die er Winland nannte, weil dort so viel wilder Wein wuchs. Sein Gefährte, der Deutsche Tyrker, der aus dem Weinland stammte, erkannte sofort die Rebe. Bald sahen die Normannen auch einige Eingeborene, von kleiner Statur, die sie Skrälinger (d. h. Abschnittsel oder Zwerge) nannten. Es waren das keine Indianer, sondern in Seehundsfelle gehüllte Eskimos, die auf schmalen, ledernen Kähnen heranfuhren. Jedenfalls haben sich die Indianer erst später in diesen Gegenden ausgebreitet und die Eskimos verjagt. Das in der Nähe des heutigen New York gelegene Winland wurde 126 Jahre lang wegen des Handels mit Pelzwerk besucht. Dann verschwindet alle Kunde davon, und man weiss nur noch, dass 1121 ein Bischof Erich sich von Grönland dorthin begab, um seine noch heidnischen Landsleute zum Christentum zu bekehren.
Wichtiger als die Normannen sind die Araber für die Ausbreitung der Erdkunde geworden. Von seiner Begründung im Jahre 622 ab hat der Mohammedanismus sich wie ein Flugfeuer über Nordafrika und Asien verbreitet und sprang dann später auch im Westen und Osten nach Europa hinüber. Mit dem Schwert in der Hand zerstörten die Sendboten der neuen Religion die alten Kulturen, aber sie gründeten auch überall neue, blühende Staaten und belebten einen weit ausgedehnten Handelsverkehr, der bis nach China ging. Vor allem hatten sie eine grosse Veranlagung für wissenschaftliche Studien, und indem sie an die Forschungen der Griechen anknüpften, brachten sie es in der Geographie, der Mathematik, der Philosophie und Medizin zu hervorragenden Leistungen. Aber auch in der Dichtung und Baukunst haben sie eine hohe Blüte erreicht.
Von Ptolemäus übernahmen sie die Lehre von der Kugelgestalt der Erde und ergänzten dann die Karten der Alexandriner durch ihre eigenen Entdeckungen. Die Zahl der arabischen geographischen Schriften ist überraschend gross; das darin ausgedrückte Wissen übertrifft weit das des griechisch-römischen Altertums. In Asien kannten sie den ganzen Westen, Süden und Osten bis nach Nordchina hinauf, so dass ihnen nur der grösste Teil von Sibirien unbekannt blieb. Nach dem Norden von Asien verlegten sie, ebenso wie die Christen, das fabelhafte finstere Land des Gog und Magog, von wo nach der Lehre der Bibel am jüngsten Tage das Verderben kommen sollte. Von Europa erwähnen sie sogar alle Länder des Nordostens, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, und hatten Handelsverbindungen die Wolga hinauf durch ganz Russland. Auch im Westen reisten sie bis zu den Faröer-Inseln. Am besten kannten sie Afrika. Sie besiedelten nicht nur den ganzen Norden bis zum Atlantischen Ozean, sondern drangen auch durch die grosse Wüste in die Negerstaaten Zentralafrikas hinein. Sie kannten genau die Staaten zwischen dem Senegal und dem Niger und an der Ostküste Afrikas hatten sie Kolonien bis über die Insel Madagaskar hinaus, die sie die Mondinsel nannten.
Alle diese Entdeckungen und Forschungen hatten auch für die christlichen Völker einen grossen Wert. In dem von den Arabern beherrschten Spanien entstanden grosse Universitäten und zahlreiche, kostbare Bibliotheken, und vom achten bis dreizehnten Jahrhundert strömten die europäischen Gelehrten und Studenten nach Cordoba, Granada und Sevilla, um sich hier das griechisch-arabische Wissen anzueignen und es in ihre Heimat zu verpflanzen. Hierdurch und durch die Handelsbeziehungen, die sich im Verlaufe der Kreuzzüge mit dem Orient entwickelten, entstanden in Europa allmählich freiere Anschauungen und ein reges Interesse für ferne Länder, das dann später im Zeitalter der Entdeckungen und Erfindungen so reiche Früchte tragen sollte.
Dazwischen aber lag die Blüte der italienischen Handelsstädte und die grösste Landreise des Mittelalters überhaupt: die Reise des Marco Polo.
Die Reisen des Marco Polo
Im Jahre 1260 reisten die Brüder Maffeo und Nicolo Polo, zwei Kaufherren und Patrizier des damals sehr mächtigen Venedig, mit einem reich beladenen Kauffahrteischiff nach Konstantinopel, wo der Kaiser Balduin regierte. Von dort fuhren sie durch das Schwarze Meer nach der Krim und wurden durch Kriegswirren über die Wolga nach Buchara verschlagen, wo sie sich drei Jahre aufhielten. Ein Gesandter des Khans von Persien, der zum Grosskhan der Tataren Kublai reisen wollte, veranlasste sie wegen ihrer Sprachkenntnisse, ihn zu begleiten, und sie schlossen sich ihm an, da zurzeit wegen der Unsicherheit der Wege an eine Rückkehr in die Heimat doch nicht zu denken war.
Kublai, der inzwischen den Titel eines Kaisers von China angenommen und seine Residenz von Karakorum nach Peking verlegt hatte, empfing die Europäer sehr wohlwollend. Er beschenkte sie bei ihrer Rückkehr reichlich und gab ihnen eine Botschaft an den Papst mit, worin er diesen bat, ihm hundert kluge und in der Religion erfahrene Männer zu schicken, die das Christentum in China verbreiten sollten. Als Pass überreichte er den Reisenden eine goldene Platte mit dem kaiserlichen Wappen, die ihnen auch überall den Weg erleichterte. Immerhin wurden sie durch Ueberschwemmungen und andere Hindernisse häufig aufgehalten, so dass die Rückreise länger als drei Jahre dauerte.
Als die Gebrüder Polo nach neunjähriger Abwesenheit wieder in Europa anlangten, erfuhren sie, dass der Papst gerade gestorben war, und es dauerte fast zwei Jahre, bis Gregor X. zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Dieser gab ihnen Briefe und reiche Geschenke an den Grosskhan mit, aber statt der hundert gelehrten Männer nur zwei Mönche, die noch dazu in Armenien, als sie von einem kriegerischen Zuge des Sultans von Babylon hörten, den Mut verloren und umkehrten.
Die Polos aber, die diesmal Nicolos Sohn, den siebzehnjährigen Marco, bei sich hatten, schlugen sich mutig durch und erreichten nach drei und einem halben Jahr Peking, wo sie von Kublai wieder mit grossen Ehren empfangen wurden. Besonders zog Marco Polo die Aufmerksamkeit des Kaisers in so hohem Masse auf sich, dass ihn dieser zu seinem Ehrenbegleiter ernannte und ihm häufig die wichtigsten Gesandtschaften und Aufträge gab, die Marco alle zu grosser Zufriedenheit seines Herrn ausführte.
Auf seinen vielen Reisen erwarb sich Polo eine sehr genaue Kenntnis Chinas und der angrenzenden Länder, was ihm später für die Beschreibung seiner Erlebnisse zugute kam.
Endlich, als die Venezianer schon über zwanzig Jahr am mongolischen Hofe gewesen waren, baten sie um Erlaubnis, in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen. Der Grosskhan wollte sie anfangs durchaus nicht ziehen lassen, willigte aber doch schliesslich in ihre Bitten ein, wobei er Marco den Auftrag gab, eine kaiserliche Prinzessin dem Khan von Persien als Braut zuzuführen.
Auf vierzehn, wohlbewaffneten viermastigen Schiffen reiste die Abordnung, die reiche Schätze mit sich führte, unter der Führung Marco Polos ab. Die Seefahrt war eine wahre Odyssee. Unter schweren Stürmen erreichten sie nach drei Monaten Java, wo sie durch widrige Winde fünf Monate zurückgehalten wurden. Endlich gelangten sie über Ceylon nach dem Persischen Meerbusen und begleiteten die Prinzessin an den Hof des Khans. Dann reisten sie zu Lande weiter und gelangten nach vielen Gefahren und Mühen nach Trapezunt am Schwarzen Meer, von wo sie über Konstantinopel im Jahre 1295 ihre Heimat wieder erreichten.
In Venedig waren sie inzwischen längst für tot gehalten worden und ihre Verwandten hatten sie schon beerbt und ihr Haus in Besitz genommen. Niemand wollte sie anfangs wiedererkennen, und es wird erzählt, dass sie erst durch ihre ungeheuren Schätze an Edelsteinen, die sie in China gesammelt hatten, die Venezianer überzeugen konnten. Jedenfalls wurden sie nachher wegen ihres Reichtums und ihrer Kenntnisse hoch geehrt, und als kurz darauf ein Krieg mit Genua ausbrach, erhielt Marco den Oberbefehl über eine Galeere. In der nun folgenden Seeschlacht wurde die venezianische Flotte geschlagen und Marco geriet in Gefangenschaft. Auch von den Genuesen wurde er sehr achtungsvoll behandelt und im Gefängnis zu Genua konnte er in aller Ruhe sein berühmtes Buch verfassen.
Marco Polos Reisebeschreibung ist das wichtigste Entdeckungswerk des Mittelalters. Leider ist es nicht ganz chronologisch angelegt; es vermischt persönliche Erfahrungen mit fremden Berichten und lässt durchaus nicht sicher erkennen, wie eigentlich die Reiseroute der Venezianer verlaufen ist. Dafür bringt es aber wirklich interessante Einzelheiten und schildert die einzelnen ostasiatischen Länder mit einer Genauigkeit, die für die damalige Zeit erstaunlich ist.
Das Buch berichtet zunächst von verschiedenen Völkerschaften Armeniens und erwähnt den Berg Ararat. Auf diesem hohen Berge war es, wo nach dem allgemeinen Glauben des Mittelalters, den auch Polo teilt, Noahs Arche nach dem Verströmen der Sintflut stehen blieb. Dann berichtet er offenbar von einer Petroleumquelle: Nördlich von dem Lande findet man eine starke Quelle, aus welcher eine Flüssigkeit, dem Oele ähnlich, hervorströmt. Sie ist nicht zum Genuss geeignet, aber sehr verwendbar zum Verbrennen und zu manchem anderen Gebrauche. Von Zeit zu Zeit kommen benachbarte Völker hierher und versehen sich in solchen Mengen damit, dass sie ganze Schiffe damit anfüllen. Trotzdem kann die Quelle durch diesen Abgang nie erschöpft werden.
Südlich vom Kaspischen Meer, westlich vom heutigen Teheran, kam er an die Residenz des berühmten und gefürchteten Alten vom Berge, des Grossmeisters der Ordensverbindung der Assassinen. Man hat lange Zeit die Angaben Polos für ein Märchen gehalten, neuere Forschungen haben sie aber bestätigt. Er erzählt über den Alten der Gebirge: Dieser Fürst mit allen seinen Untertanen verehrte den Mahomed und beging ganz eigene Niederträchtigkeiten. Er versammelte allerlei Banditen, die man gewöhnlich Totschläger hiess, und durch diese rasenden Halunken liess er alle diejenigen töten, deren Dasein ihm ein Anstoss war. Auf diese Art brachte er oft die ganze Gegend in Furcht und Schrecken. Auf eine sonderbare Art verstand er es auch, seine Anhänger oder Würgeengel sich ergeben zu machen. Er besass ein sehr schönes, zwischen hohen Bergen verstecktes Tal. Dieses liess er in einen bezaubernden Garten, reich an allen Früchten und Bäumen, verwandeln. Wundervolle Paläste standen darin, die mit dem kostbarsten Hausgerät und den seltensten Gemälden ausgeschmückt waren. Springbrunnen gab es, die von Wein, Milch und Honig strömten. Man vernahm überall die lieblichste Musik, und erlebte die herrlichsten Tänze und Freudespiele. Mit einem Wort, es fehlte an nichts, um diesen Ort für den schönsten der Erde, für das Paradies selbst zu halten. Wenn nun der Alte, dessen Name Ala-Eddin war, Jünglinge für seinen Dienst begeistern wollte, so liess er sie durch einen Schlaftrunk betäuben und in den Garten bringen, wo sie einige Tage in einem Uebermass der Lust verlebten. Dann wurden sie aufs neue betäubt und zurückgebracht und konnten sich nun kaum über den Verlust des Paradieses trösten. Das war der Augenblick, den der Alte erwartet hatte. Er machte die Betrogenen glauben, dass er ein Prophet Gottes sei. »Hört mich an«, rief er ihnen zu, »und beruhigt euch! Wenn ihr bereit seid, euch furchtlos allen Gefahren des Todes preiszugeben, wenn ihr alle meine Befehle treulich erfüllt, dann verspreche ich euch, dass ihr bald und auf immer diese Freuden geniessen sollt, von denen ihr schon einen Vorgeschmack erhalten habt.« Auf diese Art betrachteten diese Elenden den Tod als ein wahres Gut und waren gern bereit, sich dem Tyrannen aufzuopfern. Dieser aber benutzte sie, um ganze Gegenden zu verheeren und den Einwohnern Entsetzen einzujagen. Um solchen Schrecken zu entgehen, unterwarfen sich ganze Völker mit ihren Fürsten dem Alten vom Berge.
Diese Assassinen, die auch auf dem Libanon hausten und von dort aus die Kreuzfahrer in Schrecken setzten, wurden dann von den Tataren besiegt und zu vielen Tausenden mit ihrem letzten Fürsten Rocu-Eddin, dem Sohn des Alten vom Berge, hingerichtet. Der mörderische Orden verschwand dann allmählich, aber man sieht heute noch die Ruinen ihrer Schlösser.
Von Nordpersien aus zogen die Reisenden durch die Bucharei nach der Pamir-Hochebene. Unterwegs kamen sie durch ein Land Balascia, wo es ausserordentlich viele Ballasrubinen und Lapislazuli gab. Die dortigen Fürsten hielten sich für Nachkommen Alexanders des Grossen. Sie hatten eine besondere Pferderasse, die man wegen ihrer harten Hufe selbst auf dem felsigsten Boden nie zu beschlagen brauchte und die von Buzephalus abstammen sollten.
Auf dem Pamir-Plateau gab es zahlreiche wilde Schafe von besonderer Grösse, aus deren langen Hörnern die Hirten alle Arten von Schüsseln und Gefässen anfertigten. Auch war es so kalt, dass das Feuer gar nicht hell brannte und es sehr schwer war, Speisen zum Kochen zu bringen. Diese Beobachtung Polos ist übrigens auch durch moderne Forscher bestätigt worden.
Als er von diesen unwirtlichen Höhen heruntergestiegen war, sah er nach dem Mittelpunkt von Asien hin die fruchtbaren und blühenden Ebenen von Kaschgar, ein dem grossen Khan unterworfenes Königreich. Die Hauptstadt Samarkand war damals ausserordentlich reich, mit festen Schlössern besetzt und von herrlichen Gärten und Ländereien umgeben, in welchen Wein und Früchte edelster Art wuchsen.
Die Polos aber wandten sich nach Osten und gelangten nach vielen Mühseligkeiten an den Rand der Wüste Gobi, wo damals eine grosse Stadt Lop lag. Hier pflegten die Reisenden Maultiere und Kamele für den Transport durch das Sandmeer einzukaufen und sich auch mit Lebensmitteln und Wasservorräten zu versehen, denn es gab unterwegs nur wenige Quellen. Polo, der die Wüste an einer schmalen Stelle durchschritt, aber dazu auch so noch dreissig Tage gebrauchte, berichtet von nächtlichen Sinnestäuschungen, denen Reisende in der Wüste unterlagen, was übrigens auch andere Forscher bestätigen. Er schreibt sie dem Blendwerk böser Geister zu und sagt, die Reisenden müssten sehr auf der Hut sein, dass sie sich dabei nicht von der Karawane trennten oder gar zurückblieben. Denn nichts ist leichter, als dass sie in den vielen Bergen und Sandwolken sich verirren, und nichts gewöhnlicher, als dass die Dämonen sie mit nachahmenden Stimmen Bekannter von einem Ort zum andern nach sich ziehen und sie endlich ins Verderben locken. In der Luft vernimmt man zuweilen auch musikalische Instrumente, die meist den Klang von Tamburins haben, oder man sieht herannahende Reiterscharen und hört deutlich das Klirren der Waffen. Jedenfalls war der Weg durch diese Wüste mit grossen Gefahren verknüpft.
Jenseits der Wüste kam Polo in ein Land Hamil, wo eine ausgedehnte Gastfreundschaft Sitte war. Wenn ein Fremder hier Unterkunft suchte, so empfängt ihn der Hausvater aufs freundlichste und befiehlt seinem Weibe und seiner Familie, für ihn die möglichste Sorgfalt zu tragen, ihm zu gehorchen und ihn in dem Hause zu lassen, solange es ihm darin gefällt. Er selbst bezieht indes eine andere Wohnung und kehrt nicht früher zu den Seinigen zurück, bis der Fremdling sein Haus wieder verlassen hat. In der Zwischenzeit gehorcht die Hausfrau ihrem Gaste, als wenn es ihr eigener Gatte wäre. Die Einwohner sagen, eine solche Gastfreundschaft sei der Wille der Götter, und schreiben ihr ihren Wohlstand und die Fruchtbarkeit ihrer Felder zu.
In einer anderen Gegend herrschte die Gewohnheit, dass, wenn ein Mann auf einer Reise über zwanzig Tage ausblieb, seine Frau nach Belieben einen anderen heiraten konnte, in welchem Falle sich dann die heimkehrenden Männer auch mit anderen Frauen nach ihrer Wahl vermählten.